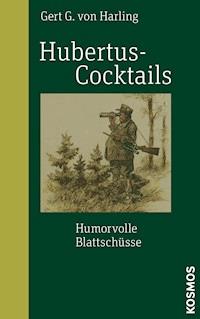18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Müller Rüschlikon
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Natur kennt keine Langeweile Von alten Böcken auf weiten Feldern: Erfolgreich heißt geduldig sein / Beharrlichkeit führt schließlich auch zum Ziel / Wiedersehen mit der Moritzkanzel / Ein flotter Feger / Eine ungewollte Dublette / Erfolgreich jagen heißt: Vom Hasen lernen Von Hirschen und von Flugwild: Bunte Strecke Die Spannung wächst an Taubentagen / Rülpskonzert im Paradies der Schaufler / Gänsesegen / Im Heiligtum der Hirsche Vom Jagen in guter Gesellschaft: Drückjagdimpressionen / Waidgerecht trotz Waldschutzjagd /Abblasen – Hahn ohne Ruh’ / Die Nachsuche, die keine war / Rotwild, Panzer, Manöverlärm Von langen Pirschgängen: Die Kunst des Anschleichens / Im Gleichschritt, marsch! /Jagd auf den Geisterbock Von schlechten Schüssen und guten Hunden: Nachsuchen mit Lady Di / Bleifrei – eine totsichere Suche / Nahkampf – Der Bock, der aus dem Dschungel kam / Nachsuchensplitter Von Frischlingen und alten Keilern: Sauensammelsurium / Liebe auf der Drückjagd / Roter Bock und gelbe Sauen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelseite
Impressum
Widmung
Inhalt
Natur kennt keine Langeweile
Von alten Böcken auf weiten Feldern: Erfolgreich heißt geduldig sein
Beharrlichkeit führt schließlich auch zum Ziel
Wiedersehen mit der Moritzkanzel
Ein flotter Feger
Eine ungewollte Dublette
Erfolgreich jagen heißt: Vom Hasen lernen
Von Hirschen und von Flugwild: Bunte Strecke
Die Spannung wächst an Taubentagen
Rülpskonzert im Paradies der Schaufler
Gänsesegen
Im Heiligtum der Hirsche
Vom Jagen in guter Gesellschaft: Drückjagdimpressionen
Waidgerecht trotz Waldschutzjagd
Abblasen – Hahn ohne Ruh’
Die Nachsuche, die keine war
Rotwild, Panzer, Manöverlärm
Von langen Pirschgängen: Die Kunst des Anschleichens
Im Gleichschritt, marsch!
Jagd auf den Geisterbock
Von schlechten Schüssen und guten Hunden: Nachsuchen mit Lady Di
Bleifrei – eine totsichere Suche
Nahkampf – Der Bock, der aus dem Dschungel kam
Nachsuchensplitter
Von Frischlingen und alten Keilern: Sauensammelsurium
Liebe auf der Drückjagd
Roter Bock und gelbe Sauen
Page List
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Guide
Cover
Titelseite
Inhalt
Einbandgestaltung: R2 I Ravenstein, Verden
Titelfoto: Marco Schütte
Rückseitenfoto: Hans-Martin Lösch
Bildnachweis:
Alle Fotos stammen von Burkhard Winsmann-Steins.
Alle Angaben in diesem Buch wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Für einen eventuellen Missbrauch der Informationen in diesem Buch können weder der Autor noch der Verlag oder die Vertreiber des Buches zur Verantwortung gezogen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Eine frühere Ausgabe dieses Buches ist unter der ISBN 978-3-275-02128-4 erschienen.
ISBN 978-3-613-31300-2 (EPUB)
Copyright © by Müller Rüschlikon Verlag
Postfach 103743, 70032 Stuttgart
Ein Unternehmen der Paul Pietsch Verlage GmbH & Co. KG
Sie finden uns im Internet unter www.mueller-rueschlikon-verlag.de
Nachdruck, auch einzelner Teile, ist verboten. Das Urheberrecht und sämtliche weiteren Rechte sind dem Verlag vorbehalten. Übersetzung, Speicherung, Vervielfältigung und Verbreitung einschließlich Übernahme auf elektronische Datenträger wie DVD, CD-ROM usw. sowie Einspeicherung in elektronische Medien wie Internet usw. ist ohne vorherige Genehmigung des Verlages unzulässig und strafbar.
Lektorat: Claudia König
Innengestaltung: Kornelia Erlewein
Folgen Sie uns für mehr Infos zu unseren Pferdebüchern auf:
www.instagram.com/muellerrueschlikon.pferd
www.facebook.com/muellerrueschlikonverlag
Gewidmet meinem Freund Dr. Steffen Koch
Natur kennt keine Langeweile
Von alten Böcken auf weiten Feldern: Erfolgreich heißt geduldig sein
Beharrlichkeit führt schließlich auch zum Ziel
Wiedersehen mit der Moritzkanzel
Ein flotter Feger
Eine ungewollte Dublette
Erfolgreich jagen heißt: Vom Hasen lernen
Von Hirschen und von Flugwild: Bunte Strecke
Die Spannung wächst an Taubentagen
Rülpskonzert im Paradies der Schaufler
Gänsesegen
Im Heiligtum der Hirsche
Vom Jagen in guter Gesellschaft: Drückjagdimpressionen
Waidgerecht trotz Waldschutzjagd
Abblasen – Hahn ohne Ruh’
Die Nachsuche, die keine war
Rotwild, Panzer, Manöverlärm
Von langen Pirschgängen: Die Kunst des Anschleichens
Im Gleichschritt, marsch!
Jagd auf den Geisterbock
Von schlechten Schüssen und guten Hunden: Nachsuchen mit Lady Di
Bleifrei – eine totsichere Suche
Nahkampf – Der Bock, der aus dem Dschungel kam
Nachsuchensplitter
Von Frischlingen und alten Keilern: Sauensammelsurium
Liebe auf der Drückjagd
Roter Bock und gelbe Sauen
Ich danke meinem langjährigen Weggefährtenund Jagdfreund Burkhard Winsmann-Steinsfür das einzigartige Bildmaterial.
Natur kennt keine Langeweile
Die Blume im Knopfloch ist das Einzige, was den Menschen noch mit der Natur verbindet.
Oscar Wilde
»Langeweile? Ist eine Erfindung der Städter, gibt es auf der Jagd nicht!«
Mein Bruder betont es seit Jahrzehnten, und ich stimme ihm zu. Nie zuvor hatte ich den Satz aus meinem Gedächtnis kramen müssen, um mich zu trösten, im weiten Mecklenburger Land kam er mir nach stundenlangem Ansitz wieder in den Sinn. Da ich Zeit hatte, dachte ich nach. Natürlich über die Jagd sowie diesen Satz und kam zu dem Schluss: gerade stilles Warten und geduldiges Ausharren gehören zur Jagd wie das Beutemachen. Diese Stunden – scheinbar verlorene Zeit – sind es, die den Jäger formen. Ausdauer, abwarten können, Überlegenheit, die aus der Ruhe kommt, bringt schließlich den Erfolg, der ein Ergebnis der Ruhe ist. Langeweile gibt es nicht, wohl aber Zeit zum Nachdenken.
Vor einer Woche war ich von einer Jagdreise zurückgekehrt und denke mit Wehmut an die unwirtlichen Nächte in einem Iglu an der Hudson Bay, wo wir nach einer Gänsejagd wegen des Schneesturmes festgehalten wurden, weil uns das kleine Flugzeug nicht wie geplant abholen konnte. Drei Tage verbrachten mein Freund und ich mit Eingeborenen auf engstem Raum, erzählten Geschichten und verkürzten uns mit Anekdoten die Zeit. Wie jagt Ihr in Deutschland?«, hatte mich der Chef der Eskimos gefragt, und ich berichtete von Abschussplänen, die vorschreiben, wie viel Wild geschossen werden darf, wie stark es zu sein hat, erzählte von unseren kleinen Revieren, von geschlossenen Kanzeln und Wildäckern, bis er mich unterbrach: »O.K., das ist Wildmanagement, aber was macht Ihr, wenn Ihr zur Jagd geht?« Diese Frage hat mich sehr beschäftigt, und nun, von der Natur ausgesperrt auf einer Kanzel, denke ich an den Ausspruch des Naturburschen.
Ein Freund hatte mich und meinen Terrier »Chico« in die Nähe des Wildackers gefahren. Ich war die letzten 100 Meter auf dem geharkten Pirschpfad zu der geschlossenen Kanzel gegangen, hatte sie, den Hund unter dem Arm, erklommen und fühle mich nun hier oben auf der bequemen Holzbank von der Natur ausgesperrt. Daran ändern auch die offenen Fensterluken nichts.
»Kurz vor Einbruch der Dämmerung tritt aus der linken Ecke der Dickung totsicher ein älterer Bock, schwach verreckter Sechser, stark im Wildbret, graues Haupt – den kannst Du schießen«, hatte der Freund beim Abschied gesagt, und »ich hole Dich nach Schwinden des Büchsenlichtes wieder ab.« Dann rollte der Wagen davon. Endlich war ich dem quirligen Stadtleben entronnen und mit meinem Hund allein.
Mir steht nicht der Sinn danach, einen »totsicher« bestätigten Bock zu schießen, doch um den Freund nicht zu enttäuschen, hatte ich ihm hiervon nichts gesagt. Was mich erwartet ist passives Warten, kein Überlisten, wenig Einsatz, ohne ein bleibendes Erlebnis zu hinterlassen. Ähnliches kenne ich aus anderen Ländern. Safaris, quasi von der Stange oder nach Maß gemacht, glänzend durchorganisiert. Die mitunter mühelose Erbeutung einer guten Trophäe wird garantiert, um nach Rückkehr den Daheimgebliebenen damit zu imponieren.
Ein Stück (Groß)wild zu strecken ist dann nur eine simple Sache des Geldbeutels und der Technik, doch die stärkste Trophäe an der Wand ist wertlos, wenn sie lediglich zur Schau gestellt wird und nicht mit Passion »erarbeitet« wurde.
Josẽ Ortega y Gasset schreibt, dass, wenn der Mensch seine technische Überlegenheit dem Tier gegenüber ausspielt, die Jagd zu Ende ist. Das fing bereits mit Hochsitz und Zielfernrohr an.
So gehen meine Gedanken zurück zu fremden Kontinenten, wo die Jagd noch ihren ursprünglichen Charakter bewahrt, aber eine andere Berechtigung bekommen hat. Im fernen Afrika, wo ich noch vor zwei Wochen dem Großwild nachstellte, wäre es ohne organisierte Jagd und passionierte Jäger, die auch bereit sind, Strapazen auf sich zu nehmen, um Elefant und Nashorn schlecht bestellt. Ihr überwiegender Teil wäre längst abgeschlachtet worden, ohne Einnahmen durch Abschussquoten und Trophäengebühren für ihren Schutz, wären hilflos der Wilderei ausgesetzt, lange in den Pulversammlungen reicher Asiaten gelandet.
Über mir jagt lautstark ein Schwarm Mauersegler hinweg. Wegen des kleinen Gesichtsfeldes, das die vier Luken der Kanzel gewähren, kann ich die lärmenden Jäger nur kurz sehen und nicht länger beobachten.
Am Waldrand erscheint eng umschlungen ein Liebespärchen. Als es mich bemerkt, zieht es sich verschämt den gekommenen Pfad (der Tugend?) zurück. Aus der Ferne klingt Hupen und Reifenquietschen auf der Landstraße, Tuckern eines Treckers vom Feld her und Lachen vergnügter Menschen aus dem Dorf. Dazwischen brummt ein Flugzeug im klaren Abendhimmel.
Abzubaumen, um einen Pirschgang zu machen, traue ich mich nicht, da es mit dem Jagdherrn nicht abgesprochen wurde. Also bleibe ich in meinem »Käfig«, akustisch mitten in der Zivilisation, optisch weit von der Natur entfernt.
»Langeweile gibt es auf der Jagd nicht«! Nach einer Stunde untätigen Sitzens beginne ich, an dem Ausspruch meines Bruders zu zweifeln. Trotzdem harre ich aus. Mückenschwärme schweben vor der Hochsitzluke verspielt auf und ab, scheinen die einzigen Lebewesen in meiner Nähe zu sein.
Fasziniert betrachte ich mir das Treiben, und meine trüben Gedanken sind wie weggewischt. In Tanzgruppen heben sich die kleinen Flugwunder in die Höhe, als drehten sie sich um eine Spindel. Dann kommen alle wieder gleichzeitig herab, Hals über Kopf, zitternd, ohne aneinander zu stoßen. Ein herrliches Spiel. Ich werde nicht müde, ihnen zuzusehen. Es ist unglaublich, dass Tausende solcher Winzlinge so einen tollen Lufttanz aufführen können, immer in der gleichen, schmalen Säule, ohne einander zu berühren. Die kleinen Wesen schlagen Purzelbäume, eins aufwärts, eins abwärts, eins hüpft geradezu im Fliegen, ein anderes kreist wie im Tanz, und keins scheint das andere dabei zu stören.
Der Hund neben mir auf der Sitzbank ist von dem Schauspiel wenig beeindruckt. Plötzlich windet er aufgeregt nach rechts, und ich bin sicher, dort ist Wild im Anmarsch. Gespannt beobachte ich die Reaktionen meines vierläufigen Begleiters. Dabei bemerke ich eine prall mit Blut gefüllte Zecke hinter seinem linken Behang. Mit Zeigefinger und Daumen befreie ich den Terrier von dem Quälgeist und werfe ihn aus dem Fenster. Der Unhold verfängt sich wenige Meter von uns in einem dichten Spinnennetz, wo er einige Male auf und ab federt und dann ruhig hängen bleibt. Nicht lange. Eine Blaumeise, die im Gezweig der Erle herumturnt, schwirrt heran, dreht den Kopf schief nach links und rechts, äugt zu mir, dann zu dem Holzbock, piepst, ergreift den Plagegeist meines Hundes und fliegt davon.
Wie hingezaubert sitzt wenig später ein Hase auf dem Wildacker. Die Zeiten der groß angelegten Treibjagden auf Hasen sind in diesen Breiten längst Legende, Mümmelmänner eine Rarität. Ich hole mir den Dreiläufer durch das achtfache Fernglas ganz nah heran.
Deutlich erkenne ich seine großen, braunen Lichter und einzelne lange Barthaare. Ein alter Rammler, vermute ich, jedenfalls spricht der dicke Kopf dafür. Unruhe reißt den Krummen fortwährend aus seinem Gemümmel und lässt ihn zu einem unbeweglichen Kegel erstarren. Sein Verhalten passt so gar nicht zu der friedlichen Stimmung dieses schwülen Abends. Dann beginnt Lampe mit seiner Abendtoilette. Als erstes gleitet er mit dem Lecker von oben bis unten und umgekehrt wieder und wieder die Vorderläufe entlang. Dann streicht er mit seinen Hinterläufen von rückwärts über seine Löffel, bis ihm wohl auch diese endlich trocken genug erscheinen. Nun leckt er die Sohlen der Hinterläufe peinlich genau ab. Die gesamte Maniküre hat schon mehr als zwei Minuten in Anspruch genommen.
Durch die vielen Vogelstimmen um mich herum klingt der Ruf eines Ringeltaubers und scheint signalisieren zu wollen, dass kein Feind in der Nähe steckt.
Der Hase beginnt derweil ausgiebig seine Barthaare zu putzen, spielt, während er erneut einen Kegel macht, mit den Löffeln, schüttelt sich, hoppelt einige Sprünge weiter, legt die Löffel zurück und verharrt unbeweglich. Er scheint immer älter zu werden und ich immer jünger, je länger ich ihn betrachte. Ein zwölf Jahre alter Pennäler bin ich plötzlich und darf meinen ersten Hasen schießen. Nachdem einer meiner Vettern kurz vorher seinen ersten Krummen erlegt hatte und ihm aus kurzer Entfernung mit Schrot Nummer 7 einen Fangschuss gab, da Lampe »sich noch bewegte«, bekam ich das alte Kleinkalibergewehr unseres Wildmeisters, statt der bewunderten Bockbüchsflinte, um eine Wiederholung solchen Malheurs zu vermeiden.
Ich hatte damals den Hasen lange vor der Zeit selbst ausgemacht. Am besagten Abend saß ich voller Herzklopfen schon nachmittags allein auf einer Leiter am Feldrand und erwartete, das Gewehr in meinen schweißnassen Händen im Voranschlag, ungeduldig das vertraute Geräusch hinter mir im trockenen Falllaub der alten Buchen. Doch das Jagdfieber machte mir einen zittrigen Strich durch die Rechnung. Ich war so aufgeregt, dass ich dem heiß ersehnten Mümmelmann, als er endlich wie an den Vorabenden auf dem gewohnten Pass angehoppelt kam, das kleine Geschoss durch seine Löffel sandte, was uns beiden bestimmt einen gleich großen Schrecken einjagte.
Für die nächsten Tage war mein jagdliches Selbstvertrauen erschüttert. Glücklicherweise konnte ich den nun »markierten« Dreiläufer in der folgenden Woche vom gleichen Sitz aus strecken. Mein Stolz kannte kaum Grenzen. Schnell ging es nach Hause, wo auf dem Rasen vor dem Herrenhaus Strecke gelegt wurde. Mein Bruder blies voller Inbrunst »Hase tot« und anschließend tranken wir meine Beute mit Selterswasser zünftig tot.
Und an eine andere Begegnung denke ich:
Als ich Mitte Mai morgens vom Ansitz nach Hause fuhr und mich einer Brücke über den Elbe-Seitenkanal näherte, kam mir auf der anderen Seite der Überquerung ein Hase entgegen. Ich ließ den Wagen ausrollen, blieb auf der Brücke stehen, und der Dreiläufer machte einen Kegel. Wohl eine Minute lang saßen, beziehungsweise standen, wir uns reglos gegenüber, dann machte der Krumme einen großen Satz, hoppelte die Böschung hinunter, rannte durch den Kanal, stieg am Ufer, wo ich wartete, aus, schüttelte sich ausgiebig, dass die Wassertropfen stoben, hoppelte hinter dem Auto wieder auf die befestigte Straße und wurde im Rückspiegel immer kleiner, bis auch ich meinen Weg fortsetzte. Meine Träumereien werden unterbrochen, als aus der Deckung ein Reh zieht. Der Blick durchs Glas bestätigt ein Schmalreh. Ein Bild voller Frieden, Harmonie und Grazie.
In vollendeter Anmut und Eleganz, hier und dort äsend, zwischendurch verhoffend, bewegt es sich vertraut am Waldrand entlang, bis es wieder im dichten Bewuchs verschwindet.
Am Rand steht ein riesiger, knorriger Holunder. Der Holunderbusch war der Lieblingsbaum der germanischen Göttin Holla, durch das Grimm-Märchen als Frau Holle bekannt. Die Liebe der Göttin zum Holderbusch verwundert allerdings, denn eine besondere Schönheit ist er nicht. Seine Äste wirken morsch, sind krumm und mit einer unschönen Rinde bedeckt. Im Winter gleicht er einer zusammengefallenen, greisenhaften Figur. Leuchten seine weißen Blüten aus dem satten Grün der Blätter heraus, besitzt er allerdings eine stille Schönheit, und da ist die Wohnung des beschützenden Hausgeistes Holla sehr wohl in ihm zu vermuten.
Bei den Germanen genoss Frau Holla als Hausgöttin hohes Ansehen. Opfer zu ihren Ehren wurden stets unter Holunderbüschen dargebracht. Deshalb stehen sie noch heute vornehmlich an Waldrändern, alten verfallenen Wohnstätten oder nahe menschlicher Behausungen. Holla, Holda oder Hohe war eine Göttin, die den Menschen und Pflanzen Schutz gab, sie von Krankheiten heilen konnte und als eine weise Frau galt. Die Menschen verehrten in ihr die Güte von Mutter Erde und das strahlende Himmelslicht.
Der Name hat den gleichen Ursprung wie die Worte »hold« oder »Huld«. In manchen Gegenden wurde sie auch Perchtha genannt, die ursprüngliche Form des Namens Bertha. Der Name bedeutet »die Strahlende«.
Holar, Baum der Holler, tauften ihn unsere Vorfahren. Viele Märchen und Sagen ranken sich um den seltsamen Strauch, der in der Heilkunde seit uralten Zeiten einen hervorragenden Platz einnimmt, und aus dessen Zweigen wir als Jungen Blasrohre und Flöten machten.
Etwas Trautes, Heimeliges, ein Hauch Geborgenheit geht von seinem grünen, mit weißen Lichtern winkenden Blätterdach aus.
Langsam senkt sich die Sonne dem Horizont entgegen. Der Tag verabschiedet sich, der Himmel erscheint in wunderschönen Farben und taucht die Kiefern am Waldrand in purpurnes Licht.
Seit Galileo Galilei weiß man, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern umgekehrt, der Trabant um die Sonne dreht. Aber Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang klingt natürlich viel schöner, viel romantischer, als die Erde hat sich wieder gedreht.
In der Dämmerung tasten sich Strahlen von Autoscheinwerfern näher. Es ist der Jagdkumpel, der zügig meine Ansitzwarte ansteuert. Erschreckt sehe ich auf die Uhr. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Vier Stunden bin ich mit meinem Hund und mit meinen Gedanken allein gewesen und habe keinen Schuss abgegeben. Zufrieden baume ich ab. Der »totsichere« Bock scheint doch nicht so totsicher zu sein. Ich bin nicht traurig darüber. Mir kommt ein Ausspruch von Hermann Hesse in den Sinn: »Langeweile ist etwas, was die Natur nicht kennt, sie ist eine Erfindung der Städter.«
Von alten Böcken auf weiten Feldern: Erfolgreich heißt geduldig sein
Beharrlichkeit führt schließlich auch zum Ziel ...
»Was der Augenblick verdorben, Dir entkam durch Deine Schuld, wird vielleicht Dir noch erworben, nur durch Ruhe und Geduld.«
Ist die Frucht auf den mitunter mehrere hundert Hektar großen Äckern in Mecklenburg herangewachsen, ist es mit der Kunst des Waidwerks auf einen alten Bock vorüber. Es bleibt lediglich der Ansitz als erfolgversprechende Jagdart, doch auch der kann inspirierend und aufregend sein.
Mitte August. Die Rehbrunft ist längst vorüber. Trotzdem folge ich zuversichtlich der Einladung meines Freundes in dessen großes Revier in Mecklenburg. Gäste hatten in der Hauptbrunft nur leidlich Erfolg, und die drei Jagdfreunde, die kurz vor mir abgereist waren, fuhren als Schneider nach Hause, hatten kaum Wild gesehen.
Man hatte mich vorgewarnt, und bei der ersten Fahrt durchs Revier werden meine Erwartungen gedämpft. Der Weizen steht prächtig, der Mais hoch und dicht, der Raps bietet dem Wild ebenfalls noch sichere Einstände. Er sollte zwar in wenigen Tagen gemäht werden, aber bis dahin müsste ich zwei, drei Böcke geschossen haben und längst wieder zu Hause am Schreibtisch sitzen.
Spät nachmittags pirsche ich an einem Ackerrandstreifen entlang, beobachte Ricken und Kitze, im Wald springen zwei junge Böcke aufs Blatt, dann wird es nach dem heißen Tag kühl. Dunst zieht über die Felder, und ich schlafe mit meiner Hündin im »Tausend Sterne Hotel« unter einer hohen Eiche, um früh wieder zur Stelle zu sein und vielleicht einer Sau den Wechsel aus dem Mais in den Wald abzuschneiden. Ohne Erfolg.
Auch meine Blattarien am Vormittag bringen nicht, was ich mir gewünscht habe. Gegen Mittag endlich sehe ich mein nutzloses Unterfangen ein, begreife, dass die Rehbrunft vorüber ist, alte Böcke wieder heimlich geworden sind und sich von den kräftezehrenden Aktivitäten der Vorwochen ausruhen.
Enttäuscht fahre ich Richtung Gutshaus. Rechts und links des Feldweges, vor und hinter mir steht Raps soweit das Auge reicht.
Ein Bussard kreist kurz über der grünen Monokultur und segelt davon. Auch für ihn ist diese landwirtschaftliche Einheitswüste keine lohnende Nahrungsquelle mehr.
Über manchen Stellen in der unendlich trostlos erscheinenden Fläche schwimmt ein heller, silberner Schimmer. Disteln haben sich dort zum Leidwesen der Bauern ausgesamt.
»Gelb sind schon die Felder und der Herbst beginnt«