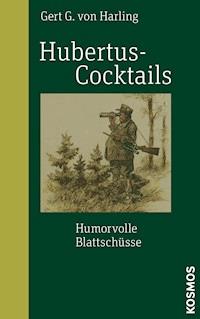15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Müller Rüschlikon
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Jagen ist für Gert G. von Harling mehr als Trophäen-Sammeln in heimischen Gefilden, mehr als der Sundowner on the Rocks vor dem Safarizelt im afrikanischen Busch. Der Autor hat in mehr als sechs Jahrzehnten, in denen er seiner Jagdleidenschaft nachging, dies alles erlebt. Es beschreibt spannend und ehrlich, was Jagen ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Ähnliche
Einbandgestaltung: R2I Ravenstein, Verden
Titelfoto: Frank Eckler; Foto auf Umschlagrückseite: MaciejBledowski/stock.adobe.com; Foto auf Umschlagklappe vorn: Gert G. von Harling; Foto auf Umschlagklappe hinten: giedriius/stock.adobe.com
Bildnachweis: Die Bilder im Innenteil stammen von Remo Engelbrecht: S. 72, 76, 78, 80/81; Nadine Grimm: S. 148/149, 152/153; Gert G. von Harling: S. 6, 34, 118/119, 126/127; Moritz von Oertzen: S. 136/137, 146, 150 sowie von Adobe Stock/stock.adobe.com: Dirk70 S. 3; veneratio S. 4, 8/9, 102/103, 159; baksiabat S. 7; LuisGregorio S. 12; Liddy Lange S. 14; alexanderoberst S. 17, 62; giedriius S. 19, 105; SGR Photography S. 20/21; pict rider S. 22; Gisela S. 24/25; WildMedia S. 26; Ana Gram S. 29; José 16 S. 31; Ronny Behnert S. 32/33; petrsalinger S. 37; szczepank S. 41, 48; EdLantis S. 42/43; Bernd Wolter S. 44; zoyas2222 S. 50; Shutter81 S. 52; bridgephotography S. 55; Alexander von Düren S. 56; Jason Reid S. 58; Steve Oehlenschlager S. 60/61; Rionegro S. 64; adrenalinapura S. 67; MeisterFoto S. 68; ksuksa S. 70/71; Sergey Novikov S. 82/83; ekim S. 84; Gregory Johnston S. 87; Erik Mandre S. 89, 96/97; Kertu S. 90/91; Dovydas S. 92; foto4440 S. 95; bortnikau S. 98; Regina S. 100; MaciejBledowski S. 107; panifuzja S. 108/109; ufotopixl10 S. 110; Andreas Edelmann S. 112/113; peter_qn S. 114; slowmotiongli S. 116; Dawid G S.121; Paul S. 123; Kevin S. 124; Vinod S. 129; Kwest S. 131; Klaus Heidemann S.132; GizmoPhoto S. 135; Agami S. 138; Pablo Avanzini S. 140; reisegraf S. 143; Nino S. 144/145; SobrevolandPatagonia S. 155; juan pablo carro/EyeEm S. 156/157.
Alle Angaben in diesem Buch wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Für einen eventuellen Missbrauch der Informationen in diesem Buch können weder der Autor noch der Verlag oder die Vertreiber des Buches zur Verantwortung gezogen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
ISBN 978-3-613-31299-9(EPUB)
Copyright © by Müller Rüschlikon Verlag
Postfach 103743, 70032 Stuttgart
Ein Unternehmen der Paul Pietsch Verlage GmbH & Co. KG
Sie finden uns im Internet unter www.mueller-rueschlikon-verlag.de
Nachdruck, auch einzelner Teile, ist verboten. Das Urheberrecht und sämtliche weiteren Rechte sind dem Verlag vorbehalten. Übersetzung, Speicherung, Vervielfältigung und Verbreitung einschließlich Übernahme auf elektronische Datenträger wie DVD, CD-ROM usw. sowie Einspeicherung in elektronische Medien wie Internet usw. ist ohne vorherige Genehmigung des Verlages unzulässig und strafbar.
Gesamtleitung: Claudia König
Lektorat: Angelika Glock
Innengestaltung: Angelika Glock
Grundlayout: Kornelia Erlewein
Folgen Sie uns für mehr Infos zu unsere n Pferdebüchern auf:
www.instagram.com/muellerrueschlikon.pferd
www.facebook.com/muellerrueschlikonverlag
Vorwort
Jagen in vertrauten Revieren …
Keine Sauen im Mais
Weitgerecht
Der Trägerschuss
Wenn ich ein Rehbock wär …
Nachtgespenster
Nur ein schwacher Spießer
… und in fremden Gefilden
Kämpfe am Wasserloch
Estland, Elche und Enttäuschungen
Hirschjagd ohne Ruf
Jagen in Down Under
Gauchos und die Pampa
Zwei Seelen und ein Gedanke, zwei Herzen und ein Schlag!Freiherr v. Münch-Bellinghausenaus: „Der Sohn der Wildnis“, Wien 1842
Gewidmet meinem Freund Dr. Sigurd Lehmann-Tolkmitt
Reminiscere, putz die Gewehre;Oculi, da kommen sie;Laetare, das ist das Wahre;Judica, sie sind noch da;Palmarum, trallarum,Quasimodogeniti –Halt, Jäger, halt, jetzt brüten sie!
(Alter Merkvers zum Schnepfenstrich)
Vorwort
„Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben.“ Der große Tenor Joseph Schmidt hat dieses Lied als Erster gesungen.
Wenn ich es höre, denke ich an die Jagd, bin dabei allerdings weniger pessimistisch. Jagd, das bedeutet für mich Einsamkeit, Ehrfurcht, Entbehrung, Erschöpfung, mitunter auch Qual. Steht am Ende der Erfolg, ist das Gefühl, das mich erfüllt, mit nichts zu vergleichen. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Nichts trifft dieser Satz besser als die Jagd. Es sind die anstrengenden Jagden, an die ich mich besonders erinnere, nicht die, bei denen mir die Beute sozusagen in den Schoss gefallen ist. Die Jagd ist gerechter als das Leben: Von ihr wird zurückgegeben, was genommen worden ist, und das mit Lohn und Gewinn, sie hat mir nichts geschenkt, aber viel gegeben.
Wenn einer auf Safari geht, dann kann er was erzählen. So geht es auch mir. Mein berufliches Leben und meine Jagdleidenschaft führten mich auf alle Kontinente und durch viele Länder dieser Erde. Allein rund drei Dutzend Mal habe ich Afrika bereist.
Mein Leben und wie ich es gestaltet habe, ist für junge Menschen heute schwer nachzuvollziehen. Ich bin konsequent meiner Passion gefolgt. Trotz guter Voraussetzungen verzichtete ich in einer Zeit, in der alte Werte nicht mehr so positiv gesehen und vertreten wurden, auf eine erfolgreiche Karriere, wählte einen Weg, der nicht zeitgemäß war. Dabei wurde mir klar: Keine Gesetze, keine Verordnungen, Verbote, freiwilligen Einschränkungen oder Bestimmungen werden die Jagd, die ethisch-moralischen Grundsätze, wie sie mir in der Jugend vermittelt wurden, retten. Die einzige Chance, das Waidwerk in seiner bewährten konservativen Form zu erhalten, liegt darin, das, was wir erfahren durften, der folgenden Generation mit Konsequenz weiterzugeben. Moral und Ethik, Verständnis, Gefühl und Demut vor der Schöpfung kann man nicht durch Gesetze regeln oder oder beeinflussen.
Gert G. von Harling Lüneburg, zur Zeit der Hirschbrunft 2021
Jagen in vertrauten Revieren …
Keine Sauen im Mais
Weit über 50 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird in Deutschland nicht mehr für die menschliche Ernährung, sondern für die Energieerzeugung bestellt. Bewusst wird mir das, als ich Kilometer für Kilometer an nicht enden wollenden Maisschlägen links und rechts der Straßen, die von der Lüneburger Heide Richtung Mecklenburg führen, vorbeifahre. Wegen der extremen Trockenheit sind viele Felder schon abgeerntet, manche, damit sich die Stoppeln noch schneller umsetzen, bereits wieder umgebrochen, auf neue Bestellung wartend. Wo Schwarzwild vor Kurzem noch Fraß und Deckung im Überfluss fand, halten Kranichschwärme nun Nachlese. Der Kreislauf in der Landwirtschaft wird von Jahr zu Jahr schneller, die Erde stöhnt unter dem Raubbau, die Natur kommt kaum noch zur Ruhe.
Sauen hatten in dem Mais gewütet, die Schäden waren enorm, wie mir der Landwirt erzählte. Bevor sich der Tag verabschiedet hatte, war ich mit meinem Hund einige Meter in das Feld hineingeschlichen. Von außen war keine Spur von Wildschaden sichtbar. Kaum war ich aber in den Schlag eingedrungen, stand ich vor riesigen platt gewalzten Flächen, übersät mit niedergerissenen Maisstängeln, angefressenen Kolben und frischer Schwarzwildlosung. Kreuz und quer hatten die Sauen breite Wechsel in die Frucht getrampelt. Aber nicht nur Schwarzwild hatte hier gewütet, auch Dachse hatten sich an den Feldfrüchten gütlich getan, wie ich an einzelnen an- und abgebissenen Kolben und Spindeln erkennen konnte.
Am Abend hatte ich dann an einem Dornenverschlag gesessen, kein Wild gesehen. Als es dunkel war, hatte ich mich mit meiner Hündin zum Schlafen an den Waldrand gelegt, um nun, beim ersten Licht, „den Erzfeinden der Kultur“, wie Johann Wolfgang v. Goethe die Schwarzkittel bezeichnete, auf die Schwarte zu rücken, an dem riesigen Schlag entlangzupirschen und sie auf dem Ein- oder Auswechsel abzupassen.
Es ist bereits so hell, dass ich die Ricke, als sie mit ihrem Kitz vertraut aus dem Mais über den Blühstreifen zwischen Waldrand und Acker zieht, von meinem Lager aus ansprechen kann. Mein Hund hat die beiden nicht bemerkt, blickt in die andere Richtung, dorthin, wo das Auto steht. Die Nacht war kalt und feucht. Hose und Jacke sind völlig durchnässt. In den letzten Tagen war es heiß gewesen, der Wetterbericht hatte weitere Hitze vorausgesagt, und ich bin guter Hoffnung, dass die Sonne bald höher steigt und ihre Strahlen wärmer werden.
Erwartungsvoll pirschen wir los. Ich voller Zuversicht, Diva etwas missmutig. Ihr behagt der hohe nasse Bewuchs nicht. Ein Hase hoppelt davon, darauf bedacht, nicht die breite Fahrspur einer Spritzmaschine mitten auf dem Grünstreifen zu verlassen. Offenbar ist es ihm ebenfalls unangenehm, durch das knöchel-, mitunter kniehohe Gewirr der Gründüngung zu springen.
Zeitweilig habe ich in der tiefen Dämmerung das Gefühl, mich auf dem Grünstreifen wie durch einen Tunnel zu bewegen, rechts die dunkle Waldkulisse, links eine Wand aus gut drei Meter hohen Maisstauden.
Kolkraben rufen, immer wieder melden sich auch Kraniche. Vor nicht allzu langer Zeit galten beide noch als „heilige Kühe“ von Vogel- und Naturschutzorganisationen. Nun sind die Besätze höher als die vieler anderer Vogelarten. Wie Sauen profitieren auch sie von dem übermäßigen Maisanbau in der Umgebung.
Allmählich verzieht sich die Dämmerung. Wir sind kaum eine Viertelstunde gelaufen, da ist es bereits fast hell, und nach einer weiteren Viertelstunde stoße ich, eingerahmt von hohen Schlehenbüschen, auf einen Ansitzbock. In der vergangenen Nacht haben die Schweine in unmittelbarer Nähe gebrochen, den Boden so umgewühlt, dass die schwarze Erde großflächig aus dem Grün hervorsticht. Der Sitz ist vermutlich seit den Drückjagden im Herbst von keinem Jäger mehr genutzt worden, auf Brüstung und Sitzbank haben sich Moos und Flechten angesiedelt.
Vorsichtig steige ich hinauf und erkenne an den Spuren im feuchten Gras, dass aus dem Feld vor höchstens einer Stunde Schwarzwild in die Dornen gezogen ist, mehrere Stücke, wie sich unschwer aus den umgelegten und umgeknickten Gräsern, Blättern und Halmen rückschließen lässt.
Hinter dem dichten Dornenverhau biegen an noch fast grünen Ebereschen orangerote Vogelbeeren die Zweige ernteschwer nach unten, senden mit wunderschön leuchtenden Früchten Signale in knalligen Farben an viele Liebhaber aus und locken vor allem gefiederte Sänger an. Zwischen dieser Baumart und den Vögeln besteht anscheinend eine Art ökologische Beziehung zum gegenseitigen Nutzen. Die Vögel bekommen mit dem Fruchtfleisch der Beeren Nahrung und verbreiten im Gegenzug die Samen der Eberesche. Daher auch ihr volkstümlicher Name „Drosselbeere“. Unter einheimischen Bäumen und Sträuchern ist die Vogelbeere bei fruchtfressenden Vogelarten die beliebteste aller Wildfrüchte.
Die Sonne nimmt nun schnell an Kraft zu. Die Schatten der hohen Maispflanzen werden kürzer. Bald leuchten sie in hellem Licht, oben noch grün, das untere Drittel braun, als hätten sie zu lange im Wasser gestanden.
Weiter geht unsere Pirsch zwischen Feld und Forst. Hinter einer Biegung tritt eine Ricke aus dem Mais. Von der Sonne beschienen, leuchtet ihre Decke rot auf. Das ihr folgende bräunlicher gefärbte Kitz strotzt ebenfalls vor Kraft und Gesundheit. Ich stehe wie versteinert, während die Büchse auf dem Zielstock ruht, und beobachte zufrieden, wie die beiden vertraut im Wald verschwinden.
Angestrengt lausche ich immer wieder. Leises Knistern und Knirschen, sanftes Rauschen und Raunen der trockenen Maisblätter, aber kein Quietschen, Blasen, Grunzen oder sonstiger Laut, der auf Sauen hindeutet.
Der Schlag ist fast zwei Kilometer lang. Über drei Viertel davon haben wir bereits hinter uns gelassen. Das behutsame Schleichen im Zeitlupentempo wird in dem hohen Bewuchs immer mühsamer, erste Ermüdungserscheinungen machen sich bemerkbar. Gegen 8.00 Uhr, nach zwei Stunden Pirsch, ist es so heiß, dass ich überlege, den Rückweg anzutreten. Da zieht ein Bock aus dem Maisfeld und verhofft drei Meter vom Rand entfernt. Weil er in die entgegengesetzte Richtung sichert, bemerkt er nicht, dass ich das Glas hochnehme, den Pirschstock vor mich aufstelle und meine Büchse in Position bringe. Durch das Zielfernrohr betrachte ich ihn mir nun genauer. Er ist nicht jung, nicht alt, nicht stark, nicht schwach, nur unauffällig. Ein Freund bezeichnet solche Böcke als 08/15-Böcke, für mich ist aber jedes Lebewesen, jeder Bock etwas Besonderes.
Da wendet er sein Haupt zu mir, und ich registriere den Schreck in seinen Lichtern, als er mich eräugt und die Gefahr erkennt. In hohen, federnden Fluchten springt er ab.
Als ich kurz darauf erneut stehen bleibe, um zu lauschen, ob sich nicht doch noch Sauen im Mais verraten, knackt es neben uns. Erst leise, verhalten, dann lauter und näher. Wildkörper streifen an harten Pflanzen entlang. Diva blickt ebenfalls gebannt zum Rand des Maisfeldes, aber der grüne Dschungel gibt sein Geheimnis nicht preis.
Tief atme ich durch. Längst liegt der Vorderschaft meiner Büchse wieder in der Schießgabel. Über das Zielfernrohr hinweg versuche ich zwischen den Maisstielen eine Bewegung auszumachen, doch nichts Auffälliges ist zu erkennen. Das Knistern, Prasseln und Brechen kommt näher. Dann ist es plötzlich ruhig.
Mit der Stille steigt die Spannung. Die Hündin steht neben mir und bebt am ganzen Körper. Fast unmerklich geht ihre Rute hin und her, ungewöhnlich, denn bei Schwarzwildbegegnungen sitzt sie sonst vollkommen erstarrt, wie ein Denkmal, und rührt sich nicht von der Stelle.
Und dann steht mitten auf dem Blühstreifen, wie hingezaubert, ein Rottier. Uns trennen nur 40 Gänge. Während es unbekümmert äst, folgen ein Hirschkalb und ein schwacher Spießer.
Der Schuss bricht, Sekundenbruchteile später dumpfer Kugelschlag, mein Puls erhöht seine Schlagzahl, und die drei sind verschwunden, zurück ins Maisdickicht geflüchtet.
Während ich zum Anschuss stapfe, trabt die Hündin vor. Im Dämmerlicht der hohen Stauden erkenne ich in dem ausgelaugten nackten Erdboden – die industrielle Agrarwirtschaft duldet keinen Raum für andere Pflanzen – Eingriffe und wenig später Lungenschweiß.
Diva sucht bereits weiter und ist nicht mehr zu sehen. Gebannt lausche ich. Nichts ist zu vernehmen, nur das sachte Spiel des Windes mit den Maisblättern dringt an meine Ohren.
Da raschelt es. Die Hündin kommt zurück. Auffordernd blickt sie mich an, und ich weiß, der Spießer liegt nicht weit vor uns im Maisdschungel. 20 Meter folge ich ihr, dann stehe ich vor ihm.
Es kostet mich viel Schweiß, unsere Beute aus dem dichten Urwald herauszuziehen. Die nun störende Büchse auf dem Rücken, muss ich das Stück quer zu den Drillreihen zerren. Unter lautem Bersten und Krachen hinterlasse ich in der Frucht eine breite Schleifspur der Verwüstung, erhöhe den Schaden, den die Sauen bereits verursacht haben, beträchtlich.
Als der junge Hirsch aufgebrochen ist, träume ich mit dem Hund noch eine halbe Stunde lang neben ihm in den frühen Vormittag, während fünf Kolkraben über uns ihrer Umwelt verkünden, dass frische Atzung am Boden wartet.
Der Verkehr auf der zwei Kilometer entfernten Landstraße wird lauter. Zu den Motorengeräuschen der Autos gesellen sich ratternde Landmaschinen. Die Arbeit auf den Feldern beginnt, die besinnliche Ruhe, der Friede der Nacht sind dahin.
Schließlich schultere ich meine Büchse und ziehe unsere Beute über das längst von der Sonne getrocknete Gras mühsam hinter mir her, zurück zum Auto. Als ich schweißgebadet dort anlange, bewegt sich eine riesige Staubwolke auf dem benachbarten Acker. Der schwere Traktor mit der großen Egge im Schlepptau ist kaum zu erkennen. Für den Fahrer hat wieder ein arbeitsreicher Tag begonnen. Ich bin froh, dass ich nun Muße habe, um erschöpft, aber dankbar mit meinem Hund gemeinsam Rückschau auf eine erfolgreiche Morgenpirsch zu halten.
Weitgerecht
Auf der Jagd in Nordfriesland kamen zwar reichlich Hasen vor, doch das Verhältnis der Schützen zu den erlegten Kreaturen stimmte nachdenklich: Nur 46 Mümmelmänner lagen auf der Strecke. Bevor sie verblasen wurden, trug mir der Wind wahre Wundergeschichten über weite Schüsse der Mitjäger zu, die Münchhausen alle Ehre gemacht hätten: „Nicht geschossen ist auch vorbeigeschossen“, meinte einer. „Habe es mal versucht, obwohl er viel zu hoch war, hätte ja klappen können“, hörte ich von einem anderen, der den Begriff „Hohe Jagd“ wörtlich genommen hatte, und während des feierlichen „Jagd vorbei“ und „Halali“ kam mir das folgende Zwiegespräch mit einem Jäger nach einer Gamsjagd in den Sinn.
„Ich musste auf 310 Gänge schießen“, schwärmte der eine Jäger. „Mein Entfernungsmesser zeigte exakt 366 Meter, mein Führer sagte, eine Handbreit drüberhalten, und es hat geklappt“, meinte ein anderer, und der dritte Kunstschütze fügte hinzu: „Ich hatte keine andere Wahl, der Bock war über 350 Schritte entfernt.“ Die „Waidmänner“ waren sich einig: Schüsse im Gebirge unter 300 Meter sind eher die Ausnahme.
Mit entsprechender Technik und unter günstigen Witterungsbedingungen mag ein versierter Sportschütze imstande sein, eine Gams auf diese Distanz zu töten. Waffenspezialisten ebenso wie Pirschführer, die auf solche Entfernungen einen Anschuss finden, gibt es aber nicht viele. In alten Jagdberichten liest man über Lebensstrecken von mehreren 1.000 Stück Gamswild. Damals waren Weitschussgewehre, Hochrasanzpatronen, stark vergrößernde Optik und Entfernungsmesser unbekannt, war Jagd anspruchsvolles Waidwerk, kein technischer Tötungsakt. Wer über weite Distanzen auf Wild schießt, baut innerlich eine Distanz zu seiner Beute auf, entfremdet sich von ihr. Manche Schützen glauben zu jagen, doch es ist lediglich leidenschaftsloses Liquidieren von Lebewesen, wenn sie den Sinnen der Tiere ausgeklügelte Technik entgegenstellen.
Jagen an sich muss Freude machen. Lauern, Schleichen und schließlich das sichere Strecken der Beute aus gerechter Entfernung oder aber ohne Beute, doch voller Erlebnisse heimkehren und nicht aus unangemessener Entfernung einfach technisch zu töten, das ist Waidwerk.
Wie ein englischer Jagdfreund es einmal auszudrücken pflegte: „Man sollte nicht die Handicaps abschaffen, die den Sport ausmachen.“
„Du brauchst keine Sternwarte auf deiner Büchse, krieche gefälligst an das Wild heran, du bist Jäger und kein Kunstschütze“, schnauzte mich unser alter Wildmeister Mackerodt an, als ich mir im zarten Alter von 16 Jahren ein Zielfernrohr wünschte.