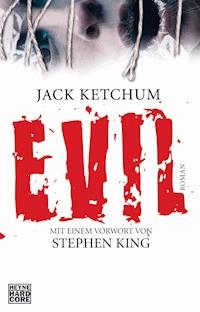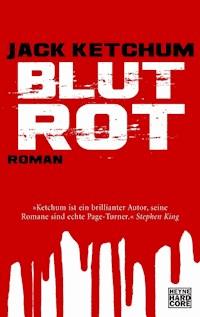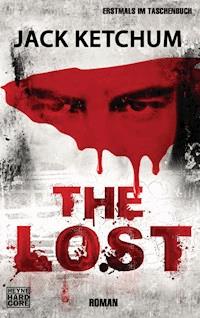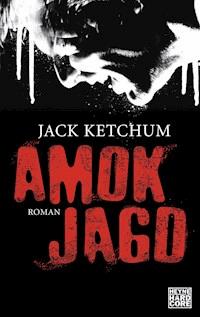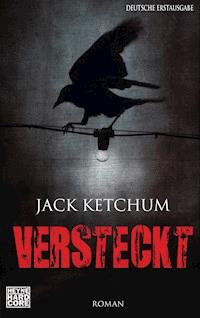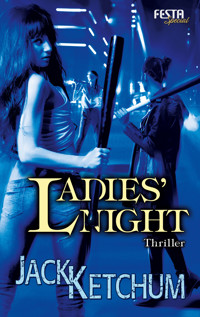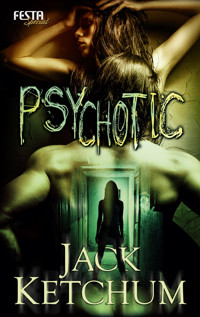3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lee ist lebend aus dem Krieg zurückgekehrt, doch er ist ein anderer Mensch geworden. Die Erinnerung verfolgt ihn in seinen Träumen. Er lebt zurückgezogen tief in einem Wald und meidet den Kontakt zu Menschen. Aber heute ist er nicht allein. Eine Gruppe Camper ist in seine zerbrechliche Welt eingedrungen. Er hört ihre Stimmen, beobachtet ihr Lager. Mit einem Mal ist der Krieg zurück. Und Lees Besucher müssen um ihr Leben kämpfen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Lee ist lebend aus dem Krieg zurückgekehrt, doch er ist ein anderer Mensch geworden. Die Erinnerung verfolgt ihn in seinen Träumen. Er lebt zurückgezogen, tief in einem Wald, und meidet den Kontakt zu Menschen. Aber heute ist er nicht allein. Eine Gruppe Camper ist in seine zerbrechliche Welt eingedrungen. Er hört ihre Stimmen, beobachtet ihr Lager. Mit einem Mal ist der Krieg zurück. Und Lees Besucher müssen um ihr Leben kämpfen.
Der Autor
Jack Ketchum ist das Pseudonym des ehemaligen Schauspielers, Lehrers, Literaturagenten und Holzverkäufers Dallas Mayr. Seine Horrorromane zählen in den USA unter Kennern neben den Werken von Stephen King oder Clive Barker zu den absoluten Meisterwerken des Genres und wurden mehrfach ausgezeichnet.
www.jackketchum.net
www.heyne-hardcore.de/ketchum
Am Ende des Buchs finden Sie ein ausführliches Werkverzeichnis aller im Wilhelm Heyne Verlag erschienenen Ketchum-Romane.
JACK KETCHUM
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Urban Hofstetter
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe COVER erschien 1987 bei Warner Books.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter www.facebook.com/heyne.hardcore
Vollständige deutsche Erstausgabe 07/2016
Copyright © 1987 by Dallas Mayr
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Marcus Jensen
Umschlaggestaltung: yellowfarm gmbh, S. Freischem,
unter Verwendung eines Motivs von© plainpicture / Westend 61 / Thomas Jäger
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-18537-4V001
www.heyne-hardcore.de
Für meine Mutter und meinen Vater
VORWORT
Was hast du während des Krieges getan, Daddy?
Von Jack Ketchum
Soweit ich weiß, habe ich keine Kinder, aber wenn ich welche hätte und sie mir die oben genannte Frage stellen würden, müsste ich eine ganze Menge und auch verdammt wenig antworten.
Als 1961 die ersten US-amerikanischen Unterstützungstruppen in Vietnam landeten, war ich gerade in der zweiten Klasse an der Highschool und hatte kaum etwas anderes im Kopf als Rock ’n’ Roll, Mädchen, mehr Mädchen, noch mehr Mädchen und Elvis’ Auftritt mit Tuesday Weld in Lied des Rebellen. Zu jener Zeit hatte niemand die Worte Krieg in Südostasien auf der Zunge; ich war also nicht alleine mit meiner Fünfzigerjahre-Unschuld.
Drei Jahre später ging ich aufs College, und alles hatte sich verändert. Johnson hatte die Tonkin-Resolution durch den Kongress gemogelt, und ich Schlauberger aus New Jersey, der mit Ach und Krach den Notendurchschnitt fürs College geschafft hatte, arbeitete wie ein Besessener, um nicht wieder von dort abgehen zu müssen. Unter den besten Studenten meines Jahrgangs. Studentensprecher. Mitglied in diesem und jenem Club. Nachts sang ich für mein Abendessen und die Unterrichtsgebühren – und klang dabei wirklich ein wenig wie Elvis. Tagsüber leerte ich die Mülltonnen der reichen Matronen von Boston.
Alles, um auf gar keinen Fall eingezogen zu werden.
Zur Zeit der Tet-Offensive im Jahr 1968, als innerhalb von nur zehn Tagen etwa 34000 Seelen ausgehaucht wurden und ein durch und durch in Misskredit geratener Lyndon B. Johnson verkündete, dass er keine »Kampagne für irgendeine verdammte Wiederwahl« betreibe, hatte ich mich einer weiteren Metamorphose unterzogen. War zu einem bunten, batikgemusterten, Schlaghosen tragenden und mit Klimbim behängten bärtigen Freak geworden, dessen Haare länger waren als die des Jesusbildes auf der Schlafzimmerwand des Fernsehpredigers Oral Roberts. Ich war stoned und auf LSD und verliebt in eine Frau, die sich Crystal Meth in den Arm spritzte. Ich marschierte und demonstrierte. Ich machte Liebe statt Krieg. An einem denkwürdigen Abend in Cambridge jagten mich Polizisten in voller Montur in eine Hayes-Bickford-Cafeteria hinein, durch das ganze Lokal hindurch und auf der anderen Seite wieder hinaus.
Ich war damals schneller.
Während des Einmarschs in Kambodscha unternahm ich mit drei anderen eine Pilgerfahrt von New York nach San Francisco – dahin, wo alles angefangen hatte. Während der Sommermonate hatte ich mich einer Theatertruppe in Maine angeschlossen und war in die Rollen von El Gallo, Duperret und Mackie Messer geschlüpft; außerdem hatte ich gerade zwei Jahre als Highschool-Lehrer hinter mir – in denen ich mit dem Lehrkörper, dem Schulrat und dem Elternbeirat auf Kriegsfuß gestanden hatte. Ich trug zwar keine Blumen im Haar, aber dafür den zerschlissenen und verbeulten Fedora-Hut meines Vaters, der sehr gut zu meinen Perlenketten und der Nickelbrille passte.
An der Westküste nahm ich auch meinen ersten Job als Autor an, bei dem ich weichgespülte Werbetexte für den Psychology Today Book Club schrieb, ohne damit sofort zu einem beschissenen Anzugträger zu werden. Wir blieben bis Winteranbruch und flogen dann zurück nach New York City. Am Flughafen von Los Angeles hielt man mich wegen eines Beutels mit Gras und vier Black Beauties fest, die in meiner Fliegerjacke aus Chamoisleder steckten, und ließ mich wieder laufen, als die Metalldetektoren wegen einer .38er zu kreischen begannen, die in der Hosentasche eines mexikanischen Geschäftsmannes steckte.
Vielleicht hatte ich damals auch mehr Glück.
Es dauerte bis 1975, dass Südvietnam endgültig zusammenbrach. Und zu diesem Zeitpunkt war ich ein beschissener Anzugträger, der als Agent und besserer Sekretär für die Cosmodemonic Literary Agency, die Agentur von Scott Meredith, arbeitete. Ein Jahr später kündigte ich diesen Job. Wenn es mir gelang, etwas von dem Mist zu verhökern, den ich im Namen der Agentur anbot, so meine Überlegung, müsste ich eigentlich auch meinen eigenen merkwürdigen Schund verkauft kriegen. Und meine Rechnung ging auf. Ich tauschte den Anzug für immer gegen einen Bademantel und eine IBM-Selectric-Schreibmaschine ein, zu der ich gelangen konnte, indem ich mich einfach nur aus dem Bett wälzte.
Der eigentliche Punkt von alldem ist nicht so sehr, was ich tat, sondern vielmehr, was ich nicht tat.
Ich bin nicht in den Krieg gezogen.
Ich kenne ein paar Jungs, die es getan haben. Mit einem von ihnen hatte ich zusammengewohnt, bevor er im ersten Jahr vom College abging und sich den Marines anschloss. Als Jugendliche hatten wir uns regelmäßig in der Combat Zone von Boston herumgetrieben, dem Rotlichtviertel der Stadt, und dort Doppelvorstellungen von Nackt-Shows besucht: DER UNMORALISCHE MR. TEAS und ORGIE BEI LIL. Wir hatten jede Menge Spaß. Jahre später bin ich ihm in New York auf der Straße begegnet. Ich steckte damals in meiner Langhaar-Phase, und er war nicht sehr erfreut, mich zu sehen.
Mit einem anderen teilte ich mir meine erste Wohnung auf dem Beacon Hill. Er machte seinen Bachelor und meldete sich dann zum Militärdienst. Er hielt das für recht und billig. Knapp zwei Jahre später war ich immer noch Lehrer in Boston, und er besuchte mich während seines Fronturlaubs. Er saß heulend auf meiner Couch und erzählte mir, dass ich der Erste in den Staaten sei, der ihm das Gefühl gebe, ehrlich willkommen zu sein. Dass die meisten ihn wie einen miesen Kriegsverbrecher behandelten, dass er sich von uns allen in der Heimat betrogen fühle und dass er sich auch von der Army betrogen fühle. Er war angeschossen worden – keine schlimme Wunde, aber sie hatte genügt, um ihn zu Tode zu ängstigen, und die Army unterbreitete ihm ein Angebot. Er hatte nicht mehr lange zu dienen, nur noch ein paar Monate. Er konnte sich zwischen zwei Optionen entscheiden: Entweder er verpflichtete sich jetzt für eine zweite Runde und bekam einen netten Schreibtischjob mit einer Schreibmaschine, oder er kehrte in die Dörfer und zu den Feuergefechten zurück und leistete dort den Rest seiner Zeit ab. Mein Freund wählte den Schreibtischjob, und ich bin froh darüber. Ich hoffe, er ist es auch.
Ich habe ihn allerdings seither ein paarmal getroffen und wünschte, ich könnte mir da sicherer sein.
In meiner Generation von US-Amerikanern kennt jeder irgendjemanden, der in diesem gottverdammten Krieg gekämpft hat – und auch irgendjemanden, der im Kampf gefallen ist. Und ich glaube, dass es in meiner Generation keinen einzigen Schriftsteller gibt, der sich nicht auf die eine oder andere Weise mit diesem Thema auseinandersetzen wollte.
Es ist unbestreitbar besser, wenn man dabei gewesen ist. Soweit es das Schreiben betrifft, meine ich.
Man kann die Geräusche, die Gefühle, sogar die einzelnen Schweißtropfen authentisch wiedergeben.
Aber dieses kleine Schweinchen ist zu Hause geblieben …
Die Idee, wie ich meinen eigenen Vietnam-Roman aufziehen wollte, kam mir ganz schlagartig, während ich mir einen fünfzehn Minuten langen Ausschnitt aus einer einstündigen HBO-Fernsehdokumentation mit dem Titel America Undercover ansah. Die Inspiration zum Originaltitel dieses Romans hier, Cover, stammt – jetzt, wo ich darüber nachdenke – möglicherweise auch daher. In dem Fernsehfilm ging es um Vietnam-Veteranen, die versuchten, sich in das Leben daheim in der echten Welt einzufügen – und dabei mehrheitlich scheiterten. Vier Männer wurden begleitet, die sich an verschiedenen Orten und in verschiedenen Situationen befanden, und einer von ihnen war dieser Kerl, der tief im Wald lebte, weil er in der Stadt Leib und Leben seiner Mitmenschen bedrohte, da er seine plötzlichen Erinnerungsschübe und Wutausbrüche nicht kontrollieren konnte. Immer mal wieder tobte er und zertrümmerte eine Bar oder seinen Arbeitsplatz. In der Wildnis dagegen war er für niemanden eine Gefahr, außer vielleicht für sich selbst. Und möglicherweise für seine Frau.
Seitdem sind vierzehn Jahre vergangen, dreizehn seit ich dieses Buch geschrieben habe, und ich kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber ich weiß noch, dass dieser Mann mich sehr berührt hat, sein innerer Kampf genauso wie die Lösung für sein Problem – seine selbstgewählte Isolation. Er steckte in einem Gefängnis so groß und weit wie der Himmel.
Er wollte nie mehr irgendwen verletzen.
Noch mehr berührte mich jedoch seine Ehefrau. Ich dachte, diese Frau nimmt eine gewaltige Herausforderung auf sich. Und sie ist nicht dumm, sie weiß es genau. Indem sie mit diesem Mann zusammenlebt, geht sie ein immenses persönliches Risiko ein. Wenn er die Kontrolle verliert, ist er so gefährlich wie Beschuss aus den eigenen Reihen. Doch wenn sie ihn verlässt, davon ist sie zutiefst überzeugt, wird er hier draußen sterben. Eines Tages wird er sich den Lauf seines Gewehrs in den Mund stecken.
Ich habe ihm mal gesagt, dass ich nicht die sein möchte, die ihn findet, wenn er sich umbringt … aber wen gibt es hier denn sonst noch? Ich werde ihn finden. Ich. Das weiß ich.
Ich glaube, diese Passage in meinem Roman ist ein beinahe wörtliches Zitat aus dem Film.
Sie liebt ihn. Betet ihn an. Man kann es ihr deutlich ansehen. Diese Frau und der gemeinsame Schmerz der beiden brachen mir das Herz und machten mich von Neuem wütend auf den Krieg.
Die Frau taucht im Buch nur sehr kurz auf, aber so, wie ich es sehe, ist sie es, die der Geschichte Seele verleiht. Sie bestimmt den Grundton, und gerade ihre Abwesenheit bildet das thematische Fundament des Romans. No se puede vivir sin amar. Dieses Zitat von Malcolm Lowry ist dem Roman vorangestellt. Es ist nicht möglich, ohne Liebe zu leben.
Ich wollte ein Buch über einen Mann schreiben, der genau das versuchen muss.
Ein liebloses Vietnam, versetzt in einen lieblosen Wald hier in der echten Welt. Ruhelose, schmerzhafte Einsamkeit beinahe jenseits aller Vorstellungskraft.
Und damals, als ich an der Highschool war, behauptete mein Vater doch wirklich, ich hätte keinen Ehrgeiz.
Ich musste es mir vorstellen. Es war meine Aufgabe, es mir vorzustellen.
Die anderen Romanfiguren, die aus der Verlagsbranche stammen, der Welt des Theaters oder der Mode – ich war mir ziemlich sicher, dass ich die hinbekäme. Zum Teufel, ich habe als Agent gearbeitet. Ich war mehrere Monate mit einer Bodybuilderin zusammen. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie sehr es schmerzt, wenn Theaterstücke, die man geschrieben hat, an winzig kleine Off-Off-Broadway-Bühnen verbannt werden. Ich habe sogar einmal zusammen mit Norman Mailer einen Berg bestiegen, mit einem Fotografen des Rolling Stone im Schlepptau. Ich kann es beweisen, weil das Magazin die Aufnahmen veröffentlicht hat.
Aber was den Veteran, das Herzstück meiner Geschichte, anbelangte – na ja, ich habe es einfach nicht selbst erlebt.
Was hätte ich also darüber wissen sollen?
Ich benötigte Hilfe, jede Menge. Ich hatte nicht vor, mit schriftstellerischer Geschicklichkeit und ein wenig Recherche billige Pappkameradenversionen von Veteranen zusammenzubasteln. Wenn es wirklich nicht anders gehen sollte, würde ich das verdammte Buch lieber gar nicht schreiben.
Die Hilfe, die ich brauchte, kam in Gestalt von Richard »Dick« Carey.
Ich habe Dick über unseren gemeinsamen Freund Neil Linden kennengelernt, der gemeinsam mit Dicks Frau Pat als Sprachtherapeut an einem Krankenhaus arbeitete.
Viele der Veteranen sprechen nicht über den Krieg, und das aus gutem Grund. Sie versuchen, die Schrecken, die sie damals erfahren haben, ein für alle Mal hinter sich zu lassen und mit dem Leben weiterzumachen. Ein paar von ihnen sprechen nicht einmal mit anderen Veteranen über ihre Erlebnisse, geschweige denn mit irgendeinem fremden Zivilisten und Schriftsteller-Fuzzi. Ich werfe es ihnen nicht vor. Mein ehemaliger Mitbewohner, den man dazu erpresst hatte, ein weiteres Mal beim Militär anzuheuern, war der Erste, den ich anrief. Er erklärte mir höflich, aber bestimmt, dass er alles, was er über den Krieg zu sagen hatte, bereits damals auf meiner Couch gesagt hatte.
Dick dagegen redete gern.
Nicht dass es immer leicht war. Im Laufe unserer Unterhaltungen sah ich einige Male, wie er sich eine verirrte Träne aus dem Augenwinkel wischte. Dick hat wohl Glück, dass er weinen kann. Ich vermute, dass viele der Jungs, die in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, es nicht können.
Das Reden hatte für Dick zwar eindeutig etwas Therapeutisches, aber es war noch mehr als das. Es gibt Veteranen, die Erfahrungen aus mehreren Lebensspannen in diesem Krieg angehäuft zu haben scheinen. Und Dick, der zwei Dienstzeiten abgerissen hatte, war so ein Soldat. Für ihn waren unsere Gespräche nicht nur eine Form der Therapie. Es ging ihm darum, mir von seinem ganz persönlichen Anteil an den geschichtlichen Ereignissen zu berichten. Er erzählte mir seine ganz eigene Geschichte und wusste, dass sie über seine Gefühle hinaus Gewicht besaß und bedeutsam war. Seine Erinnerungen an den Krieg waren sehr lebhaft, sowohl die guten als auch die schlechten – ja, ich habe gelernt, dass es in jedem Katastrophengebiet immer auch ein klein wenig Himmel gibt –, aber er machte sich nichts vor und konnte das Gute und das Schlechte voneinander unterscheiden. Dabei ging er mit sich selbst sehr offen ins Gericht.
Aus seinen Aufzeichnungen:
Sgt. Beyerling bei seinem zweiten Einsatz … wurde unser Sprengstoffexperte, hatte viel C4 und Zündkapseln bei sich. Löste eine Granaten-Sprengfalle aus, wurde in sechs Stücke gerissen und überall verstreut, schöner und milder Tag, wie ein Spaziergang im Park … sind nach Süden gezogen, haben uns der 11. Kavallerie angeschlossen … haben einen nächtlichen Hinterhalt gestellt. Ich habe den Vietcong-Späher getötet, zwei weitere tot, andere entkommen … drei Enten IKG (Im Kampf Gefallen) haben mit Aprikosenmarmelade sehr lecker geschmeckt … mit dem Helikopter nach Westen … tief im Dschungel patrouilliert … neblig, regnerisch, feucht … das Tal der Blutegel, jeder hatte welche … zurück zum Lager, wo die Bunker mit zahlreichen Sandsäcken verstärkt waren; der Monsun hat uns mit voller Gewalt getroffen und alle Bunker schwer beschädigt; zwei Jungs haben sich die Beine gebrochen, als die Wände einstürzten; ein spaßiger Ort … nach Norden verlegt … neue Jungs in der Einheit haben es nicht geschafft, ein Vietcong-Mädchen mit dem Gewehr zu erschießen … sie ist entkommen … Thanksgiving 1967, leichter Nieselregen … haben erfahren, dass Kav.-Einheit in Schwierigkeiten steckt … zwei Platoons waren schon angetreten, um von Helikoptern aufgenommen zu werden … Helikopter kamen aus der falschen Richtung und landeten in der Hölle … die ersten beiden Helikopter schlugen auf dem Boden auf, das zweite Platoon ist praktisch ausgelöscht …
Das sind nur Auszüge.
Von seiner Frau Pat erfuhr ich, was es bedeutet, mit einem Mann zusammenzuleben, den man liebt und der immer noch von den Dingen heimgesucht wird, die er in Vietnam gesehen und getan hat. Mit einem Mann, den man immer noch sanft und leise aufwecken muss, damit er einem nicht an die Gurgel geht, weil er glaubt, er sei wieder drüben. Einem Mann, der immer noch zu zittern anfängt, sobald Hubschrauber über seinen Kopf hinwegfliegen. Und der bei so ziemlich jedem lauten Geräusch zusammenzuckt und sofort an einen feindlichen Angriff denkt.
Dick hat mir auch eine Menge Bücher, Artikel und Romane zu dem Thema empfohlen. Dispatches (dt. An die Hölle verraten) von Michael Herr, Vietnam: The Valor and the Sorrow von Thomas D. Boettcher, Charlie Company: What Vietnam Did to Us von Peter Goldman und Tony Fuller, One Morning in the War von Richard Hammer, Born on the Fourth of July (dt. Geboren am 4. Juli) von Ron Kovic, Going after Cacciato von Tim O’Brien, The 13th Valley von John M. Del Vecchio, um nur ein paar zu nennen.
Die Bücher waren zwar hilfreich, doch wirklich geholfen haben mir vor allem Dick und Pat. Wenn ich wollte, erzählten sie mir ganze Nächte lang Geschichten, bei ein paar Gläsern Bier oder Scotch, bei Grillpartys oder in Restaurants. Über mehrere Monate hinweg hießen sie mich immer wieder bei sich zu Hause willkommen und erlaubten mir, ihnen jede erdenkliche Frage zu stellen, egal wie persönlich, Tag und Nacht, am Telefon oder im direkten Gespräch. Niemals zuvor oder seither habe ich so eine großzügige Zusammenarbeit erlebt. Oder Menschen, mit denen die Zusammenarbeit so einen Spaß gemacht hat. Ich habe den beiden zwar bereits in der bei Warner Books veröffentlichten Ausgabe gedankt. Aber ich glaube, dass die Erzählstimme dieses Buchs zu einem großen Teil von Dick inspiriert ist – wenn ich es heute wieder lese, höre ich ihn ganz deutlich heraus –, und ich freue mich über die Gelegenheit, ihm und Pat ein weiteres Mal und etwas ausführlicher danken zu können.
Es dauerte fast ein Jahr, bis ich den Mut aufbrachte, diesen Roman zu beginnen – bis ich endlich das Gefühl hatte, dass mein Veteran authentisch wirkte. Als ich so weit war, ging mir das Schreiben ziemlich leicht und innerhalb eines halben Jahres von der Hand. In dieser Zeit telefonierte ich noch einige Male mit Dick und Pat, um ganz sicherzugehen, dass auch alle Details stimmten. Aus anderen Quellen holte ich mir ein paar Ratschläge zum Thema Mode ein. Und ein alter Freund erklärte mir, wie man große Mengen von allerfeinstem Cannabis Sativa pflanzt, kultiviert und erntet. Meiner Agentin Alice Martell gelang es dann relativ schnell, das Buch an Jim Frost bei Warner Books zu verkaufen. Im April ’86 unterschrieb ich den Vertrag.
Was hast du während des Krieges getan, Daddy?
Eine ganze Menge und verdammt wenig. Zumindest im Vergleich zu den Veteranen. Natürlich habe ich all die Entwicklungen durchgemacht, die ich zu Beginn dieses Textes beschrieben habe. Mädchen an der Highschool hinterherjagen, mich besaufen, schauspielern, singen, protestieren, reisen, unterrichten.
Und ich habe noch etwas anderes getan. Während all dessen habe ich geschrieben – oder versucht zu schreiben. Von Beginn der Highschool an.
Jack Ketchum, September 1999
Lasst uns mutig bleiben und versuchen, geduldig und freundlich zu sein. Wir wollen nicht davor zurückschrecken, exzentrisch zu sein. Und nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden.
– Vincent van Gogh
No se puede vivir sin amar.
(Es ist nicht möglich, ohne Liebe zu leben.)
– Malcolm Lowry, Unter dem Vulkan
Bräuchte ich für das, was ich tue, nicht mehr Legitimation?
– Lyndon B. Johnson
Teil 1
Kapitel 1
Dienstagnacht / Mittwochmorgen
Sie ließ sich neben ihm auf die Knie nieder. Er konnte den sauberen, frischen Duft ihrer Seife riechen. Und den Duft ihres Haares, das im Licht der untergehenden Sonne langsam trocknete. Ihre Vertrautheit versetzte ihm einen Stich.
Halt durch, dachte er.
Sie half ihm, das Feuer anzuzünden. Das Anzündholz war heute gut – gut und trocken. Am Vormittag hatte es einen kurzen Schauer gegeben, der Nachmittag wurde dann heiß. Ein schöner Tag. Ein leichter Tag. Der Wald wogte sanft im warmen Herbstwind. Sie arbeiteten, ohne ein Wort zu wechseln. Und er dachte, dass es vielleicht gerade an der Leichtigkeit und Schönheit des Tages gelegen hatte, weshalb sie nun so miteinander waren.
Denn auch Ruhe und Frieden können trügerisch sein. Nicht jeder stirbt in einem Feuergefecht.
Nicht jeder stirbt schreiend.
Sie hatte viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Zeit, während der sie innerlich all die alten, ausgetretenen Pfade ihrer Unzufriedenheit entlangwandern konnte. An alles denken, was sie vermisste. Alleine. Ohne den Jungen – und ohne ihn.
Er betrachtete sie: die niedergeschlagenen großen blauen Augen, die zusammengekniffenen Lippen, die kleinen, kräftigen Hände, die emsig Stöcke zerbrachen und Zweige von Laub befreiten.
Sie wird alt, dachte er. Sie runzelt immer öfter die Stirn.
Ich mache sie alt.
Er spürte, wie das vertraute Gefühlsgemisch von Wut und Zärtlichkeit in ihm hochkochte, von Zorn und Tränen. Er wandte sich ab.
Mir kommen in letzter Zeit so schnell die Tränen.
In Vietnam hatte er nie geweint. Er hatte sich zusammengerissen und getan, was getan werden musste. Damals war es überlebenswichtig gewesen, keine Schwäche zu zeigen. Aber was hatte sich seitdem eigentlich geändert? War es nicht immer noch eine Frage des Überlebens? Ein anderer Wald, natürlich, ein anderer Partner – aber da draußen lauerte weiterhin der Feind, drohte eine Art Friendly Fire. Von jemandem, der einen aufgreifen und von hier wegbringen könnte, irgendwohin, wo man zu überhaupt nichts nutze und vielleicht sogar gefährlich wäre. Nach Hause.
Wobei es doch gar kein Zuhause gab. Es sei denn, das hier war sein Zuhause. Als ob es so etwas überhaupt je geben könnte. Als ob Vietnam für ihn je zu Ende gegangen wäre.
Er fühlte, wie seine Eingeweide sich zusammenkrampften – der Zusammenstoß zweier Ängste. Er hatte Angst davor, alleine zu sein. Todesangst. Sie tobte wie ein tollwütiger Hund in ihm.
Niemand würde ihn je von hier wegbekommen. Niemals. Nicht mal sie.
Was geschah, was sollte man tun, wenn man dem Menschen nicht mehr vertrauen konnte, den man am meisten brauchte? Wenn man seinem eigenen Partner nicht mehr vertrauen konnte?
Er schürte die Flammen und sah sie nicht an.
Neun Jahre, dachte sie. Neun Jahre, und er lächelt immer noch nicht. Lacht nicht. Und seit fünf Jahren haben wir ein gemeinsames Kind, Lee Jr., das klug ist und blond und stark. Aber er nennt ihn nicht beim Namen. Für ihn ist er nur »der Junge«. Sein einziger Sohn. Und jetzt musste ich ihn wieder wegschicken – meinen einzigen Trost hier draußen –, weil sein Vater erneut von der Vergangenheit eingeholt wird. Ich spüre, wie er auf dem Hochseil balanciert, wie Wut und Frustration sich in ihm aufstauen. Und seinen ständig stärker werdenden Verfolgungswahn, der es ihm immer schwerer macht, lieb zu uns zu sein. Und ich weiß, dass er einem wehtun kann. Einem hier draußen sehr wehtun kann.
Und jetzt kommt noch eins. Noch ein Kind. In sieben Monaten ist es so weit. Ich wollte ein Mädchen.
Was, wenn er es wüsste?
Würde er sich freuen?
Ich glaube nicht. Er kann das gar nicht: sich freuen.
Es wäre nur etwas Neues, was ihm Angst einjagt. Wieder eine Chance für die Welt, ihn hier in seinem Versteck in der Wildnis aufzuspüren und zu verletzen. Ein weiterer Grund, warum man ihn von hier verschleppen könnte.
Also weiß er es nicht.
Und ich sitze hier und mache ein Feuer für ihn. Das billionste Feuer zwischen uns. Immer und immer wieder.
Während Lee Jr. im Haus seiner Großmutter spielt; während etwas Neues und – für mich – Wundervolles in mir heranwächst. Während er ins Feuer starrt, mit Augen, die in einem Moment so traurig aussehen und so ausdruckslos und leer im nächsten. Ich habe ihm einmal gesagt, dass ich nicht die sein möchte, die ihn findet – wie einen weggeworfenen Sack –, falls er sich eines Tages umbringt. Er hat es verstanden. Er hat gesagt, dass er es versteht. Und er hat es mir versprochen. Aber wer ist denn sonst noch da?
Ich werde ihn finden. Ich werde diejenige sein. Ich weiß es.
Wenn ich ihn verlasse, wer ist denn sonst noch da? Ich habe mir diese Frage schon so oft gestellt. Und jedes Mal lastet sie schwerer auf mir. Ich könnte ein Leben lang um ihn weinen, um uns, wenn sich nicht etwas von ihm inzwischen auch in mich eingebrannt hätte und ich mich nicht ebenso zurückhalten könnte wie er. Aber dieses Leben fühlt sich wie ein Todesurteil an. Wie ein verhängnisvolles Schicksal. Wie die Strafe für irgendeine Sünde. Und Gott steh mir bei, ich fühle mich wie eine Verräterin, wie Judas. Ich muss dem ein Ende setzen.
Er macht mir Angst.
In den Nächten, wenn er um drei oder vier Uhr morgens rastlos vor dem Lagerfeuer hin und her geht, hin und her. Und dann bleibt er stehen und lauscht, und ich sehe, wie sich die Muskeln in seinem Rücken verkrampfen. Und ich weiß, was er hört. Nicht die Geräusche der Nacht, die Frösche und die Grillen. Die Geräusche kommen nicht aus diesem Wald hier. Der Schweiß glänzt auf seiner Haut, rinnt ihm den Rücken runter. Die Nacht kann sogar kühl sein, aber das ist ganz egal. Er steht in einem anderen Wald, und da ist es heißer. Er hört seine Kameraden sterben, im Schlaf stöhnen. Er hört Explosionen, Schüsse. Es ist mehr als nur eine Erinnerung.
Er ist wirklich dort.
Er kommt zu mir zurück, und wir reden. Er sieht, dass ich wach bin, und er erzählt es mir. Ich höre ihm zu. Das kann ich für ihn tun – etwas, was sie in jenem Wald nie tun konnten. Sie konnten niemals wirklich miteinander reden. Weil sie Männer waren. Ich vermute, dass es zum Teil daran lag. Und weil sie Soldaten waren. Aber auch weil sie nie wussten, wer dort draußen im Dschungel lauerte, sich vom Klang ihrer Stimmen leiten ließ, sich heranpirschte, um sie zu töten. Das ist es, was ich um drei, vier Uhr morgens, bei Tagesanbruch, in der Dämmerung für ihn tun kann. Ich kann mit ihm reden.
Und was wird er tun, wenn er das nicht mehr hat?
Ich bin seine Freundin, seine Geliebte, seine Waffengefährtin.
Und was wird er tun, wenn er das nicht mehr hat?
Ich sage mir selbst, dass es sich nicht ändern lässt, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich werde nicht noch ein Kind in die Welt setzen, nur damit wir uns hier draußen zugrunde richten. Aber das ist es nicht allein.
Ich ertrage es nicht, mich so einsam zu fühlen.
Weil er kaum jemals hier bei mir ist. Nicht richtig. Er ist irgendwo dort drüben, Meilen und Jahre von mir entfernt, in Sümpfen und in der Hitze. Ich schwöre, ich habe nie geahnt, dass man sich so einsam fühlen kann.
Ich mache mir nichts vor. Ich weiß, was ich tun werde. Ich werde ihn umbringen. Das werde ich.
Er ist ein großer, starker neununddreißig Jahre alter Mann, der mehr vom Überlebenskampf versteht, als die meisten Männer je verstehen müssen oder wollen. Er könnte mich in der Mitte durchbrechen, ganz leicht; er könnte die meisten anderen Männer in der Mitte durchbrechen. Und trotzdem ist sein Leben ein so dünnes Gespinst, dass ich glaube, der Wind könnte es wegwehen – so zerbrechlich, wie es ist.
Ich weiß also, was ich bin und was ich morgen sein werde, wenn ich von hier fortgehe. Ich spüre, wie er mich ansieht. Er hat die Augen eines Kindes, das im Wald zurückgelassen wurde. Und ich weiß, wie seine Augen aussehen werden – wie die einer Katze, die man in eine Papiertüte steckt und ertränkt. Und vielleicht bringt der Schmerz, den ich ihm zufüge, auch mich selbst um. Vielleicht bringt es mich um, dass ich ihn verrate. Denn ich verrate ihn.
Ich liebe ihn. Ich sehe ganz klar, wer er ist. Und ich muss wieder anfangen zu leben, aber ich mache mir keine Illusionen. Ich weiß, wer es ist, die ihn verlassen wird, um ihr eigenes trauriges, verängstigtes und einsames Leben zu retten.
Eine Mörderin.
Eine Feindin.
Wie so viele zuvor.
Die Nacht brach herein, und von Westen wehte ein kühler Wind. Daher schichteten sie mehr Holz auf das Feuer und wählten jetzt große Scheite, damit es möglichst lange brannte, ohne dass sie etwas dafür tun mussten. Sie drehten sich Zigaretten mit dem Tabak aus der Dose und tranken Kaffee. Der Hund, Pawlow, ein drei Jahre alter Schäferhund mit einer Kerbe im linken Ohr, rollte sich ihnen gegenüber zusammen und sah zwischen ihnen hin und her. Der Mann zog seine hohen Lederstiefel aus und streckte seine Füße näher an das Feuer heran. Die Frau stand auf und holte Decken aus dem Zelt. Sie gab ihm eine. Er legte sie sich um die Schultern.
Bald langte der Mann hinter sich nach dem Kassettengerät und durchwühlte eine Plastikschachtel mit Aufnahmen. Als die Musik erklang, war sie leiser als das Knistern des Feuers.
Born under a bad sign
I been down since I began to crawl
If it wasn’t for bad luck
I wouldn’t have no luck at all.
Der Hund war unruhig. Er achtete nicht auf die Musik und spitzte die Ohren zu den Geräuschen der Nacht. Der Mann zog eine Flasche Bourbon aus dem Rucksack, schraubte den Deckel ab, nahm einen Schluck und hielt sie der Frau hin. Sie sah sie einen Moment lang an, zuckte die Schultern und nahm sie. »Du weißt es, oder?«, stellte sie fest.
Er nickte. »Ja.«
»Gleich morgen früh nach dem Aufstehen.«
»Ich werde uns was zum Frühstück besorgen und dir helfen.«
Er nahm ihr die Flasche aus der Hand und trank noch einen Schluck.
»Du wirst es nicht versuchen?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort kannte.
»Ich habe es versucht.«
»Das ist schon ziemlich lange her.«
»Nicht lange genug.«
Der Wind wehte aus dem Osten und blies den Rauch zu ihm hin. Es schien ihm nichts auszumachen.
Sie saßen da.
»Wir werden dich vermissen, Alma«, sagte er. Sie lächelte ein wenig, weil er den Hund mit einschloss. Das sah ihm ähnlich.
Er nahm einen Zug aus der Flasche. Er trank sogar vorsichtig – nicht unkontrolliert.
Sie beobachtete durch die blassen Rauchschwaden, wie er sich zurücklehnte und mit den Zehen wackelte, sie am Feuer wärmte. Sie sah Tränen in seine Augen steigen. Dann blinzelte er, und die Tränen waren weg.
ENDE DER LESEPROBE