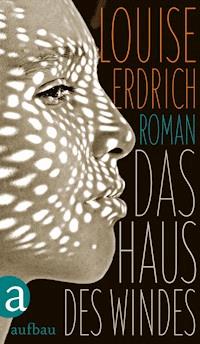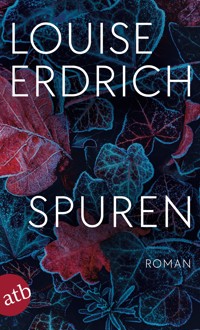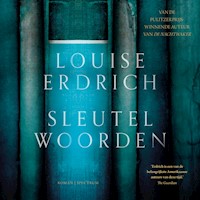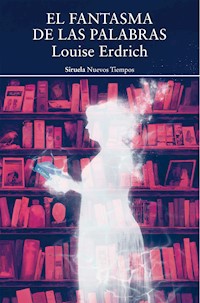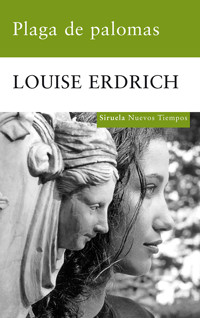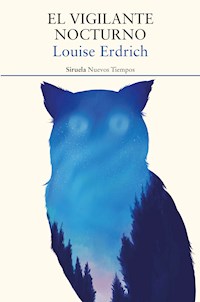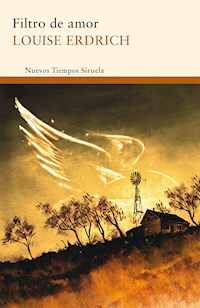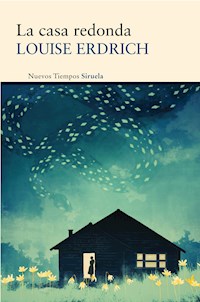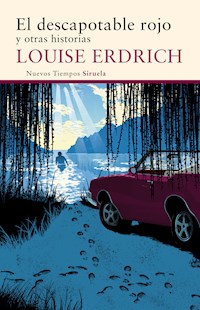10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman von Pulitzer-Preisträgerin Louise Erdrich.
Während sich in Minneapolis wütender Protest gegen rassistische Polizeigewalt formiert, wird eine kleine Buchhandlung zum Schauplatz wundersamer Ereignisse: Flora, eine treue Kundin, stirbt an Allerseelen und treibt fortan als Geist ihr Unwesen im Laden. Besonders Tookie, die dort nach einer Gefängnisstrafe arbeitet, erhält rätselhafte Zeichen. Denn die beiden Frauen verbindet mehr als ihre Liebe zur Literatur. Tookie muss sich den Geistern der Vergangenheit und ihrer indigenen Herkunft stellen. Und sich wie alle in der Stadt fragen, was sie den Lebenden und den Toten schuldet.
Louise Erdrich zeigt eindrucksvoll, wie erhellend Literatur in düsteren Zeiten sein kann – und verfasst zugleich eine Liebeserklärung an Lesende, Bücher und jene, die sie verkaufen.
»Bezaubernd, hinreißend und witzig.« The New York Times.
»Ein Wunder … Ein absolut origineller, erheiternder Roman.« Boston Globe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Während sich in Minneapolis wütender Protest gegen rassistische Polizeigewalt formiert, wird eine kleine Buchhandlung zum Schauplatz wundersamer Ereignisse: Flora, eine treue Kundin, stirbt an Allerseelen und treibt fortan als Geist ihr Unwesen im Laden. Besonders Tookie, die dort nach einer Gefängnisstrafe arbeitet, erhält rätselhafte Zeichen. Denn die beiden Frauen verbindet mehr als ihre Liebe zur Literatur. Tookie muss sich den Geistern der Vergangenheit und ihrer indigenen Herkunft stellen. Und sich wie alle in der Stadt fragen, was sie den Lebenden und den Toten schuldet. Louise Erdrich zeigt eindrucksvoll, wie erhellend Literatur in düsteren Zeiten sein kann – und verfasst zugleich eine Liebeserklärung an Lesende, Bücher und jene, die sie verkaufen.
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Für ihren Roman »Der Nachtwächter« erhielt sie 2021 den Pulitzer-Preis. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag und im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls ihre Romane »Die Wunder von Little No Horse«, »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« sowie »Von Büchern und Inseln« lieferbar.
Gesine Schröder übersetzt seit 2007 aus dem Englischen und hat u. a. Jennifer duBois und Curtis Sittenfield ins Deutsche übertragen. Nach Aufenthalten in den USA, Australien, Indien, England und Kanada lebt sie in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Jahr der Wunder
Roman
Aus dem Amerikanischen Englisch von Gesine Schröder
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
Bußzeit Auszeit
Erde zu Erde
Die Geschichte einer Frau
November 2019
Raue Buchhandelsromanze
Kundschaft
Papierhandtücher
Lachsforellen
Miigwechiwigiizhigad — (Der Danksagungstag)
Bücherpfade
Das andere Ich der Penstemon Brown
Der Beichtstuhl
Verurteilt
So dankbar!
Fragen an Tookie
Echt
Das Medizinhistorische Militärmuseum
Schlummersonntag
Schwarzer Schnee
Nie
102 Jahre
Blau
Unzufrieden
Die Verwechslung
Geröstete Maissuppe
Sonnenwendfeuer
Hetta
Einundzwanzigster Dezember
Bonne Année
Ein warmer Januarabend
Sanfter Sasquatch
Kuckucksbücher
Laurent
Fegefeuer?
1000 Grad
Weissagung
Ende Januar
Lass mich rein
Februar 2020
Vierzehnter März
Hettas Mitternachtsgeister
Tookies Umkreis
Adlerlieferung
Unser letzter Kunde
Perfekte kurze Romane
Tookies Heimsuchung
Floras Streiche
Ain’t No Grave
Komm mich holen
Komm mich holen
Penstemongrün
Das Jahr der brennenden Geister
Mai
Midnite Cowgirl
Brennende Geister
Minnesota Goddamn
Signalereignis
25. Mai
Heimgesuchte Stadt
Der Rasenstreifen
28. Mai
Nacht
29. Mai
Popcorn und Brandstiftung
30. Mai
Das Haus
31. Mai
32. Mai
Die Kreise
34. Mai
Pollux’ Heimsuchung
Der Kreis
Eine besondere Vorsichtsmaßnahme
Die Professorin
Die Begegnung
Mein Herz, mein Baum
Der Rugaroo
Kissen und Laken
Die Geschichte des Rugaroo
Glück und Liebe
Die Frybread-Stunde
Fragen von Tookie an Tookie
Regenbogen
Lily Florabella
Der schönste Satz
Ego te absolvo
Tookies Rückkehr
Seelen und Heilige
Dunkle Jahreszeit
Halloween
Allerheiligen
Allerseelen
Knochen
Tookies komplett subjektive Lieblingsbücherliste
Heimsuchungsbewältigungsbücher
Perfekte kurze Romane
Der Segelboottisch (erbaut von Quint Hankel)
Bücher über verbotene Liebe
Indigenes Leben
Indigene Lyrik
Indigene Geschichte und Sachbuch
Erhabene Bücher
Tookies Pandemielektüre
Strafvollzug
Danksagung
Erläuterungen
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für alle, die je bei Birchbark Books gearbeitet haben, für unsere Kundinnen und Kunden sowie für unsere Geister
Vom Zeitpunkt der Geburt bis zum Zeitpunkt des Todes ist jedes Wort, das man ausspricht, Teil eines einzigen langen Satzes.
Sun Yung Shin, Unbearable Splendor
Bußzeit Auszeit
Erde zu Erde
Im Gefängnis bekam ich ein Wörterbuch. Es wurde mir mit einer persönlichen Notiz per Post gesendet. Dies ist das Buch, das ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Später ließ meine Lehrerin noch andere Bücher folgen. Aber wie sie es vorhergesehen hatte, erwies sich vor allem das Wörterbuch als unendlich nützlich. Das erste Wort, das ich darin nachschlug, war »sentence«. Ich hatte ein unfassbares Strafmaß – a sentence – von sechzig Jahren Haft aufgebrummt bekommen, von einem Richter mit einem unverbrüchlichen Glauben ans Jenseits. Deshalb verfolgte mich dieses Wort mit seinem gähnenden c, den feindseligen kleinen es, den scharfen Zischlauten und dem zweifachen n, dieser repetitive Alptraum von einem Wort aus lauter hinterrücks stichelnden Buchstaben, die ein einsames menschliches t umstanden, jede Minute eines jeden Tages. Ich weiß genau, ohne das Wörterbuch hätte dieses leichte Wort, das so schwer auf mir lastete, mich erdrückt – oder was von mir übrig war nach meiner verqueren Tat.
Ich war in einem schwierigen Alter, als ich straffällig wurde. In den Dreißigern zwar, aber ich klammerte mich an die körperlichen und mentalen Gepflogenheiten der Jugend. Es war das Jahr 2005, aber ich feierte wie 1999, trank und nahm Drogen wie mit siebzehn, trotz aller Proteste meiner ein schlechtes Jahrzehnt älteren Leber. Aus allen möglichen Gründen wusste ich nicht, wer ich war. Jetzt, wo ich es besser weiß, kann ich sagen: Ich bin eine hässliche Frau. Nicht die Sorte, über die Männer Bücher und Filme schreiben, und plötzlich kommt da dieser Schwall blendender, belehrender Schönheit. Ich hab’s nicht so mit Erkenntnismomenten. Und innere Schönheit besitze ich auch nicht. Zum Beispiel lüge ich gern, und ich bin gut darin, Leuten sinnloses Zeug anzudrehen, das sie sich nicht leisten können. Jetzt allerdings, wo ich rehabilitiert bin, verkaufe ich bloß noch Wörter. Sammlungen von Wörtern zwischen zwei Pappdeckeln.
In Büchern steht alles, was du wissen musst, bis auf das, was am Ende zählt.
An dem Tag, als ich mein Verbrechen verübte, lag ich meinem Schwarm Danae zu den dürren weißen Füßen und kämpfte mit einem inneren Ameisenhaufen. Das Telefon klingelte, und Danae fummelte sich den Hörer ans Ohr. Sie lauschte, sprang auf, kreischte. Umklammerte das Telefon mit beiden Händen und verknautschte ihr Gesicht. Dann wasserwanzten ihr die Augen über.
Er ist in Maras Armen gestorben. O Gott, o Jesus. Sie weiß nicht, was sie mit der Leiche tun soll!
Danae schleuderte das Telefon von sich, warf sich wieder aufs Sofa, heulte und zappelte mit den spinnengliedrigen Armen und Beinen. Ich verkroch mich unter dem Couchtisch.
»Tookie! Tookie! Wo bist du?«
Ich stemmte mich auf ihre jagdhüttenen Elchpolster und versuchte mein verstörtes Liebchen zu trösten – wiegte sie und drückte mir ihren gelben Zauskopf an die Brust. Danae war älter als ich, aber dürr wie eine flaumige Vorpubertäre. Wenn sie sich an mich schmiegte, fühlte ich mein Herz sich weiten und wurde zu ihrem Schutzschild. Oder vielleicht erzeugt das Wort »Bollwerk« das passendere Bild.
»Ist schon gut, ich hab dich«, sagte ich mit möglichst rauer Stimme. Je lauter sie weinte, desto glücklicher war ich.
»Und nicht vergessen«, fügte ich von ihrem hilflosen Schniefen hocherfreut hinzu, »du bist eine Gewinnerin!«
Zwei Tage davor hatte Danae einen einmalig hohen Gewinn im Casino eingestrichen. Aber es war zu früh, um über die rosige Zukunft zu reden. Danae packte sich an die Kehle, versuchte sich die Luftröhre herauszureißen, knallte den Kopf auf den Couchtisch. Von unheimlicher Kraft erfüllt, zerschlug sie die Lampe und versuchte sich mit einer der Plastikscherben aufzuschlitzen. Wo sie doch allen Grund hatte zu leben.
»Scheiß auf das Geld. Ich will ihn! Budgie! O Budgie, meine Seele!«
Sie rammte mich vom Sofa.
»Er sollte bei mir sein, nicht bei ihr. Bei mir.«
Diesen Sermon bekam ich seit einem Monat zu hören. Danae und Budgie hatten zusammen durchbrennen wollen. Ein kompletter Umsturz der Realität. Sie hatten beide behauptet, sie wären in eine Paralleldimension des Begehrens vorgestoßen. Aber dann gab ihnen die alte Welt eins über die Rübe. Eines Tages nüchterte Budgie sich aus und kehrte zu Mara zurück, die nicht einmal ein schlechter Mensch war. Sie hatte es immerhin geschafft, clean zu werden und clean zu bleiben. Glaubte ich zumindest. Jetzt allerdings sah es danach aus, als wäre Budgies Versuch, wieder normal zu werden, gescheitert. Wobei sterben ja auch normal ist.
Danae stieß ein Geheul aus.
»Weiß nicht, was sie mit seiner Leiche tun soll! Was, was, was soll das heißen?«
»Du bist wahnwitzig vor Trauer«, sagte ich.
Ich gab ihr gegen diese Heulerei ein Küchenhandtuch. Es war dasselbe Handtuch, mit dem ich die Ameisen zu bekämpfen versucht hatte, obwohl ich wusste, dass ich halluzinierte. Sie hielt es sich vors Gesicht und wiegte sich vor und zurück. Ich ignorierte die zerquetschten Ameisen, die ihr durch die Finger rannen. Sie zuckten immer noch mit den Beinchen und wedelten mit zarten Fühlern. Eine Idee durchfuhr Danae. Es schüttelte sie, und sie erstarrte. Dann drehte sie den Hals, plärrte mich aus geröteten Augen an und sprach grausige Worte.
»Budgie und ich sind eins miteinander. Ein Körper. Seinen Körper sollte ich haben, Tookie. Ich will Budgie, meine Seele!«
Ich verdünnisierte mich zum Kühlschrank und holte ein Bier heraus. Ich brachte es Danae. Sie schlug meinen Arm weg.
»In dieser Lage müssen wir einen klaren Kopf bewahren!«
Ich stürzte das Bier hinunter und sagte, wir müssten uns kaputtsaufen in dieser Lage.
»Wir sind schon kaputt! Das Irre ist doch, sie hat ihm ein Jahr lang den Sex verweigert, und jetzt hat sie seinen gottgegebenen Körper.«
»Es war ein ganz normaler Körper, Danae. Er war kein Gott.«
Sie war für meine Einwände unempfänglich, und die Ameisen waren Feuerameisen; ich kratzte mir die Arme blutig.
»Wir treten ihr die Tür ein«, sagte Danae. Ihre Augen waren flammend rot geworden. »Wir gehen da rein wie gottverdammte Marines. Wir bringen Budgie nach Hause.«
»Er ist doch schon heimgegangen.«
Sie schlug sich auf die Brust. »Ich, ich, ich bin sein Zuhause.«
»Ich geh dann mal.«
Ich kroch auf die kaputte Tür zu. Dann kam der Hammer.
»Warte, Tookie. Wenn du mir hilfst, Budgie herzuschaffen, ja? Wenn du ihn zurückholst? Dann kriegst du den Casinogewinn. Das ist ein Jahresgehalt, also, für eine Lehrerin, Süße. Oder für eine Schuldirektorin? Das sind 26 000 Dollar.«
Ich hielt auf der schmierigen Fußmatte inne und überlegte auf allen vieren.
Danae spürte meine Ehrfurcht. Ich legte den Rückwärtsgang ein, wälzte mich herum und blickte in ihre kopfüber gedrehte zuckerwattige Miene.
»Ich gebe sie dir gern. Aber bitte hilf mir, Tookie.«
Ich hatte schon so vieles in diesem Gesicht gesehen. Das glitzernde Glühen, die Lamettariesenräder und so manches mehr. Die vier Winde, wie sie die großmaschige grüne Welt durchfuhren. Blätter, die sich in ein künstliches Gewebe verflochten und mir den Blick versperrten. Nie hatte ich gesehen, wie Danae mir Geld anbot. Egal, welchen Betrag. Und dieser Betrag war verlockend. Es war verstörend, berührend und das Folgenreichste, das sich je zwischen uns abgespielt hatte.
»Oh, Babe.« Ich legte die Arme um sie, und sie hechelte wie ein weicher Hundewelpe. Öffnete den nassen Schmollmund.
»Du bist meine beste Freundin. Du kannst das schaffen. Du kannst mir Budgie wiederbringen. Sie kennt dich nicht. Mara hat dich noch nie gesehen. Und du hast doch den Kühltransporter.«
»Jetzt nicht mehr. North Shore Foods haben mich gefeuert«, sagte ich.
»Nein!«, rief sie. »Warum das denn?«
»Ich hab mich manchmal mit dem Obst verkleidet.«
Ich hatte mir beim Ausliefern Melonen in den Ausschnitt gesteckt und so was. Gurken in die Hose. Was sollte daran so schlimm sein? Meine Gedanken kreiselten. Wie immer, wenn ich einen Job antrat, hatte ich die Schlüssel nachmachen lassen. Sobald die Kündigung kam, gab ich das Original zurück. Meine Kopien legte ich sorgfältig beschriftet in eine Zigarrenkiste. Als Andenken an meine Arbeit. Es war bloß eine Angewohnheit. Ohne böse Hintergedanken.
»Ich weiß nicht, Danae, da braucht man einen Notarztwagen oder Leichenwagen oder so was.«
Sie streichelte mir flehend den Arm, hoch und runter.
»Aber Tookie, hör zu! Hör mir zu. Tookie! Konzentrier dich!«
Ich war ganz woanders. Das Streicheln fühlte sich gut an. Schließlich brachte sie mich dazu, ihr in die Augen zu schauen, und redete mit mir wie mit einem trotzigen Kind.
»Also, Tookie, Süße. Mara und Budgie sind beide rückfällig geworden, und er ist gestorben. Wenn du was Nettes anziehst? Dann lässt sie dich ihn in den Transporter legen.«
»Danae, auf denen sind Pflaumen im Speckmantel drauf oder Steak mit Salat.«
»Sie braucht den gar nicht zu sehen! Du trägst Budgie einfach raus und verlädst ihn. Dann ist er …«
Dana stockte. Würgte wie ein Kleinkind.
»… in tiefgekühltem Zustand geborgen. Und das Geld …«
»Ja.«
Mein Hirn lief heiß vor Dollarzeichen-Adrenalin, und meine Gedanken rasten. Ich konnte die Neuronen feuern hören. Danaes Stimme wurde sanft und schmeichelnd.
»Du bist groß. Du kannst ihn tragen. Budgie ist eher zierlich.«
Budgie sei mickrig wie eine Ratte, sagte ich, aber es war ihr egal, was ich sagte. Sie lächelte durch ihre Tränen, weil sie merkte, dass ich ihr nachgeben würde. In dem Moment schlug der Job durch, den ich gerade angenommen hatte. Vertragsleserin. Das war ich zu der Zeit. Eine Anwaltsgehilfin in Teilzeit, die Verträge durchlas und deren Modalitäten klärte. Ich sagte Danae, ich bräuchte den Deal schriftlich. Wir sollten ihn beide unterzeichnen.
Sie ging sofort zum Tisch und setzte etwas auf. Dann tat sie etwas noch Besseres. Stellte den Scheck aus mit einer Null nach der anderen und hielt ihn mir unter die Nase.
»Zieh dein Kleid an. Mach dich schick. Hol Budgie, und der Scheck gehört dir.«
Sie brachte mich zu North Shore. Ich ging zur Lagerhalle. Nicht lange darauf verließ ich im Kühltransporter das Gelände. Ich trug hochhackige Schuhe, ein unangenehm enges schwarzes Cocktailkleid und ein grünes Jackett. Mein Haar war zurückgekämmt und mit Haarspray befestigt. Danae hatte mich schnell noch geschminkt. So gut hatte ich seit Jahren nicht ausgesehen. Ich hatte ein Notizbuch dabei und einen Ordner aus dem Schulsachenstapel von Danaes Tochter. In meiner Handtasche einen Kugelschreiber.
Was wollte Danae mit Budgie anstellen, wenn sie ihn wiederhatte? Das fragte ich mich, als ich so dahinfuhr. Was zur Hölle hat sie mit ihm vor? Antworten fand ich keine. Die Ameisen regten sich unter meiner Haut.
Budgie und Mara lebten gleich westlich von Shageg, der Casinostadt nahe der Grenze zwischen Wisconsin und Minnesota. Sie bewohnten ein in sich zusammengesacktes graues Cottage. Ich stellte den Kühlwagen am Straßenrand ab, wo er nicht so auffiel. Ein hingestreckter Pitbull-Mix im Maschendrahtzwinger an der Hauswand hob den Kopf. Er bellte nicht, was mir Angst machte. Mit solchen stillen Überrumplern hatte ich meine Erfahrungen. Dieser legte sich aber wieder hin. Seine farblosen Augen folgten mir, als ich die Türklingel drückte, die wohl in besseren Zeiten eingebaut worden sein musste. Von drinnen ertönte ein zivilisiertes Dingel-Dong. Mara kämpfte mit der Tür und stieß sie weit auf.
Ich schaute ihr voller extraktivem Mitleid in die rotgeweinten Augen.
»Mein herzliches Beileid.«
Wir streckten die Hände aus und krallten die Finger ineinander, wie es Frauen tun, übertrugen über unsere schartigen Nägel Emotionen. Mara wirkte bemerkenswert überzeugend für jemanden, der nicht weiß, was er mit einer Leiche anfangen soll. Sie ließ ihre Joan-Jett-Gedenkfransen fliegen. Wie sich herausstellte, hatte sie ihre Gründe.
»Klar habe ich überlegt, die Feuerwehr zu rufen«, erklärte sie mir. »Aber dann diese Sirenen! Er sieht so friedlich aus und so glücklich. Und Bestatter mag ich auch nicht. Mein Stiefvater war einer. Ich wollte nicht, dass jemand Budgie mit Konservierungsmitteln vollpumpt und er wie eine Wachsfigur aussieht. Ich dachte, ich sende es einfach mal raus ans Universum … rufe ein paar Leute an …«
»Weil Sie wussten, dass das Universum antworten würde«, sagte ich. »Der Natur etwas zurückzugeben ist nur natürlich.«
Ich ließ sie beiseitetreten und ging ins Haus. Sie blinzelte in ahnungslosem Haselgrün. Ich nickte ihr voll lebensklugen Verständnisses zu und schaltete in den Verkaufsmodus: Alles, was ich dann von mir gebe, beruht auf Spekulationen darüber, was das Gegenüber sich wirklich wünscht. Mein markantes Gesicht lässt mich einerseits vertrauenswürdig wirken. Andererseits ist es ein Ansporn, es allen recht machen zu wollen. Aber vor allem besitze ich ein Talent, anderen ihre tiefsitzenden Bedürfnisse abzulauschen. Ich ließ mich einfach von Maras Fragen leiten.
»Was meinen Sie damit, der Natur etwas zurückzugeben?«
»Wir verwenden keine Chemikalien«, sagte ich. »Damit alles biologisch abbaubar ist.«
»Und dann?«
»Dann folgt die Rückkehr zur Erde. Wie von unserer psycho-spirituellen Konstitution her vorgesehen. Daher unser Name: Erde zu Erde. Und Bäume. Wir umgeben die Verschiedenen mit Bäumen. Lassen Haine erwachsen. Unser Motto: Frisches Grün aus der Grube. Man kann dort gut meditieren.«
»Wo ist das denn?«
»Zur gegebenen Zeit bringe ich Sie hin. Im Augenblick sollte ich Budgie auf seine Reise vorbereiten. Ob Sie mir zeigen könnten, wo er gebettet ist?«
Bei meinen letzten Worten zuckte ich zusammen – war das zu schwurbelig? Aber Mara ging mir schon voran.
Das hintere Schlafzimmer in Maras und Budgies Haus war bis oben hin mit frisch ausgepackten Versandartikeln vollgestopft. Da hatten sie ein Problem, bei dem ich helfen konnte – aber das musste warten. Budgie lag mit offenem Mund auf seinen fleckigen Kissen und beäugte verdattert den Stapel Plastikbehälter in einer Ecke. Er sah aus, als hätte er sich zu Tode gewundert. Ich überreichte Mara Formulare. Es waren Einverständniserklärungen für Klassenausflüge von Daneas Tochter, die ich auf dem Küchentresen gefunden hatte. Mara las sie sorgfältig durch, und ich versuchte mir die Panik nicht anmerken zu lassen. Leute lesen selten durch, was sie unterschreiben; manchmal kommt es mir vor, als sei ich die Einzige, die so etwas tut, was natürlich an meinem heutigen Beruf liegt. Dann wiederum lesen manche bloß scheinbar, nur mit den Augen und nicht mit dem Hirn. Das tat auch Mara. Leise wimmernd trug sie Budgies Namen in das erste Feld ein. Dann unterschrieb sie das Formular mit einem Anflug tragischer Endgültigkeit und viel Druck auf den Linien des M.
Diese ehrliche Geste rührte mich. Ich bin nicht herzlos. Ich ging zum Wagen und kramte hinter den Milchkühlregalen herum, weil ich wusste, dass dort eine Plane liegen musste. Die trug ich ins Haus und legte sie neben Budgies Leiche. Er war noch einigermaßen beweglich. Er trug ein langärmeliges T‑Shirt und darüber ein zerrissenes, fake-vintage Whitesnake-Bandshirt. Ich wickelte ihn in die Plane und brachte es fertig, seine Beine gerade hinzulegen und ihm die Arme vor der Brust zu kreuzen, als wäre er ein Horus-Jünger oder so was. Ich schloss Budgie die fragenden Augen, und sie blieben zu. Bei alledem sagte ich mir: Erst der Job. Dann die Gefühle. Aber wie ich ihm mit den Fingern über die Augenlider fuhr, um sie zu schließen, das kriegte mich ziemlich. Dass er niemals die Antwort zu sehen bekommen würde. Ich brauchte etwas, um ihm das Kinn hochzubinden. Im Transporter hatte bloß ein Spanngummi gelegen.
»Mara«, sagte ich, »ist es Ihnen lieber, wenn ich aus meinem Fahrzeug spezielle Haltebinden hole, oder haben Sie ein Halstuch, das Sie ihm als Liebesbeweis in die jenseitige Welt mitgeben möchten? Am besten nicht geblümt.«
Sie gab mir ein langes blaues, seidiges Tuch mit Sternenmuster.
»Ein Hochzeitstagsgeschenk von Budgie«, sagte sie sehr leise.
Das erstaunte mich, denn ich kannte Budgie als Geizhals. Vielleicht war das Tuch das Entschuldigungsgeschenk eines reuigen Ehemanns gewesen. Ich wickelte es Budgie um den Kopf, um ihm den Kiefer hochzubinden, und trat zurück. Fragte mich, ob ich meine Bestimmung gefunden hatte. Plötzlich hatte er einen übermenschlich weisen Ausdruck. Es war, als hätte er sich nur im Diesseits als Arschloch getarnt und wäre in Wahrheit ein schamanistischer Priester.
»Als wäre er … allwissend«, sagte Mara beeindruckt.
Wir verschränkten wieder die Finger. Das alles begann sich erdrückend bedeutsam anzufühlen. Beinahe wäre ich eingeknickt und hätte Budgie da liegen lassen. Heute wünschte ich natürlich, ich hätte es getan. Aber meine stets verlässliche Verkäuferidentität übernahm die Führung und machte weiter.
»Also, Mara. Ich werde mit Budgie nun die nächste Etappe seiner Reise einleiten, und das gelingt umso besser, wenn die Hinterbliebene einen Tee trinkt und meditiert. Sie möchten ihn schließlich nicht aufhalten.«
Mara beugte sich vor und küsste ihren Gatten auf die Stirn. Dann richtete sie sich auf, atmete tief durch, ging in die Küche. Ich hörte Wasser laufen, vermutlich in einen Wasserkessel, und lud mir Budgie im Gamstragegriff auf die Schultern. Während Mara ihren Tee kochte, schleppte ich ihn zur Tür hinaus, am depressiven Pitbull-Mischling vorüber, und legte ihn in den Laderaum meines Kühltransporters. Ich musste die Schuhe ausziehen und an Bord springen, um ihn ganz reinzuzerren. Der Adrenalinrausch half, aber mein Kleid riss ein. Ich klemmte mich hinters Steuer und brachte ihn zu Danae.
Sie erwartete mich schon auf der Veranda. Ich stieg aus dem Wagen. Sie eilte mir entgegen, aber bevor ich ihr Budgie überließ, wackelte ich mit den Fingern. Sie zog den Scheck aus ihrer hinteren Jeanstasche und faltete ihn auseinander, sagte dann aber, sie müsse erst die Leiche sehen. Sie leckte sich über die vollen Lippen und grinste. Es war, wie wenn man unter den falschen Stein schaut.
Meine Liebe zu Danae glitt von mir ab wie eine alte Haut. Manchmal enthüllt einem jemand etwas. Alles. Budgie umgab eine Aura kontemplativer Würde. Danae dagegen hatte es erschreckend eilig. Das beides kriegte ich einfach nicht zusammen. Wir gingen zur Ladeklappe. Ich lehnte mich in den Wagen und zog die Plane beiseite, aber ohne dabei Budgie oder Danae anzusehen. Sie gab mir den Scheck, dann kletterte sie zu ihm hinein. Ich vergewisserte mich, dass der Scheck ordentlich unterschrieben war, und trat erleichtert zurück. Und was ich dann tat, ist der Beweis, dass ich nicht die professionelle Leichenräuberin war, als die ich später verurteilt wurde. Ich ging. Ich warf die Schlüssel auf den Vordersitz des Transporters und stieg in meinen zerbeulten kleinen Mazda. Ich war schneller da raus, als irgendwer gucken konnte. Ich meine, eigentlich hätte ich Danae helfen sollen, Budgie ins Haus zu schaffen. Ich hätte den Transporter heimlich zurückbringen sollen. Oder, Moment. Ich hätte die Leiche gar nicht erst holen sollen. Aber am meisten schadete es mir, dass ich Budgie im Kühltransporter zurückließ.
Na, und dass ich ihm nicht in die Achselhöhlen schaute. Wie auch immer.
Es war noch Nachmittag, also fuhr ich direkt zur Bank, ließ den Scheck auf mein Konto gutschreiben und hob alles ab, worüber ich verfügen konnte, bis der Scheck verrechnet war. Sechzig Dollar. Mit den drei Zwanzigern in der Tasche fuhr ich weiter und versuchte Abstand zu gewinnen, durchzuatmen, nicht zurückzuschauen. Ich steuerte das Steakhouse mit Bar an, das ich öfter besuchte, wenn ich flüssig war. Es lag ein paar Meilen den Highway runter im Wald. Im Lucky Dog bestellte ich einen Whiskey und ein teures Rib-Eye-Steak. Dazu gab es grünen Salat und eine gefüllte Ofenkartoffel. Köstlich. Meine Sinne belebten sich. Das Mahl und das Geld waren heilsam. Vom Whiskey wurden die Ameisen abgetötet. Ich war ein neuer Mensch, einer, der nicht die letzten Sekunden seines Lebens damit zubringen würde, einen Stapel Plastikboxen zu beäugen. Eine Frau, deren Schicksal sich unter ungewöhnlichen Umständen gewendet hatte. Ich sinnierte über meinen Ausbruch an Kreativität. Die Geschäftsidee, die ich mir spontan aus den Fingern gesogen hatte, Erde zu Erde, daraus konnte etwas werden. Die Leute waren bereit für Alternativen. Außerdem war der Tod krisensicher und konnte schlecht ins Ausland ausgelagert werden. Ich wusste, dass es Gesetze, Verordnungen und Hürden geben würde, aber mit Danaes Zuschuss konnte ich mir eine Existenz aufbauen.
Während ich so dasaß und mir meine verheißungsvolle Zukunft ausmalte, schob er sich mir gegenüber auf die Bank. Meine Nemesis. Mein zeitweiser Schwarm.
»Pollux«, sagte ich. »Mein hochmoralischer Potawatomi. Wo ist dein niedliches Stammespolizistenoutfit?«
Pollux war früher ein glutäugiger Boxer gewesen. Seine Nase war zermatscht, die linke Augenbraue gekerbt. Er hatte einen falschen Zahn. Seine Knöchel waren unregelmäßige Knubbel.
»Ich bin außer Dienst«, sagte er. »Aber ich bin nicht ohne Grund hier.«
Mir schlug das Herz bis zum Hals. Ich bekam Angst, dass Pollux vorhatte, Überstunden zu leisten.
»Tookie«, sagte er. »Du kennst ja das Skript.«
»›Wir sollten aufhören, einander zu treffen‹?«
»Ich wusste, dass du es warst, als ich den Kühltransporter gesehen habe. Sehr innovativ.«
»Erfinderisch, das bin ich wirklich.«
»Der Stamm hat dich nicht umsonst aufs College geschickt.«
»Hat er wohl«, sagte ich.
»Pass mal auf. Wie wär’s, wenn ich dir erst noch einen Whiskey ausgebe, bevor das Theater losgeht?«
»Ich wollte gerade ein großartiges Geschäft gründen, Pollux.«
»Das kannst du immer noch. In zwanzig Jahren, höchstens. Du hast das gut gemacht, wirklich. Der Verdacht fiel gleich auf deine Freundinnen. Bloß dass die dann hysterisch geworden sind und dein Genie in den Himmel gelobt haben.«
(Danae, Danae! Andere Münze meines Herzens.)
»Das mit den zwanzig soll wohl ein Witz sein? Huuuh, ich habe Angst! Hast du mit Mara geredet?«
»Sie hat deinen Service gewürdigt und dein Mitgefühl, ja, selbst dann noch, als wir ihr gesagt haben, dass Danae dahintersteckte.«
»Ach, wirklich?« Sogar unter diesen Umständen war ich hoch erfreut. Aber er hatte nicht zugegeben, dass er mich nur einschüchtern wollte.
»Pollux, jetzt mach mal halblang mit deiner alten Tookie. Ich meine, hey, wie bitte, zwanzig Jahre?«
»Man munkelt so einiges«, sagte er. »Du könntest auch … ich meine, bei deiner Vorgeschichte. Man weiß nie. Es könnte auf das Doppelte rauslaufen.«
Jetzt hatte ich Mühe, nicht zu hyperventilieren. Aber da fehlte doch etwas. Ein Verbrechen.
Pollux hatte diesen Blick – einen traurigen, dunklen Blick unter der vernarbten Braue. Er schaute direkt in den zitternden Morast meines Herzens. Aber ich merkte, dass er mit sich rang.
»Worum geht’s hier? Warum zwanzig Jahre?«
»Es ist nicht an mir, rauszufinden, ob du wusstest, was Budgie an sich hatte.«
»An sich hatte? Dasselbe wie immer, irgendeinen tragischen Bullshit. Du beantwortest meine Frage nicht.«
»Du kennst die Abläufe. Aber es wäre hilfreich, wenn du darauf verzichten würdest, den Scheck einzulösen.«
»Ich bin doch nicht blöd. Natürlich habe ich den eingelöst.«
Er schwieg. Wir saßen ein bisschen herum. Seine kaputte Augenbraue senkte sich. Er trank von seinem Whiskey und trauerte mir fragend in die Augen. Mir kann man zwar unter Umständen einen gewissen Hell-Girl-Appeal zuschreiben, aber Pollux wirkt definitiv hässlich, in egal welcher Hinsicht. Als Mann und als Kämpfer kostet ihn das allerdings kaum Punkte. Markant nennt man so einen. Er wandte den Blick ab. Schon klar, dass das zu schön war, wie er mich ansah, um so weiterzugehen.
»Jetzt sag schon«, drängte ich. »Zwanzig?«
»Du kommst endlich groß raus, Tookie.«
»Es war wirklich ein dicker Scheck. Ich wollte das spenden, weißt du? Abzüglich der Spesen …«
»Nicht der Scheck, wobei der noch dazukommt. Aber, Tookie – eine Leiche zu klauen? Und was er an sich hatte? Das ist mehr als schwerer Diebstahl. Und der Kühltransporter …«
Ich hätte mich fast verschluckt. Ich verschluckte mich wirklich. Mir traten Tränen in die Augen. Ich war nicht einmal auf die Idee gekommen, dass ich ein Verbrechen begangen haben könnte. Schwerer Diebstahl – grand larceny – das hat einen tollen Klang, aber nur bis zu dem Moment, wo man es in Jahre umrechnet.
»Ich habe doch nicht gestohlen, Pollux! Bloß einen Leichnam umverlegt. Als Gefallen für eine Freundin. Okay, gut, und einen Transporter habe ich ausgeborgt. Was hätte ich denn machen sollen, wenn sie schreit: Budgie, meine Seele?«
»Schon klar, Tookie. Aber dann hast du den Scheck eingelöst. Und extra einen Kühltransporter verwendet. Als hättest du Organe entnehmen wollen.«
Ich sagte nichts mehr.
Pollux kaufte mir einen Drink.
»Du bist echt was Besonderes«, brachte ich schließlich heraus. »Und ein Potawatomi. Ein Stammesverwandter.«
»Und Herzensbruder«, sagte Pollux. »Wir haben eine endlose Vorgeschichte. Sind auf dem Rücken der Schildkröte Seite an Seite herangewachsen. Ach, Tookie, meine ewige …«
»Ewige was?«
Er antwortete nicht. Ich fragte noch einmal. »Wir reduzieren das irgendwie«, sagte er schließlich. »Ich setze mich für dich ein. Vielleicht eine Art Deal. Ich denke, so schlimm sollte das mit dem Leichenraub nicht sein. Und du wusstest ja nicht …«
»Genau. Wieso ist das ein Verbrechen? Es war bloß Budgie.«
»Ich weiß. Und das mit den Organen …«
»Das ist albern. Er war nicht annähernd frisch genug für den Verkauf.«
Pollux schaute mich sehr ernst an und sagte, das solle ich vor Gericht bitte nicht wiederholen.
»Das Stammesgericht wird damit nichts zu tun haben«, fuhr er fort. »Das geht vors Bundesgericht. Die Leute dort verstehen deinen Sinn für Humor nicht. Deinen Charme. Für die bist du bloß eine gefährliche Indianerin, so wie ich. Andererseits …«, wollte er weiter ausführen. Ich unterbrach ihn.
»Bloß dass du Polizist geworden bist. Kluger Schachzug.«
»Du könntest werden, was immer du willst«, sagte Pollux. »Bei dir kocht mir das Hirn über. Mein Herz« – er berührte zart seine Brust – »schlägt Saltos. Verdreht sich. Es ist fast so, als hättest du nie kapiert, dass wir selbst entscheiden, wo wir im Leben landen.«
Das war die reine Wahrheit, aber mir fiel keine Erwiderung ein. Die Gedanken tobten mir durch den Schädel.
Wir schauten einander in die Augen. Ich krempelte die Ärmel meines grünen Jacketts hoch und legte die Arme auf den Tisch. Und er zog die Handschellen hervor und nahm mich fest. Einfach so, gleich an Ort und Stelle.
Mit dem Fernsehen habe ich’s nicht so, also wollte ich meinen Anruf in der Untersuchungshaft nutzen, um Danae zu bitten, dass sie mir Bücher brachte. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Später versuchte ich es bei Mara – dasselbe. Ausgerechnet meine Lehrerin aus der siebten Klasse der Reservatsschule kam mir schließlich zu Hilfe. Ich hatte immer gedacht, Jackie Kettle sei bloß nett zu mir gewesen, weil es ihr erstes Berufsjahr und sie so jung war. Aber wie sich herausstellte, behielt sie ihre Schüler im Auge. Sie hatte mitbekommen, dass ich in Haft saß, war zu einem Trödelverkauf gegangen und hatte für einen Dollar eine Kiste voller dicker Schinken erstanden. Viele davon waren erbaulich, also albern. Aber zwei, drei lagen dazwischen, die vielleicht Pflichtlektüre im ersten Studiensemester gewesen waren. Oldschool-Literatur. Eine angestaubte Norton Anthology of British Literature durfte ich behalten. Das half. Besuch bekam ich wenig. Pollux kam einmal vorbei, aber ich glaube, er musste weinen, und das war es dann. Danae hatte mich reingeritten mit ihrer Geschichte, die aus meiner Aktion so eine große Sache gemacht hatte – das war unbedacht von ihr gewesen. Ich verzieh es ihr, aber sehen wollte ich sie nicht. Die Anthologie jedenfalls ließ die Zeit verschwimmen, und bald wurde meine Verabredung mit L. Ron Hubbard fällig. Unser Stamm hatte doch wahrhaftig einen Scientologen als Anwalt. So ergeht es den Hütern des Landes. Aber er hieß nicht wirklich L. Ron Hubbard. So nannten wir ihn bloß. In Wahrheit hieß er Ted Johnson. Ted und ich trafen uns in demselben tristen kleinen Zimmer wie immer. Ted Johnson war der unauffälligste Mensch aller Zeiten, ein Verlierer in weiten Anzügen von Men’s Wearhouse, mit labbrigen Achtziger-Jahre- Krawatten, einem halb kahlen Kopf, aus dem Haare nur bis knapp über die Ohren sprossen, in einem lockigen Büschel, das er ständig glattstrich. Er hatte ein fades Gesicht mit komplett undurchsichtigen grünen Augen und winzigen Pupillen, kalt wie Bohraufsätze. Leider verbarg sich dahinter keine übermenschliche Schläue.
»Tookie, ich bin überrascht.«
»Sie sind überrascht, Ted? Was soll ich erst sagen. Seit wann ist das ein Verbrechen?«
»Es war Leichendiebstahl!«
»Es war kein Diebstahl. Ich habe die Leiche nicht behalten.«
»Gut, das kann ich verwenden. Sie haben allerdings eine Zahlung von über 25.000 Dollar entgegengenommen, was angesichts der Rechtlage und so weiter.«
»Rechtlage? Fehlt da nicht ein s?«
»Ja, wie gesagt.« Ted zuckte nicht mal. Ich saß tief in der Tinte.
»Der menschliche Körper ist gerade mal 97 Cent wert«, sagte ich. »Also, wenn man ihn auf die Mineralien und so was runterkocht.«
»Gut, das kann ich verwenden.«
Er schwieg kurz.
»Woher wissen Sie das?«
»Von meinem Chemielehrer an der Highschool«, sagte ich. Dann fiel mir ein, was für ein Wirrkopf Mr Hrunkl gewesen war und dass Budgie auf irgendeinem finsteren Schwarzmarkt für Körperteile vielleicht viel mehr wert wäre. Ich schauderte und redete weiter.
»Hören Sie, Ted, das mit dem Geld von Danae war ein Zufall. Ich habe das bloß in Verwahrung genommen. Ich hatte Angst, dass sie vor lauter Trauer etwas Dummes damit anstellen würde, und ich bin ihre beste Freundin. Ich habe es für sie in Sicherheit gebracht. Sobald Sie mich hier raushauen, landet es wieder auf ihrem Konto, und sie wird es verprassen.«
»Natürlich. Das kann ich verwenden.«
»Also, wie sieht jetzt die Strategie aus?«
Ted schaute in seine Notizen. »Sie haben den Leichnam nicht behalten, der heruntergekocht nur 97 Cent wert ist.«
»Vielleicht besser ohne ›heruntergekocht‹. Und es könnte inzwischen mehr sein. Von wegen Inflation.«
»Okay. Das Geld von Danae ist nur zur Verwahrung auf Ihrem Konto, damit sie es nicht laut ihrer Trauer verschwendet.«
»Vor lauter Trauer. Und ich bin ihre beste Freundin. Schreiben Sie das auf.«
»Gut. Na, das ist doch bestens! Ich haue Sie raus!«
Er sah aus, als wäre sein Nickerchen fällig. Aber ehe er wegdöste, flüsterte er mir etwas Seltsames zu.
»Sie wissen, was am Leichnam festgeklebt worden war, oder?«
»Vermutlich eine Art Etikett? ›Dead on arrival‹ oder so?«
»Nein, unter dem Shirt.«
»Dem Whitesnake-Shirt. Ein Klassiker. Alte Kassetten?«
Teds Gesicht knautschte sich bei dem Versuch, meine Antworten zu deuten. Er schaute paranoid nach rechts und links und schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht riskieren, darüber zu reden. Sie werden vermutlich Besuch von der Drogenvollzugsbehörde bekommen. Keine Ahnung, vielleicht nur von den Regionalbeamten. Es steckt mehr hinter der Geschichte, als Sie wissen. Oder Sie wissen es doch. Ich habe damit nichts zu tun.«
»Womit denn?«
Er erhob sich und stopfte seine Papiere hektisch in die Plastikaktentasche.
»Womit nichts zu tun?«
Ich sprang auf und schrie hinter ihm her. »Kommen Sie zurück, Ted. Womit haben Sie nichts zu tun?«
Ein paar Tage darauf kam Ted tatsächlich wieder, noch schläfriger als beim letzten Mal. Er rieb sich ständig die Augen und gähnte mir ins Gesicht.
»So«, sagte er. »Danae und Mara haben endlich nachgegeben.«
»Der Trauer nachzugeben ist ein wichtiger erster Schritt«, sagte ich.
»So war es nicht gemeint. Ich meinte, sie haben angefangen zu reden.«
»Das ist gut! Sie sollten ihren Verlust in Worte fassen. Gut, dass sie einander jetzt beistehen.«
»Ich glaube fast schon, dass Sie es wirklich nicht wissen.«
»Was denn, dass es eine Überdosis war? Das wusste ich.«
»Es geht um viel mehr. Sie sind doch vernommen worden.«
»Ja, aber ich hatte nichts damit zu tun.«
»Tookie«, sagte er viel zu sanft, »Sie haben einen menschlichen Leichnam mit Crack in den Achselhöhlen von Wisconsin nach Minnesota gebracht. Über Staatsgrenzen hinweg.«
»Also hören Sie, die Staatgrenzen haben wir Indigenen sowieso nie anerkannt. Und warum hätte ich ihm in die Achselhöhlen schauen sollen?«
»Danae und Mara haben ausgesagt und sind einen Deal eingegangen. Das Problem ist, dass sie beide schwören, der Achselhöhlenschmuggel sei Ihre Idee gewesen, und das Geld, das Sie angenommen haben, sei Ihr Vorschuss auf den Verkaufserlös gewesen. Es tut mir leid, Tookie.«
»Ich soll einen Scheck für künftige Drogenverkäufe eingelöst haben? Sehe ich wirklich so blöd aus?«
Es beunruhigte mich, dass Ted keine Antwort gab.
»Ach, verdammt noch mal, Ted, keiner hört mir zu! Ich wusste von gar nichts!«
»Alle hören Ihnen zu. Sie sagen nur leider, was immer alle sagen. Ich wusste von nichts ist als Verteidigung ganz schön abgegriffen.«
Es folgte eine Zeit wie leere Seiten im Tagebuch. Keine Ahnung, was da los war. Dann bestellte man mich zu einer weiteren Vernehmung. Aus diesem Verhör stammte der Beweis, der mir zum Verhängnis wurde. Die Sache mit dem Gaffer-Tape. Diesmal befragten mich ein stahläugiger Mann mit Selbstbräuner im Gesicht und eine muskulöse Frau mit lippenlosem Grinsen.
»Ihre Freundinnen sagen, Sie seien bei diesem Vorhaben der führende Kopf gewesen.«
»Welchem Vorhaben?«
»Crack mithilfe eines menschlichen Leichnams zu schmuggeln. Diesem armen Mann seine letzte Würde zu rauben. Sie wollten ihn bei ihrer kleinen blonden Freundin abliefern. Die sollte Sie für den Transport bezahlen. Ihnen später einen Anteil am Gewinn abgeben. Die Schmuggelware sollte sie von dem Leichnam ablösen und dann ein Beerdigungsunternehmen rufen.«
»Crack? Da war kein Crack. Ich habe nur für Danae Budgies Leiche befördert. Sie hat ihn geliebt. Das zwischen den beiden, das war eine heilige Liebe, von den Göttern gesegnet, wissen Sie, und sie wollte ihn bei sich haben. Warum zum Geier das so wichtig war, weiß ich auch nicht.«
»Da war Crack. Und Gaffer-Tape.«
Gaffer-Tape. Klugscheißerin, die ich bin, fragte ich, ob es graues Gaffer-Tape war. Meine Peiniger atmeten den großtuerischen, erschöpften Zynismus von Highschool-Footballtrainern. Sie schauten einander mit unbewegter Miene an und zuckten dann bedeutungsvoll mit den Brauen.
»Was ist?«, fragte ich.
»Sie haben nach dem Gaffer-Tape gefragt.«
Ich erklärte ihnen, ich hätte nicht gewusst, wie ich auf diese Information reagieren sollte. Deshalb hätte ich eine inkongruente Frage gestellt.
Sie sagten, so inkompetent hätte sie gar nicht geklungen.
»Ich sagte inkongruent.«
»Wie Sie meinen. Wissen Sie, warum?«
»Vielleicht war es nicht grau?«
»Welche Farbe hatte es?«
»Keine Ahnung.«
»Sind Sie sicher?«
»Warum hätte ich sonst fragen sollen?«
»Es ist eine sehr ungewöhnliche Frage.«
»Finde ich nicht. Es ist doch normal, sich das zu fragen. Es gibt Gaffer-Tape inzwischen in verschiedenen Farben.«
Wieder die bedeutungsvolle Augenbrauengymnastik. »Verschiedene Farben«, sagten sie. Und dann kam die Frage, die mich in Panik versetzte.
»Wenn Sie eine Farbe wählen sollten, welche wäre das?«
»Weiß ich nicht. Ich habe auf einmal so einen trockenen Mund«, sagte ich. »Könnte ich bitte einen Schluck Wasser bekommen?«
»Natürlich, natürlich. Sobald Sie die Frage beantwortet haben.«
Ich war sehr lange in diesem Verhörraum. Und das ganz ohne Wasser. Als die beiden wiederkamen, hatte ich schon angefangen zu halluzinieren. Meine Zunge war so geschwollen, dass ich den Mund nicht ganz zu bekam. Auf meinen Lippen klebte eine eklige braune Kruste. Die Frau hatte einen Pappbecher dabei. Sie goss ihn vor meinen Augen voll, und ich stürzte mich darauf.
»Erinnern Sie sich jetzt an die Farbe des Gaffer-Tapes?«
Ich hatte Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Was, wenn ich eine Farbe aussuchte und es die richtige war? Besser, ich entschied mich für alle auf einmal. Ja. Das konnte nicht schiefgehen.
»Alle Farben auf einmal«, sagte ich.
Sie nickten, streiften mich mit durchtriebenen, hochzufriedenen Blicken und sagten: Bingo.
Wer hätte gedacht, dass es auch regenbogenfarbenes Tape gibt? Und aus welchen unerfindlichen Gründen hatte Mara damit Rocks unter Budgies Achseln befestigt?
Als ich von Richter Ragnik zu sechzig Jahren verurteilt wurde, war im Saal Fassungslosigkeit zu spüren, aber ich für meinen Teil kam aus dem Wundern nicht heraus. Ich hatte genau denselben Gesichtsausdruck wie Budgie. Für viele andere kam es nicht überraschend. Bundesgerichtsurteile fallen häufig hart aus. Crack machte alles um ein x‑Faches schlimmer. Und schließlich hatte der Richter einen Ermessensspielraum – dass ich Budgie geklaut hatte, war ein erschwerender Umstand, und dieser Richter war inbrünstig entrüstet über meine Tat. Er sprach von der Unantastbarkeit und heiligen Würde der Toten und wie hilflos sie den Lebenden ausgeliefert seien. Dies könne einen Präzedenzfall schaffen. Der lächerliche Vertrag war aufgetaucht – ich und meine schlauen Ideen. Außerdem ist da die Statistik. Ich stand statistisch auf der falschen Seite. Indigene sind in amerikanischen Gefängnissen die am stärksten überrepräsentierte Bevölkerungsgruppe. Ich liebe Statistiken, weil sie das, was einem einzigen Bruchteil der Menschheit zustößt, zum Beispiel mir, in globale Zusammenhänge stellen. Zum Beispiel werden allein in Minnesota dreimal so viele Frauen inhaftiert wie in ganz Kanada, ganz zu schweigen von ganz Europa. Und viele andere Statistiken, mit denen ich gar nicht erst anfangen will. Seit vielen Jahren frage ich mich, warum wir bei allem, was messbar ist, ganz unten oder an der traurigen Spitze stehen. Ich weiß nämlich, dass wir als Indigene wahre Größe besitzen. Vielleicht liegt diese Größe in Bereichen, die nicht messbar sind. Vielleicht wurden wir zwar kolonisiert, aber nicht gründlich genug. Trotz all der Casinos und meiner eigenen Marotten ist für die meisten von uns Geld nicht der einzige Fixstern. Nicht so sehr jedenfalls, dass es die Liebe zu unseren Vorfahren auslöschen würde. Wir sind nicht kolonisiert genug, dass wir die Mentalität der Mehrheitssprache übernommen hätten. Unsere eigenen ursprünglichen Sprachen beherrschen die meisten von uns gar nicht, trotzdem bestimmt ein ererbtes Gefühl für diese Sprachen unser Handeln. Sie sind großzügig. Im Anishinaabemowin drückt sich diese Großzügigkeit in verschachtelten zwischenmenschlichen Beziehungen aus und in unerschöpflichen Möglichkeiten, einen Witz zu machen. Vielleicht stehen wir also auf der falschen Seite der englischen Sprache, das könnte schon sein.
Dennoch half mir die Definition eines englischen Wortes gegen die Verzweiflung. In der Haftanstalt, in der ich zu Anfang einsaß, wurde mein Wörterbuch geröntgt, der Einband abgerissen, die Bindung untersucht, und alle Seiten wurden durchgeblättert. Danach musste ich es mir durch gutes Betragen verdienen, und das tat ich. Schlechtes Betragen gab es nicht mehr, seit das Urteil gefällt war. Soweit ich es in der Hand hatte zumindest. Manchmal hatte ich das nicht. Ich war Tookie, viel zu sehr Tookie. So bleibt es, im Guten wie im Schlechten.
Mein Wörterbuch, das war das American Heritage Dictionary of the Englisch Language von 1969. Jackie Kettle hatte es mir samt einem Brief geschickt. Darin stand, sie habe es von der National Football League bekommen, als Auszeichnung für einen Essay über ihre Gründe, zu studieren. Es habe sie ans College begleitet, und jetzt überlasse sie es mir.
sentence (n.) 1. In sich abgeschlossene grammatikalische Einheit aus einem oder mehreren Wörtern, die meist zumindest aus einem Subjekt mit zugehörigem Prädikat besteht und die ein finites Verb oder eine Verbalphrase enthält. Die Tür ist offen und Geh! sind Beispiele für Sätze.
Als ich diese Definition zum ersten Mal las, blieb ich an den kursiv gedruckten Beispielen hängen. Das waren nicht bloß Sätze, dachte ich. Die Tür ist offen. Geh! Das waren die schönsten Sätze, die je geschrieben wurden.
Ich verbrachte acht Monate in einer baufälligen Haftanstalt, weil sonst nirgendwo Platz war. Es gab in Minnesota einfach zu viele Frauen, die, wie meine Haftbetreuer es ausgedrückt hätten, die falschen Entscheidungen trafen. Wegen dieses Anstiegs der Haftstrafen für Frauen war das Shakopee Frauengefängnis voll belegt, das zu der Zeit noch nicht mal einen richtigen Außenzaun hatte. Da wollte ich hin. Aber ich war ja ein Fall fürs Bundesgefängnis. Das Waseca im Süden Minnesotas, das heute auf vor dem Bundesgericht verurteilte Frauen spezialisiert ist, war damals noch eine Männeranstalt. Also verlegten sie mich aus Thief River Falls in eine Stadt außerhalb von Minnesota, nennen wir sie Rockville.
Der Transport brachte mich gleich wieder in Schwierigkeiten. Gefangenentransporte werden nachts abgewickelt. Wie sich herausstellte, wurde ich im Gefängnis immer dann geweckt, wenn ich einen meiner sehr seltenen schönen Träume hatte. Eines Nachts in der Haftanstalt wollte ich gerade in ein riesiges Stück Schokokuchen beißen, da riss es mich aus dem Schlaf. Ich musste Hemd und Hose aus Papier überziehen und in Papierlatschen zu einem Transporter schlurfen. Die Gefangenen wurden in Einzelkabinen angekettet. Als ich mitbekam, dass ich in einen dieser winzigen Käfige sollte, brach ich zusammen. Ich war damals extrem klaustrophobisch. Ich hatte von der heiligen Lucia gehört, die mit Gottes Hilfe so schwer geworden war, dass sie nicht von der Stelle bewegt werden konnte. So schwer versuchte ich mich auch zu machen und gleichzeitig den Wärtern zu erklären, dass ich an Klaustrophobie litt. Ich bettelte wie eine Wahnsinnige, also behandelten sie mich auch wie eine. Zwei Männer schwitzten, schoben, drückten, drängten und zerrten mich in den Käfig. Dann kam der tote Budgie mit rein, die Tür schlug zu, und ich fing an zu schreien.
Ich hörte sie von einer Beruhigungsspritze reden. Ich bettelte darum, eine zu kriegen. Aber mitten in der Nacht war keine Pflegekraft da, um sie mir zu geben. Wir fuhren los, ich schrie, und Budgie grinste, das Tuch noch um den Kopf, mit dem ich ihm den Kiefer hochgebunden hatte, samt dem wippenden Knoten auf dem Scheitel. Die anderen Frauen fluchten, und die Wärter brüllten uns alle miteinander an. Auf der Weiterfahrt wurde es schlimmer. Wenn das Adrenalin einer Panikattacke erst mal durchs System rauscht, ist es nicht zu bremsen. Man sagt zwar, allein wegen der Heftigkeit so eines Anfalls könne er schließlich nicht ewig dauern, aber ein paar Stunden leider doch, und das tat er, weil Budgie durch seine fauligen Zähne zischte. Ich selbst kann mich nicht erinnern, was ich in diesen Stunden tat, aber anscheinend beschloss ich mich umzubringen, indem ich alles in Stücke riss, was ich von meiner Hose und den Latschen in die Finger kriegte, es zusammenknüllte und mir in Mund und Nase stopfte. Als ich verstummte, heißt es, waren alle so erleichtert, dass niemand nach dem Rechten sehen wollte. Unbeschriebenes Papier hätte mein Tod sein können, hätte nicht doch einer der Wärter ein Gewissen gehabt. Hätten Wörter darauf gestanden, wäre es dann ein poetischer Tod gewesen? Für solche Grübeleien hatte ich später eine Menge Zeit.
Gleich nach der Ankunft kam ich ein Jahr in Isolationshaft. Wegen meines Selbstmordversuchs per Papier erhielt ich keine Bücher. Allerdings stellte sich heraus, dass ich, ohne es zu wissen, eine Bibliothek mit mir herumtrug: Jedes Buch, das ich seit der Grundschule gelesen hatte, war mir im Kopf hängen geblieben, und auch die, die mich später faszinierten. In meinen Hirnwindungen lagerten lange Passagen und Szenen – alles vom Redwall-Zyklus über Huckleberry Finn bis zur Xenogenesis-Trilogie. So verging ein Jahr, in dem ich es irgendwie fertigbrachte, nicht durchzudrehen, und zwei weitere Jahre bis zur nächsten Verlegung. Diesmal ging es nach Waseca, und ich war angekettet, aber nicht in einer Kabine. Meine Zeit in Isolationshaft hatte mir sowieso die Angst vor engen Räumen ausgetrieben. In Waseca saß ich sieben Jahre, und dann wurde ich eines Tages ins Büro der Gefängnisleitung gerufen. Bis dahin hatte ich meine Haltung gründlich verändert. Ich hielt den Ball flach. Absolvierte Collegekurse. Machte meinen Job. Was hatte ich also verdammt noch mal ausgefressen? Ich betrat das Büro in der Erwartung irgendeiner Katastrophe, nur um Sätze zu hören, bei denen mir das Herz stockte: Ihre Zeit bei uns ist um. Ihr Strafmaß ist herabgesetzt worden.
Dann Schweigen wie ein Donnerschlag. Herabgesetzt auf die bereits verbüßte Haftzeit. Ich musste mich setzen, und zwar auf den Boden. Sobald der Papierkram erledigt war, sollte ich gehen dürfen. Ich stellte keine Fragen, falls sich herausstellen sollte, dass sie mich verwechselt hatten. Aber wie ich später erfuhr, hatte ich Ted Johnson total unterschätzt. Er hatte nie aufgegeben. Dass er mich jedes Jahr um eine Begnadigung hatte ersuchen lassen, wusste ich natürlich. Aber ich hätte nie geglaubt, dass das etwas brachte. Er hatte wieder und wieder Berufung eingelegt. Er hatte meinen Fall einer Arbeitsgruppe an der University of Minnesota vorgestellt. Die Sache mit Budgie und mit dem starren Glauben des Richters hatten Interesse geweckt. Und Ted Johnson hatte Danae und Mara Geständnisse aus den Rippen geleiert, denn jetzt, wo ihre ausgesprochen kurzen Strafsätze abgegolten waren – Beispiel: Ihr Arschlöcher! –, sahen sie keinen Grund mehr, mir die Schuld zuzuschieben, und gaben zu, dass sie mich reingeritten hatten. Er hatte sich für mich eingesetzt, wo immer er konnte.
Ich schrieb Ted Johnson einen Brief, um ihm für die Chance auf ein Leben in Freiheit zu danken. Der erreichte ihn aber nicht, denn er befand sich in einer Welt ohne Postadressen. Er war an einem schweren Herzinfarkt gestorben.
In der Nacht vor meiner Entlassung konnte ich nicht schlafen. Obwohl ich lange von diesem Augenblick geträumt hatte, erfüllte mich die Realität mit einer Mischung aus Euphorie und Angst. Ich dankte meiner winzigen Gottheit.
Einmal, während der Isolationshaft, als ich im Dämmerzustand auf der Bettkante hockte, hatte mich ein winziges Geisterwesen in der Zelle besucht. Auf Ojibwe lautet das Wort für »Insekt« Manidoons, kleiner Geist oder kleine Gottheit. An jenem Tag landete eine schillernd grüne Fliege auf meinem Handgelenk. Ich rührte mich nicht, sondern schaute nur zu, wie sie mit den bewimperten Beinen ihren Panzer putzte. Später schaute ich in einem Buch nach, und es war bloß eine Schmeißfliege, Lucilia sericata. Aber in dem Moment war sie eine Gesandte alles dessen, was ich womöglich nie wieder erleben würde – gewöhnliche außergewöhnliche Schönheit, Begeisterung, Staunen. Am nächsten Morgen war sie weg. Zu einem Mülleimer oder einem Kadaver abgeschwirrt, dachte ich. Aber nein. Ihre zerdrückten Überreste klebten an meiner Handfläche. Ich hatte das Manidoons im Schlaf erschlagen. Ich war geliefert. Meinen Sinn für Ironie hatte ich natürlich verloren, nachdem ich so lange ein grausames Klischee bewohnte. Aber in der Routine der Verzweiflung erstrahlt jede Abweichung als bedeutsames Zeichen. Noch Wochen später glaubte ich verbissen daran, das kleine Geistwesen sei ein Omen gewesen, dass ich eines Tages freikommen würde. Und ich hatte es erschlagen.
Doch die Götter waren mir gnädig.
Ich verließ das Gefängnis in einem mit Sonnenblumen bedruckten Overall, einem weißen T‑Shirt und Arbeitsstiefeln. Mein Wörterbuch besaß ich noch immer. Ich kam in einem Übergangswohnheim unter, bis ich schließlich im Schatten der Interstate 35 eine eigene Wohnung fand.
In der Zeit von 2005 bis 2015 hatten die Handys sich weiterentwickelt. Mir fiel auf, dass jeder Zweite da draußen in ein glimmendes Rechteck starrte. So eins wollte ich auch. Um es zu kriegen, brauchte ich einen Job. Ich konnte jetzt eine industrielle Nähmaschine und eine Druckmaschine bedienen, aber die wichtigste Fähigkeit, die ich im Gefängnis erworben hatte, war mörderisch aufmerksames Lesen. In der Bücherei für die Insassen hatte es haufenweise Handarbeitsbücher gegeben. Anfangs las ich wahllos alles, sogar übers Stricken. Als gelegentliche Glücksfälle gab es gespendete Bücher. Von den »Great Books of the World« las ich alle Bände, dazu jede Menge Philippa Gregory und Louis L’Amour. Von Jackie Kettle bekam ich verlässlich jeden Monat ein Buch. Aber mein Traum war, mir meine Lektüre selbst aussuchen zu können. Ich hinterließ meinen sogenannten Lebenslauf, ein Traktat voller Lügen, in jeder Buchhandlung von Minneapolis. Nur eine antwortete mir, weil Jackie dort als Einkäuferin und Managerin angestellt war.
Die Buchhandlung war ein schlichter kleiner Laden gegenüber von einem Schulgebäude aus Backstein in einem freundlichen Viertel. Eine zurückgesetzte blaue Tür führte in den leicht verschrammten, nach Süßgras duftenden und mit Büchern vollgestopften, 75 Quadratmeter großen Verkaufsraum mit Abteilungen für indigene Literatur, Geschichte, Lyrik, Sprachen, Biographien und so weiter. Ich erkannte, dass wir mehr draufhaben, als mir bewusst war. Die Besitzerin erwartete mich in einem kleinen Büroraum mit hohen Fenstern, durch die Streifen sanften Lichts hereinfielen. Louise trug eine altmodische ovale Brille, und ihr Haar wurde von einer perlenbestickten Spange gehalten. Ich kannte sie nur von frühen Autorenfotos. Das Alter hatte ihr Gesicht und die Nase breiter werden lassen, ihre Wangen gepolstert, ihr Haar ergraut und ihr den Anschein von Gelassenheit verliehen. Sie erklärte mir, die Buchhandlung sei ein Verlustgeschäft.
»Vielleicht kann ich ja helfen«, sagte ich.
»Wie denn?«
»Indem ich Bücher verkaufe.«
Ich war zu der Zeit maximal einschüchternd und aktivierte meine alten Verkäuferqualitäten. Den Sonnenblumenoverall hatte ich entsorgt und kultivierte seitdem einen brutal hinreißenden Look – dicker schwarzer Eyeliner, ein grausamer Hieb Lippenstift, Gewichtheberarme und breite Schenkel. Mein Lieblingsoutfit waren schwarze Jeans, klobige schwarze Stiefel, ein schwarzes Footballtrikot, Nasen- und Augenbrauenpiercing, ein eng um die Stirn gebundenes schwarzes Bandana, das meine Haare im Zaum hielt. Wer würde es wagen, mir kein Buch abzukaufen? Louise betrachtete mich ausgiebig und nickte. Sie hatte meinen Lebenslauf in der Hand, stellte aber keine einzige biographische Frage.
»Was lesen Sie gerade?«
»Almanach der Toten. Ein Meisterwerk.«
»Das ist es. Und sonst?«
»Comics. Graphic Novels. Und, äh, Proust?«
Sie nickte skeptisch und scannte mich quasi einmal von oben bis unten.
»Es sind düstere Zeiten für Buchhandlungen, und wir werden wahrscheinlich nicht überleben«, sagte sie. »Möchten Sie mitarbeiten?«
Ich begann mit einer Büroschicht nach Ladenschluss und nahm weitere Zeiten dazu. Ich sah Jackie Kettle wieder, die alles gelesen hatte, was je geschrieben wurde, und mir zeigte, wie der Laden funktionierte. Die alte Tookie hatte ihre eigenen Vorstellungen von Gewinnchancen im Einzelhandel. Aber ich widerstand der Versuchung, die Kasse zu leeren, und ich widerstand der Versuchung, Kreditkartendaten abzugreifen, und ich widerstand der Versuchung, die Non-Book-Artikel zu plündern, selbst den besten Schmuck. Manchmal musste ich mir auf die Fingerknöchel beißen. Nach und nach wurde der Widerstand zur Gewohnheit, und der Drang ließ nach. Ich erarbeitete mir eine Lohnerhöhung, und dann noch eine, und dazu kamen Vergünstigungen wie ein Rabatt auf Bücher oder Leseexemplare. Ich führte ein sparsames Leben. Ging Schaufensterbummeln. Streunte. Nach der Arbeit fuhr ich mit dem Bus hier- und dahin, stieg ein und aus, wo es gerade passte. Vieles hatte sich seit meiner Jugend verändert. Es machte Spaß, mich ohne festes Ziel durch die Stadt tragen zu lassen, in fremde Viertel voller überraschender Menschen. Frauen in fuchsienroten Kleidern mit lila Kopftuch bevölkerten den Gehweg. Ich sah Hmong. Eritreer. Mexikaner. Vietnamesen. Ecuadorianer. Somalis. Laoten. Und eine erfreuliche Anzahl Schwarze Amerikaner und Indigene wie mich. Ladenschilder in Sprachen mit ineinanderfließenden Schriftzeichen und dann Villen über Villen – rausgeputzt, verfallen, abgerissen, von schwebenden Baumkronen beschirmt. Dann die verlassenen Orte – Zugdepots, hektargroße Parkplätze, dystopische Einkaufszentren. Manchmal entdeckte ich ein winziges Restaurant, das sympathisch aussah, und dann stieg ich aus, ging hinein und bestellte Suppe. Ich unternahm eine Weltreise der Suppen. Avgolemono. Sambar. Menudo. Egusi mit Fufu. Ajiaco. Borschtsch. Leberknödelsuppe. Gazpacho. Tom Yam. Soljanka. Nässelsoppa. Gumbo. Gamjaguk. Miso. Pho Ga. Samgyetang. Ich führte in meinem Tagebuch eine Liste mit den Namen und Preisen. Alle waren sehr sättigend und angenehm billig. Einmal bekam ich mit, wie ein Mann am Nebentisch im Café Rinderpenissuppe bestellte. Ich wollte auch so eine Suppe, aber der Kellner bedauerte sehr; sie bekämen nur einen Penis pro Woche geliefert, und der sei schnell vergriffen.
»Die haben auch welche«, sagte ich und zeigte auf ein paar dünne, dickbäuchige Männer.
»Die brauchen das«, sagte er leise. »Das hilft gegen Kater und für … na ja.« Er klappte den Unterarm hoch.
»Ah, verstehe.«
»Ihre Frauen schicken sie her.«
Er zwinkerte mir zu. Statt zurückzuzwinkern, durchbohrte ich ihn mit tödlichen Blicken. Ich wollte ihn einknicken sehen. Das tat er nicht, aber die Gratissuppe war köstlich.
Eines Tages stieg ich am Hard Times Cafe aus dem Bus und lief zu einem Outdoorladen an der Cedar Avenue Ecke Riverside. Midwest Mountaineering hatte einen umzäunten Außenbereich voller Kajaks und Kanus. Sie waren knallbunt – ein Blau, so blau, dass es strahlte, frohes Rot, Sonderangebotsgelb. Als ich auf den Hintereingang zuhielt, um im August einen herabgesetzten Parka abzustauben, spürte ich Blicke auf mir ruhen und drehte mich um.
Diese breiten Schultern. Dieser kantige Kopf. Er stand vor dem Wachsmalkasten aus Paddelbooten. Seine Beine waren dünner geworden, und er trug leuchtend weiße Sneaker. Mit dem Licht im Rücken war er ein schwarzer Umriss. Sein Schatten schmerzhaft gekrümmt, schon seit vor der Zeit als Boxer und als Stammespolizist. Er trat in die Sonne hinaus und erglühte. Flachärschig, schüchtern grinsend, hässlich. Pollux umarmte mich wie ein Riesenbaby und trat zurück. Er kniff die Lider zusammen und schaute mich seltsam kraftvoll an.
»Du bist also frei?«
»Sagen wir so, ich bin draußen.«
»Auf der Flucht?«
»Nein.«
»Dann sag’s mir.«
»Was? Wie geht’s dir, mein hochmoralischer Potawatomi?«
»Nein, nicht das.«
»Sondern?«
»Sag, du willst mich heiraten.«
»Du willst mich heiraten?«
»Ja, will ich.«
Die Tür ist offen. Geh!
Jetzt lebe ich als jemand mit einem normalen Leben. Einem Job mit normalen Arbeitszeiten, und danach gehe ich zu meinem normalen Mann nach Hause. In ein normales kleines Haus, aber mit einem großen unnormalen fleddrigen Garten. Ich lebe jetzt wie jemand, der sich nicht vor der täglichen Ration Lebenszeit fürchtet. Ich lebe das, was man nur dann ein normales Leben nennen kann, wenn man immer damit gerechnet hat, so zu leben. Wenn man glaubt, man hätte darauf ein Anrecht. Arbeit. Liebe. Essen. Ein Schlafzimmer im Schutz einer Kiefer. Sex und Wein. Nach allem, was ich über die Vorgeschichte meines Stammes weiß, und nach allem, was ich von meiner eigenen Vorgeschichte zu erinnern ertrage, kann ich das Leben, das ich jetzt lebe, einfach nur himmlisch nennen.
Seit dem Moment, als ich begriff, dass dieses Leben jetzt meins war, wünsche ich mir nur kostbares Gleichmaß und Kontinuität. Und die habe ich. Aber. Ordnung strebt nach dem Chaos. Die Entropie belauert unsere schwachen Mühen. Man muss immer auf der Hut sein.
Ich arbeitete hart, hielt Ordnung, dimmte mein inneres Durcheinander, blieb beständig. Und trotzdem fand der Ärger raus, wo ich wohnte, blieb mir auf der Spur. Im November 2019 holte der Tod eine unserer nervigsten Kundinnen. Aber sie verschwand nicht.
Die Geschichte einer Frau
November 2019
Fünf Tage nachdem Flora gestorben war, kam sie noch immer in den Laden. Ich war nie streng rational. Wie könnte ich auch? Ich verkaufe Bücher. Trotzdem fiel es mir nicht leicht, das als Tatsache zu akzeptieren. Flora kam, wenn die Buchhandlung leer war, immer während meiner Schichten. Sie kannte die Flautezeiten. Als es zum ersten Mal passierte, hatte ich gerade erst die traurige Nachricht erhalten und war leicht zu erschüttern. Ich hörte sie murmeln, dann raschelte es in einem der hohen Regale in der Belletristik, ihrer Lieblingsabteilung. Auf der Suche nach Zuspruch griff ich nach meinem Handy und wollte Pollux schreiben, aber was? Ich legte es weg, atmete durch und befragte die Leere. Flora? Ein gleitendes Schlurfen. Floras weich aufsetzende, leise Schritte. Ihre Kleidung war immer aus einem Material gewesen, das Geräusche machte – Seide oder Nylonjacken, um diese Jahreszeit gefüttert. Dazu kam das kaum wahrnehmbare Tipp-Klicken ihrer zwei Ohrringe nebeneinander, das gedämpfte Klimpern vieler interessanter Armbänder. Irgendwie beruhigten mich diese vertrauten Geräusche so weit, dass ich klarkam. Ich geriet nicht in Panik. Ich meine, für ihr Ableben konnte ich nichts. Sie hatte keinen Grund, mir übel zu wollen. Aber ich sprach sie kein zweites Mal an und arbeitete unglücklich hinter dem Tresen, während ihr Geist sich umsah.
Flora starb am 2. November, an Allerseelen, einem Tag, an dem der Schleier zwischen den Welten dünn wie Papier ist und leicht einreißt. Seitdem ist sie jeden Tag da gewesen. Es ist verstörend genug, wenn eine normale Kundin stirbt – doch Floras sture Weigerung, abzutreten, begann mich zu ärgern. Es war aber auch typisch. Natürlich geisterte sie durch den Laden. Flora war eine hingebungsvolle Leserin und leidenschaftliche Sammlerin von Büchern. Und unsere Spezialität ist ihr größtes Steckenpferd, indigene Literatur. Aber jetzt kommt das Nervige daran: Sie war ein Stalker von allem Indigenen. Vielleicht ist Stalker ein zu hartes Wort. Sagen wir lieber, sie war ein Möchtegern von der sehr ausdauernden Sorte.
In meinem alten Wörterbuch war »Möchtegern« nicht enthalten. Es galt damals als Umgangssprache, aber Mitte der Siebziger scheint es aufgenommen worden zu sein. Ein Möchtegern ist jemand, der gern etwas sein möchte oder gewesen wäre, wie in dem Satz, den ich so oft zu hören bekommen habe: Als Kind wäre ich gern ein Indianer gewesen