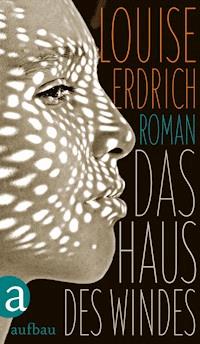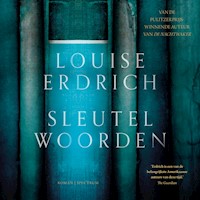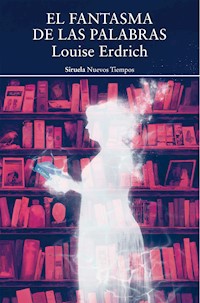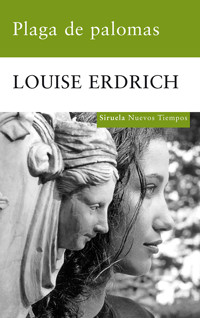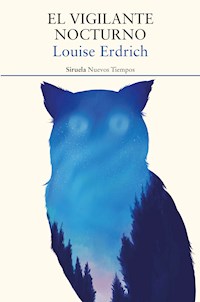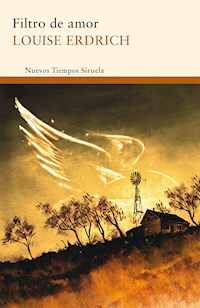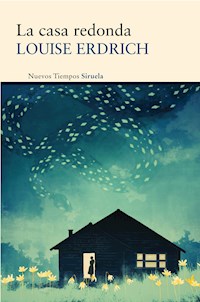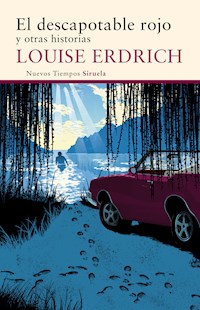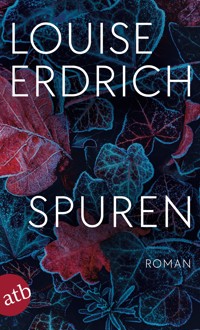
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Atemberaubend.« The New Yorker.
Es ist ihnen kaum etwas von ihrem Land geblieben. Aber das wollen sie verteidigen. Wie alle amerikanischen Ureinwohner, werden die Pillagers, Kashpaws und Lazarres von der Regierung enteignet. Die charismatische Fleur begehrt dagegen auf. Ob ihre Kräfte reichen, um den Wald vor der Rodung zu bewahren?
»Louise Erdrich wird eines Tages den Nobelpreis gewinnen.« Ann Patchett.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Spuren« spielt in North Dakota zu einer Zeit des letzten Jahrhunderts, als die amerikanischen Ureinwohner darum kämpften, das Wenige, was von ihrem Land übrig geblieben war, zu retten. Der Roman erzählt von den ineinander verflochtenen Schicksalen mehrerer Chippewa-Familien. Im Mittelpunkt steht die schöne, der Zauberei mächtige Fleur Pillager. Ihre Geschichte, die der alte Nanapush ihrer Tochter Lulu erzählt, ist die Geschichte ihres Stammes, der von der weißen Kultur überrollt wird. »Ich habe die Zeiten vorbeiziehen seen, die du nie mehr erleben wirst«, sagt er Alte, ein Zauberer und Träger mythischer Geheimnisse auch er. »Ich habe die letzte Büffeljagd geführt, ich habe gesehen, wie der letzte Bär geschossen wird.«
Die Bilder in diesem frühen Buch der Pulitzer-Preisträgerin Louise Erdrich leuchten mit einer traumartig poetischen Intensität und beleuchten ein dunkles Kapitel historischer Realität.
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Für ihren Roman »Der Nachtwächter« erhielt sie 2021 den Pulitzer-Preis. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag und im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls ihre Romane »Jahr der Wunder«, »Die Wunder von Little No Horse«, »Der Gott am Ende der Straße «, »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« sowie »Von Büchern und Inseln« und »Schattenfangen« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Spuren
Roman
Aus dem Amerikanischen von Barbara von Bechtolsheim und Helga Pfetsch
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
DANKSAGUNG
ERSTES KAPITEL
Winter 1912 — Manitou-geezisohns Kleine Geistersonne
Nanapush
ZWEITES KAPITEL
Sommer 1913 — Miskomini-geezis Himbeersonne
Pauline
DRITTES KAPITEL
Herbst 1913 – Frühling 1914 — Onaubin-geezis Harschsonne
Nanapush
VIERTES KAPITEL
Winter 1914 – Sommer 1917 — Meen-geezies Blaubeersonne
Pauline
FÜNFTES KAPITEL
Herbst 1917 – Frühling 1918 — Manitou-geezis Starke Geistsonne
Nanapush
SECHSTES KAPITEL
Frühling 1918 – Winter 1919 — Payaetonookaedaed-geezis Bohrasselsonne
Pauline
SIEBTES KAPITEL
Winter 1918 – Frühling 1919 — Pauguk Beboon Skelettwinter
Nanapush
ACHTES KAPITEL
Frühling 1919 — Baubaukunaetae-geezis Flecken von Erdsonne
Pauline
NEUNTES KAPITEL
Herbst 1919 – Frühling 1924 — Minomini-geezi Wilde Reis-Sonne
Nanapush
Impressum
Michael, die Geschichte ist jedesmal anders und hat kein Ende, aber immer beginnt sie mit dir.
DANKSAGUNG
Gewidmet meiner Mutter, Rita Goumeau Erdrich, meiner Freundin und meinem Vorbild, chi migwitch. Ich höre noch deine Geschichten vom Leben im Reservat und im Wald.
Dank schulde ich Michael Dorris, der in der Nähe von Tyonek, Alaska, Elche aufspürte und dessen Gegenwart aus dieser Geschichte natürlich nicht wegzudenken ist.
Dank auch meiner Schwester Lise Erdrich Croonenberghs für ihre scharfen Beobachtungen und Mary Lou Fox von Manitoulin Island in Ontario.
Den verstorbenen Ben Gourneau, meinen Großonkel, Trapper und Geschichtenerzähler, grüße ich ebenso wie meinen Großvater Patrick Gourneau und die vier Zweige des Ojibwa-Volkes, jene, die Stärke beweisen, die durchhalten.
ERSTES KAPITEL
Winter 1912
Manitou-geezisohnsKleine Geistersonne
Nanapush
Unser Sterben begann vor dem Schneefall, und wie der Schnee fielen wir immer weiter. Es war erstaunlich, dass noch so viele von uns übrig waren zum Sterben. Denen, die bisher alles überlebt hatten – das Fleckfieber aus dem Süden, unseren langen Kampf gen Westen um Nadouissioux-Gebiet, wo wir den Vertrag unterzeichneten, und dann den Wind aus dem Osten, der mit einem Wirbel von Regierungspapieren das Exil brachte: denen, die alles überlebt hatten, musste das, was im Jahr 1912 von Norden hereinbrach, unfassbar erscheinen.
Das Unheil, so dachten wir, musste seine Kraft doch nun verausgabt, die Krankheit musste so viele Anishinabe gefordert haben, wie die Erde nur aufnehmen und behausen konnte.
Aber die Erde ist grenzenlos, genau wie das Glück und wie früher unser Volk. Meine Enkelin, du bist das Kind der Unsichtbaren, derer, die verschwanden, als mit den bitteren Strapazen des frühen Winters eine neue Krankheit herunterfegte. Schwindsucht nannte sie der junge Pater Damien, der in jenem Jahr zu uns kam, um den Priester zu ersetzen, der derselben verheerenden Krankheit erlegen war wie seine Gemeinde. Diese Krankheit war anders als die Pocken und das Fieber, denn sie kam langsam daher. Das Ergebnis, allerdings, war genauso endgültig. Ganze Familien aus deiner Verwandtschaft lagen krank und hilflos von ihr umgeblasen. Im Reservat, wo wir dicht zusammengedrängt waren, schwanden die Clans dahin. Unser Stamm löste sich auf wie ein grobes Seil, das an beiden Enden ausfranst, da jung und alt dahingerafft wurden. Meine eigene Familie wurde einer nach dem anderen ausgelöscht und hinterließ nur Nanapush. Und danach, obwohl ich erst fünfzig Winter gelebt hatte, galt ich als alter Mann. Ich hatte genug gesehen, um einer zu sein. In den Jahren, die ich erlebt hatte, sah ich mehr Veränderungen als in hundert und nochmals hundert Jahren vorher.
Mein Mädchen, ich habe Zeiten vorbeiziehen sehen, die du nie mehr erleben wirst.
Ich habe die letzte Büffeljagd angeführt. Ich habe gesehen, wie der letzte Bär geschossen wurde. Ich habe den letzten Biber mit einem über zweijährigen Pelz gefangen. Ich habe die Worte des Regierungsvertrages laut gesprochen und mich geweigert, die schriftliche Vereinbarung zu unterschreiben, die uns unsere Wälder und den See wegnehmen sollten. Ich habe die letzte Birke gefällt, die älter war als ich, und ich habe die letzte Pillager gerettet. Fleur, die du nicht Mutter nennen willst.
Eines kalten Nachmittags im Spätwinter haben wir sie gefunden, draußen in der Hütte deiner Familie in der Nähe des Matchimanito-Sees; mein Begleiter, Edgar Pukwan von der Stammespolizei, hatte Angst, dort hinzugehen. Um das Wasser herum standen die höchsten Eichen, Wälder, die von Geistern bewohnt und von den Pillagers durchstreift wurden, die die Geheimnisse des Heilens und des Tötens kannten, bis ihre Kunst sie im Stich ließ. Als wir unseren Schlitten auf die Lichtung zogen, sahen wir zwei Dinge: den rauchlosen Blechkamin, der von dem Dach aufragte, und das leere Loch in der Tür, wo die Schnur nach innen gezogen war. Pukwan wollte nicht hineingehen, weil er Angst hatte, die Geister der unbegrabenen Pillager könnten ihm an die Kehle gehen und ihn zum Wahnsinn treiben. Also musste ich die dünngeschabte Haut, die ein Fenster bildete, durchstoßen. Ich ließ mich in die stinkende Stille hinab, auf den Boden. Und ich fand den alten Mann und die Frau, deine Großeltern, den kleinen Bruder und zwei Schwestern, eiskalt und in graue Pferdedecken gewickelt, die Gesichter nach Westen gewendet.
Beklommen und durch ihre stummen Gestalten selbst still geworden, berührte ich jedes Bündel in der düsteren Hütte und wünschte jedem Geist eine gute Reise auf der Dreitage-Straße, der alten Straße, die von unserem Volk in dieser tödlichen Zeit schon so ausgetreten war. Dann klopfte etwas in der Ecke. Ich stieß die Tür weit auf. Es war die älteste Tochter, Fleur, damals etwa siebzehn Jahre alt. Sie fieberte so, dass sie ihre Decken abgeworfen hatte, und jetzt kauerte sie sich gegen den kalten Holzofen, zitternd und mit großen Augen. Sie war wild wie ein heruntergekommener Wolf, ein großes, hageres Mädchen, deren plötzlich ausbrechende Kraft und hervorgestoßenes Gefauche den lauschenden Pukwan in Angst und Schrecken versetzte. Also war wieder ich es, der sich abmühte, um sie an den Vorratssäcken und Schlittenbrettern festzubinden. Ich wickelte weitere Decken um sie und band auch diese fest.
Pukwan hielt uns zurück, überzeugt, er müsse die Vorschriften der Agentur wortgetreu ausführen. Vorsichtig nagelte er das offizielle Quarantäneschild an, und ohne die Toten herauszuholen, versuchte er dann, das Haus abzubrennen. Aber obgleich er immer wieder Kerosin an die Balken schüttete und sogar mit Birkenrinde und Holzspänen ein Feuer anfachte, wurden die Flammen schmal und schrumpften, erloschen in Rauchwölkchen. Pukwan fluchte und sah verzweifelt aus, hin- und hergerissen zwischen seinen offiziellen Pflichten und seiner Angst vor den Pillagers. Letztere trug dann den Sieg davon. Er ließ schließlich den Zunder fallen und half mir, Fleur den Weg entlangzuziehen.
Und so ließen wir fünf Tote, erfroren hinter ihrer Hüttentür, am Matchimanito zurück.
Manche Leute sagen, dass Pukwan und ich besser daran getan hätten, die Pillagers gleich zu begraben. Sie sagen, dass die Unruhe und der Fluch des Unheils, der unser Volk in den darauffolgenden Jahren traf, das Werk unzufriedener Geister gewesen sei. Ich weiß, was Sache ist, und habe nie Angst gehabt, die Dinge beim Namen zu nennen. Unsere Probleme kamen vom Leben, vom Alkohol und vom Dollar. Wir sind dem Regierungsköder nachgestolpert, haben nie auf den Boden geschaut und gar nicht gemerkt, wie das Land uns schrittweise unter den Füßen weggezogen wurde.
Als Edgar Pukwan dran war, den Schlitten zu ziehen, rannte er los, als jage ihn der Teufel, ließ Fleur über Schlaglöcher holpern, als sei sie ein Stück Holz, und kippte sie zweimal in den Schnee. Ich ging hinter dem Schlitten her, ermunterte Fleur mit Liedern, rief Pukwan zu, dass er auf versteckte Äste und unsichtbare abschüssige Stellen achten solle, und schließlich hatte ich sie in meiner Hütte, einem kleinen mit Lehm abgedichteten Gehäuse oberhalb der Kreuzung.
»Hilf mir«, rief ich, schnitt die Schnüre durch, gab mich gar nicht erst mit den Knoten ab. Fleur machte die Augen zu, keuchte und warf den Kopf hin und her. Sie röchelte, wenn sie nach Luft rang; sie fasste mich um den Hals. Noch geschwächt von meiner eigenen Krankheit stolperte ich, fiel, taumelte in meine Hütte, während ich das kräftige Mädchen mit mir nach drinnen zerrte. Ich hatte keine Puste mehr, Pukwan zu verfluchen, der zuschaute, aber sich weigerte, sie zu berühren, sich abwandte und mit dem ganzen Schlitten voller Vorräte verschwand. Es überraschte mich nicht, und mein Kummer war auch nicht allzu groß, als Pukwans Sohn, der auch Edgar hieß und auch zur Stammespolizei gehörte, mir später erzählte, sein Vater sei heimgekommen, ins Bett gekrochen und habe von dem Augenblick an bis zu seinem letzten Atemzug keine Nahrung mehr zu sich genommen.
Was Fleur anbelangt, so ging es ihr mit jedem Tag schrittweise besser. Zuerst wurde ihr Blick konzentriert, und in der darauffolgenden Nacht war ihre Haut kühl und feucht. Sie war klar im Kopf, und nach einer Woche erinnerte sie sich daran, was über ihre Familie hereingebrochen war, wie sie ganz plötzlich von einer Krankheit gepackt worden und ihr zum Opfer gefallen waren. Mit ihrer Erinnerung kam auch die meine zurück, nur allzu genau. Ich war nicht darauf vorbereitet, an die Menschen zu denken, die ich verloren hatte, oder von ihnen zu sprechen, doch wir taten es, vorsichtig, und ohne ihre Namen dem Lufthauch preiszugeben, der ihnen zu Ohren kommen würde.
Wir fürchteten, dass sie uns hören und niemals zur Ruhe kommen würden, dass sie zurückkommen könnten aus Mitleid für die Einsamkeit, die wir empfanden. Sie würden im Schnee draußen vor der Tür sitzen und warten, bis wir uns aus Sehnsucht zu ihnen gesellen würden. Dann würden wir uns alle zusammen auf die Reise machen, und unser Ziel wäre das Dorf, wo die Leute Tag und Nacht spielen, ohne je ihr Geld zu verlieren, essen, ohne je ihren Magen zu füllen, trinken, ohne je um den Verstand zu kommen.
Der Schnee verzog sich lange genug, dass wir den Boden mit Pickeln bearbeiten konnten.
Als Stammespolizist war Pukwans Sohn per Verordnung gezwungen, bei der Beerdigung der Toten zu helfen. Also machten wir uns wieder auf den dunklen Weg zum Matchimanito, wobei diesmal der Sohn anstelle des Vaters voranging. Wir verbrachten den Tag damit, die Erde auszuhauen, bis wir ein Loch hatten, das lang und tief genug war, um die Pillagers Schulter an Schulter hineinzulegen. Dann bedeckten wir sie mit Erde und bauten fünf kleine Lattenhäuser. Ich kratzte ihre Clanzeichen ein, vier schraffierte Bären und ein Marder, dann schulterte Pukwan junior die Dienstwerkzeuge und machte sich auf den Rückweg. Ich ließ mich in der Nähe der Gräber nieder.
Ich bat die Pillagers, so wie ich meine eigenen Kinder und Frauen gebeten hatte, jetzt von uns zu gehen und nie mehr zurückzukommen. Ich bot ihnen Tabak an, rauchte eine Pfeife Rotweide für den alten Mann. Ich bat sie, ihre Tochter nicht zu belästigen, nur weil sie überlebt hatte, noch mir vorzuwerfen, dass ich sie gefunden hatte, oder Pukwan junior, dass er zu früh weggegangen sei. Ich sagte ihnen, es tue mir leid, aber sie müssten uns jetzt allein lassen. Darauf beharrte ich. Aber die Pillagers waren genauso dickköpfig wie der Clan der Nanapush und ließen meine Gedanken einfach nicht los. Ich glaube, sie verfolgten mich bis nach Hause. Den ganzen Weg entlang, knapp außerhalb meines Blickfelds, zuckten sie auf, dünn wie Nadeln, die Schatten durchbohren. Die Sonne war untergegangen, als ich zurückkam, aber Fleur war wach und saß im Dunkeln, als wisse sie Bescheid. Sie rührte sich nicht, um das Feuer zu unterhalten, sie fragte mich nicht, wo ich gewesen war. Ich sagte es ihr auch nicht, und während die Tage vergingen, sprachen wir immer weniger. Die Geister der Toten kamen uns so nah, dass wir schließlich ganz aufhörten zu reden.
Das machte es nur noch schlimmer.
Ihre Namen wucherten in uns, sie schwollen uns bis an den Rand der Lippen, zwangen uns mitten in der Nacht, die Augen aufzumachen. Das Wasser der Ertrunkenen erfüllte uns, kalt und schwarz, stickiges Wasser, das gegen das Siegel unserer Zungen schwappte oder uns langsam aus den Augenwinkeln sickerte. Ihre Namen tauchten wie Eisschollen in uns hin und her. Dann fingen die Eissplitter an, sich über uns zu sammeln und uns zuzudecken. Wir wurden so schwer, heruntergezogen von dem bleigrauen Eis, dass wir uns nicht mehr bewegen konnten. Unsere Hände lagen wie verschwommene Klötze auf dem Tisch. Das Blut in uns wurde dick. Wir brauchten keine Nahrung. Und wenig Wärme. Tage vergingen, Wochen, und wir gingen nicht aus der Hütte, aus Angst, unsere kalten, empfindlichen Körper würden in Stücke brechen. Wir waren schon halb von Sinnen. Ich erfuhr später, dass das normal war, dass viele von uns auf diese Art gestorben waren, an dieser unsichtbaren Krankheit. Manche konnten keinen Bissen Nahrung mehr schlucken, weil die Namen ihrer Toten ihnen die Zunge festzurrten. Manche brachen mit den Blutsbanden und schlugen am Ende den Weg nach Westen ein.
Aber eines Tages machte der neue Priester, der fast noch ein Junge war, unsere Tür auf. Ein blendendes, schmerzendes Licht flutete herein und umschloss Fleur und mich. Man habe noch einen Pillager gefunden, sagte der Priester, Fleurs Vetter Moses sei in den Wäldern noch am Leben. Taub, dumm wie Bären in einer Winterhöhle blinzelten wir die schmächtige Silhouette des Priesters an. Unsere Lippen waren ausgetrocknet, klebten zusammen. Wir konnten kaum einen Gruß hervorbringen, aber ein Gedanke rettete uns: Ein Gast muss essen. Fleur bot Pater Damien ihren Stuhl an und legte Holz auf die grauen Kohlen. Sie fand noch Mehl für Gaulette. Ich wollte Schnee holen, um ihn für Teewasser aufzutauen, aber zu meinem Erstaunen war der Boden frei. Ich war so erstaunt, dass ich mich hinunterbeugte und die weiche, feuchte Erde berührte.
Meine Stimme krächzte, als ich zu sprechen versuchte, aber dann, geölt von starkem Tee, Schmalz und Brot, legte ich los und redete. Mich hält so schnell nichts auf, wenn ich erst mal in Schwung komme. Pater Damien sah verwundert aus, und dann argwöhnisch, als ich zu knarren und zu rollen anfing. Ich wurde immer schneller. Ich redete in beiden Sprachen, in Strömen, die nebeneinander herflossen, über jeden Stein, um jedes Hindernis. Der Klang meiner eigenen Stimme überzeugte mich davon, dass ich noch am Leben war. Pater Damien hörte mir die ganze Nacht zu, seine grünen Augen rund, sein hageres Gesicht bemüht zu verstehen, sein merkwürdiges braunes Haar in Locken und gestutzten Zotteln. Manchmal holte er Luft, als wolle er seine eigenen Beobachtungen beitragen, aber ich redete ihn mit meinen Worten in Grund und Boden.
Ich weiß nicht mehr, wann deine Mutter wieder verschwand. Sie war zu jung und hatte noch keine Geschichten oder tiefere Lebenserfahrung, auf die sie sich hätte verlassen können. Sie hatte nur unverbrauchte Kraft, und die Namen der Toten, die sie erfüllten. Heute kann ich sie aussprechen. Sie haben jetzt an keinem von uns mehr Interesse. Der Alte Pillager. Ogimaakwe, Die-die-das-Sagen-hat, seine Frau. Asasaweminikwesens, Wildkirschen-Mädchen. Bineshii, Kleiner-Vogel, auch als Josette bekannt. Und der Letzte, der junge Ombaashi, Er-der-vom-Wind-getragen-wird. Dann gab es noch den anderen, einen Vetter Pillager namens Moses. Er hatte überlebt, aber wie sie später auch von Fleur sagten, wusste er nicht mehr, wo er war, ob hier auf dem Reservat mit den Vermessungsarbeiten oder an dem anderen Ort, dem ohne Grenzen, da wo die Toten sitzen und reden, zu viel sehen und die Lebenden als Narren betrachten.
Und genau das waren wir. Der Hunger machte jeden zum Narren. Früher hatten manche ihr zugeteiltes Land für einhundert Pfund Mehl verkauft. Andere, die verzweifelt durchzuhalten versuchten, drängten uns nun, wir sollten uns zusammentun und unser Land zurückkaufen oder wenigstens eine Steuer dafür zahlen und das Holzfällergeld ablehnen, das unsere Grenzmarkierungen von der Landkarte fegen würde wie ein Muster aus Strohhalmen. Viele waren entschlossen, den angeheuerten Landvermessern und sogar unseren eigenen Leuten nicht zu gestatten, den tiefsten Wald zu betreten. Sie erwähnten die Führer Hat und Viele-Frauen – heute nicht mehr am Leben –, die sich von der Regierung hatten bezahlen lassen.
Aber in jenem Frühling drangen wie schon früher Fremde und auch einige von uns ins Buschinnere vor. Der Grund war die Vermessung des Sees. Nur traten sie jetzt auf die frischen Gräber der Pillagers, überquerten die Todesstraßen, um die tiefsten Stellen des Wassers zu vermessen, wo das Seeungeheuer, Misshepeshu, sich versteckt hielt und wartete.
»Bleib bei mir«, sagte ich zu Fleur, als sie zu Besuch kam.
Sie wollte nicht.
»Das Land wird verloren gehn«, sagte ich zu ihr. »Das Land wird verkauft und vermessen werden.«
Aber sie warf ihr Haar zurück und ging weg, den Weg hinunter, ohne etwas zu essen bis zur Schneeschmelze, außer einem Beutel von meinen Zwiebeln und einem Sack Hafer.
Wer weiß, was passierte? Sie ging an den Matchimanito zurück und lebte dort allein in der Hütte, die selbst das Feuer nicht gewollt hatte. Noch nie hatte ein junges Mädchen so etwas getan.
Ich hörte, dass man in jenen Monaten für alle vier Parzellen eine Grundbesitzsteuer von ihr verlangte, sogar für die Insel, wo Moses sich versteckte. Der Regierungsvertreter ging raus, verirrte sich dann, verbrachte eine ganze Nacht damit, den sich bewegenden Lichtern und Lampen von Leuten zu folgen, die ihm nicht antworten wollten, sondern nur untereinander redeten und lachten. Sie ließen ihn erst im Morgengrauen gehen, und nur, weil er derart töricht war. Trotzdem verlangte er von Fleur wieder Geld, und als Nächstes hörten wir, dass er in den Wäldern lebte und sich von Wurzeln ernährte, mit den Geistern Glücksspiele spielte.
Jedes Jahr kommen mehr, die hier Profit suchen, die mit ihren Schnüren und gelben Fähnchen Linien über das Land ziehen. Manchmal verschwinden sie, und jetzt gibt es nachts draußen am Matchimanito so viele, die mit Stöcken und Würfeln wetten, dass man sich fragt, wie Fleur da schlafen kann, oder ob sie überhaupt schläft. Warum sollte sie auch? Sie kommt ohne so vieles aus. Die Gesellschaft der Lebenden. Munition für ihr Gewehr.
Manche haben so ihre Vorstellungen. Man weiß ja, wie alte Hühner scharren und gackern. So haben die Geschichten angefangen, all der Klatsch, das Herumrätseln, all die Dinge, die die Leute sagten, ohne etwas zu wissen, und dann auch glaubten, weil sie es mit eigenen Ohren gehört hatten, von ihren eigenen Lippen, Wort für Wort.
Das Gerede von denen, die im Schatten des Lagerhauses des neuen Regierungsvertreters Fett ansetzten, habe ich nie beachtet. Aber ich habe beobachtet, wie die Wagen um die ausgefurchte Abzweigung zum Matchimanito fuhren. Wenige sind zurückgekommen, das stimmt, aber es waren noch genug, die zurückkamen, hoch beladen mit festem grünem Holz. Von der Stelle, an der wir jetzt sitzen, meine Enkeltochter, habe ich Knarren und Krachen gehört, ich habe gespürt, wie der Boden zitterte mit jedem Baum, der zu Boden schlug. Ich bin ein alter, schwacher Mann geworden, während diese Eiche fiel, und noch eine und noch eine verloren ging, während hier eine Lücke entstand, da eine Lichtung, und das helle Tageslicht hereinfiel.
ZWEITES KAPITEL
Sommer 1913
Miskomini-geezisHimbeersonne
Pauline
Als Fleur Pillager zum ersten Mal in den kalten, glasklaren Wassern des Matchimanito ertrank, war sie noch ein Kind. Zwei Männer sahen das Boot kentern, sahen sie in den Wellen kämpfen. Sie ruderten hinüber an die Stelle, an der sie untergegangen war, und sprangen hinein. Als sie sie über das Dollbord zogen, fühlte sie sich kalt und steif an, deshalb versetzten sie ihr Ohrfeigen, hoben sie an den Fersen hoch und schüttelten sie, bewegten ihre Arme und klopften ihr auf den Rücken, bis sie Seewasser hustete. Sie zitterte am ganzen Leib wie ein Hund, dann schöpfte sie Atem. Doch nicht lange danach verschwanden beide Männer. Der Erste ging in die Irre, und der andere, Jean Hat, wurde vom Wagen seines eigenen Landvermessers überfahren.
Da sähe man es ja, sagten die Leute. Für sie war es sonnenklar. Weil sie Fleur Pillager gerettet hatten, waren die beiden ins Verderben gestürzt worden.
Als Fleur Pillager das nächste Mal in den See fiel, war sie fünfzehn Jahre alt, und keiner rührte einen Finger. Sie wurde ans Ufer getrieben, die Haut ein stumpfes totes Grau, aber als George Viele-Frauen sich hinunterbeugte und genauer hinschaute, sah er, dass sich ihre Brust bewegte. Dann taten sich ihre Augen auf, klar und achatschwarz, und sie blickte ihn an. »Tritt du an meine Stelle«, zischte sie. Alle stoben auseinander und ließen sie dort liegen, deshalb weiß keiner, wie sie sich nach Hause geschleppt hat. Bald danach fiel uns auf, dass Viele-Frauen sich veränderte, ängstlich wurde, das Haus nicht mehr verlassen wollte und nicht mehr dazu zu bewegen war, sich in die Nähe von Wasser zu begeben oder die Kartographen zurück in den Wald zu führen. Dank seiner Vorsicht blieb er am Leben, bis zu dem Tag, an dem ihm seine Söhne eine neue Blechbadewanne mitbrachten. Als er sie das erste Mal benutzte, rutschte er aus, wurde bewusstlos und bekam Wasser in die Lunge, während seine Frau nebenan in der Küche stand und das Frühstück briet.
Nach dem zweiten Ertrinken hielten sich die Männer auf Abstand von Fleur Pillager. Obwohl sie hübsch war, wagte es keiner, ihr den Hof zu machen, weil klar war, dass Misshepeshu, der Wassermann, das Ungeheuer, sie für sich allein wollte. Ein ganz teuflischer ist der, liebeshungrig und voller Verlangen und verrückt danach, junge Mädchen anzufassen, vor allem die starken, waghalsigen, solche wie Fleur.
Unsere Mütter weisen uns warnend darauf hin, dass uns sein Aussehen gefallen wird, denn er erscheint einem mit grünen Augen, kupferner Haut und einem Mund sanft wie der eines Kindes. Aber wenn man in seine Arme sinkt, sprießen ihm Hörner, Reißzähne, Klauen, Flossen. Seine Beine sind zusammengewachsen, und seine Haut, Schuppen aus Bronze, tönt, wenn man sie berührt. Du bist verzaubert und kannst dich nicht mehr rühren. Er wirft dir eine Muschelkette vor die Füße, weint schimmernde Tränensplitter, die sich auf deinen Brüsten zu Katzengold verhärten. Er taucht dich unter. Dann nimmt er die Gestalt eines Löwen, eines fetten braunen Wurms oder eines dir bekannten Mannes an. Er ist aus Gold. Er ist aus Strandmoos. Er ist ein Ding aus trockenem Schaum, ein Ding aus dem Tod durch Ertrinken, dem Tod, den kein Chippewa überleben kann.
Es sei denn, du bist Fleur Pillager. Wir alle wussten, dass sie nicht schwimmen konnte. Nach dem ersten Mal dachten wir, sie würde sich jetzt zurückziehen, still vor sich hin leben, damit aufhören, durch ihr Ertrinken Männer umzubringen. Wir dachten, sie würde auf die rechte Bahn kommen. Aber dann, nach ihrer zweiten Rückkehr und nachdem der alte Nanapush sie gesund gepflegt hatte, merkten wir, dass es etwas viel Schlimmeres war. Allein dort draußen schnappte sie über, geriet außer Rand und Band. Sie befasste sich mit Bösem, lachte über den Rat der alten Frauen und kleidete sich wie ein Mann. Sie ließ sich auf einen fast vergessenen Zauber ein und befasste sich mit Praktiken, über die wir gar nicht reden sollten. Manche Leute sagen, sie hätte einen Kinderfinger in der Tasche getragen und ein Pulver aus ungeborenen Kaninchen an einem Lederriemen um den Hals. Sie legte sich das Herz einer Eule auf die Zunge, so dass sie nachts sehen konnte, und ging hinaus zum Jagen, aber nicht in ihrer eigenen Gestalt. Das ist bewiesen, weil wir am nächsten Morgen im Schnee oder in der Erde den Spuren ihrer nackten Füße folgten und sahen, wo sie sich verwandelten, wo die Klauen wuchsen, der Ballen breiter wurde und sich tiefer in die Erde drückte. Nachts hörten wir ihren puffenden Husten, den Bärenhusten. Bei Tag machten ihr Schweigen und das breite Lächeln, das sie aufsetzte, um uns in Sicherheit zu wiegen, uns Angst. Manche meinten, man sollte Fleur Pillager aus dem Reservat vertreiben, aber nicht ein Einziger von denen, die so was sagten, hatte den Nerv dazu. Und als die Leute endlich drauf und dran waren, sich zusammenzutun und sie gemeinsam rauszuwerfen, da ging sie von selbst und kam den ganzen Sommer nicht zurück. Und davon will ich erzählen.
Während der Monate, als Fleur ein paar Meilen weiter südlich wohnte, in Argus, da passierte so einiges. Um ein Haar hätte sie die ganze Stadt vernichtet.
Als sie anno 1913 runter nach Argus kam, war das Städtchen nichts weiter als ein Raster von sechs Straßen zu beiden Seiten des Bahnhofs. Es gab zwei Getreidesilos, einen im Zentrum, den anderen ein paar Meilen westlich. Zwei Kaufläden wetteiferten um die Kundschaft der dreihundert Einwohner, und drei Kirchen zankten sich um ihre Seelen. Es gab ein Holzhaus für die Lutheraner, ein dickes Backsteingebäude für die Episkopalier und eine lange, schmale geschindelte katholische Kirche. Letztere besaß einen schlanken Turm, der doppelt so hoch war wie alle anderen Gebäude und Bäume.
Zweifellos sah Fleur, als sie zu Fuß auf der Straße näher kam, über den niedrigen, flachen Weizenfeldern diesen Turm aufragen, einen Schatten dünn wie eine Nadel. Vielleicht zog er sie in dieser leeren Gegend an, so wie ein allein stehender Baum den Blitz anzieht. Vielleicht sind letzten Endes die Katholiken schuld. Denn hätte Fleur dieses Zeichen des Stolzes nicht gesehen, dieses schlanke Gebet, diese Markierung, so wäre sie vielleicht einfach weitergegangen.
Aber Fleur Pillager bog ab, und die erste Stelle, die sie anlief, als sie die Stadt erreichte, war die Hintertür des Pfarrhauses, das an die markante Kirche angebaut war. Sie ging dort nicht hin um einer milden Gabe willen, obwohl sie die bekam, sondern um nach Arbeit zu fragen. Auch die bekam sie, oder vielmehr bekamen wir Fleur. Es ist schwer zu sagen, wem am übelsten mitgespielt wurde, ihr oder den Männern oder der Stadt, nur dass Fleur, wie immer, überlebte.
Die Männer, die in der Schlachterei arbeiteten, hatten zusammen schon um die tausend Stück Vieh zerlegt, zur Hälfte vielleicht Ochsen, zur anderen Hälfte Schweine, Schafe und Wild wie Rehe, Elche und Bären. Die unzähligen Hühner nicht eingerechnet. Pete Kozka war der Besitzer, und er hatte drei Männer angestellt: Lilie Veddar, Tor Grunewald und Dutch James.
Ich kam durch Dutch nach Argus. Er hatte im Reservat eine Warenauslieferung zu machen und lernte dabei die Schwester meines Vaters, Regina, kennen, eine geborene Puyat und dann durch ihren ersten Ehemann eine Kashpaw. Dutch hat ihr nicht gleich seinen Namen gegeben, das kam erst später. Er hat auch nie ihren Sohn Russell adoptiert, dessen Vater inzwischen irgendwo in Montana lebte.
Während der Zeit, als ich bei ihnen wohnte, habe ich kaum je erlebt, dass Dutch und Regina einander ansahen oder miteinander redeten. Vielleicht, weil die Puyats, bis auf mich, als schweigsame Leute galten, die wenig zu sagen haben. Wir waren Mischlinge, Pelzhändler in einem Clan, dessen Name verloren gegangen war. Im Frühjahr vor dem Winter, der so viele Chippewa dahinraffte, plagte ich meinen Vater, mich in den Süden zu schicken, in die weiße Stadt. Ich hatte beschlossen, dass ich von den Nonnen des Spitzenklöppeln lernen wollte.
»Du wirst da draußen ein Bleichgesicht werden«, sagte er, womit er mich daran erinnerte, dass ich heller als meine Schwestern war. »Du wirst keine Indianerin mehr sein, wenn du zurückkommst.«
»Dann komme ich vielleicht nicht mehr zurück«, erklärte ich. Ich wollte wie meine Mutter sein, deren halbweiße Herkunft offensichtlich war. Ich wollte wie mein Großvater sein, rein kanadisch. Und das, weil ich schon als Kind sah, dass Hinterherhinken den Untergang bedeutet. Ich schaute durch die Augen der Welt außerhalb von uns. Ich weigerte mich, unsere Sprache zu sprechen. Auf Englisch sagte ich zu meinem Vater, dass wir einen Abort bauen sollten mit einer Tür, die man auf- und zumachen konnte.
»So was gibt’s bei uns am Haus nicht.« Er lachte. Aber er verachtete mich, als ich keine Perlenstickerei machen wollte, als ich mich weigerte, mir mit den Stachelschweinborsten die Finger zu zerstechen, und mich versteckte, um nicht steife Tierfelle mit Hirn weichreiben zu müssen.
»Ich bin zu etwas Besserem bestimmt«, sagte ich zu ihm. »Schick mich runter zu deiner Schwester.« Also tat er es. Aber ich lernte dort nicht das Fädenziehen und Arbeiten mit Garnrollen und Spulen. Ich fegte Böden in einem Metzgerladen und kümmerte mich um meinen Vetter Russell.
Jeden Tag nahm ich ihn mit in den Laden, und wir machten uns an die Arbeit – streuten frisches Sägemehl, trugen einen Schinkenknochen für den Bohneneintopf einer Kundin über die Straße oder ein Paket Würstchen an die Ecke. Russell übernahm den größeren Teil an Aufträgen und arbeitete schwerer. Obwohl er noch klein war, war er fix und zuverlässig. Er blieb nie stehen, um zuzuschauen, wie eine Wolke vorüberzog oder eine Spinne mit derselben raschen Sorgfalt eine Fliege einwickelte wie Pete ein dickes Steak für den Doktor. Russell und ich waren verschieden. Er setzte sich nie zum Ausruhen hin, träumte nie davon, ein Paar Schuhe zu besitzen wie die, die an den Füßen von weißen Mädchen vorüberkamen, Schuhe aus hartem rotem Leder, das mit ausgestanzten Löchern verziert war. Er lauschte auch nie auf das, was diese Mädchen über ihn sagten, und stellte sich nicht vor, wie sie umkehren und seine Hand fassen würden. In Wahrheit hatte auch ich kaum eine Vorstellung von dem, was die weißen Mädchen dachten.
In diesem Winter hörten wir überhaupt nichts von meiner Familie, obwohl Regina fragte. Noch wusste keiner, wie viele Menschen umgekommen waren, niemand registrierte es. Wir hörten nur, dass man gar nicht schnell genug das Holz für ihre Grabhäuser sägen konnte; und ohnehin waren so wenige Leute kräftig genug zum Arbeiten, dass das Gestrüpp schon wieder wucherte, wenn sie sich schließlich dranmachten, und den frisch umgegrabenen Boden, das Zeichen, dass hier jemand begraben lag, verdeckte. Die Priester versuchten, die Leute von der Sitte, ihre Toten in den Bäumen zu bestatten, abzubringen, aber die Leichen, die sie herunterzogen, hatten keine Namen, sondern trugen nur Überbleibsel ihres Besitzes bei sich. Manchmal ging mir ein Traum durch den Kopf, den ich nicht abschütteln konnte. Ich sah meine Schwestern und meine Mutter in den Zweigen schwanken, so hoch oben bestattet, dass keiner drankam, eingewickelt in die Spitzen, die ich nie geklöppelt hatte.
Ich versuchte, nicht daran zu denken, wie es gewesen war, in Gesellschaft zu sein, meine Mutter und meine Schwestern um mich zu haben, aber als Fleur in diesem Juni zu uns kam, fiel es mir wieder ein. Ich erfand Ausreden, um neben ihr arbeiten zu können, ich fragte sie aus, aber Fleur weigerte sich, über die Puyats oder über den Winter zu reden. Sie schüttelte den Kopf, schaute weg. Einmal fasste sie mein Gesicht an, wie aus Versehen oder um mich zum Schweigen zu bringen, und sagte, dass meine Familie vielleicht, wie andere Mischlinge auch, in den Norden gezogen sei, um der Epidemie zu entgehen.
Ich war fünfzehn, einsam und sah so armselig aus, dass ich für die meisten Kunden und die Männer in der Metzgerei unsichtbar war. Solange sie mich nicht brauchten, war ich eins mit den fleckigen braunen Wänden, ein mageres Mädchen mit großer Nase und stechenden Augen.
Aus dieser Tatsache zog ich allerdings allen Nutzen, den ich konnte. Da ich in einer Ecke verschwinden oder mich unter ein Regal verdrücken konnte, wusste ich alles: wieviel Bargeld in der Kasse war, worüber die Männer ihre Witze rissen, wenn sie sich allein glaubten, und was sie schließlich Fleur antaten.
Kozkas Fleischwaren bediente die Farmer im Umkreis von fünfzig Meilen, sowohl was das Schlachten anging, denn die Metzgerei war mit einem Stall und einer Schlachtrinne ausgestattet, als auch das Konservieren des Fleisches durch Räuchern oder die Verarbeitung zu Wurst. Das Kühllagerhaus war ein Wunderwerk, gebaut aus vielen Lagen Backstein und isolierender Erde und Bauholz aus Minnesota, und innen ausgekleidet mit Sägespänen und riesigen Eisblöcken, die jeden Winter aus dem tiefsten Ende des Matchimanitosees gehauen und mit Pferd und Schlitten aus dem Reservat heruntergeholt wurden.
Ein klappriges Brettergebäude, teils Schlachthaus, teils Laden, war an den niedrigen würfelförmigen Kühlhauskomplex angebaut. Dort arbeitete Fleur. Kozka hatte sie wegen ihrer Bärenkräfte angestellt. Sie konnte eine Rinderkeule hochheben oder eine ganze Deichsel Würste schultern ohne zu stolpern, und das Fleischzerlegen lernte sie bald von Fritzie, einer spindeldürren Blondine, die Kette rauchte und die rasierklingenscharfen Messer mit seelenruhiger Präzision handhabte, wenn sie damit dicht an ihren fleckigen Fingern entlangschnitt. Die beiden Frauen arbeiteten nachmittags, verpackten die Fleischstücke in Papier, und Fleur trug die Pakete zum Kühlhaus. Russell half ihr gern. Er verschwand, wenn ich ihn rief, befolgte keinen meiner Befehle, aber ich hatte bald heraus, dass er immer dicht an Fleurs Hüfte zu finden war, wo er mit einer Hand vorsichtig eine Falte ihres Rockes hielt, so sachte, dass sie tun konnte, als merke sie es nicht.
Natürlich merkte sie es. Sie kannte die Wirkung, die sie auf Männer ausübte, schon auf die allerjüngsten. Sie zog sie in Bann, narrte sie, machte sie neugierig auf ihre Gewohnheiten, lockte sie mit sorgloser Ungeniertheit an und servierte sie mit derselben Gleichgültigkeit wieder ab. Zu Russell war sie allerdings freundlich, verhätschelte ihn gar wie eine Mutter, fuhr ihm mit den Fingern durchs Haar und schalt mich, wenn ich ihn trat oder ärgerte.
Wenn wir beim Essen saßen, fütterte Fleur Russell mit Zuckerstückchen, schöpfte, wenn Fritzie den Rücken kehrte, den Rahm vom Milchkrug und löffelte ihn Russell in den Mund. Bei der Arbeit gab sie ihm kleine Pakete zu tragen, wenn sie und Fritzie das zerlegte Fleisch vor den schweren Türen des Kühlhauses stapelten, die erst um fünf Uhr jeden Nachmittag geöffnet wurden, bevor die Männer zu Abend aßen.
Manchmal blieben Dutch, Tor und Lilie nach der Arbeit vor dem Kühlhaus sitzen, und dann blieben auch Russell und ich in der Nähe, putzten die Böden, schürten die Feuer im vorderen Räucherhaus, während die Männer um den gedrungenen, kalten gußeisernen Ofen saßen und sich Heringsstücke auf Schiffszwieback spießten. Sie spielten endlose Pokerspiele oder Cribbage mit einem Brett, das aus dem glatt gehobelten Ende einer Salzkiste gemacht war. Sie redeten. Wir aßen unser Brot und Wurstzipfel, schauten zu und lauschten, obwohl es nicht viel zu hören gab, da in Argus fast nie etwas passierte. Tor war verheiratet, Dutch lebte mit Regina zusammen, und Lilie las Postwurfsendungen. Sie sprachen hauptsächlich über bevorstehende Auktionen, Landwirtschaftsmaschinen oder Frauen.
Gelegentlich kam Pete Kozka zum Whistspielen heraus, derweil Fritzie im Hinterzimmer ihre Zigaretten rauchte und Berliner buk. Er setzte sich und spielte ein paar Runden mit, behielt aber seine Gedanken für sich. Fritzie ließ nicht zu, dass er hinter ihrem Rücken redete, und das einzige Buch, das er las, war das Neue Testament. Wenn er etwas sagte, dann betraf es entweder das Wetter oder den Weizenüberschuss. Er besaß einen Talisman, die opalweiße Linse aus einem Kuhauge. Beim Romméspielen rieb er sie zwischen den Fingern. Dieses leise Geräusch und das Klatschen der Karten war zumeist die einzige Unterhaltung.
Schließlich lieferte Fleur ihnen Gesprächsstoff.
Fleurs Wangen waren breit und flach, ihre Hände groß, rissig und muskulös. Ihre Schultern waren breit und gebogen wie ein Joch, ihre Hüften fischähnlich, glatt und schmal. Ein altes grünes Kleid klebte ihr um die Taille, durchgewetzt an der Stelle, wo sie saß. Ihre glänzenden Zöpfe waren wie Schwänze von Tieren und baumelten gegen ihren Körper, wenn sie sich bewegte, bedächtig, langsam bei der Arbeit, beherrscht und halb gezähmt. Aber nur halb. Ich hatte einen Blick für so etwas, aber die anderen merkten es gar nicht. Sie sahen ihr nie in die schlauen braunen Augen, und auch die starken, scharfen und sehr weißen Zähne fielen ihnen nicht auf. Fleurs Beine waren nackt, aber da sie in perlenbestickten Mokassins herumging, sahen sie nie, dass bei ihr die fünften Zehen fehlten. Sie wussten auch nicht, dass sie schon ertrunken war. Sie waren blind, sie waren dumm, sie sahen sie nur oberflächlich.
Aber nicht, dass sie eine Chippewa war, oder überhaupt eine Frau, nicht dass sie gut aussah oder auch dass sie allein war, brachte ihnen den Kopf zum Schwirren. Sondern wie sie Karten spielte.
Normalerweise spielten Frauen nicht mit Männern, deshalb kam die Überraschung wie ein Schock, als Fleur sich eines Abends einen Stuhl an den Tisch der Männer zog.
»Was soll’n das«, sagte Lilie. Er war fett, hatte die blassen Augen und die kostbare Haut einer Schlange, glatt und lilienweiß, woher auch sein Name kam. Lilie besaß einen Hund, ein stummeliges gemeines bulliges Etwas mit einem Bauch, der von Speckschwarten stramm wie eine Trommel war. Der Hund liebte die Karten genauso sehr wie Lilie und saß ganze Spiele von Stud-Poker, Rum-Poker und Siebzehnundvier hoch aufgerichtet auf seinen Tonnenbeinchen. An jenem ersten Abend schnappte das Vieh nach Fleurs Arm, duckte sich aber und ließ sein Knurren im Halse ersticken, als sie sich niederließ.
»Ich hab gedacht«, sagte sie mit sanfter schmeichelnder Stimme, »ihr könntet mich mitspielen lassen.«
Zwischen dem Bleifass mit Würzmehl und der Wand war eine Lücke, in die Russell und ich genau hineinpassten. Er versuchte, sich zu Fleurs Rock vorzuarbeiten, um sich an sie zu schmiegen. Wer weiß, vielleicht hätte er ihr Glück gebracht wie der Hund Lilie, nur hatte ich das Gefühl, dass wir weggescheucht werden würden, wenn die Männer uns bemerkten, deshalb zog ich ihn an den Hosenträgern zurück. Wir hockten uns hin, und ich legte ihm den Arm um den Hals. Russell roch nach Kümmel und Pfeffer, nach Staub und saurer Erde. Er beobachtete das Spiel etwa eine Minute lang mit gespannter Aufmerksamkeit, dann sackte er zusammen, lehnte sich an mich, und sein Mund klappte auf. Ich hielt die Augen offen, sah Fleurs schwarzes Haar über den Stuhl fliegen, ihre Füße, die fest auf den Dielenbrettern standen. Auf den Tisch, auf dem die Karten aufklatschten, konnte ich nicht sehen, deshalb drückte ich, als sie in ihr Spiel vertieft waren, Russell zu Boden, richtete mich im Schatten auf und hockte mich auf ein Holzgesims.
Ich sah zu, wie Fleurs Hände in Windeseile die Karten stapelten, mischten, teilten, jedem Spieler hinwarfen, sie zusammenrechten und wieder mischten. Tor schloss kurz und kampflustig das eine Auge und blinzelte Fleur mit dem anderen an. Dutch schraubte die Lippen um eine nasse Zigarre.
»Muss mal ein Ei legen«, murmelte er und stand auf, um nach hinten zum Abort zu gehen. Die anderen unterbrachen das Spiel, ließen die Karten liegen, und Fleur saß allein im Lampenlicht, das glänzend auf ihren vorgeschobenen Brüsten schimmerte. Ich sah sie unverwandt an, und da schenkte sie mir zum ersten Mal kurze Beachtung. Sie drehte sich um, schaute mir in die Augen und grinste das weiße Wolfsgrinsen, das die Pillagers ihren Opfern zuwerfen, nur dass sie es nicht auf mich abgesehen hatte.
»He, Pauline«, sagte sie. »Wieviel Geld hast du?«
Wir hatten an dem Tag alle unser Geld für die Woche ausgezahlt bekommen. Ich hatte acht Cents in der Tasche.
»Setz auf mich.« Sie streckte ihre langen Finger aus. Ich legte ihr die Münzen in die Hand, und dann verschmolz ich wieder mit dem Nichts, wurde Teil der Wände und Tische, verflocht mich wieder dicht mit Russell. Einige Zeit später begriff ich etwas, was ich damals noch nicht wusste. Die Männer hätten mich ohnehin nicht gesehen, egal was ich tat und wie ich mich bewegte. Denn mein Kleid hing lose an mir, und mein Rücken war schon gebeugt wie der einer alten Frau. Die Arbeit hatte mich stumpf gemacht, meine Augen waren vom Lesen entzündet, mein Gesicht vom Vergessen meiner Familie hart geworden, und das Schrubben der rohen Dielenbretter hatte mir die Fingerknöchel gerötet und anschwellen lassen.
Als die Männer zurückkamen und sich wieder um den Tisch setzten, herrschte bestes Einvernehmen. Sie warfen einander bedeutsame Blicke zu, steckten die Zunge in die Wange und brachen in eigenartigen Augenblicken in Gelächter aus, um Fleur nervös zu machen. Aber die ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie spielten ihr Siebzehnundvier, und die Männer blieben gleich, während Fleur langsam Gewinn machte. Die Pennys, die ich ihr gegeben hatte, zogen Fünfer und Zehner an, bis endlich ein ganzes Häufchen vor ihr lag.
Dann köderte sie sie mit einem Fünfkarten-Draw, ohne Wilde. Sie teilte aus, warf ab, zog, und dann seufzte sie, und ihre Karten zitterten ein klein wenig. Tors Auge blinkte, und Dutch richtete sich auf seinem Stuhl auf.
»Ich halte. Zeig her«, sagte Lilie Veddar.
Fleur zeigte ihre Karten, und sie hatte nichts auf der Hand, überhaupt nichts.
Tors dünnes Lächeln wurde breit, und auch er warf seine Karten hin.
»Also, eins wissen wir schon mal«, sagte er und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, »bluffen kann die Squaw nicht.«
Danach ließ ich mich auf einem Haufen zusammengefegten Sägemehls nieder und schlief ein. Während der Nacht wachte ich einmal auf, aber keiner von ihnen hatte sich von der Stelle gerührt, deshalb konnte auch ich nicht weg. Noch später mussten die Männer wohl noch einmal nach draußen gegangen sein, oder vielleicht war Fritzie gekommen, um das Spiel abzubrechen, denn ich wurde von den Armen einer Frau hochgehoben, gehalten und gestreichelt und so sanft gewiegt, dass ich die Augen geschlossen ließ, während Fleur erst mich, dann Russell in einen Wandschrank auf eine Schicht aus schmutzigen Hauptbüchern, Ölpapier, Schnurknäueln und dicken Aktenordnern schob.
Am nächsten Abend nach der Arbeit ging das Spiel weiter. Russell schlief ein, ich bekam meine acht Cents fünfmal vermehrt zurück, und Fleur behielt den Rest des Dollars, den sie gewonnen hatte, als Einsatz. Dieses Mal spielten sie nicht so lange, aber von jetzt an spielten sie regelmäßig, blieben dabei. Eine geschlagene Woche spielten sie nur Poker oder Pokervarianten, und jedesmal gewann Fleur genau einen Dollar, nicht mehr und nicht weniger, und viel zu konsequent, als dass es hätte Zufall sein können.