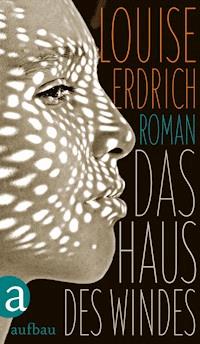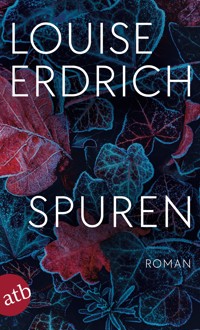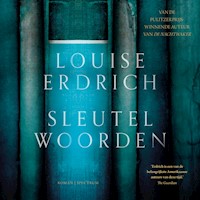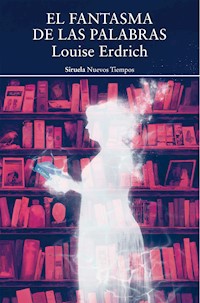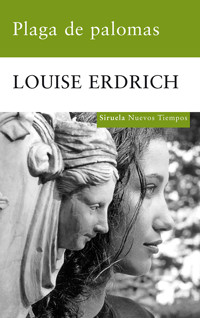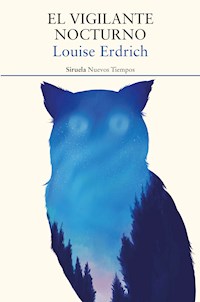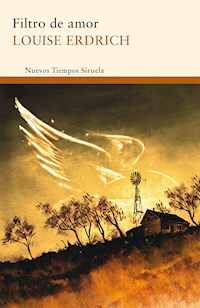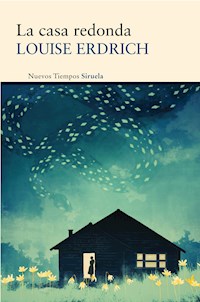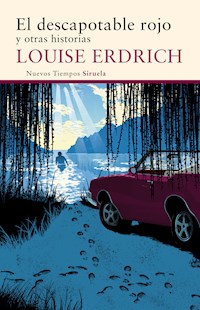9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein beeindruckendes Psychodrama der Pulitzer-Preisträgerin.
Als Irene entdeckt, dass ihr Ehemann Gil ihr Tagebuch liest, legt sie ein neues an, das sie sicher aufbewahrt. Darin hält sie die Wahrheit über ihr Leben und ihre Ehe fest. Ihr altes Tagebuch benutzt sie, um Gil zu manipulieren. Louise Erdrich zeigt so beeindruckend wie schmerzlich, was geschieht, wenn aus Liebe Hass wird.
»Es gibt kaum eine so gefühlvolle und zugleich scharfsinnige Autorin wie Louise Erdrich.« Anne Tyler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ein beeindruckendes Psychodrama der Pulitzer-Preisträgerin.
Als Irene entdeckt, dass ihr Ehemann Gil ihr Tagebuch liest, legt sie ein neues an, das sie sicher aufbewahrt. Darin hält sie die Wahrheit über ihr Leben und ihre Ehe fest. Ihr altes Tagebuch benutzt sie, um Gil zu manipulieren. Louise Erdrich zeigt so beeindruckend wie schmerzlich, was geschieht, wenn aus Liebe Hass wird.
»Es gibt kaum eine so gefühlvolle und zugleich scharfsinnige Autorin wie Louise Erdrich.« Anne Tyler.
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den Pulitzer-Preis, National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag und im Aufbau Taschenbuch sind ebenfalls ihre Romane »Jahr der Wunder«, »Die Wunder von Little No Horse«, »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Spuren«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Schattenfangen«, »Das Haus des Windes«, »Ein Lied für die Geister«, »Der Gott am Ende der Straße«, »Der Nachtwächter« sowie »Von Büchern und Inseln« und lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Schattenfangen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Chris Hirte
Übersicht
Titelinformationen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Teil
Blaues Notizbuch
Rotes Tagebuch
Blaues Notizbuch
Rotes Tagebuch
Blaues Notizbuch
Blaues Tagebuch
Rotes Tagebuch
2. Teil
Rotes Tagebuch
Blaues Notizbuch
Rotes Tagebuch
3. Teil
4. Teil
Rotes Tagebuch
5. Teil
Riel
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
210
211
212
213
215
217
218
219
220
221
222
223
224
225
227
228
229
230
231
233
234
235
236
237
238
239
1. Teil
Blaues Notizbuch
2. November 2007
Ich führe jetzt zwei Tagebücher. Anfangs nur den rot eingebundenen Tageskalender, wie ich ihn seit 1994 benutze, als wir Florian bekamen. Den hast du mir damals geschenkt, damit ich mein erstes Jahr als junge Mutter festhalten konnte. Das war sehr lieb von dir. Seitdem schreibe ich in diese Kalender. Sie liegen mit Bindfaden verschnürt ganz hinten in einer Schublade meines Schreibtischs. Das aktuelle Tagebuch, das dich im Moment interessiert, liegt im Aktenschrank hinter den alten Kontoauszügen und Scheckheften, die wir jedes Jahr vernichten wollen, aber am Ende doch wieder in Ordner stopfen. Nach ziemlich hartnäckiger Suche, wie ich vermute, hast du es gefunden. Du liest es, um herauszufinden, ob ich dich betrüge.
In das andere Tagebuch, das man als mein echtes Tagebuch bezeichnen könnte, schreibe ich jetzt.
Heute habe ich das Haus verlassen und bin nach Minneapolis hineingefahren, zur Wells Fargo Bank im Gebäude der Sons of Norway Hall. Ich stellte den Wagen auf dem Kundenparkplatz ab und ging durch zwei Glastüren, dann eine Wendeltreppe hinab zum Schalter für die Schließfächer. Nachdem ich die Klingel gedrückt hatte, erschien eine Frau namens Janice. Sie half mir bei der Anmietung eines mittelgroßen Schließfachs. Ich zahlte ein Jahr im Voraus, in bar, und schrieb dreimal meinen Namen zur Unterschriftsprüfung auf die Karte. Dann händigte mir Janice den Schlüssel aus. Sie steckte ihn mit einem anderen Schlüssel zusammen und ließ mich in den Tresorraum ein. Nachdem wir meine Box aus dem Wandfach gezogen hatten, führte sie mich in eine der drei Kammern, die nichts enthielten als ein Wandbord und einen Stuhl. Ich schloss die Tür hinter mir und nahm dieses blaue Notizbuch aus der großen schwarzen Ledertasche, die du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Ich musste zehn bis fünfzehn Minuten warten, bevor ich anfangen konnte, so sehr klopfte mein Herz. Vor Angst oder vor Kummer. Vielleicht auch vor Glück.
*
Kaum war Irenes Motorengeräusch vom Lärmpegel der Stadt verschluckt worden, richtete sich Gil auf. Das Handtuch, mit dem er seine Augen bedeckt hatte, rutschte herunter. Wenn seine Augen Erholung brauchten, legte er sich gern ein Stündchen auf die Couch im Atelier. Meist schlief er ein und schreckte nach fünfzehn Minuten hoch. Dann fühlte er sich so frisch, als wäre er in eine kalte Tiefenströmung eingetaucht. Er tastete nach seiner Metallbrille, die er auf der Brust abgelegt hatte. Natürlich war sie wieder auf den Fußboden gefallen. Er hob sie auf, klemmte die Bügel hinter die Ohren, strich sein dichtes Haar nach hinten und band den kurzen grauen Pferdeschwanz wieder zusammen. Dann stellte er sich vor das Porträt seiner Frau und betrachtete es. Mit engstehenden, dunklen, neugierigen Augen, den Zeigefinger unters Kinn gestützt. Seine schmalen Wangen waren mit gelber Farbe beschmiert.
Nachdem er Irenes Abbild eine Weile studiert hatte, wandte er sich mit einem Stirnrunzeln ab und blinzelte, als wäre er kurzsichtig. Dann beugte er sich ruckartig vor und brachte ein paar nervöse Pinselstriche an. Er trat einen Schritt zurück, wickelte den Pinsel in einen Öllappen und schob ihn zusammen mit der Palette in einen Plastikbeutel, den er in einem kleinen Kühlschrank verstaute. Von einem vagen Hungergefühl befallen, ging er in die Küche hinunter. Er nahm die eine Dose Cola, die er sich täglich gestattete, aus dem Kühlschrank, und stieg, an ihr nippend, die restlichen Stufen zum Büro seiner Frau hinab. Er ging geradewegs auf den sandfarbenen Aktenschrank zu und öffnete die Schublade mit der Aufschrift Alte Kontoauszüge.
Rotes Tagebuch
1. November 2007
Wie seltsam so ein Tag, wenn das Haus leer ist und Gil oben endlos an einem Gemälde herumbessert. Ich glaube, er traut sich nicht zu fragen, ob ich wieder für ihn sitze. Flo und Stoney haben sich von ihrem Fieber erholt. Riel wird nie krank, aber sie hat es dieses Jahr schwer in der Schule. Stoney bastelt für irgendein Hortprojekt an einem Brettspiel, das die Lebensgewohnheiten der Schwarzbären zum Thema hat. Typisch Minnesota. Und ich verliere noch den Verstand wegen dieser Geschichte.
*
Er glaubte förmlich zu spüren, wie ihm das Blut aus dem Herzen wich, als er diesen Satz las. Ich verliere noch den Verstand wegen dieser Geschichte. Er presste die Stirn auf die kühle Eichenplatte ihres Schreibtischs, aber dann dachte er, was er immer dachte, wenn er versteckte Hinweise auf den anderen Mann fand: Was zum Teufel habe ich erwartet? Ich bin selbst schuld. Ich hab es nicht anders gewollt. Er gab sich einen Ruck, zwang sich, nach anderen Erklärungen zu suchen. Sie konnte auch ihre liegen gebliebene Dissertation damit meinen. Oder den alten Artikel über Louis Riel. Bevor die Kinder kamen, hatte sie etliche Sachen veröffentlicht, die sehr gelobt wurden. Sie war eine vielversprechende Forscherin gewesen, hatte neue Quellen erschlossen, die Licht auf Louis Riels psychische Probleme warfen. Nach Florians Geburt hatte sie weitergearbeitet. Aber als sie erneut schwanger wurde, gab sie es auf – und benannte ihre Tochter nach dem depressiven Helden der Metis, einem Mann, mit dem seine Familie entfernt verwandt war. Riel war jetzt elf. Und seit Stoney in die Schule ging, versuchte Irene, ihre Dissertation fertigzuschreiben, damit sie sich langsam nach einer Stelle umsehen konnte. Ihr Thema war jetzt George Catlin, der im 19. Jahrhundert das Leben der Indianer auf Bildern festgehalten hatte.
Vielleicht steckte sie in einer wissenschaftlichen Krise? Und verlor den Verstand über George Catlins ungelenken, betulichen Darstellungen – von Menschen, die wenig später sämtlich krank wurden und starben. Gil konnte den Anblick von Catlins Bildern nicht ertragen. Die tragische Ironie, die in ihnen steckte, empfand er als Kränkung. Und für Irene war sie ein billiger Vorwand.
Ich verliere noch den Verstand. Na gut, das bewies, dass sie noch so etwas wie ein Gewissen hatte. Irgendwie geschah es ihr recht, wenn sie litt – heimlich, innerlich, wenn nicht gar öffentlich – für das, was sie ihm und den Kindern antat. Rücksichtslos, gefühllos, lieblos! Er riss den Kopf hoch und schlug mit beiden Händen auf den Schreibtisch. Ein paar Spritzer kamen aus der Coladose, aber sie kippte nicht um. Er trank sie aus, bevor er das Tagebuch wieder so zurücklegte, wie er es vorgefunden hatte. Wenn er sie jetzt auf dem Handy anrief, würde sie wahrscheinlich nicht abnehmen. Nachmittags wurde sie immer unruhig und machte Besorgungen, bevor sie die Kinder abholte. Und kam immer mit deutlich sichtbaren Belegen für ihr Tun zurück – einer Tüte Lebensmittel, einer Plastikwanne, Bankunterlagen. Oder sie fuhr zum Training. Sie war kräftig und hatte ein entspanntes Körpergefühl. Sie glaubte, allem gewachsen zu sein, und konnte schwimmen wie ein Fisch. Daran war natürlich nichts auszusetzen. Viele sportliche Menschen waren emotionale Wracks. Er kniff die Augen zusammen und schüttelte den Kopf.
Irene America war mehr als zehn Jahre jünger als er und hatte ihm in all ihren Inkarnationen Modell gestanden – jungfräulich mager, erst mädchenhaft, dann fraulich, schwanger, nackt, züchtig posierend oder ungehemmt pornographisch. Und jedes Porträt hatte er nach ihr benannt. America 1, America 2, America 3. America 4 war gerade für eine sechsstellige Summe weggegangen. Hätte er nur ein paar von den frühesten und besten Porträts behalten. Die brachten jetzt bedeutend mehr. Die Serie war auf dem besten Wege, berühmt zu werden, oder sie war es schon. Vor Irene hatte er Landschaften gemalt, Reservatsszenen, die mit Hopper verglichen wurden. Manche nannten ihn den indianischen Edward Hopper – sehr irritierend. Eine Kunstschule hatte er nicht besucht, aber er hatte viel gelesen, gemalt und gemalt und genau hingeschaut. Dann war er für zwei Jahre nach New York gegangen, hatte für Galerien gearbeitet, an Installationen anderer Künstler mitgewirkt. Abends ging er nach Hause und malte seine eigenen Bilder. Eine Weile hatte er an einem kleinen College unterrichtet. Aber die Studenten kamen ihm eingebildet und anmaßend vor, und er verlor die Geduld mit ihnen. Er kratzte ein wenig Geld zusammen, machte das Malen zu seinem Beruf, und die Bilder verkauften sich. Er ging seinen Weg weiter, wurde erfolgreich, fast zur Berühmtheit. Ein Künstler, der von seiner Arbeit leben, eine Familie ernähren konnte – keine kleine Sache. Aber neuerdings litt sein Selbstvertrauen, die Dinge entglitten ihm. Seine Bilder verschwiegen ihm etwas, weil Irene ihm etwas verschwieg. Er sah es an ihrem undurchdringlichen Blick, spürte es an der Gleichgültigkeit ihres Fleisches, an der Ungeduld und Passivität ihres Körpers, wenn sie die Maske fallen ließ. Sie liebte ihn nicht mehr. Ihr Blick war leer und abwesend.
*
Gil saß noch an Irenes Schreibtisch, als die Kinder nach Hause kamen. Sie polterten die Treppe hinauf, warfen Mäntel und Stiefel ab. Er hörte ihre Rucksäcke auf den Boden plumpsen, direkt über seinem Kopf, dann entfernten sich ihre Schritte in Richtung Küche. Sie öffneten den Kühlschrank und machten sich über den Inhalt her. Irene sorgte dafür, dass der Kühlschrank und die Schublade mit den Snacks immer gut mit Sachen gefüllt waren, die man sofort essen konnte, während Gil Bohnen kaufte, Reis, Gefrierfleisch, Pasta in Riesenmengen, und seine Vorräte in den Schränken und in der Tiefkühltruhe stapelte. Jetzt hörte er die Kinder in der Küche rumoren, wie Eichhörnchen in den knisternden Kekspackungen und Chipstüten wühlen. Er wollte schon hochgehen und dazwischenfahren, aber bevor er sich dazu entschlossen hatte, waren sie zu ihren Zimmern hinaufgetrappelt, und es wurde wieder still.
*
Schon seit Jahren, so überlegte er, betrauerte er einen Tod, ohne zu wissen, wer eigentlich gestorben war und weshalb. Zuerst hatte er diese Trauer gespürt, wenn er mit Irene schlief, sich aber bald daran gewöhnt. Sie verschaffte ihm Lust, doch sie hatten aufgehört, in ihren Gesichtern zu forschen, und die Ausdrücke, mit denen sie sich erregten, schienen nur noch Routine. Dann, im Lauf der Zeit, wurde die Liebe zu einer dunkleren, schmerzhafteren Angelegenheit.
Es war, als wäre Irene nicht wirklich bei ihm, sondern irgendwie unter Wasser und beobachtete ihn von dort. Er stellte sich vor, dass sie irgendein inneres Drama durchlebte, dessen Inhalt er erst erfuhr, wenn es zu Ende war. Und er ahnte schon, dass ihm der Ausgang dieses Dramas nicht gefallen würde. Also tat er, was er konnte. Doch im Bett konnte er ihre Beteiligung nur mit Gewalt erzwingen, und er fand die Wut, in die sie sich dabei hineinsteigerten – mit Kratzen, Beißen und sogar Schlägen –, erregend und peinlich zugleich. Am Tage hatte er nicht die Kraft, sie mit kleinen Überraschungen zu umgarnen, also benutzte er die Kinder, um an sie heranzukommen. Er nahm irgendein kleines Problem und bauschte es auf. Aber danach schlüpfte sie ihm sofort wieder durch die Finger.
Früher einmal war sie wild darauf gewesen, ihm Modell zu stehen. Da hatte es eine sanfte elektrische Spannung zwischen ihnen gegeben, wenn er malte, ein ständig wechselndes Kraftfeld. Seine ganze Aufmerksamkeit hatte er auf ihre Jugend gerichtet. Später verfolgte er eifrig die Spuren des Lebens auf ihrer nackten Haut. Den Abdruck seines Mundes auf ihrem Mund. Das Fortschreiten der Zeit, des Alterns. Eine Schneelast, die vom Ast rutschte und als weiße Wolke herunterkrachte. Irenes weiches, erschöpftes Fleisch nach der Entbindung, ihre fieberheißen Brüste, als die Milch einschoss, gewaltig angeschwollen und so empfindlich, dass die Milch schon bei der kleinsten Berührung austrat. Sie hatte in seinem Atelier gestillt, nackt, mit Stillkissen für das Baby, und er malte an zwei Staffeleien gleichzeitig, um jedesmal zu wechseln, wenn sie die Brust wechselte. Das war das Glück. Als aus den Säuglingen Krabbelkinder wurden, malte er, wie sich ihr Körper zurückverwandelte und verfestigte. Für eine Weile gab er sie ganz auf und wandte sich anderen Themen zu. Aber seine Porträts hatten eine mythische Dimension erreicht – sie weckten unwillkürlich den Gedanken an Ausbeutung, den indigenen Körper, die zerstörerische Last der Geschichte. Und mehr als das – er hatte ein technisches Können erreicht, das ihm einen fast grenzenlosen Ausdruck ermöglichte. Obwohl der abstrakte Expressionismus den Zeitgeschmack regierte, hatte er der figürlichen Malerei trotzig die Treue gehalten, und jetzt wirkte seine Beherrschung der altmeisterlichen Techniken schon fast wieder radikal.
Irenes Distanz schürte in ihm ein trostloses Verlangen. Ihre Geheimnisse versetzten ihn in eine geradezu manische Verzweiflung, in der ihm auf einmal die stärksten Bilder seiner Laufbahn gelangen. Worin auch immer ihre Sünde bestehen mochte, er glaubte, sie mit reinem Blick zu betrachten. Die Leute nannten ihn einen charmanten Heuchler, doch mit seiner Kunst wollte er zur Wahrheit vorstoßen. Ihr Körper kann doch nichts dafür, sagte er sich, während er sich selbst ins Bild malte, in einen Spiegel wie Velásquez. Wie Degas, der sich an eine Kurtisane im Bade heranschleicht. Hätte er nur eine einzige Katzenwimper als Pinsel gehabt und eine einzige Leinwand für sein ganzes Leben – es wäre ein Bild von Irene geworden.
Sie hatte ihn innig geliebt. Hatte zu ihm aufgeschaut und ihm vertraut. Ihn für einzigartig gehalten. Eigentlich sagte sie das noch immer. Aber auf eine Art, die er herablassend fand.
Er stand auf und schob den Stuhl zurück an seinen Platz, reckte sich, nahm die Coladose und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. Heute war er mit Kochen dran. Der Mann, mit dem sie ihn betrog, kochte nicht für sie, da war er sicher. Dabei wusste er nicht einmal, wie und wo sie mit dem Mann, den er verdächtigte und der einmal sein Freund gewesen war, zusammenkommen sollte. Germaine wohnte gute tausendsechshundertzweiundfünfzig Meilen entfernt. Auf einem Berg in Seattle, mit seiner Frau Lissa, einer empfindsamen Menschenrechtlerin, die in Ausübung ihrer wichtigen Tätigkeit ständig in der Welt umherreiste – natürlich ohne ihn. Germaine Okestaf-Becker nannte er sich – mit Bindestrich und so politisch korrekt, dass es zum Kotzen war. Zudem steckte in ihm mehr Indianer als in Gil, drei Viertel im Gegensatz zu einem Viertel, also schlug ihn Germaine um eine halbe Länge, was ein großes Plus war, weil Mischlingsfrauen generell schärfer auf dunklere Männer waren und Irene wahrscheinlich auch, obwohl sie sich hütete, das zuzugeben. Aber dass er ihr sexuell in jeder Hinsicht gewachsen war, daran zweifelte er keinen Moment – sei’s drum … sie hatte sich immerhin dafür entschieden, ihre Kinder mit ihm, Gil, zu bekommen. Indianische Frauen, egal mit welchem Blutsanteil, waren äußerst wählerisch, wenn es um den Vater ihrer Kinder ging, nicht nur wegen der Gene und so weiter, sondern vor allem wegen der Stammeszugehörigkeit – daran hingen die von der Regierung garantierten Vorrechte bis hin zum erleichterten Zugang zum College. Kinderkriegen, das war schon eine wichtige Sache.
Irene musste ihn sehr geliebt haben, dass sie ausgerechnet von ihm Kinder wollte, da doch seine Stammeswurzeln – ein Mischmasch aus Klamath und Cree und landlosen Montana-Chippewa – nicht anerkannt wurden. Folglich bekam er keine Casino-Gewinne ausgezahlt und musste von der Kunst leben. Sie hatte ihn sicher nur geheiratet, weil sie in ihm den Künstler sah, und dann allmählich begriffen, dass das Leben mit einem Künstler kein Zuckerlecken war. Seine Begabung, das war nicht er, die machte ihn eher zu einem langweiligen Menschen, und er trank abends zu viel, weil ihn die Anstrengung des Tages zermürbte. Andererseits – und in zunehmendem Maße – trank auch sie und zermürbte ihn.
Er fühlte sich ausgelaugt, alleingelassen. Diese Schaltstunde zwischen ihrem und seinem Tag machte ihn einsam. Er gönnte sich ein Glas Wein, schaute sich in der Küche um, sammelte sich. Dann ging er an den Kühlschrank, nahm Eier, Butter, Milch, alten Cheddar heraus. Vor Wochen hatte Irene etwas von einem Käsesoufflé gesagt. Er würde sie überraschen, sie mit dem Käsesoufflé beglücken. Er schlug sein Lieblingskochbuch auf, beschwerte die Seite mit einem speziell für Köche erfundenen transparenten Lesezeichen und befolgte penibel die Anweisungen. Kochen machte ihm Spaß, genau wie Wäschewaschen, denn eine Arbeit, die genau nach Vorschrift ausgeführt wurde, brachte schnelle und verlässliche Resultate.
*
Gil nahm den gedeckten Tisch in Augenschein. Sehr zufriedenstellend. Grüne Teller, gelbe Servietten. Das Käsesoufflé. Ein knuspriges Baguette. Frischer Salat aus jungem Spinat, mit gerösteten Walnüssen und Birnenschnitzen. Eine Flasche kaltgestellter Wein.
Also, was habt ihr heute so getrieben?, fragte Gil. Stoney, du zuerst.
Stoney war ein schüchterner Sechsjähriger mit Zottelhaaren, die sich hinter seinen Ohren ringelten. Seine Augen waren heller als seine Haut, was ihn später mal sehr attraktiv machen würde. Jetzt war er einfach nur verwirrt, verschämt, und er hatte eine Zahnlücke. Gil sah seinen Sohn schon als Künstler. Er erkannte sich wieder in Stoneys Liebe zum Zeichnen und Malen. Zugleich beneidete er ihn um seine Vorteile und sogar um die Malutensilien, die ihm Irene kaufte. Manchmal sicherte sich Gil ein dickes, kräftiges Blatt, das Stoney nach nur ein paar Bleistiftstrichen weggeworfen hatte. Er nahm solche Blätter mit ins Atelier, um sie für sich selbst zu benutzen, und dachte daran, wie er früher gezeichnet hatte – mit einem abgekauten Kugelschreiber, einem Bleistiftstummel oder einem Wachsstift, im Supermarkt geklaut. Seine ersten Werke hatte er auf Pappen gemalt, auf die Innenseiten der Makkaroni- und Cornflakes-Schachteln und auf Packpapier, das er aus dem Abfall eines Ladens fischte.
Wie bitte? Was hast du gemacht? fragte Gil nach.
Ich hab gemalt.
Und was hast du gemalt?
Na, Bühnenbilder. Für ein Stück.
Einen Satz fängt man nicht mit na an. Kannst du das bitte anders formulieren?
Stoney blickte hilfesuchend in die Runde. Irene legte die Hand auf Gils Arm und tätschelte ihm den Handrücken, bis er sie ansah.
Bühnenbilder für ein Stück.
Geht es auch in einem vollständigen Satz?
Stoney hat Bühnenbilder für ein Stück gemalt, Gil. Für einen Sechsjährigen ist das eine tolle Leistung. Irene nahm sich Salat und fügte etwas liebenswürdiger hinzu: Dein Soufflé ist spitze! Kochen kannst du wirklich.
Wer hätte gedacht, dass ein Künstler dieses Formats so gekonnt mit einem einfachen Ei umgehen kann!, bemerkte Florian. Er erinnerte an einen Faun mit seinem feinen, aber boshaften Lächeln. Von den Kindern sah er Gil am ähnlichsten.
Gil wandte sich wieder an Stoney. Und wie läuft dein Projekt mit den Schwarzbären?
Keine Schwarzbären, Daddy.
Ach, nein? Was denn sonst?
Wölfe.
Irenes Gabel verharrte über einem halbmondförmigen Stück Birne. Wölfe. Keine Schwarzbären. In ihrem Tagebuch hatte sie denselben Fehler gemacht. Sie blickte starr auf ihren Teller, mit hastigem Atem, bis Gil stutzig wurde.
Ist was?
Mir ist nicht gut, sagte Irene.
Die Kinder wechselten erschrockene Blicke. Riel, die liederliche, schlampige Riel, schoss von ihrem Stuhl hoch und strich ihrer Mutter über den Ärmel.
Mommy …
Es ist nichts weiter, wirklich. Nur ein bisschen Kopfschmerzen, ganz plötzlich. Ich muss mal raus …
Die Kinder reckten ihr die Hälse nach, als sie ging.
Hört auf zu gaffen, sagte Gil. Er goss sich den restlichen Wein ins Glas. Und trinkt nicht alle Milch aus, bevor ihr mit Essen fertig seid. Florian, was macht dein Salat?
Ja, Dad.
Nur eine Scheibe von dem Brot, Riel, und nicht so viel Butter.
Ist Mom okay?
In vieler Hinsicht ja, in mancher nicht. Jetzt hör auf, Fragen zu stellen.
Blaues Notizbuch
2. November 2007
Du warst leichtsinnig geworden, und für eine Weile hatte ich so ein merkwürdiges Gefühl. Als könntest du meine Gedanken lesen. Du hast zwar darauf geachtet, mein Tagebuch genau an den alten Platz zu legen und nichts in meinem Zimmer durcheinanderzubringen. Aber es war mehr als das. Ich konnte es nicht glauben. Es war ein Versagen meiner Vorstellungskraft. Oder zumindest dachte ich das am Anfang. Aber hier in der Bank, in meiner kleinen Schreibkammer, wird mir klar, dass ich meinem roten Tagebuch nicht allzu viele Wahrheiten anvertraut habe. Und ich habe es versteckt. Ich muss also gewusst haben, dass du nicht widerstehen konntest, dass du dem Geheimnis nachgehen musstest.
Du hast mich fast fünfzehn Jahre lang gemalt. In dieser Zeit hatte ich öfter Geheimnisse. Ich ließ sie auf meiner Haut landen wie Libellen. Einmal hast du sogar einen fein ziselierten, zarten, durchsichtig geäderten Libellenflügel auf meinen Innenschenkel gemalt, und ich dachte – er weiß Bescheid!
Unsere Kinder wurden in deine Hände geboren. Was gibt es da noch für dich zu wissen?
Man hat mir beigebracht, dass das Leben sich aus seinen prägenden Startbedingungen entwickelt und später nur noch schwer beeinflussen lässt. Wenn es mit der Liebe genauso ist, dann war sie von Anfang an von bösen Vorzeichen überschattet. In der Nacht vor unserer Hochzeit träumte ich von wilden Hunden, die mich anfielen und in Stücke rissen. Deinen Vater hast du kaum gekannt, und deine Mutter hatte ein seltsames Hüftleiden, so dass sie sich dir auf eine schiefe Art entgegenkrümmte. Und du bist dreizehn Jahre älter als ich – eine Unglückszahl. Aber jetzt kommt das Entscheidende: Du willst mich besitzen. Und mein Fehler: Ich habe dich geliebt und im Glauben gelassen, es könnte dir gelingen.
Nachdem ich dein nettes Abendessen verlassen hatte, ging ich in mein Arbeitszimmer und setzte mich an den Schreibtisch. Schwarzbären. Wölfe. Und das Soufflé. Alles klar. Ich strich über das kühle Eichenfurnier meines Schreibtischs und ertastete den Ring, wo deine Coladose stand – eine klebrige Stelle, die du nicht weggewischt hast.
*
Irene ging hinauf in die Küche und wusch das Geschirr ab, das die Kinder ordentlich abgestellt hatten. Sie waren jetzt in ihren Zimmern und machten Schularbeiten. Nachher würde sie alle der Reihe nach herabholen und die Aufgaben und die Klavierübungen mit ihnen durchgehen. Nebenan, im Fernsehzimmer, sah Gil CNN und telefonierte dabei. Den Ton hatte er weggedreht. Unaufhaltsam rückte der Tag auf sein Ende vor. Die Hunde schliefen im Korridor, am Fuß der Treppe. Ganz gleich, wie sich die Familie übers Haus verteilte: diese zwei Burschen, sechsjährige Schäferhundmischlinge, hielten ihren Posten am zentralen Ein- und Ausgangspunkt des Hauses. Gil nannte sie Pförtnerhunde. Und es stimmte, sie waren neugierig und aufmerksam. Weder aufdringlich noch übermäßig verspielt, einfach nur wachsam und umsichtig. Irene fand, dass sie Würde ausstrahlten, etwas Gravitätisches hatten – wie Diplomaten. Immer wenn Gil aus dem Häuschen geriet, stand einer von ihnen auf und versuchte, ihn abzulenken. Einmal, als er herumbrüllte wegen der Mahngebühr für ein verschollenes Video, kam einer der Hunde gelaufen und hob das Bein über Gils Schuh. Während Gil Florian anbrüllte, plätscherte die Hundepisse auf seinen Schuh, und Irene registrierte es mit Stolz.
*
Als die Kinder im Bett waren, schlüpfte Irene ins Badezimmer, verriegelte die Tür, ließ die Wanne volllaufen und tauchte ins heiße Wasser ein. Die Wanne war groß, tief und altmodisch, Irene konnte die Hüften heben und die Beine bis zum glucksenden Überlauf strecken. Vor zweihundert Jahren als Indianerin, dachte sie, hätte ich unbedingt zu einem Stamm mit einer heißen Quelle gehört – und diesen Luxus erbittert gegen die Bleichgesichter verteidigt. Ein Leben ohne heißes Bad? Kaum vorstellbar. Wahrscheinlich war das ihre Schwäche, diese Genusssucht, eine Art Makel. Aber es ging ja nicht nur um das wohlige Brennen des heißen Wassers, auch um das Gefühl der Nacktheit. Dass sie mit ihrem Körper allein sein konnte. Dass keine Anforderungen an ihre Nacktheit gestellt wurden, nicht von ihrem Mann, dessen Reaktionen darauf viel zu komplex waren, nicht von ihren Kindern, die, als sie noch klein waren, ihre Nacktheit als fröhliches Ereignis empfunden hatten, nicht einmal vom Spiegel, der verlangte, dass sie ihre Nacktheit auf Frauenart wahrnahm – mit den Augen der anderen.
Wenn sie mit Gil ausging, umgab sie sich mit einer Aura der Nachlässigkeit. Sie wusste, dass sie faszinierte – gerade deshalb. Sie trug ihr Haar in wilden Strähnen und schminkte sich aufwendig in Farbtönen, die nicht unbedingt modern waren. Blassgrüner Lidschatten, hellvioletter Lippenstift, Rouge auf den Wangen. Manchmal trug sie eine dicke weiße Pudermaske wie eine Geisha. Sie war langgliedrig, groß, dunkel und zurückhaltend. Ein Kunsthändler hatte sie als Pantherfrau bezeichnet, und Gil hatte sich wochenlang darüber amüsiert, aber Irene gefiel es, dass man in ihrem Schweigen eher einen erotischen Reiz als eine Verlegenheit sah. Alle ihre Macht beruhte auf dieser gespielten Nonchalance.
Sie musste Gils Kontrollblick abschütteln. Sich unbeobachtet fühlen können. Dann wäre sie auch das lästige Gefühl der Selbstbeobachtung los. Das Baden war deshalb etwas Spirituelles, das nicht nur reinigte, auch regenerierte. Irene konnte ihre Selbstwahrnehmung in rein körperliche Empfindungen überführen – schwereloses Schweben, wohliges Erschlaffen ihrer Hände, leichtes Schwitzen auf der Stirn, ihr Haar enganliegend wie eine Kappe, das sanfte Brennen hinter ihren geschlossenen Lidern, das panikartige Pochen in ihrem Hals.
*
Der Satz ging ihm immer noch durch den Kopf – Ich verliere noch den Verstand wegen dieser Geschichte –, als er an die Badezimmertür klopfte.
Darf ich reinkommen?
Ich hab abgeschlossen. Ich bin in der Wanne.
Was machst du da?
Ich bade.
Wie lange denn noch?
Ich lese.
Was liest du denn?
Irene schwappte Wasser über ihre Brüste und blickte genervt auf die Tür.
Ein Tagebuch, sagte sie schließlich.
Gil verstummte, aber sie wusste, dass er wartete.
Oh. Wessen Tagebuch?
Irene überlegte kurz.
Das Tagebuch von Christoph Kolumbus. Von seiner ersten Reise.
Ach wirklich? Gil lehnte sich an den Türpfosten. Sie konnten sich genau hören.
Er beschreibt seine erste Begegnung mit einem menschlichen Wesen der Neuen Welt – ein junges Mädchen, das auf sein Schiff zuschwimmt. Erinnerst du dich? Ein historischer Moment. Gil, bist du noch da?
Ja.
Hast du dich mal gefragt, was aus dem Mädchen wurde? Hat er sie zur Sklavin gemacht, oder ist sie an einer Krankheit aus der Alten Welt gestorben? Keiner von ihrem Stamm hat die nachfolgenden zehn Jahre überlebt. Wie ist sie umgekommen? Wir Frauen schwimmen immer voller Vertrauen auf die Männer zu! Neugierig wie die Fischotter. Dabei müssten wir auf der Hut sein wie die Schlangen.
Irene musste lachen. Ein seltsames helles Lachen, das hohl von den Kachelwänden widerhallte. Gil wandte sich wütend von der Tür weg.
Wie kannst du so was sagen! Er ging weg, zu leise für ihre Ohren. Du bist die Schlange! Du hast mein Herz vergiftet!
*
Kaum hatte Gil die Worte ausgesprochen, Schlange, Gift, kam ihm eine Idee. Er ging ins Atelier hinauf und stellte sich vor die Holztafel, die er bemalen wollte. Gil arbeitete immer an mehreren Bildern gleichzeitig, und er malte gern auf Holz, obwohl es schwierig war, geeignetes Material zu finden. Spanplatten verschmähte er. Er stöberte in Holzlagern, Deponien, bei Gebrauchtwarenhändlern herum. Manchmal konnte er eine massive Eichentür aus einem Abrisshaus ergattern. Amerikanische Weißeiche. Die Mona Lisa war auf Weißpappel gemalt worden. Türen benutzte er am liebsten. Er konnte sie in zwei Hälften sägen, aufs richtige Maß bringen, abschmirgeln, aber wenn er auf eine Holztafel malte, die früher eine Tür gewesen war, ging etwas von der ursprünglichen Funktion auf das Bild über. Es öffnete und schloss sich wie einst die Tür. Von der Aura ihres Türseins, von der Bestimmung der Tür, neue Räume zu eröffnen, blieb etwas im Bild erhalten.
Gil hatte den Untergrund schon vorbereitet, mit Hasenleim gestrichen, dann mit Gesso, dann mit Sandpapier bearbeitet und die ganze Prozedur Schicht um Schicht wiederholt, bis sich die Grundierung samtig anfühlte. Jetzt stand er vor der leeren Fläche. Er setzte sich eine Stunde hin und starrte sie an, ging weg, kam wieder, brachte ein paar Markierungen an, entfernte sich wieder und kehrte zurück. Er visualisierte und verwarf Bildideen. Diese Phase durchlief er hunderte, manchmal tausende Male, bevor er sich auf eine Szene festlegte oder Irene Modell sitzen ließ oder hinausging und noch mehr Skizzen machte, zurückkam und sie ausprobierte, sich sein Bild zusammensuchte, bis es im Kopf die endgültige Form annahm. Die Schlange, das Gift, der Hass. Er dachte diese Dinge. Gils Hass war ein wertvoller Treibstoff, er schärfte seinen Blick und brachte Klarheit. Wo lag die Wahrheit? Die Fläche war eine offene Frage. Er trat näher heran und zeichnete ein paar Umrisse. Sein Herz klopfte. Er setzte sich wieder. Sein Marderblick, flink und wendig, war fest auf das Bild gerichtet.
Plötzlich roch er seine Mutter. Sie war natürlich nicht wirklich da, nur der Geruch, den sie mitbrachte, wenn sie von ihrer Arbeit im Kirchenkeller kam. In diesem Kellerladen der Kirche sortierte sie die Gebrauchtwaren, die als Spenden bei der Indianermission abgeliefert wurden – alte Vinylplatten, schweißfleckige BH