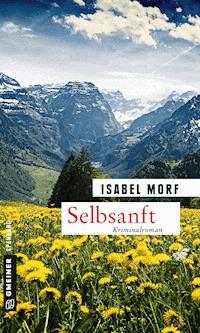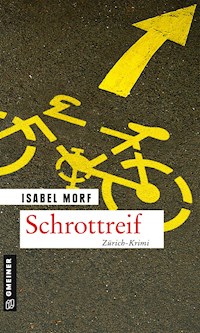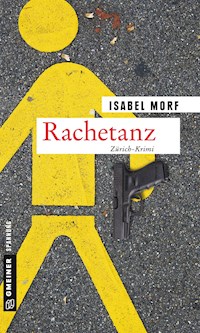Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Streiff
- Sprache: Deutsch
Zürich versinkt im Schnee. Die Bewohner werden zu Gefangenen ihrer Wohnungen, auch an der Bristenstrasse, wo die fünfundsiebzigjährige, unbeliebte Renate Ingold erstochen aufgefunden wird. Wer war’s? Die alte Ursula Meyer, mit deren Mann die Tote einst eine Affäre hatte? Lajos Varga, von dem Ingold wusste, dass er im Spielcasino regelmäßig Geld verspielt? Aline Behrend, die unter Depressionen und Panikzuständen leidet und Angst hatte vor Frau Ingold? Beat Streiff ermittelt in alle Richtungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabel Morf
Jahrhundertschnee
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © aremac / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4502-6
Der erste Tag: Die tote Frau
Hätte er es sehen müssen? Es war dunkel draußen, die Glasscheibe der Haustür widerspiegelte das Treppenhaus, seine eigene Gestalt, die hinunterkam. Zudem war er etwas verschlafen und mit seinen Gedanken doch schon halb bei der Arbeit. Während er die Tür aufmachte, warf er einen flüchtigen Blick auf das Anschlagbrett rechts davon, auf dem die Hausverwaltung eine Überholung der Waschmaschine ankündigte – und dann fuhr er zusammen, weil kalter Schneestaub ihm ins Gesicht fiel. Dann prallte sein Kopf gegen die Wand vor ihm. Ein erschrockener Laut entfuhr ihm. Er trat einen halben Schritt zurück und starrte ungläubig. Dann berührte er die Wand. Schnee. Dicht vor der Haustür erhob sich eine Mauer aus Schnee. Bis zuoberst. Er trat mit dem Fuß nach ihr, boxte hinein. Das war keine dünne Schicht, sondern dick und solide. Er eilte eine Etage höher, öffnete das Treppenhausfenster und spähte durch die Gitterstäbe. Der Schnee reichte bis hier. Es mussten fast drei Meter sein. Die Bäume am Straßenrand boten einen grotesken Anblick. Aus sehr kurzen Stämmen erhoben sich die kahlen Kronen. Wo normalerweise die Straße und das Trottoir waren, war nichts als eine Schneefläche, die ganze Straße hinauf und hinunter, so weit er sehen konnte. Keine Fußabdrücke. Keine Menschen. Kein Geräusch. Lajos Varga schloss das Fenster und ging langsam hinauf. Er wischte sich den Schnee von der Stirn.
Er hörte das Öffnen und Schließen einer Tür, eilige Schritte. Seine Nachbarin Janine Bianchera kam ihm entgegen. Sie arbeitete als Kellnerin in einem Café und hatte heute offenbar Frühschicht. Er schüttelte langsam den Kopf. »Sie können nicht zur Arbeit gehen, Frau Bianchera«, sagte er.
Sie hörte nur halb zu. »Guten Morgen, Herr Varga, ich bin in Eile.« Schon war sie an ihm vorbei. Er folgte ihr. »Sie können nicht hinaus«, sagte er eindringlich. Oder spinne ich?, fuhr es ihm durch den Kopf. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, so viel Schnee, in Zürich. Aber da hatte sie es schon selbst gemerkt. Sie schrie auf. »Was ist denn das?«
»Schnee«, sagte er hilflos. »Schnee bis übers Erdgeschoss hinaus.«
Sie starrte ihn an. »Wie ist das denn möglich? Gestern Nachmittag war es ein Meter. Das ist ja schon viel, aber das hätte man doch räumen können. Salzen, Kies streuen, irgendetwas. Ich sollte doch das Café aufmachen. Rubina muss in einer Stunde zur Schule.«
»Wahrscheinlich kommen heute Morgen keine Gäste ins Café«, sagte Lajos, »und die Schulen sind wohl auch geschlossen. Das Beste ist, wir gehen zurück und hören Radio.«
»Aber das geht doch nicht«, stotterte die Frau. »Irgendwer muss kommen. Die Armee, die Polizei, das Grenzwachtkorps.«
»Oder die Amerikaner«, kommentierte Lajos Varga sarkastisch und ging hinauf.
Luca Oertle tappte in die Küche. Er war schlecht gelaunt wie immer am Dienstagmorgen, wenn er schon vor acht an der Uni sein musste. Er schaltete die Kaffeemaschine ein, holte aus dem Kühlschrank ein Joghurt und machte das Radio an. Ein bisschen gute Musik würde ihn wecken. Schon war das Stück zu Ende. Nachrichten. »Ausnahmezustand in Zürich und in Teilen des Mittellandes«, hörte er, »außergewöhnlich heftiger Schneefall, zwei bis drei Meter Schnee«. Am stärksten hatte es den Kanton Zürich getroffen, aber auch Teile des Aargaus und von Zug. Was? Luca riss das Fenster auf. Wahnsinn. Auch ihm bot sich die schweigende kalte Schneelandschaft dar wie eine halbe Stunde zuvor Lajos Varga. »… Jahrhundertschnee. Das öffentliche Leben vollständig zum Erliegen gekommen«, hörte er die Radiostimme hinter sich. »Verkehr, Schulen, Geschäfte, Restaurants, Firmen – alles geschlossen.« Die Uni wohl auch, ging es Luca durch den Kopf. »Schneeräumung bis auf weiteres nicht möglich. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen.«
Puh. Luca setzte sich an den Küchentisch und löffelte mechanisch sein Joghurt. Er war ein gut aussehender Mann von Ende zwanzig. Sein Gesicht war leicht gebräunt, dunkle Locken fielen ihm ins Gesicht. Er wusste, dass er attraktiv war, aber im Moment dachte er nicht an sich. Er merkte nicht einmal, dass er ein Aprikosen- statt eines Haselnussjoghurts erwischt hatte. Nochmals ins Bett? Nein, jetzt war er wach. Zeitung holen? Quatsch, Zeitung gab es wohl heute nicht. Er hörte leise Schritte, die Tür ging auf, Aline tappte herein, in ihren graugrünen Morgenmantel gehüllt. Scheußliches Ding, dachte Luca. Aber leider passte er zu Aline. Sie war blass, ihre Haare ungekämmt, neben der Nase hatte sie einen roten Pickel. Eigentlich musste sie einem leidtun, aber häufig fühlte sich Luca nur genervt von ihr.
Er stellte sich vor sie hin. »Jetzt ist es passiert«, rief er dramatisch, »jetzt bist du die Gefangene der Bristen-straße. Für dich gibt es kein Entkommen mehr!«
Sie fuhr zusammen, der Schrecken auf ihrem Gesicht war echt. »Was ist los?«, rief sie.
Er fühlte sich bereits gelangweilt. »Schau aus dem Fenster«, gab er kurz zurück, holte vom Regal eine Tasse und nahm sich einen Kaffee.
Aline schloss das Fenster. »Und wir sind wirklich eingeschlossen?«, fragte sie. »Wir können nicht hinaus?«
»Wirklich und wahrhaftig eingeschlossen«, bestätigte Luca boshaft. »Auf Gedeih und Verderb dem Winter ausgeliefert.«
Aline lief hinaus. »Carsten«, hörte er sie rufen.
Er verdrehte die Augen. Aline war Carstens jüngere Schwester, die vor Kurzem in München ihr Abitur gemacht hatte. Seit zehn Tagen schon war sie bei ihnen auf Besuch, schlief im Wohnzimmer, hockte mager und deprimiert und krankhaft schüchtern in der Küche, versuchte gleichsam, gar nicht da zu sein und nahm gerade dadurch sehr viel Raum ein. Seraina war nett zu ihr. Sie übte wohl schon für die Zukunft, in der sie in irgendeinem Bündner Bergdorf eine Hausarztpraxis führen würde und verknorzte Dorforiginale zu verarzten hätte, dachte Luca. Er hatte jedenfalls keine Lust, Sozialarbeiter zu spielen. Im Lokalradio lief eine Sonderberichterstattung zum Wetter. »Ausnahmezustand kann mehrere Tage andauern«, hörte Luca. Die Schneeräumungsdienste seien heillos überfordert, weil weite Teile des Mittellandes vollkommen zugeschneit seien. Ein Armee-Einsatz werde erwogen. Nur, dachte Luca spöttisch, dass die Soldaten wohl auch nicht aus ihren Wohnungen ausrücken konnten. Eine CVP-Politikerin wies darauf hin, dass der Mensch eben nicht alles im Griff hatte, dass man sich jetzt bewähren müsse. Offenbar war das ein Telefoninterview mit mehreren Zürcher Politikern. Jetzt meldete sich ein Grüner, der den Atomausstieg und die Klimaveränderung ins Feld führte. Unterbrochen wurde er von einem SVP-Mann, der höhnisch sagte, was Klimaveränderung? Dann müsste es ja warm sein. Es habe immer schon Wetterextreme gegeben. Siebzehnhundertsowieso habe es im Juli geschneit. Der Moderator wandte sich an eine FDP-Frau, die erklärte, man müsse jetzt vernünftig bleiben und die paar Tage halt aushalten. Mehrere Tage? Luca riss den Schrank auf, in dem die Lebensmittel aufbewahrt wurden. Immerhin. Einige Pakete Spaghetti und Risottoreis. Pelati und andere Konserven. Zwei Kilo Brot. Im Kühlschrank drei volle Milchpackungen, eine Reihe von Joghurts, zwei Plastiktüten mit Chicorée und ein Kilogramm Karotten. Im unteren Fach ein großes Stück Käse, mindestens ein Pfund, und einige Würstchen. In der Obstschale auf dem Tisch ein Berg Orangen und Äpfel. Hatte also gestern jemand einen Großeinkauf gemacht. Na, er wars nicht gewesen. Vermutlich Seraina. Die WG-Mama. Nein, da tat er ihr Unrecht. Seraina war in Ordnung. Sie sah gut aus mit ihren rotblonden Locken und sie hatte so einen gewissen Berglercharme. Ganz zu Anfang hatte Luca abgecheckt, ob er bei ihr landen könnte. Nix zu machen. Sie hatte ihn bloß ausgelacht, aber fröhlich, nicht herablassend. Einige Tage würden sie also überleben können. Und sonst gabs ja noch die Nachbarn.
Raffaela Zweifel stand im Bad, in einen seidenen lila Morgenmantel gehüllt und tuschte sich die Wimpern. Sie betrachtete sich verdrossen im Spiegel. »Ich sehe furchtbar aus«, murmelte sie.
»Unsinn.« Fridolin Heer, der hinter sie getreten war, küsste sie auf den Nacken. »Du siehst super aus, wie immer. Vielleicht ein bisschen unausgeschlafen. Dabei bist du doch gestern früh zu Bett gegangen.«
»Ich fühle mich, als ob ich gestern Abend zu viel getrunken hätte«, sagte sie, »schwerer Kopf, verklebte Augen.«
»Schlaf doch noch ein bisschen«, riet er.
»Unsinn, ich muss zur Arbeit.«
Fridolin schüttelte bedächtig den Kopf. »Musst du heute nicht. Ebenso wenig wie ich – und alle anderen Bewohner dieser Stadt und über die Stadt hinaus.«
»Soviel ich weiß, haben wir heute weder den 1. Mai noch den 1. August.«
»Du hast noch nicht Radio gehört, meine Schöne. Drei Meter Schnee. Schau es dir an.«
»Was? Das ist doch nicht möglich. Immer deine Witze!« Raffaela eilte zum Fenster, öffnete es und schaute hinaus. »Wahnsinn!«
Sie griff nach dem Telefon und rief in ihrer Firma an. Nur der Beantworter meldete sich. Dann versuchte sie es bei einer Arbeitskollegin, die im Stadtviertel Wollishofen, auf der anderen Seite der Stadt, wohnte. Dort war die Situation genau gleich. Mindestens zweieinhalb Meter Schnee. Keine Chance hinauszukommen.
Ich trinke eine Tasse Tee, und dann lege ich mich nochmals hin, beschloss Raffaela. Ich habe wirklich nicht gut geschlafen. Fridolin küsste ihre Schulter. »Gute Idee«, murmelte er.
Auch Janine Bianchera hatte weder im Café, in dem sie arbeitete, noch an Rubinas Schule jemanden erreicht. Rubina kaute am letzten Bissen Butterbrot. »Da hätte ich ja gar nicht aufstehen müssen«, brummelte sie missmutig. Rubina war, dachte die Mutter, entschieden ein Nachtmensch. Wie wohl die allermeisten Dreizehnjährigen.
»Da du nun schon mal wach und auf bist, mach das Beste draus«, riet Janine. »Klemm dich hinter die Französischwörter. Du warst noch gar nicht sattelfest, als ich dich gestern abgefragt habe. Und für die Prüfung in Geschichte, die ihr übermorgen schreibt, könntest du auch lernen.«
Rubina verdrehte die Augen. »Okay«, murmelte sie seufzend und zog ab. Janine verzichtete darauf, sie darauf hinzuweisen, dass sie ihr Frühstücksgeschirr noch abräumen könnte. Das würde doch nur Streit geben. Es würde wohl heute ohnehin irgendwann Streit geben, wenn sie beide den ganzen Tag zusammen in der Wohnung waren, aber es musste ja nicht unbedingt schon am frühen Morgen sein. Rubina. Janine liebte ihre Tochter, aber einfach hatten sie es nie gehabt miteinander. Als kleines Mädchen hatte Rubina sehr an ihrem Vater gehangen. Es hatte ihr sehr zu schaffen gemacht, als Janine und Mario sich getrennt hatten, und Marios Tod, als Rubina acht gewesen war, war für das Mädchen ein schrecklicher Schlag und für die Beziehung zwischen Mutter und Tochter eine harte Belastungsprobe gewesen. Rubina hatte lange gebraucht, um einigermaßen über den Verlust ihres Vaters hinwegzukommen und wieder ein bisschen Lebensfreude zu finden. Und ich konnte ihr dabei nicht helfen, dessen war sich Janine bewusst. Sie hatte aufgehört, sich deswegen Vorwürfe zu machen. Sie hatten dann zwei recht friedliche, gute Jahre miteinander verlebt, aber seit Rubina langsam in die Pubertät kam, wurde es wieder schwieriger. Als Janine ihr kürzlich nicht erlaubt hatte, den ganzen Samstagnachmittag zusammen mit Freundinnen in Kaufhäusern an der Bahnhofstrasse zu vertrödeln, hatte Rubina plötzlich aufgestampft – tatsächlich, aufgestampft – und gerufen: »Papa würde es mir erlauben!«
Es war besser, gar nicht mehr an diese Szene zu denken. Janine war so wütend geworden, dass sie dem Mädchen am liebsten eine heruntergehauen hätte. Sie konnte sich gerade noch davor zurückhalten zu schreien: »Dann geh doch zu deinem Papa!« So weit darf es nie kommen, dass ich mich vergesse, schwor sie sich. Sie gestand sich ein, dass Rubinas unbeherrschter Ausruf sie eifersüchtig gemacht hatte. Eifersüchtig auf einen Toten. Sie schämte sich. Aber Rubina und sie waren so verschieden, sie hatten nie die enge, vertraute Beziehung gehabt, die Janine sich gewünscht hatte. Ihre Tochter sah ihr schon äußerlich gar nicht ähnlich. Sie war nach Mario geraten mit ihrer gebräunten Haut, den dunklen Augen, den schwarzen Haaren und dem rundlichen Gesicht. Eine Italienerin. Sie hatte nach dem Tod ihres Vaters ihr Italienisch nicht vergessen, hatte sich in der Schule mit einem italienischen Mädchen angefreundet, sich auf Geburtstag und Weihnachten italienische Kinderbücher, DVD und Hörbücher gewünscht. Sie konnte die Sprache ihres Vaters fließend. Wenn sie zusammen Ferien in Italien verbrachten, merkte Janine, dass die Kleine sich ihr überlegen fühlte, wenn sie in Restaurants oder Läden ihr klägliches Italienisch hervorkramte und die kleine Tochter ihr über den Mund fuhr, schnell und perlend erklärte, was die Mama hatte sagen wollen und ihr dann die Antwort etwas gönnerhaft übersetzte.
Schluss jetzt, befahl sich Janine. Wenn ich schon mal unter der Woche frei habe, kann ich mir den Kühlschrank vornehmen, nötig hat er es. Sie schaltete das Radio ein und begann, den Kühlschrank auszuräumen. Sie lenkte ihre Gedanken auf das Wetter. Die Prognosen stimmten sie nicht zuversichtlich. Es schneite weiter, es würde weiterschneien, ein Ende war offenbar nicht abzusehen. Einen Moment lang hatte sie Angst. Es könnte eine Naturkatastrophe werden. Wenn die Heizungen ausfielen, könnte es gefährlich werden, sie könnten erfrieren. Nein, sagte sie sich, so schlimm wird es nicht werden. Wir sind immer noch mitten in der Zivilisation, in der Schweiz, in der Stadt Zürich. Sie öffnete den Schrank mit den Lebensmittelvorräten. Doch, einige Tage würde es reichen. Teigwaren, Reis, Gemüsekonserven, Knäckebrot. In der Gefrierschublade lagerten Fleisch, eine Packung Fischfilets und Eis. Und vorgestern hatte sie zwei Kilo Orangen und ein großes Stück Kürbis gekauft.
Patrick Freuler blinzelte verschlafen. Der Wecker sagte ihm in grün leuchtenden Zahlen, dass es Viertel nach acht war. Warum war es dann noch stockdunkel? Er setzte sich abrupt auf. Warum war es überhaupt stockdunkel? Zumindest den Schein der Straßenlaterne hätte er doch wahrnehmen müssen. Über Nacht erblindet war er nicht, sonst hätte er die Uhrzeit auf dem Wecker nicht gesehen. Was war denn da los? Er ging hinaus in die Küche. Auch dort: stockfinster. Ebenso im Wohnzimmer und im Büro. Patrick schlüpfte in den Morgenmantel und ging ins Treppenhaus. Ein paar Stufen hinunter, die Tür aufgerissen – ihm bot sich der gleiche Anblick wie Lajos Varga anderthalb Stunden vorher. »Verdammt«, rief er verblüfft aus. Er eilte hinauf in den ersten Stock, schaute dort durchs Treppenhausfenster. »Zugeschneit«, murmelte er, den Kopf schüttelnd, »komplett zugeschneit. In Zürich.« Langsam ging er wieder hinunter in seine Wohnung. Er machte das Radio an, duschte, zog sich an, schaltete die Kaffeemaschine ein. »Mehrere Tage«, hörte er aus der Nachrichtensendung. Ich werde verhungern, dachte er. Er brauchte seine Vorräte gar nicht zu checken, es gab keine. In der Brotbüchse fand er ein vertrocknetes Croissant von gestern, das er lustlos aß. Ich muss mich bei der WG anhängen, dachte er, oder bei Valerie. Das ist ja kein Leben, tagelang so im Finsteren. Seine Nachbarin vom gleichen Stock kam ihm in den Sinn. Der wird’s auch nicht besser gehen. Zumindest kann sie für diese Übeltat nicht jemandem vom Haus die Schuld geben, überlegte er ein bisschen boshaft und grinste. Vermutlich schlief sie noch. Patrick fuhr sich durchs Haar. Er trug seinen hellbraunen Schopf kurz geschnitten und es war ihm anzusehen, dass er in zehn Jahren vermutlich schon fast eine Glatze haben würde. Aber das kümmerte ihn nicht. Er hielt sich ohnehin nicht für besonders gut aussehend mit seinem breiten Gesicht und der etwas zu groß geratenen Nase.
Beat Streiff schlug die Augen auf. Er gähnte und streckte sich. Valerie kam ins Schlafzimmer. »Na?«, fragte sie.
»Ich glaube, es geht mir besser«, sagte er.
Sie kam zum Bett, küsste ihn auf die Stirn und schob ihm den Fiebermesser unter den Arm. »Mal schauen, wie deine Temperatur ist. Wie hast du denn geschlafen?«
»Jedenfalls habe ich geschlafen«, meinte er.
»Du warst viel ruhiger als die Nächte zuvor«, bestätigte sie. »Noch vorletzte Nacht hast du dich nur herumgewälzt.«
»Wird auch Zeit«, brummte er. »Macht keinen Spaß, so eine blöde Grippe.«
Beat Streiff war selten krank. Er war Kommissar bei der Stadtpolizei Zürich, zuständig für schwere Verbrechen wie Tötungsdelikte. Er war ständig auf Achse, nicht selten auch nachts oder am Wochenende. Aber in diesem Februar hatte es ihn doch erwischt. Ausgerechnet an einem Freitagabend, als er früh Schluss machte, um einen gemütlichen Abend bei Valerie zu verbringen, hatte er sich unversehens miserabel gefühlt, innert kürzester Zeit Halsschmerzen und recht hohes Fieber gehabt. Valerie hatte ihn ins Bett gepackt und ihm Tee gekocht, den er, zu kaputt, um sich zu sträuben, brav getrunken hatte.
Das Fieberthermometer piepste. Valerie griff danach: »Nur 37,1«, verkündete sie, »fast normal.«
»Ja dann«, Beat setzte sich auf, »wird’s Zeit, mich wieder mal im Büro zu zeigen.« Er stand auf, schwankte leicht und musste sich gleich wieder setzen.
»Oh, offenbar noch nicht ganz wiederhergestellt«, brummte er. »Mir ist gleich schwindlig geworden.«
»Ja, eben«, protestierte Valerie energisch, »du bist noch viel zu schwach, um arbeiten zu gehen. Mindestens noch zwei Tage bleibst du hier. Wenn es dir wirklich besser geht, machen wir heute Nachmittag einen kleinen Spaziergang, eine Viertelstunde, nicht mehr.«
Beat erhob sich nochmals, diesmal vorsichtiger. »Wenigstens duschen will ich«, sagte er, »und danach einen Kaffee trinken. Mit diesem Kräuterteezeugs ist jetzt Schluss.«
Es klingelte. »Wer kann denn das sein, so früh?«, fragte sich Valerie. Sie ging zur Tür. Draußen stand ihre Nachbarin, die alte Frau Meyer.
»Haben Sie es schon gesehen?«, fragte sie ängstlich.
»Was denn?«, fragte Valerie zurück.
»Den Schnee«, sagte Frau Meyer.
»Ich weiß schon, dass es Schnee hat«, erwiderte Valerie etwas unsicher. Was wollte die Frau nur? Es hatte ja schon seit zwei Wochen ordentlich Schnee in der Stadt.
»Nein, ich meine, wie viel Schnee es jetzt hat«, versuchte die alte Frau zu erklären. Valerie ging zum Fenster. Frau Meyer folgte ihr und deutete nach unten. »Das ganze Erdgeschoss ist zugeschneit«, sagte sie. »Wir können nicht aus dem Haus. Sie haben es im Radio gesagt.«
Hm. Tatsächlich, stellte Valerie fest, als sie sich aus dem Fenster lehnte. Verrückt. So viel Schnee gab es doch sonst nur in den Bergen. Irgendwie spannend.
»Ich hätte doch heute einen Arzttermin«, sagte Frau Meyer aufgeregt, »ich habe angerufen, aber niemand meldete sich.«
»Ihr Arzt ist vermutlich auch zu Hause und kann nicht hinaus«, meinte Valerie, »machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Es bleibt uns allen wohl nichts anderes übrig, als daheim zu bleiben. Für mich kein Problem, da ich eh eine Woche Ferien genommen habe. Im Februar kaufen die Leute keine Fahrräder.« Valerie führte das Fahrradgeschäft FahrGut bei der Schmiede Wiedikon.
Frau Meyer nickte.
»Haben Sie alles, was Sie brauchen?«, fragte Valerie. »Genügend zu essen, zu trinken und so weiter?«
»Ja, ich habe alles. Es ist nur ein bisschen unheimlich.« Die Frau schaute sie mit großen Augen an.
»Nein, nein«, beschwichtigte Valerie, »gefährlich ist das sicher nicht. Wir müssen einfach abwarten, bis die Schneeräumungswagen wieder durchkommen. Wenn was ist, kommen Sie ruhig.«
Die alte Frau ging zur Tür. Die Badezimmertür ging auf und Beat Streiff erschien, in ein großes Handtuch gewickelt. Er brummte einen Gruß und verschwand im Schlafzimmer.
»Ach, Ihr Freund ist da!« Frau Meyer schien das zu beruhigen. »Dann ist wenigstens ein Polizist im Haus.« Valerie wusste nicht so recht, was ein Polizist zur Wetterberuhigung beitragen könnte, aber sie sagte nichts.
»Sie ging zu Beat ins Schlafzimmer. Er war daran, sich anzuziehen. »Bad news«, erklärte sie, »kein Spaziergang heute Nachmittag.« Er schaute sie fragend an.
»Jahrhundertschnee.«
»Was?«
»Schau aus dem Fenster!«
»Wow!« Ein erschrockener Laut entfuhr ihm. »Das gibt’s doch nicht, das ist ja verrückt. Aber das war nicht das ganze Wochenende so?«
»Nein. Aber es hat halt stetig vor sich hingeschneit. Du hast das gar nicht bemerkt, weil du die meiste Zeit ziemlich weggetreten warst. Gestern war es ein Meter, und die große Menge kam in den letzten zwölf, vierzehn Stunden. Jetzt ist es so viel, dass keine Räumungsfahrzeuge mehr ausrücken können.«
Er schüttelte fassungslos den Kopf. »Ich muss im Büro anrufen.«
»Viel wirst du dort nicht erreichen. Vielleicht sollte ich mal bei den anderen Nachbarn klingeln gehen«, überlegte sie. »Schauen, ob alle okay sind und genügend Vorräte für ein paar Tage haben.«
»Die Frau im Erdgeschoss sicher«, grinste Beat.
Ja, Renate Ingold, eine ältere Frau, hatte bestimmt Essensvorräte. Sie war eine unzugängliche Person, deren Kontakte mit den Hausbewohnern sich in Reklamationen erschöpften. Aber sie musste eine begnadete Köchin sein. Zweimal pro Tag stiegen aus ihrer Wohnung die verführerischsten Essensdüfte im Treppenhaus hoch. Sie hatte niemals Besuch zum Essen, sie kochte und aß ganz für sich allein.
Eine Stunde später waren fast alle Hausbewohner im Treppenhaus versammelt, vor der Wohnung der Wohngemeinschaft. Patrick Freuler und Raffaela Zweifel und Fridolin Heer waren diejenigen, die am wenigsten für Notzeiten vorgesorgt hatten. »Du kannst in diesen Tagen bei uns essen« bot Seraina Patrick an, während Csilla Varga das Paar vom zweiten Stock zum Mittagessen einlud.
»Heute Abend könnten wir alle bei uns essen«, schlug Seraina vor, »wir haben massenhaft Spaghetti und Fertigsaucen, und Reibkäse ist auch mehr als genug im Kühlschrank. – Aber wo sind denn unsere älteren Ladys?«, fragte sie.
»Frau Meyer ist okay«, meldete Valerie, »ein bisschen ängstlich, aber versorgt mit allem, was sie braucht. Und sehr beruhigt über die Anwesenheit eines Polizisten im Haus.«
Luca murmelte spöttisch etwas von »Freund und Helfer«.
»Aber was ist mit Frau Ingold?«, erkundigte sich Csilla Varga. Sie schnupperte. »Um diese Zeit müsste man doch schon langsam ihr Mittagessen riechen. Sie kocht ja häufig Gerichte, die sie endlos lange schmoren lässt.«
Valerie und sie gingen ins Erdgeschoss hinunter und klingelten. Nichts war zu hören. Sie klingelten nochmals. Nichts. »Ob sie weg ist?«, fragte Valerie.
»Nein«, sagte Csilla, »wir haben gestern Abend ihren Fernseher gehört. Sie geht ja abends kaum weg.«
Valerie klopfte. Nichts. »Frau Ingold«, rief sie. Die beiden Frauen schauten sich an. Dann drückte Valerie die Türfalle hinunter. Die Wohnungstür ging auf.
»Sie schließt doch immer ab«, murmelte Csilla ratlos.
»Frau Ingold«, rief Valerie nochmals, dann betraten sie die Wohnung.
Csilla verdrehte die Augen. »Peinlich«, flüsterte sie, »wahrscheinlich schläft sie heute länger.« Sie warfen einen Blick in die leere, aufgeräumte Küche, dann ins Wohnzimmer mit seiner behäbigen Polstergruppe, dem großen Fernsehapparat und der dunklen Wohnwand. Auch im Esszimmer war niemand. Sechs Stühle standen um den runden Esstisch, an der Wand stand ein riesiger Geschirrschrank. Und das alles für eine einzige Person, ging es Valerie durch den Kopf.
»Wir müssen im Schlafzimmer nachschauen« sagte sie zu Csilla, »vielleicht ist sie krank.« Csilla nickte und folgte ihr. Leise öffnete Valerie die Schlafzimmertür. »Frau Ingold«, rief sie leise. Dann hielt sie erschrocken den Atem an. Rasch ging sie zum Bett der alten Frau. Sie lag darin, ihre Augen waren geöffnet und auch ihr Mund stand leicht offen. Aber sie sah nichts und sie würde nie mehr etwas sagen. Renate Ingold war tot. Csilla entfuhr ein entsetzter Laut. Valerie schlug die Bettdecke etwas zurück und sie sahen Blut auf der Höhe ihrer Brust.
»Sie ist tot«, flüsterte Csilla. »Hatte sie einen Herzinfarkt?«
»Nein«, sagte Valerie, »das war kein natürlicher Tod. Ich hole Beat.«
Im Flur hing ein Schlüsselbrett, von dem Valerie einen Hausschlüssel nahm, mit dem sie die Wohnung abschloss. »Wie schrecklich«, brach es aus Csilla Varga heraus, »was ist denn da passiert?«
»Ich glaube, sie ist erstochen worden«, murmelte Valerie.
»Die Kinder«, rief Csilla Varga in Panik, »sie dürfen es nicht erfahren!«
»Ruhig, Frau Varga«, Valerie reagierte automatisch. Noch ließ sie keine Gefühle an sich heran, keinen Schrecken, keine Angst. »Gehen Sie in Ihre Wohnung, bleiben Sie bei Ihren Kindern. Beat Streiff wird sich das ansehen.« Csilla eilte davon, Valerie rief Beat und Seraina Loretz.
»Ich kann den Todeszeitpunkt nicht genau bestimmen«, sagte die Medizinstudentin. Sie strich eine Locke, die ihr ins Gesicht fiel, zurück. »Das ist nicht so einfach wie im Fernsehkrimi.« Streiff nickte.
»Irgendwann nachts«, fuhr Seraina fort«, »ihre Körpertemperatur beträgt noch sechsundzwanzig Grad, die Leichenstarre ist eingetreten. Ihr Tod kann vielleicht zehn, zwölf Stunden her sein. Vielleicht mehr, vielleicht auch weniger.«
Es war kühl im Schlafzimmer. Renate Ingold hatte die Heizung auf Stufe 1 eingestellt gehabt, und Streiff hatte sie ganz zurückgedreht. »Ist sie im Schlaf getötet worden?«, fragte er.
Loretz zuckte die Schultern. »Kann sein. Jedenfalls erkenne ich keine Anzeichen von Gegenwehr. Ich glaube nicht, dass sie gekämpft hat. Es hat wohl auch niemand Schreie gehört. Sonst hätten die Varga oder Patrick sicher etwas gesagt.«
Streiff ging langsam durch die Wohnung. Alle Fenster waren geschlossen, ebenso die Türe, die auf einen kleinen Gartensitzplatz führte. Nur die Wohnungstür war nicht abgeschlossen gewesen. Es war eine typische Wohnung einer alten Frau, die früher zu zweit oder mit Familie gelebt hatte und die allein zurückgeblieben war, in einer zu großen Wohnung, die sie nicht für ihre jetzigen Bedürfnisse umgestaltet hatte. Ein Zimmer schien völlig unbenutzt zu sein. Vielleicht war es einmal ein Gästezimmer gewesen, in geselligeren Zeiten. Vielleicht waren Nichten und Neffen zu Besuch gekommen, fröhliche Kinder, die sich ins große Bett gekuschelt hatten. Streiff konnte es sich zwar schlecht vorstellen, aber wer weiß? Auch dieses Zimmer war ungeheizt. Es wirkte ganz unpersönlich, keine Bilder an den Wänden, keine Familienfotos auf der Kommode. Fast wie ein billiges altmodisches, fensterloses Hotelzimmer. Streiff lehnte sich an den Türrahmen. Die Glühbirne unter dem düster geblümten Stoffschirm warf ein ungemütliches Licht in den Raum.
In dieser Wohnung war letzte Nacht ein Mensch erstochen worden. Eine alte, alleinlebende Frau. Eine Situation, die ich kenne, dachte Streiff. Die ich hundertmal erlebt habe. Und doch ist diesmal alles ganz anders. Kein Staatsanwalt. Kein Polizeiarzt. Keine Sanität. Keine Spurensicherung. Bloß ich. Plötzlich erinnerte er sich an den neunjährigen Beat. Er war wohl aufgeweckt und lebhaft gewesen, aber auch ein Bücherwurm. In seiner Familie hatte es keinen Fernseher gegeben, bis er dreizehn gewesen war. Nicht weil seine Eltern irgendwie alternativ gewesen wären, sie waren schlicht altmodisch: Man musste nicht immer gleich alles haben. Fernsehen ist nichts für Kinder, es macht sie dumm. Er hatte im Radio die »Kinderstunde« gehört, oft draußen gespielt und viel gelesen. Vor Weihnachten hatte er jeweils die Kataloge der Kinderbuchverlage durchgeblättert und Kreuzchen gemacht. Natürlich hatte er nie alle Bücher bekommen, die er angekreuzt hatte. Aber es gab ja noch die Dorf- und die Schulbibliothek, die für Nachschub sorgten. Besonders hatte er Krimis geliebt, zum Beispiel die lange Serie der »Fünf-Freunde-Bücher«. »Fünf Freunde auf der Felseninsel«, »Fünf Freunde jagen die Entführer«, »Fünf Freunde auf geheimnisvollen Spuren«. Beat lächelte. Der neunjährige Beat hatte Detektiv werden wollen, nichts anderes. Dabei hatte er nicht an die Polizei gedacht, nein, ein Detektiv war einer, der allein arbeitete. Der ein Béret trug, Pfeife rauchte. Den Leuten Fragen stellte, deren Hintersinn sie nicht begriffen, sodass sie sich verrieten. Bis Beat Streiff gegen Ende zwanzig dann tatsächlich bei der Kriminalpolizei gelandet war, hatte es einige Umwege gegeben. Ein abgebrochenes Jurastudium. Einige Jahre als Judolehrer. Auch wenn er seine Arbeit manchmal als mühsam empfand, gelegentlich sogar als langweilig, war er doch mit Herzblut Polizist und hatte seine Berufswahl nie bereut. Eine Beziehung war daran kaputtgegangen, aber das war so lange her, dass Beat kein Bedauern mehr empfand. Die Arbeit bei der Kriminalpolizei hatte kaum Ähnlichkeit mit den Detektivträumen des Neun- oder Zehnjährigen gehabt. Aber in diesem Moment fühlte er sich plötzlich darauf zurückgeworfen. Einer, der allein arbeitet. Es konnte sein, dass sie alle mehrere Tage in diesem Haus eingeschlossen sein würden. Sechzehn Personen, darunter drei Kinder. Sechzehn Personen, die wussten, dass in der Wohnung im Parterre rechts eine tote Frau lag. Ein Mordopfer. Einige würden sich fürchten, die Situation als bedrohlich, als unheimlich empfinden. Wie würden sie reagieren, was würde der Tod von Frau Ingold auslösen? War der Täter ein Hausbewohner? Er musste sich das Haus ansehen. Natürlich löste man nicht als Einmannbetrieb einen Mordfall. Aber er würde jetzt sicher nicht tagelang herumsitzen und nichts tun, bis die Verstärkung anrollen konnte.
Streiff löschte das Licht und trat in den Flur hinaus. Dort stand Seraina Loretz, etwas unsicher. »Ich bräuchte Hilfe«, sagte sie, »um die Leiche, nun ja, ein bisschen zurechtzumachen. Ich dachte, ich könnte Frau Bianchera fragen. Ist das okay?«
Streiff nickte. »Tun Sie das.« Er schaute auf die Uhr. »Sagen Sie den Hausbewohnern, dass wir uns alle um zwei Uhr treffen«, er brach ab. »Wo denn? Wir sind im Ganzen sechzehn Personen.«
»Bei uns«, schlug Seraina vor. »Wir haben einen großen Tisch, weil wir oft Besuch haben. Vielleicht könnten andere noch ein paar Stühle mitbringen. Oder bei Patrick. Er hat einen riesigen Arbeitstisch – aber fast keine Stühle.«
Streiff bat die junge Frau, sich darum zu kümmern. Er schaute sich das Haus an. Ging in den Keller. Natürlich war er auch schon unten gewesen. Er hatte ja Valerie beim Umzug geholfen, als sie vor zwei Jahren ihre alte Wohnung verlassen musste, weil das Haus abgerissen wurde. Und er hatte auch schon ab und zu eine Flasche Wein aus ihrem Kellerabteil geholt. Jetzt sah er sich genauer um. Jede Wohnung hatte ein kleines Kellerabteil, dann gab es noch Waschküche und Heizungsraum. Zwei der Abteile waren praktisch leer; jenes von Renate Ingold, weil sie eine ordentliche Person gewesen war, und jenes von Patrick Freuler, weil er vor Kurzem mit fast nichts eingezogen war. Andere, beispielsweise das Abteil der Wohngemeinschaft und jenes von Mutter und Tochter Bianchera, waren komplett vollgestellt mit Schachteln, alten Haushaltgegenständen, Reisetaschen, Skiern. Hier könnte man gut irgendwo eine Waffe verstecken, dachte Streiff. Hier müssten Profis ans Werk. Er stieg die Treppe langsam wieder hoch. Im obersten Stock, zwischen den Wohnungstüren von Ursula Meyer und Valerie Gut, war noch eine kleine Tür. Streiff drückte die Falle, aber die Tür ging nicht auf. Valerie schaute hinaus. »Ach, das ist nichts. Irgendein winziges Estrichräumchen, das von niemandem benutzt wird. Abgeschlossen.« Es war Viertel nach eins. Valerie hatte eine Kartoffelsuppe gekocht. »Komm, du musst doch noch etwas essen vor diesem Treffen«, drängte sie. »Und wie fühlst du dich überhaupt? Immer noch fieberfrei?«
Er schaute sie erstaunt an. »Fieberfrei?« Er hatte vollkommen vergessen, dass er gestern noch mit Grippe im Bett gelegen hatte. Wenn er am Arbeiten war, konnte er private Befindlichkeiten völlig beiseiteschieben. »Ja, ich nehme gern etwas Suppe. Aber zuerst will ich noch telefonieren.«
Er ging ins Wohnzimmer und rief den Detektivposten Aussersihl an, wo er sein Büro hatte. Zita Elmer, seine Kollegin und engste Mitarbeiterin, hob ab. Schlecht gelaunt. Sie hatte Nachtdienst gehabt und quasi zusehen können, wie sie gnadenlos eingeschneit wurde. Sie war müde und verärgert, weil sie nicht nach Hause konnte und nicht abgelöst wurde. Streiff orientierte sie kurz über die Situation an der Bristenstraße. Er gab ihr die Namen aller Hausbewohner durch, mit der Bitte nachzuschauen, ob sie in irgendeiner Polizeidatenbank registriert waren. »Okay, mach ich«, brummte Elmer. Streiff hörte, dass sie bereits etwas zufriedener gestimmt war. So war Elmer, nicht gerade ein Ausbund an Charme, aber eine gescheite, zuverlässige, hart arbeitende Polizistin, der es am liebsten war, wenn etwas lief.
»Dein Sohn ist gut versorgt?«, fragte Streiff.
»Ja, Linus ist bei ihm, er kann ja auch nicht zur Arbeit.«
Leo war vier Jahre alt, ein stämmiger, lebhafter kleiner Junge, der ganz nach der Mutter geriet. Er würde einen Tag mit dem Papa wahrscheinlich genießen, denn Zitas Mann Linus, ebenfalls Polizist, kannte sich auch im Haushalt, in der Küche und in Sachen Spielzeug aus. Um Zita und Familie musste man sich also keine Sorgen machen.
Er öffnete sein Laptop und ging auf eine Seite, die ihm Auskunft über die Wetterentwicklung der letzten Nacht gab. Bis um elf Uhr hatte Lajos Varga noch den Fernseher von Renate Ingold gehört. Anschließend war sie wohl zu Bett gegangen und eingeschlafen. Um diese Zeit aber war es schon nicht mehr möglich gewesen, das Haus durch die Haustür zu betreten oder zu verlassen. Im Keller war niemand versteckt, und auch in den Wohnungen war es nicht möglich, dass sich ein Fremder über Stunden verstecken konnte. Ergo – Streiff ging in die Küche.
Er schöpfte sich von Valeries köstlicher Kartoffelsuppe. Sie war eine spontane Köchin, probierte gern dieses und jenes aus, und es geriet ihr leider nicht immer. Aber ihre Kartoffelsuppe mit geröstetem Mehl, wenig Käse und viel Muskatnuss war ein sicherer Wert.
»Was hast du nun vor?«, fragte sie eifrig. »Wirst du den Mord aufklären?«
Er lächelte. »Du meinst, so wie Hercule Poirot es getan hätte?«
Sie wurde ein wenig verlegen und deutete ein Schulterzucken an. »Kannst du doch sicher«, ermutigte sie ihn. Dann wurde sie ernst: »Glaubst du auch, dass es ein Hausbewohner gewesen sein muss? Ich meine, es konnte doch niemand reinkommen oder rausgehen?«
Er seufzte. »Wie wir der Presse gegenüber immer sagen: Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen, sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung – du kennst das ja.«
»Was wirst du den Nachbarn sagen?«
»Ich werde sie einfach informieren und ankündigen, dass ich sie alle besuchen werde, um ein wenig mit ihnen zu reden.«
»Und dann stellst du ihnen so raffinierte Fragen, dass sie sich in Widersprüche verwickeln und am Schluss jemand sagt, er habe es nicht mehr ausgehalten, wie die Ingold immer wegen der Waschküche reklamiert habe.«
»Das ist eine wichtige Frage«, warf Beat ein, »das Motiv.«
»Sie war eine dumme und bösartige alte Frau«, fuhr Valerie auf. Aber plötzlich verzog sich ihr Gesicht. »Es tut mir leid«, murmelte sie und schluchzte ein bisschen. »Es ist schrecklich, dass sie umgebracht worden ist.« Ihr Mann legte den Arm um sie. Valerie und er hatten vor einem Jahr geheiratet, aber sie hatten es nicht an die große Glocke gehängt, und sie waren auch nicht zusammengezogen.
»So wird es jetzt auch den anderen ergehen«, tröstete er. »Sie sind aufgewühlt, zornig, trotzig, aber auch erschrocken und entsetzt und vielleicht ein wenig traurig. Das ist normal. Ein solches Ereignis wühlt die Menschen, die involviert sind, auf, auch wenn sie mit dem Opfer vielleicht gar nicht viel zu tun hatten oder es nicht leiden konnten.«