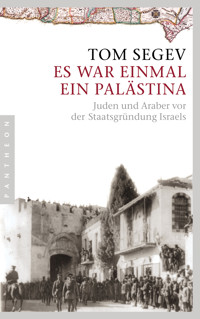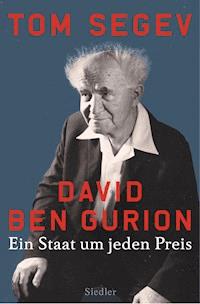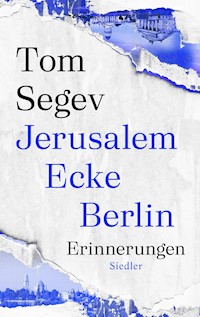
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein außergewöhnliches Leben zwischen Israel und Deutschland
Seine Eltern lernten sich am Bauhaus in Dessau kennen und flohen 1935 nach Palästina, in der verzweifelten Hoffnung, einst in die Heimat zurückzukehren. Tom Segev, 1945 in Jerusalem geboren, verlor den Vater im ersten arabisch-israelischen Krieg. Er und seine Mutter blieben daraufhin in Israel, doch sein deutsches Erbe sollte Segev nicht mehr loslassen. Seit nunmehr über 50 Jahren gehört der Publizist und Historiker zu den aufmerksamsten und klügsten Beobachtern der deutsch-israelischen Geschichte, seine Bücher, allen voran „Die siebte Million“, machten ihn international bekannt. Streitbar und leidenschaftlich, mit Ironie und Wärme erzählt Tom Segev sein Leben, vom Karrierebeginn in Jerusalem bis zum Ende der DDR, von seinen Begegnungen mit Markus Wolf und Nelson Mandela, Fidel Castro, Mutter Teresa und Hannah Arendt, Willy Brandt und Günter Grass. Bewegend beschreibt er, wie er sich auf der Suche nach dem Verständnis der deutschen Identität auch mit den historischen Lasten Israels konfrontiert sah, und wie er sein Glück schließlich in Äthiopien fand. Segev ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, der dabei indes auch heiklen und umstrittenen Themen nicht ausweicht. Ein überragendes Zeitzeugnis voller Optimismus – und ein großes Lesevergnügen.
Mit zahlreichen Abbildungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ein außergewöhnliches Leben zwischen Israel und Deutschland
Seit nunmehr über 50 Jahren gehört der Publizist und Historiker Tom Segev, geboren 1945, zu den aufmerksamsten und klügsten Beobachtern der deutsch-israelischen Geschichte. Seine Bücher, allen voran »Die siebte Million«, machten ihn international bekannt. Streitbar und leidenschaftlich, mit Ironie und Wärme erzählt Tom Segev sein Leben, vom Karrierebeginn in Jerusalem bis zum Ende der DDR, von seinen Begegnungen mit Markus Wolf und Nelson Mandela, Fidel Castro, Mutter Theresa und Hannah Arendt, Willy Brandt und Günter Grass. Bewegend beschreibt er, wie er sich auf der Suche nach dem Verständnis der deutschen Identität auch mit den historischen Lasten Israels konfrontiert sah und wie er sein Glück schließlich in Äthiopien fand. Segev ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, der dabei indes auch heiklen und umstrittenen Themen nicht ausweicht. Ein überragendes Zeitzeugnis voller Optimismus – und ein großes Lesevergnügen.
Tom Segev ist Historiker und einer der bekanntesten Journalisten Israels, dessen Bücher alle weltweit große Beachtung finden. Seine Eltern flohen 1935 aus Deutschland nach Palästina. Tom Segev wurde 1945 in Jerusalem geboren und gehört seit über 50 Jahren zu den klügsten Beobachtern der deutsch-israelischen Geschichte. In Deutschland wurde er durch sein Buch »Die siebte Million. Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung« (1995) bekannt. Für »Es war einmal ein Palästina« (2005) wurde er mit dem National Jewish Book Award ausgezeichnet. Zuletzt erschienen von ihm bei Siedler seine viel gerühmte Geschichte des Sechstagekrieges »1967. Israels zweite Geburt« (2007), »Die ersten Israelis. Die Anfänge des jüdischen Staates« (2008), »Simon Wiesenthal« (2010) und die Biographie »David Ben Gurion. Ein Staat um jeden Preis«. Segev lebt in Jerusalem.
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
Tom Segev
JerusalemEcke Berlin
Erinnerungen
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 by Tom Segev
Übersetzt aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Ditta Ahmadi
Covergestaltung: Favoritbuero, München
Coverabbildung: © privat; © shutterstock
Reproduktion: Lorenz & Zeller GmbH, Inning, a. Ammersee
Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen
ISBN 978-3-641-28209-7V004
www.siedler-verlag.de
INHALT
VORWORT
Guten Morgen, Herr Fischer
Der Schnauzer des Kaisers
ANSTÄNDIG BLEIBEN
Atempausen
So sein wie alle
Sachsenhausen
Was hätte der Richter getan
Die Telefonnummer
Großvaters Traum
Schwarze Punkte
Ein Kommunist im Königspalast
Sieben Gebote für Spielzeug
Ums Kap der Guten Hoffnung
»Wir haben es satt«
Eine Mörderkugel
Die erste Schokolade
RICARDAS SOHN
Ein Löwe im Bügelzimmer
Ein Journalist im Haus
Der namenlose Pfadfinder
Die Tatsachenlage
Ein Tischler aus Nazareth
So sagt Ruth
Ein jüdisches Mädchen
Eine sehr harte Frau
Gute Menschen, böse Menschen
Telegramm von Emils Vater
Ein gemeinsamer Egotrip
Der beste Freund
Der Preis eines Käfers
Furchtlos und unparteiisch
»Ein anderer Planet«
Wo liegt Hanoi
BANALITÄTEN
Eine Nacht in Spandau
Was geschah mit den Gesetzestafeln
Reine Luft
Die Juden waren schon tot
Nixon auf der Couch
Ein Abend bei Hannah Arendt
Wasserbetten
Aus der Ameisenperspektive
Abschiede
Sechzig Millionen Juden
Eine Stadt ohne Frohsinn
Auf den Spuren des Vaters
Schwere Zeiten
Soldaten des Bösen
VERGLEICHE
Vor den Kleiderschränken
Die siebte Million
Die Not des Uhrmachers
Alice im Wunderland
Der Impresario
Die Einheit der Stadt
Die fünfzehn Tage der Shuruk Yassin
Eine Nacht mit Dr. Ruth
Abenteuer eines cleveren Anstreichers
Verbindungen
Regierung des Volkes
Schätze im Laubfrosch
GESCHICHTE UND GESCHICHTEN
In Würde sterben
Eine neue Ordnung
Neue Geschichte
Neuer Journalismus
Jenseits von Afrika
Kunst und Terror
Ubuntu
Zwischen Karne Hittin und Ben-Jehuda-Straße
Ein Militärgeheimnis
Schwestern
Wenn der Comandante lacht
Mozartkugeln im Palais Metternich
ZURÜCK ZUM FEIGENBAUM
»Operation Moses«
Die Tamtam-Methode
Reuven
Ein Fisch auf dem Trockenen
Die Kuh, die sich als Ente erwies
Wer kennt, wer weiß
Auf Friedensmission
Das Küken, das zum Adler wurde
Nebenwirkungen
Zerbrechlich
Trip mit dem Ministerpräsidenten
Eine Nacht in Ground Zero
Freude am Holocaust-Gedenktag
Väter und Söhne auf dem Ölberg
Zurück zur Genesis
ANHANG
Personenregister
Bildnachweis
BILDTEIL
VORWORT
Guten Morgen, Herr Fischer
Einige Wochen nach meinem fünfundsiebzigsten Geburtstagblicke ich von meinem Fenster aus auf einen Jacarandabaum im Garten, der mir provozierend seine sinnliche, optimistische, junge Frühlingsblüte entgegenstreckt, als sei alles schön und gut. Doch das ist ein Trugschluss: Tatsächlich sitze ich allein in Jerusalem, in deprimierender, nervenaufreibender Corona-Quarantäne, und vertiefe mich in die Lebensgeschichte eines deutschen Bühnenschauspielers vom Beginn des vorigen Jahrhunderts. Er hieß Hermann Meltzer-Burg und war Erster Komiker am Großherzoglichen Hoftheater von Baden. Manchmal führte er auch Regie. Und warum interessiert er mich überhaupt, dieser Meltzer-Burg ? Was habe ich mit ihm zu tun ? Ich sage mir, dass er mich eigentlich nicht zu interessieren braucht. Ich beschäftige mich mit ihm, um der quälenden Einsamkeit dieser Tage zu entfliehen, und es war mir nichts eingefallen, was ferner und irrelevanter, weniger israelisch und weniger aktuell gewesen wäre.
In den Jahren 1903 bis 1905 unterhielt Meltzer-Burg die Theaterfreunde in Karlsruhe, der Hauptstadt des Großherzogtums. Sein Anstellungsvertrag bedurfte der Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs höchstpersönlich. Die Worte »Seine Königliche Hoheit der Großherzog« in altdeutschen Buchstaben nahmen das ganze obere Drittel des herzoglichen Schreibens ein und erinnerten in ihrer schwungvollen Schnörkelschrift an die Goldbänder um teure Pralinenschachteln. Ich male mir aus, wie ein ehrfürchtiger Schauder den Ersten Komiker überlief, als man ihm diese Urkunde aushändigte. Wer weiß, vielleicht hatte ein berittener Kurier mit Federhut auf einem Schimmel sie ihm überbracht. Meltzer-Burg, damals um die fünfzig, entstammte einer protestantischen Straßburger Familie. Auch seine Frau war Schauspielerin. Sein Repertoire umfasste über hundertfünfzig Rollen, fast alle in leichten Stücken mit Titeln wie Guten Morgen, Herr Fischer, die zumeist längst vergessen sind. Er konnte auch singen und trat in Operetten auf. Manchmal bekam er gute Zeitungskritiken.
Ich hatte gehofft, die Beschäftigung mit seiner Geschichte würde mich in ferne, selbst von Corona unberührte Welten entführen, ganz weit weg. Doch da irrte ich mich. Denn Großherzog Friedrich I. von Baden erwies seine Gunst auch der zionistischen Bewegung, und da er ein Onkel Kaiser Wilhelms II. war, konnte er dem Gründer der Zionistischen Weltorganisation, Theodor Herzl, eine historische – und folgenarme – Begegnung mit dem Kaiser in Jerusalem verschaffen. Wie sie mich verfolgt, die zionistische Geschichte. Und mir ist auch keine Zuflucht vor Kaiser Wilhelm persönlich vergönnt. Wann immer ich den Blick vom Computer hebe, sehe ich über den Zweigen der Jacaranda den hohen Glockenturm neben der Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion. Kirche und Turm wurden zur Demonstration deutscher imperialer Macht in der Heiligen Stadt erbaut. Nach der lokalen Legende sollte der Turm ein wenig an das Äußere des Kaisers erinnern, die Turmspitze also an seinen Helm. Der schmale Balkon um das Obere des Turms könnte ein Anklang an den mächtigen Schnauzer seiner Majestät sein. Und wenn ich auf diesen Balkon schaue, fällt mir manchmal Pater Paul ein, ein benediktinischer Ordenspriester, der mich, als ich noch ein Junge war, auf diesen Balkon mit hinaufnahm, nachdem er mir eine schwarze Mönchskutte übergezogen hatte; ich meine, ich hätte auch die Kapuze aufgesetzt. Das war ein streng verbotenes Abenteuer, nicht ungefährlich für ihn und für mich.
Nach meiner Erinnerung war ich damals vierzehn Jahre alt. Seit dem Abkommen zwischen Israel und dem Königreich Jordanien war Jerusalem geteilt. Durch die Stadt zog sich ein Streifen von Ruinen, Stacheldrahtzäunen und Betonmauern. Das war Niemandsland. Die Altstadt lag auf der jordanischen Seite. Spinner aus aller Welt und Kinder überquerten die Linie manchmal irrtümlich, oder sie drangen absichtlich ins Niemandsland ein auf der Suche nach Kupferschrott, den sie zu verkaufen hofften. Einige traten dabei auf Minen. Nicht selten zog es auch mich dorthin: Das Verbotene und Gefährliche lockte mächtig. Einmal, im Alter von acht Jahren, überschritt ich die Grenze sogar. Es war an einem Samstagmorgen; wir wohnten damals im Viertel Baka im Süden der Stadt. Ein anderer Junge, Avremale, und ich hatten einen verirrten Esel auf der Straße entdeckt, wollten ihn einfangen und seinem Besitzer zurückbringen. Doch der Esel lief weg. Wir rannten ihm nach bis nach Beit Safafa, einem arabischen Dorf, das ebenso wie Jerusalem seit dem israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948/49 zwischen Israel und Jordanien geteilt war, doch die Einwohner hüben und drüben scherten sich nicht viel um die Grenze.
An diesem Punkt bin ich unsicher, ob mein Gedächtnis richtig liegt oder die Geschichtsschreibung. In meiner Erinnerung sehe ich meinen Freund und mich jenem Esel nachjagen, bis wir uns unversehens jenseits der Grenze befanden, genau vor zwei bewaffneten jordanischen Soldaten, »Legionären«, wie man sie damals nannte. Wir waren zutiefst erschrocken, die Soldaten desgleichen. Der Esel, wohl ebenfalls verdattert, blieb neben uns stehen. Wir fassten ihn und banden ihm ein Seil um den Hals. Die Legionäre halfen uns. Dann alarmierten sie die UNO-Beobachter, die das Waffenstillstandsabkommen zu überwachen hatten, und diese riefen die israelische Polizei von Jerusalem, die uns nach Hause brachte. Auf dem Weg zeigten uns die Polizisten, wo die Grenze verlief, damit wir sie nicht erneut überquerten. Den Esel, den sie hinten an den Streifenwagen gebunden hatten, brachten sie ebenfalls nach Hause. Er iahte fröhlich, und sein Besitzer freute sich. All das habe ich gut in Erinnerung.
An jenem Schabbatmorgen war wie stets ein Journalist namens Gabriel Stern bei uns zu Gast, ein alter Freund meiner Mutter, der solche Geschichten gern auf der Titelseite seiner Zeitung Al Hamishmar veröffentlichte. Zum ersten Mal stand mein Name nun in der Zeitung. Aber in Sterns Geschichte kamen weder Legionäre noch UNO-Beobachter vor. Demnach hatten wir die Grenze gar nicht überschritten: Eine israelische Polizeistreife musste uns auf unserer Seite entdeckt haben, und das entsprach wohl der historischen Wahrheit. Es gibt allerdings eine weitere Version, die ich einmal veröffentlichte, nachdem ich zufällig meinen einstigen Mittäter wiedergetroffen hatte. Avremale hatte es unterdessen geschafft, sich einem Kibbuz anzuschließen, eine Greencard in New York zu ergattern, zurückzukehren, Jiddisch zu lernen, zu malen und zu bildhauern, zu heiraten, drei Kinder zu zeugen und in eine Siedlung bei Jericho im israelisch besetzten Westjordanland zu ziehen. Irgendeine Kampagne hatte ihn dazu veranlasst, vor der Residenz des Ministerpräsidenten zu demonstrieren, und dort traf ich ihn. Wir kamen auf die Affäre mit dem Esel zu sprechen und gelangten zu dem Schluss, dass wir tatsächlich auf jordanisches Gebiet vorgedrungen, jedoch auf keine Legionäre getroffen waren.
Mein Leben lang jage ich Eseln nach, aber meine Geschichten haben eine gewisse Neigung: Je tiefer sie mir ins Gedächtnis dringen, desto farbiger und dramatischer werden sie – einfach immer besser. Eine erneute Überprüfung ergibt dann jedoch schon mal, dass einige Höhepunkte sich selbst erfunden und in mein Gedächtnis geschlichen haben. Manche gute Story ist zudem an meiner destruktiven Skepsis gescheitert: So kann es doch gar nicht gewesen sein, sage ich mir und bedaure es oft, besonders wenn ich recht habe. Bedauern plagt mich auch, wenn ich Illusionen, Erfindungen, Fantastereien und falsche Erinnerungen bei anderen Menschen entdecke, die ich in meinen Büchern zitieren möchte. Daher ermahne ich mich, gut nachzudenken, ehe ich die Geschichte mit Pater Paul niederschreibe.
Der Schnauzer des Kaisers
Ich habe keine Ahnung, was ich an jenem Tag auf dem Berg Zion wollte. Als Junge fühlte ich mich manchmal einsam, zuweilen auch deprimiert, und schweifte allein umher, wohin meine Füße mich trugen. Der Berg Zion war von Geheimnis, Grusel und Unheil umwittert. Der Weg dorthin führte an einer Hundeklinik vorbei; das gepeinigte Jaulen verfolgte einen fast bis zum Gipfel. Man kam auch über Mamila hin, ein arabisches Stadtviertel, das im Krieg verwüstet worden war und jetzt im Niemandsland lag. Seine Bewohner hatte es wer weiß wohin verschlagen, vermutlich in Flüchtlingslager. Die Häuser waren zerstört, aber ihre Ruinen ließen noch etwas von ihrer ehemaligen Form erkennen. Gesprengte Ziegeldächer, durchlöcherte Mauern, kaputte Fensterläden, verbogene Eisengeländer, geborstene Stufen. Hier und da lagen Möbelteile und verbeulte Kochtöpfe herum. Man konnte erahnen, wie das Viertel vor dem Krieg ausgesehen hatte. Ich stellte mir vor, wer die Bewohner gewesen waren und wie sie gelebt haben mochten. Damals fragte ich mich noch nicht, warum sie nicht mehr da waren. Jenseits der Grenze standen die Legionäre; jederzeit konnte einer unvermittelt das Feuer eröffnen. Das kam häufig vor.
Der Berg Zion ist von alten Gräbern umgeben, und ein mächtiger Grabstein auf seiner Kuppe gilt seit rund tausend Jahren als König Davids Grab. Ein Mann, der immer dort saß, erzählte mir, einmal habe er um Mitternacht hinter seinem Rücken Lyraspiel gehört, und als er sich umdrehte, König David gesehen. Die christliche Überlieferung, wonach Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern auf dem Berg Zion eingenommen hat, ist auch sehr alt. Die Kirche, die Kaiser Wilhelm dort oben finanzierte, sollte außerdem den Ort markieren, an dem Maria, die Mutter Jesu, in ewigen Schlaf gesunken war.
Hans Mehl, alias Pater Paul, kannte viele Jerusalemer, und viele kannten ihn. Er war in einer Kleinstadt am Oberrhein geboren und als junger Mann ins Zionskloster eingetreten, rund dreißig Jahre vor unserer Begegnung. Er leitete den Souvenirshop der Abtei. Ich weiß nicht mehr, wieso wir uns an jenem Tag etwas angefreundet haben; wir sprachen Deutsch, das ich von zu Hause kann. Ich erinnere mich an den leicht muffigen Geruch der schwarzen Kutte, in der ich hinter dem bärtigen Pater die Treppen hinaufstieg. Hatte er wirklich einen Bart ? Ich meine, ja. Einen weißen, scheint mir. Als wir auf den Balkon hinaustraten, verschlug es mir den Atem: Die ganze Altstadt lag vor mir ausgebreitet, und in der Mitte glänzte die goldene Kuppel des Felsendoms. Als Kind hatte ich einen Modellbaukasten der Altstadt, den mein Vater gemacht hatte, eine Art Lego-Vorgänger aus Holz, komplett mit Stadtmauer, Davidsturm und Tempelberg. Ich wusste, dass es die Altstadt tatsächlich gab, dass sie aber für immer unerreichbar war, da sie jenseits der Teilungslinie, gewissermaßen auf der dunklen Seite des Mondes lag. Jetzt sah ich sie vor mir, ganz in Gold, ganz mein. Pater Paul fasste mich um die Hüften und führte mich vorsichtig an der Brüstung entlang. Hier und da war der Balkon im Krieg getroffen worden, dort durfte man nicht hintreten, damit der Boden nicht einbrach. Die Kirche neben dem Turm reichte bis an die Grenze. Zwischen ihren vier Türmchen patrouillierten ständig israelische Soldaten. Sie konnten fast jeden Punkt in der Altstadt sehen, und wenn sie zum Turm aufblickten, sahen sie auch uns.
Ich hatte einen Fotoapparat dabei, aber Pater Paul sagte, wenn die Soldaten annehmen, dass ich sie ablichte, bekämen wir Unannehmlichkeiten. Er streckte mir den Arm entgegen, sodass der Ärmel seiner Kutte ein schwarzes Dreieck bildete, und flüsterte mir zu, schnell zu fotografieren, im Schutz des Ärmels. Die Fotos existieren bis heute. Doch es gibt ein Problem: Obwohl ich schwarz-weiß fotografierte, sieht man die Sonne auf der goldenen Kuppel blitzen. Die Goldbeschichtung der Kuppel wurde aber erst 1965 fertiggestellt; zuvor war sie mit geschwärztem Blei überzogen. Das heißt, der nette Ordenspriester hatte wohl keinen Vierzehnjährigen zum Schnauzer des Kaisers hinaufgeführt, sondern einen jungen Mann von mindestens zwanzig. Das verändert die Geschichte ein bisschen. Wieder mal.
Am Fuß des Turms befanden sich mehrere düster-schauerliche Nischen, die als »Schoa-Keller« bezeichnet wurden. Gegen Bezahlung konnte man dort die Namen zerstörter jüdischer Gemeinden und seiner von den Nazis ermordeten Verwandten auf Marmorplatten eingravieren lassen. Es gab auch ein kleines Museum mit grauenhaften Bildern nackter Juden und Jüdinnen – Augenblicke vor der Erschießung – und auch das Schlimmste, was ich mir bis dahin hatte vorstellen können: Seifen, die angeblich aus dem Fett jüdischer Leichen hergestellt waren. Lange sah ich in diesen Seifenstücken den gesamten Holocaust. Zum ersten Mal war ich mit meiner Klasse dort. Viel mehr lernten wir damals nicht über den Völkermord an den europäischen Juden. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, nachzufragen, ob das mit der Seife stimmte. Später hat die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem es als unrichtig bezeichnet.
Ich blicke vom Computer auf, sehe durchs Fenster den versteinerten Kaiser und erkenne, dass all diese Geschichten mir die Corona-Depression nicht abnehmen werden, denn die geht offenbar tiefer als alle Erinnerungen, Mythen und Fiktionen, die mein Leben weitgehend geformt haben – die Deutschen und der Holocaust und der Zionismus und der Krieg mit den Arabern. Der Großherzog von Baden ist natürlich nicht schuld daran, auch nicht sein Erster Komiker. Im Gegenteil. Vielleicht hat Hermann Meltzer-Burg mir etwas von seiner Begabung vererbt, sich Abend für Abend in jemand anderen zu verwandeln und seine wahre Identität für sich zu behalten: Er war ein Großvater meiner Mutter. Die prächtige Zulassung, die er vom Großherzog erhielt, wird bis heute im Landesarchiv Baden-Württemberg verwahrt.
Eben jetzt schlagen die Glocken in Pater Pauls Turm wie gewöhnlich zur vollen Stunde, und mir fallen die ersten Worte ein, mit denen mein Lehrer Saul Friedländer seine Lebensgeschichte beginnt: »Ich wurde zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt – vier Monate vor Hitlers Machtergreifung – in Prag geboren.« Dies scheint mir ein günstiger Anfang zu sein. Ich wurde in Jerusalem in eine Zeit hineingeboren, die große Hoffnung für die Menschheit bereithielt. Vier Wochen waren seit Hitlers letzter Rundfunkansprache vergangen, und seither war seine Stimme nicht mehr zu hören gewesen. Deutschland lag in Trümmern und kapitulierte zehn Wochen später. Ich weiß nicht, ob meine Geburt, vier Jahre nach der meiner Schwester, den Glauben meiner Eltern an die neue Welt widerspiegelte. Vielleicht nicht. Wie dem auch sei, zehn Jahre, nachdem sie aus ihrer Heimat hatten fliehen müssen, erschien ihnen jeder weitere Tag in Palästina sinnlos, und sie planten ihre Heimkehr – in das Land von Großvater Hermann Meltzer-Burg und anderen anständigen Deutschen, die sie dort anzutreffen hofften. Doch sie blieben in Jerusalem hängen.
ANSTÄNDIG BLEIBEN
Atempausen
Meine Eltern trafen und verliebten sich am Bauhaus in Dessau. Meine Mutter studierte Fotografie, mein Vater Architektur. Beide waren Kommunisten. Meine Mutter war keine Jüdin. Den Vater meines Vaters, Emil Schwerin, störte das nicht, im Gegenteil: Vielleicht machte es ihn sogar stolz, dass sein jüngerer Sohn mit einem deutschen Mädchen ging. Ihre Nase war zu lang, aber sie hatte blaue Augen, und das blonde Haar wallte ihr noch fast bis zur Taille herab. Der Vater meiner Mutter hingegen war nicht erbaut von der Verbindung, vor allem fürchtete er wohl, was seine Bekannten dazu sagen würden. Meine Mutter war immer schnell bei der Hand mit ihrem Urteil, unterteilte die Menschen in Gute und Böse. Den Vater meines Vaters zählte sie zu den Guten, ihren eigenen Vater zu den Bösen. Wenn sie von ihm sprach, nannte sie ihn »den Mann aus Heidelberg«, nach dem Homo heidelbergensis, dem Urmenschen, der vor einer halben Million Jahre dort lebte.
Manchmal dachte ich, meine Mutter könnte ihrem Vater übelnehmen, dass er sie überhaupt gezeugt hatte. Das hätte auch gar nicht passieren sollen: Als seine Tochter geboren wurde, war Hans Meltzer, der Sohn des Schauspielerpaars, dreiundzwanzig Jahre alt, ein lediger Wirtschafts- und Statistikstudent an der Universität Göttingen. Er benannte das Neugeborene nach der berühmten Historikerin und Schriftstellerin Ricarda Huch, die damals noch lebte. Alle wussten, dass Ricarda »unehelich« war – alle, nur sie selbst nicht. Sie entdeckte es zufällig, mit fünfzehn Jahren. Sie verzieh ihrem Vater nie, dass er es ihr nicht erzählt hatte. Alle rätselten, wer die Mutter gewesen sein könnte: eine ausländische Studentin, die Hausangestellte, die Tochter eines Professors oder vielleicht die des örtlichen Bahnhofsvorstehers ? Als meine Mutter drei Jahre alt war, starb ihre Mutter jedenfalls, wohl an Tuberkulose. Meine Mutter kannte ihren Namen, erfuhr jedoch bis an ihr Lebensende nicht, wer sie eigentlich gewesen war. Sie wusste nur, dass ihr Vater ihre Mutter einige Monate nach ihrer Geburt geheiratet hatte. Doch hier greift meine Skepsis wieder ein: Ist es denkbar, dass sie ihren Vater nie danach gefragt hat ? Oder wenigstens ihre Großmutter ?
Kindheit und Jugend verbrachte meine Mutter in allerlei Kinderheimen und Internaten. Als sie in die Schule kam, brach die Spanische Grippe aus. Der Erste Weltkrieg war gerade erst vorbei. »Alle waren tot oder krank«, schrieb meine Mutter in ihren Erinnerungen. In Deutschland erlagen Hunderttausende der Epidemie, weltweit waren es zig Millionen. Es herrschte auch Hunger: Tagelang durften die Kinder nur ins Freie, um Pilze zu sammeln und Frösche zu fangen. Eines der Internate, die meine Mutter besuchte, gehörte zur Herrnhuter Brüdergemeine – einer strengen, protestantisch-pietistischen Reformkirche. Es war eine angesehene und teure Anstalt, Albert Schweitzer spielte dort einmal Orgel. Aber meine Mutter erwarb sich den Ruf einer Rebellin: Sie hasste Röcke und Zöpfe, spielte lieber mit Jungs, sogar »Zigeunerkindern«, und sie verabscheute jeden religiösen Glauben. Es gibt keinen Gott. Sie verweigerte die kirchliche Konfirmation.
Ihr Vater beendete sein Studium unterdessen mit der Promotion, fand eine gute Stelle bei der Stadt Mannheim und wurde später Bankdirektor. Er spezialisierte sich aufs Versicherungswesen und lehrte an der Mannheimer Handelshochschule, zuweilen auch an der Universität Heidelberg. Er besuchte seine Tochter regelmäßig, unterhielt ihre Lehrerinnen im Internat gelegentlich mit Gitarrenspiel und Flirts. Eine von ihnen wurde seine zweite Frau, was meine Mutter ihm ebenfalls nicht verzieh. Erwartungsgemäß fand sie ihre Stiefmutter dumm und böse. Ricarda verfiel in eine seelische Krise, sagte eine Zeitlang kein Wort und wurde schließlich zu ihren Schauspieler-Großeltern geschickt. Sie liebten sie innig, und die Enkelin erwiderte ihre Liebe.
Hermann und Elise Meltzer hatten unterdessen eine Tournee durch die Vereinigten Staaten gemacht und ihre Tochter Clara, die sie mitgenommen hatten, in New York gelassen. Nach der Rückkehr aus Übersee verließen sie Karlsruhe und gingen ans Görlitzer Theater. Sie lebten mit ihrer Enkelin in einer Altbauwohnung im fünften Stock, mit Gemeinschaftstoilette und ohne fließendes Wasser. Großvater Hermann empfing Schauspielschüler oder probte für seine Stücke. Meine Mutter lauschte im Nebenzimmer und lernte dabei einige seiner Rollen auswendig, einschließlich der Atempausen. Die seien sehr wichtig, die Atempausen, sagte sie einmal zu mir. Wenn Großvater Hermann ihr eine Freude machen wollte, versicherte er ihr, sie habe seine große dramatische Begabung geerbt. Meine Mutter behauptete später, ich hätte diese Begabung wiederum von ihr geerbt.
Die Großmutter kümmerte sich mit Hingabe um ihre Topfpflanzen und lud gern Verwandte und Freunde zu Kaffee und Kuchen ein. Mindestens einmal die Woche setzte sie ihre Lesebrille auf und blätterte in der Gartenlaube, einem beliebten, seriösen Familienblatt. Tochter Clara schickte ihnen die Hefte von National Geographic aus New York. Die Fotografien darin beflügelten die Fantasie meiner Mutter und regten sie vielleicht schon damals dazu an, einmal selbst Fotografin zu werden. Bei der Lektüre lernte sie etwas Englisch. Über dreißig Jahre später schickte Tante Clara das Magazin mit den großartigen Reportagen von allen Enden der Erde – von Menschenfressern im afrikanischen Dschungel bis zu Eskimos am Nordpol, von den Pyramiden in Ägypten bis zum Weißen Haus in Washington – nach Jerusalem, für mich. Auch meine Fantasie beflügelten sie, und auch mich verlockten sie zum Englischlernen.
Bald beschäftigten sich alle mit der Frage, »was mal aus ihr werden sollte«, das heißt, was Ricarda machen sollte, wenn sie groß war. Ihrem Vater schwebte vor, dass sie die Handelshochschule besuchte, damit sie später ein gesichertes Einkommen hatte. Sie zeichnete gern und bastelte allerlei Dinge aus Pappe, und als ihr ein Prospekt der legendären Bauhaus-Schule in die Hände fiel, wusste sie sofort, was sie wollte: Fotografie studieren. Insgeheim reichte sie eine Bewerbung ein, und als die Zulassung eintraf, kannte ihre Freude keine Grenzen. Nun musste sie noch einen günstigen Moment abpassen und die Zustimmung ihres Vaters einholen. Dieser Moment kam, als eine lautstarke Auseinandersetzung mit seiner zweiten Frau ihn aus dem Haus trieb. Meine Mutter begleitete ihn, »und wir haben gesprochen«, wie sie sagte. Das kam nicht oft vor: Bankdirektor Professor Meltzer war ein vielbeschäftigter Mann. Inzwischen hatte er noch einen Sohn bekommen, und auch das verzieh Ricarda ihm nie. Er begeisterte sich nicht für das Bauhaus, das damals schon als provokative, unkonventionelle, linke Einrichtung bekannt war. Aber er sagte auch nicht nein. Ihm gefiel, dass seine Tochter wusste, was sie wollte, und nicht wieder heimkehren würde, was ihm angesichts der Spannungen mit seiner Frau nicht ungelegen war. Er erklärte sich bereit, für ihre Studiengebühren und ihren Lebensunterhalt aufzukommen, und schenkte ihr seinen alten Fotoapparat.
Im Herbst 2013 durfte ich einen kurzen Rundgang durch die leeren, dunklen Korridore des ursprünglichen Bauhaus-Gebäudes in Dessau machen. Jedenfalls hielt ich es für das Originalgebäude. Die freundliche Dame, die mich begleitete, war voller Ehrfurcht, als hätten wir ein Heiligtum betreten. In einem nahen, moderneren Bau wurde an jenem Abend eine Ausstellung mit den Werken meiner Eltern eröffnet. Diese sorgfältig zusammengestellte Schau zeigte einige Möbelstücke, die mein Vater gebaut, und Spielsachen, die er angefertigt hatte, dazu Fotografien meiner Mutter. Ich war leicht verlegen. Die Schränke, die man aus Jerusalem hergeschafft, restauriert und zu Museumsstücken gemacht hatte, waren in meiner Jugend unsere Kleiderschränke gewesen; die hölzernen Autos, die Walze, der Kran, das Flugzeug und das Boot hatten zu meiner Spielzeugsammlung gehört. Nie war ich auf die Idee gekommen, sie könnten mal in die Kunstgeschichte eingehen. Deshalb wollte sich auch kein richtiges Hochgefühl einstellen, als ich als Sohn der Künstler eine Privatführung durch das historische Gebäude erhielt.
Natürlich weiß ich, dass nichts die Architektur, das Design und die Ästhetik im 20. Jahrhundert stärker beeinflusst hat als die Bauhaus-Kultur, aber darin erschöpft sich mein Wissen mehr oder weniger. Meine Mutter erzählte mir viel über ihre Studienzeit an der Schule, schilderte Zeiten des Schaffens und Liebens. Ich hörte dabei eine gewisse Nostalgie nach den ausgelassenen Festen heraus, die einige der größten Künstler, Maler, Bildhauer und Schriftsteller aus Berlin anlockten. Über die Jahre wurde sie kritischer. Das Bauhaus war ihr nun zu dogmatisch. Dabei erlangte es fast rituelle historische Verehrung, wurde Gegenstand gelehrter Aufsätze und Bücher. Einige Forscher suchten auch meine Mutter auf, aber sie lieferte ihnen nicht immer das Gewünschte: »Nicht alles, was einer von uns auf ein Blatt Papier gekritzelt hat, bedarf der wissenschaftlichen Untersuchung«, mäkelte sie. Das Streben nach einer anerkannten Geschichte des Bauhauses verzerre die Tatsachen, meinte sie: Alles sei dort experimentell gewesen, man habe Dinge ausprobiert und aus Fehlern gelernt. Einig sei man sich nur darin gewesen, dass alles, was dem Bauhaus vorausging, nichts taugte, und selbst da hatte meine Mutter mittlerweile ihre Zweifel.
So sein wie alle
Mit den Zweifeln ging es schon am ersten Tag los, erzählte sie mir. Sie war damals achtzehn Jahre alt, voll Bewunderung für das, was sie vorzufinden erwartete, und zum ersten Mal im Leben schrieb ihr niemand vor, was sie sagen oder tun oder denken sollte und was nicht. Aber gleich nach der Ankunft begriff sie, dass sie ein blaues Cordkleid brauchte, denn das trugen alle Studentinnen am Bauhaus. Sie war in einem normalen Kleid gekommen, das sie nun auf keinen Fall mehr anziehen konnte. Eilig stattete sie sich in einem Textilgeschäft aus. Auch ihr wallendes Haar verstieß gegen die örtlichen Normen. Bauhaus-Studentinnen trugen »Bubikopf«, eine Art Herrenschnitt. Und so ging sie schließlich auch zum Friseur. Später entdeckte sie, dass das Bauhaus von seinen Studierenden mehr erwartete als ein konformes Äußeres: Es wollte ihnen eine neue Persönlichkeit und eine andere Identität vermitteln. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Kaiserreichs schien es möglich, ein modernes Wertesystem mit neuen Definitionen von Gut und Böse durchzusetzen, und dafür gab es kein würdigeres Heiligtum als das Bauhaus. Dort herrschten strenge Regeln: Die Lehrer hießen »Meister«, was die Studierenden zu einer Art »Lehrling« machte, der Gehorsam schuldete. Die oberste Regel betraf die Verbindung von Kunst und Handwerk. Die Meister sprachen pausenlos von »freier Kunst«, meinten damit jedoch: »Vergiss alles, was du vor deiner Ankunft hier getan hast, und mach es wie ich.« Ungeachtet der deutschen Rechtschreibregeln benutzten sie ausschließlich Kleinbuchstaben. Das sollte wohl für Gleichheit stehen. Meine Mutter erwähnte keine Drogenkultur, erzählte jedoch, dass einige der Freikörperkultur huldigten.
Sie wusste die am Bauhaus propagierte Architektur zu schätzen und vertrat die sozialen und künstlerischen Ziele, die man an dieser Einrichtung verfolgte, unter anderem hochwertiges, egalitäres und bezahlbares Wohnen. Ihr gefielen die Stühle, die Lampen und sonstige Gegenstände, die man dort entwarf, die klaren, schnörkellosen Linien, und sie mochte die Gestaltung der Buchstaben und die Grafik, die in der hauseigenen Druckerei entstand: Alles war neu, subversiv, aufregend. Alle waren Partner, alle hatten ihre Ansichten, und alle diskutierten pausenlos mit allen, manchmal auch mit den Reinigungskräften. Alles, nur nicht »bürgerlich« sein. In diesem Stadium fühlte sich meine Mutter noch als Teil des Kollektivs mit seinen Konventionen; sie trat in die kommunistische Partei ein. »Ich wollte wie alle mit allen am Kampf für eine bessere Welt teilnehmen«, erzählte sie. Sie las Marx und Lenin. Die Genossen führten ihre ideologischen Diskussionen bis tief in die Nacht hinein oder gar bis zum Morgengrauen, und das zuweilen Nacht für Nacht.
Meine Mutter begeisterte sich vor allem für die Fotoabteilung. Dort gab es stattliche Räume und reichlich Ausrüstung: Kameras, Lampen, Dunkelkammern. »Ich habe sehen gelernt«, erzählte sie mir. Einige Monate vor ihrem Eintritt ins Bauhaus war ein neuartiger Fotoapparat auf den Markt gekommen, die »Rolleiflex«. Es handelte sich um einen hochrechteckigen Kasten mit zwei Blenden an der Vorderseite und einem umlegbaren Deckel, der beim Öffnen eine Glasplatte freigab, auf der sich das durch die Blenden sichtbare Motiv umgekehrt spiegelte. Das war der letzte Schrei der Fotokunst. Wenn ich es richtig verstanden habe, konnte man mit der Rolleiflex weit künstlerischer arbeiten als mit der Leica.
Manchmal erwähnte meine Mutter das Buch eines Fotografen, der für Natürlichkeit und eine »neue Sachlichkeit« eintrat. Er hieß Albert Renger-Patzsch. Sein Buch Die Welt ist schön erregte damals große Aufmerksamkeit und gilt bis heute als eines der wichtigsten Werke über Fotografie. Thomas Mann begeisterte sich dafür und auch meine Mutter. So hoffte sie selbst einmal zu fotografieren, so hoffte sie praktisch, einmal zu sein. Und so verstand sie auch die Philosophie des Bauhauses. Bertolt Brecht hingegen verwarf das Buch, und seine Bewunderer am Bauhaus taten es ihm nach: Schön sei die Welt vielleicht für die Bourgeoisie, aber nicht für das Proletariat, erklärten sie und bezeichneten das Werk als naiv. Meine Mutter sagte, sie verstehe nicht recht, warum alles Bürgerliche schlecht und alles Proletarische gut sein solle. »Es erschien mir nicht wünschenswert, dass alles proletarisch sein sollte«, schrieb sie später einmal. Um besser zu sein, müsste die Welt gerade weniger proletarisch werden, fand sie. Einige ihrer Genossen bezichtigten sie daraufhin »Trotzkistischer Abweichungen«, wobei sie kaum verstand, was damit gemeint war. Sie war durchaus für die Freiheit des Menschen, aber der kommunistische Rigorismus erinnerte sie an religiöse Glaubensstrenge. Sie fragte sich, wie sich das mit dem Tun am Bauhaus vereinbaren ließe, das eine durch und durch »bürgerliche« Einrichtung war. So tief in ihrem Innern, dass sie es anfangs sogar vor sich selbst zu verheimlichen suchte, war sie enttäuscht von den Lehrveranstaltungen der beiden besonders bewunderten Lehrer Maler Wassily Kandinsky und Paul Klee. Beiden misstraute sie: »Mit allen Bemühungen konnte ich keinen Sinn darin finden.« In Momenten kühner Selbstbetrachtung fragte sie sich, ob es sein könnte, nur mal kurz angenommen, dass die beiden ein Stück weit Scharlatane waren ? Diskret drückte sie sich vor den Stunden der beiden.
Wenn ich an meine Mutter denke, kommt mir nicht nur ihre Meinungsstärke in den Sinn, sondern mehr noch ihre Kompromisslosigkeit und Ungeduld im Umgang mit Andersdenkenden. Oft tat sie sie hochmütig ab. Nach dem, was sie mir über das Bauhaus erzählte und später auch niederschrieb, scheint mir jedoch, dass nicht die Weltanschauung dieser Einrichtung ihren Widerstand weckte, sondern der Versuch, sie ihr aufzudrängen. »Mir genügten schon die Herrnhuter«, erklärte sie einmal, als sei das Bauhaus eine Art geschlossene Sekte, die ihr einen bestimmten Glauben abverlangte. Es gab dort eine starke, faszinierende Gemeinschaft, aber auch die folgte häufig den ideologischen Konventionen vor Ort: Wer anders dachte oder anders empfand, riskierte, an den Rand gedrängt zu werden. In diesem Zusammenhang erinnerte sich meine Mutter an einige Studenten aus dem damaligen Palästina, Kibbuz-Mitglieder, die sich oft mit der Wendung »bei uns im Kibbuz« rechtfertigten. Mit der Zeit dachte ich, wie gut, dass sie am Bauhaus den Mann gefunden hat, der mein Vater werden sollte. Auch er glaubte nicht an Gott und schrieb nur klein. Auf gemeinsamen Fotos sehen die beiden sehr glücklich aus.
Mein Vater war großgewachsen, aber hager und nicht besonders kräftig. Auch seine Nase war zu groß, ebenso die Ohren. Schon mit zweiundzwanzig Jahren hatte er einen Glatzenansatz. Auf Bildern wirkt er meist ernst und gedankenversunken, sympathisch, vertrauenerweckend, aber nicht gerade attraktiv. Er rauchte Pfeife, spielte Saxophon und Klarinette und fuhr Motorrad. Meine Mutter fand ihn mutig. Als sie zusammenzogen, taten sie es illegal, denn es war gesetzlich verboten, unverheirateten Paaren eine Wohnung zu vermieten. Ihr Heinz war stolz auf diesen Gesetzesübertritt, er hasste freiheitsberaubende Gesetze. Er war als Sohn jüdischer Eltern in Kattowitz in Schlesien geboren, dem heutigen Katowice in Polen, betrachtete sich jedoch in erster Linie als Mensch und als Kommunist. Und auch er fragte sich, nur mal kurz angenommen, ob es sein könnte, dass das Proletariat gar nicht imstande war, die Revolution durchzuführen, die der Kommunismus von ihm erwartete.
Mein Vater besuchte die Freie Schulgemeinde in Wickersdorf bei Saalfeld, eine der besten und fortschrittlichsten Internatsschulen Deutschlands. Einige ihrer Lehrer unterrichteten auch am Bauhaus, und vielleicht brachten sie ihn dazu, nebenher das Tischlerhandwerk zu erlernen, nach dem Ideal der Vereinigung von Kunst und Handwerk. Er war ein rastloser Junge, fasziniert vom politischen Wandel in Deutschland. Doch die Weimarer Republik geriet schnell in einen Abwärtstrend. Die Nationalsozialisten gewannen an Zulauf, und die beiden wichtigsten Linksparteien bekämpften sich gegenseitig. Am 1. Mai 1929 veranstaltete die KPD in Berlin eine illegale Demonstration. Die Polizei zerstreute sie mit Gewalt. Die Unruhen hielten drei Tage an und endeten mit dreißig toten Zivilisten und über tausend Verhafteten. Die Polizei unterstand der sozialdemokratischen Stadtführung. Mein Vater, keine achtzehn Jahre alt und noch in Wickersdorf, war entsetzt.
Er sei bereit, in Kauf zu nehmen, dass der Kampf Menschenleben kosten würde, schrieb er an eine Freundin in Berlin, aber er könne nicht begreifen, wieso die Mehrheit der Proletarier tatenlos dabeigestanden, geschaut, geschwiegen und nicht eingegriffen habe: »eine gruppe von arbeitern kämpft unter einsetzung aller ihrer kräfte, und die anderen sehen zu, erklären sich nicht einmal durch einen generalstreik mit ihnen solidarisch. das ist geradezu ungeheuerlich. sie schreiben ›das organisierte proletariat ist nicht gewöhnt, ohne seine führer zu handeln‹. schlimm genug, aber es ist auch nicht gewöhnt, ohne seine führer zu denken.« Er fragte sich: »wo liegt der fehler ? hat man das wilhelminische verdummungsverfahren beibehalten, und ist das proletariat nur ein werkzeug der parteibonzen …, oder wird das proletariat überhaupt nicht lernen zu denken ?«
Er offenbarte seiner Freundin in dem Brief einen Anflug von Selbstkritik: Er fühle sich wohl in der Wickersdorfer Schule. »bei mir ist dieses zufriedensein schon sehr stark eingetreten und wenn ich nicht energisch dagegen ankämpfe, bin ich in einem jahre ein bürger übelster sorte.« Gleich darauf verspottete er die bürgerliche Atmosphäre in seinem Elternhaus: »so etwas schönes wie ein krebsessen bei den alten schwerins werden sie nicht erleben. ich tue die viecher nicht essen. und zwar aus verschiedenen erwägungen heraus: erstens schmecken sie mir nicht (ich weiß das, trotzdem ich noch nie einen gegessen habe), zweitens ist es mir ein unangenehmes gefühl zu wissen, dass die biester lebendig gekocht werden und außerdem ist krebsessen der inbegriff der bürgerlichkeit für mich. wenn man diese menschen um unseren tisch herumsitzen sieht, wie sie mit recht unappetitlichen geräuschen an den biestern kauen, dann kann man nur laut lachen, was ich auch zum größten ärger meines vaters immer tat.«
In den nächsten Monaten nahm er ein Jurastudium auf, doch bald widmete er seine ganze Zeit dem kommunistischen Jugendverband. Zuerst schickte man ihn zu einer kleinen Zelle im Süden Berlins, um den Genossen die Grundlagen des Marxismus zu vermitteln. »da habe ich die funktion eines zelleninstruktors bekommen.« Einige Zeit später berichtete er stolz, er sei befördert worden: »jetzt hat man mich aber aus dieser zelle herausgezogen, und ich sitze im sekretariat des unterbezirkes berlin süd-west.« Dort befasste er sich mit Propaganda für die bevorstehenden Wahlen. Er wurde bestätigt in seiner Ansicht, dass man »theoretisch viel wissen muss« und den Arbeitern dieses Wissen weiterzugeben habe. Die Kommunisten täten nicht genug dafür, meinte er. Er wollte etwas Radikaleres tun, als Jura zu studieren, und glaubte, als Architekt könne er mehr zur Veränderung der Welt beitragen.
Sachsenhausen
Mein Vater war zu spät ans Bauhaus gekommen: Bald forderte die nationalsozialistische Fraktion im Dessauer Gemeinderat die Schließung der Einrichtung, und der Antrag wurde angenommen. Die letzten Monate der Bauhaus-Schule standen im Zeichen eines verzweifelten und aussichtslosen inneren Kampfes. Die Studierenden protestierten vorwiegend gegen das Verbot, sich auf irgendeine Weise mit »entarteter Kunst« zu befassen. Die Leitung der Schule versuchte, deren Existenz zu schützen, und schloss daher kommunistische Aktivisten vom Unterricht aus – darunter meinen Vater. Er erhielt kein Abschlussdiplom. Zwei der drei Ausschussmitglieder, die seinen Ausschluss unterzeichneten, errangen später Weltruhm: der Architekt Ludwig Mies van der Rohe und der Maler Wassily Kandinsky. Der Rauswurf konnte das Bauhaus nicht retten: Wenige Monate später kamen die Nationalsozialisten an die Macht und schlossen es endgültig.
Adolf Hitler wurde am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Am selben Tag wurde meine Mutter einundzwanzig. Mindestens einmal pro Jahr sagte sie, sie habe Hitler zum Geburtstag bekommen. In jenen Monaten wohnte sie zusammen mit meinem Vater in dessen Elternhaus in Berlin. Mein Vater träumte von einem Massenaufstand gegen die Nazis unter Leitung der KPD und legte im Keller des Hauses ein Munitionslager an. Sein großer Bruder beeilte sich, alles zu entsorgen. Meine Eltern übersiedelten schließlich nach Frankfurt am Main und immatrikulierten sich dort an einer anderen progressiven Hochschule, deren Rektor ein Nazigegner war und den Begriff »entartete Kunst« ablehnte. Die Stimmung war noch recht frei, wie meine Mutter es liebte. Das zeigte sich unter anderem in der Kleidung der Studierenden. Meine Mutter kam manchmal in kurzen Hosen. Einmal wurde sie deswegen auf offener Straße angegriffen. Mädchen vom BDM umringten sie und riefen im Chor: »Zu-nähen, zu-nähen«, und meinten ihre Beine. Bald darauf brach die Zeit der Flucht und des Flüchtlingsdaseins für meine Eltern an. Gute, anständige Menschen – Deutsche, Juden, Kommunisten, Menschenrechtsaktivisten, die teils selbst in Gefahr schwebten – boten ihnen ein geheimes Nachtquartier, verschafften ihnen Reisepässe und führten sie auf verschwiegenen Bergpfaden an die Grenze. Was ich darüber von meiner Mutter hörte, beeinflusste weitgehend meine Vorstellungen von Gut und Böse: Es gibt nichts Edleres als Fluchthilfe. Der böse Mann in der Geschichte meiner Mutter war ihr eigener Vater.
Die Flucht begann rund drei Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Eines Tages kehrte meine Mutter zu der Frankfurter Wohnung zurück, die sie und ihr Freund Heinz gemietet hatten. Schon von Weitem sah sie einen SA-Mann am Eingang stehen. Sie ging an ihm vorbei weiter zu einem Café, wo ein alter Freund vom Bauhaus aus dem Nichts auftauchte: Jascha Weinfeld. Er stammte aus Palästina, aus dem Kibbuz Beit Alfa, und studierte in Frankfurt zusammen mit meinen Eltern. Er berichtete meiner Mutter, SA-Männer seien in die Wohnung eingedrungen, hätten sie durchsucht und Heinz mitgenommen. Gelähmt vor Schreck fragte meine Mutter ihn nicht einmal, woher er das wisse. Offenbar war er bestens vernetzt: Er brachte sie in eine Fluchtwohnung, dann in eine andere und sorgte sogar dafür, dass man sie mit Kleidung zum Wechseln und mit Geld versorgte. Sichtlich erfahren in diesen Dingen, riet er ihr, sich tagsüber draußen auf der Straße oder in Parks aufzuhalten und erst gegen Abend heimzukehren. »Wenn dir kalt ist, geh ins Kino oder auf den Bahnhof«, sagte er.
Vier Tage später war Heinz wieder da. Er war in Sachsenhausen eingesperrt gewesen und hatte dort sozialdemokratische Aktivisten getroffen. Einige hatten Demütigungen und Misshandlungen erlitten. Zweimal am Tag holte man auch ihn zum Verhör, tat ihm jedoch nichts an. Bei seiner Ankunft hatte man ihm Schnürsenkel und Gürtel weggenommen und seine Taschen geleert, jedoch eine kleine Münze übersehen. Die benutzte er als Schraubenzieher, um das Gitter vor seinem Fenster zu lösen. Unter dem Fenster befand sich ein Schrägdach mit Blitzableiter. Daran hangelte er sich ein Stückchen das Dach entlang. Durch ein Fenster sah er einige Wachen am Tisch Karten spielen. Er sprang auf den Hof und schlich sich zur Mauer. Flaschensplitter waren oben eingelassen, aber die Winterregen hatten sie stumpf gemacht, sodass er hochklettern und unbeschadet auf die Straße springen konnte. Irgendwie schlug er sich zu Bekannten durch, die ihn über Nacht versteckten. Jascha Weinfeld wusste, dass Heinz geflohen war und wo er sich verbarg – und wieder kam meine Mutter nicht darauf, ihn zu fragen, wie er es erfahren hatte. Er verfrachtete sie in ein Auto, von dem sie nicht wusste, wem es gehörte. Unterwegs stiegen sie in einen wartenden Wagen um, gelangten schließlich in ein Wäldchen am Stadtrand. Dort wartete Heinz bereits auf sie und erzählte, was er durchgemacht hatte. Weiter ging es nach Offenbach. Inzwischen war der Tag angebrochen. Heinz ließ sich rasieren, danach kauften sie in einem Kaufhaus ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln und fuhren mit der Bahn nach Berlin – erster Klasse, um das Verhaftungsrisiko zu verringern.
Über die Jahre erzählte meine Mutter oft, dass Heinz aus einem Konzentrationslager geflohen war und wie er das fertiggebracht hatte mittels der Münze. Ich lernte, ihn als wahren Helden zu betrachten. Manchmal verwies sie auf diesen Helden, wenn es beispielsweise Beschwerden über mein Verhalten in der Schule gab: »Heinz ist aus einem KZ geflohen, und ich muss hören, dass du im Klassenzimmer störst«, schimpfte sie dann. Wir sagten nie Papa, immer Heinz. Meine Schwester und ich redeten auch sie nie mit Mama an, sondern mit dem Kosenamen, den er ihr gegeben hatte, Carda. Die Verwendung der elterlichen Vornamen beruhte wohl auf derselben antibürgerlichen Ethik, die der Kleinschreibung zugrunde lag.
Einmal fragte ich meine Mutter, wo mein Vater interniert gewesen war, und sie antwortete, »in Sachsenhausen«. Als ich zum ersten Mal nach Frankfurt kam, beschloss ich, das Lager zu suchen. Ich betrachtete es fast als Geheimmission, denn wie sollte man sich nach so etwas erkundigen ? »Verzeihung, wo gibt es bei euch ein Konzentrationslager ?« Ich fragte nach Sachsenhausen. Erst jetzt erfuhr ich, dass es sich um ein ganzes Stadtviertel handelte. Es war mir unangenehm zu fragen, ob dort auch ein Lager existiert hatte. Schließlich gab ich es auf. Jahrelang, bis ich schon fast mit dem Studium fertig war, dachte ich also, dass mein Vater aus dem KZ Sachsenhausen geflohen war, was mich recht stolz machte. Vielleicht hätte es sogar sein können, aber es war nicht so.
Schließlich bat ich meine Mutter, ihre Erinnerungen niederzuschreiben. Das sollte ihr Geschenk zu meinem dreißigsten Geburtstag werden. Sie zeigte mir die ersten Kapitel, und da war mein Vater nicht aus dem KZ Sachsenhausen geflohen, sondern aus einem Amtsgerichtsgefängnis. Ich habe es nachgeprüft: Es lag im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen und war offenbar nicht besonders streng bewacht. Vielleicht hätte man ihn später zu Fuß oder per Lkw ins KZ Osthofen gebracht, das bald darauf geschlossen wurde. Das KZ Sachsenhausen bei Berlin wurde erst 1936 eröffnet, als mein Vater nicht mehr in Deutschland war.
Was hätte der Richter getan
Als ich begriff, dass mein Vater nicht aus einem Konzentrationslager geflohen war, begann ich seine Verhaftung überhaupt anzuzweifeln. Deshalb war ich froh, als der Filmemacher Amos Gitai mir die Kopie eines Protokolls schickte, das am 14. Juni 1933 bei einem Haftverlängerungsverfahren für vier Verdächtige an einem Frankfurter Gericht aufgenommen worden war. Einer der vier war Gitais Vater, der Architekt Munio Weinraub, der ebenfalls am Bauhaus studiert hatte. Ihnen wurde vorgeworfen, einen Aufruf zum gewaltsamen Widerstand gegen die Regierung gedruckt zu haben, was als Landesverrat galt. Drei der Verdächtigen verblieben in Haft. Über den vierten hieß es, sein Aufenthaltsort sei unbekannt. Das war mein Vater. Ich freute mich, nun wenigstens mit Sicherheit zu wissen, dass er sein Vaterland verraten hatte. Ich war nicht böse, dass er keinem richtigen Konzentrationslager entflohen war, begriff aber nicht, warum meine Mutter mich statt mit der Wahrheit mit einem Mythos aufgezogen hatte. Auf meine Frage reagierte sie zutiefst verletzt: »Ich sehe, du überprüfst meine Aussagen, glaubst mir wohl nicht. Dann brauche ich auch nicht zu schreiben.« Sie vernichtete alles, was sie bis dahin zu Papier gebracht hatte. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie noch ein paar Seiten, aber der Großteil dessen, was sie zu erzählen hatte, war mir durch meine Nachfrage entgangen. Ich hatte natürlich sehr dumm gehandelt und lernte daraus einen wichtigen Grundsatz für biographische Interviews: Man diskutiert nicht mit dem Interviewpartner, man hört ihm zu. Als ich später einige KZ-Kommandanten interviewte, dachte ich, dass ich meiner Mutter für diese Lektion dankbar sein müsse. Und da war noch etwas Schreckliches, das meine Mutter meiner Schwester erzählte.
Als mein Vater noch in Haft war, oder vielleicht gleich nach seiner Flucht, fuhr sie zu ihrem Vater, dem Bankdirektor, nach Mannheim. Sie suchte ihn oben in seinem Büro auf. Dort erzählte sie ihm, dass ihr Freund verhaftet sei, ihr das ebenfalls drohte, und bat ihn um Hilfe, sie bräuchten Geld. »Was, du wirst gesucht ?«, fragte ihr Vater. »Dann muss ich ja sofort die Polizei informieren, dass du hier bist.« Meine Mutter sprang auf, verließ das Büro und wechselte bis zu seinem Tod kein Wort mehr mit ihm. Sie erzählte uns immer, er sei kein Nazi gewesen, nur ein feiger, gehorsamer Bürger, der um seine Stellung fürchtete. Was sie gegen Ende ihres Lebens noch aufschreiben konnte, fand ich erst nach ihrem Tod, und dort stand, sie habe ihren Vater nur einmal getroffen, während sie in Frankfurt lebten, und das auf dem Bahnhof. »Wie immer fand er nur dann Zeit für mich, wenn er zwischen zwei Zügen wartete«, schrieb sie verletzt. Er hatte sich zufrieden darüber geäußert, dass sie vom Bauhaus abgegangen war. Das war anscheinend vor Heinz’ Verhaftung. In dem Text wird nichts erwähnt von der Begegnung im Büro, als es schien, ihr Vater würde sie an die Nazis ausliefern. Manchmal fragte ich mich, was ein Richter getan hätte, wenn er die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte hätte beurteilen müssen. Bei meinem ersten Aufenthalt in Deutschland hätte ich ihn beinahe getroffen, meinen Großvater, den »Mann aus Heidelberg«. Als ich schon zu ihm unterwegs war, telegrafierte er, es gehe ihm nicht gut. Ich bin nicht sicher, ob ich es gewagt hätte, ihn zu fragen. Vielleicht nein. Jedenfalls kannte ich diese Geschichte damals noch nicht.
Meine Eltern schafften es über die Grenze in die Tschechoslowakei. »Auf dem Weg hörten wir Schüsse«, erzählte meine Mutter, »und wir stießen auch auf eine Streife der deutschen Grenzpolizei. Wir trugen einen Rucksack und sahen aus wie Ausflügler. Die Grenzer erteilten uns einen Rat: Nehmt nichts mit, wo ein Hakenkreuz drauf ist. Die Tschechen mögen uns nicht.« Das sei das letzte Mal gewesen, dass sie in Deutschland einen guten Rat erhalten habe. Fast fünfzig Jahre später verriet eine alte Freundin meiner Mutter mir ein Geheimnis, das sie angeblich von ihr erfahren hatte: Bevor sie Deutschland verließen, hatten sie gemerkt, dass meine Mutter schwanger war, und abgetrieben.
In Prag erlebten sie eine glückliche Zeit der Freiheit und Schaffensfreude. Die Stadt florierte unter dem beliebten Staatspräsidenten Tomáš Masaryk. Sie gingen häufig in Cafés, trafen Maler, Dichter, Journalisten und freundeten sich mit anderen politischen Flüchtlingen an. Einer von ihnen wohnte bei ihnen. Er hieß Heinrich Blücher, war Dichter und Philosoph und heiratete später Hannah Arendt. Über die Jahre hielt er Verbindung zu meinen Eltern, und als ich in den USA studierte, zeigte sich Arendt mir gegenüber sehr freundlich. Zunächst plante mein Vater in Prag Wohnungsrenovierungen, meine Mutter fotografierte: Gassen und Plätze, Mauern und Schlösser, Kirchtürme und vor allem endlose Flächen roter Ziegeldächer. Die Fotos zeugen von großer Liebe, ähnlich wie die Bilder, die sie später in Jerusalem aufnahm. Beide Städte liebte sie besonders im Schnee. Schon bald gründeten die beiden eine kleine Werbeagentur und gaben ihr einen originellen Namen, im Anklang an ihre kommunistische Einstellung: Hammer und Pinsel. Sie entwarfen Plakate und Schaufensterdekorationen.
Alles war großartig, und möglicherweise wären sie dort geblieben, vielleicht sogar für immer. Aber ihre Aufenthaltsgenehmigungen liefen ab, und sie mussten sich notgedrungen eine andere Zuflucht suchen. Die Option Palästina verdrängten sie, solange sie konnten. Zuerst überzeugten sie den Schweizer Konsul davon, dass sie das Matterhorn besteigen wollten, und erhielten Touristenvisa. Eine Weile blieben sie in Genf, wo meine Mutter Englischunterricht gab. Doch auch die Gültigkeit des Schweizer Visums lief ab, und meine Eltern zogen weiter in die ungarische Stadt Pécs zu Freunden, auch er Architekt und sie Fotografin und beide ehemalige Bauhaus-Studenten. Sie brachten ihre Gäste als Erstes zum Heiraten aufs Rathaus und bedrängten sie dann, mit ihnen nach Südafrika zu emigrieren. Das stellte die beiden vor eine schwierige Entscheidung. Palästina standen sie kritisch und skeptisch gegenüber, denn jede Form von Nationalismus war ihnen zuwider. Aber Südafrika fanden sie noch schlimmer. Und so entschieden sie sich fast notgedrungen, die nächsten Jahre in Palästina zu verbringen. Dort hatten sie Freunde vom Bauhaus, die ihnen ihre Hilfe anboten. Mein Vater war damals vierundzwanzig Jahre alt, meine Mutter ein Jahr jünger. Seine Eltern kamen zum Abschied in den Hafen von Triest. Alle vier glaubten, dass sie sich eines nicht mehr fernen Tages in Berlin wiedersehen würden. Das nächste Mal trafen sie sich in Jerusalem. Meine Großeltern waren damals schon recht abgerissen.
Die Telefonnummer
Zu meinem ersten Geburtstag schenkten mir meine Großeltern eine Fünf-Dollar-Note mit dem Konterfei von Abraham Lincoln, fast der letzte Rest jüdischen Wohlstands in Schlesien, den ich bis auf das Jahr 1789 zurückverfolgen kann. Das Testament der Großmutter meines Urgroßvaters, Johanna, Witwe des Kaufmanns Salomon Schwerin, geborene Ollendorf, ist nach dem jüdischen Kalender datiert und verzeichnet unter Paragraph 6: »Mein buntseidenes Kleid soll, wenn es noch brauchbar sein sollte, zu einem Thoravorhang für die hiesige Synagogen-Gemeinde gemacht werden.« Nur einer ihrer fünf Söhne ist im Testament mit einem hebräischen Namen aufgeführt, Samuel Joseph. Seine Brüder hießen Tobias, Philipp, Moritz und Julius. Alle betrachteten sich als deutsche Juden. Ihre Mutter vererbte ihnen ein Haus und ein Geschäft in Namslau, dem heutigen polnischen Namysłów, dazu ein Warenlager und eine kleine goldene Uhr sowie zehn Esslöffel und ein Dutzend Teelöffel aus Silber, ein Paar Ohrringe, einen Gewürzbecher, ein Paar Kerzenständer und auch »eine aus Amerika erhaltene goldene Brosche« – all das unter der Bedingung, dass nichts davon verkauft wurde, sondern alles für immer in Familienbesitz blieb.
Über die Generationen fällt mir auf, dass keiner meiner Vorfahren dort gestorben ist, wo er geboren wurde, sondern dass es sie allesamt in fremde Länder verschlug und ihre Jugendträume unerfüllt blieben. Mein Großvater Emil war in Kattowitz geboren, das die ansässigen Juden schon damals als »Klein-Berlin« bezeichneten, sei es aus Lokalpatriotismus, sei es aus Sehnsucht nach dem echten Berlin. Auch mein Großvater erbte ein Haus von seinem Vater und sehnte sich bis an sein Lebensende nach diesem Besitz. Im vierten Stock lagen teure Wohnungen; im dritten war das brasilianische Generalkonsulat eingezogen, was dafür spricht, dass es sich um eine feine Adresse gehandelt hat. Die beiden unteren Etagen beherbergten ein Kaufhaus, dessen Besitzer seinen Namen auf Polnisch in erhabenen Lettern auf der Fassade hatte anbringen lassen: Karol Schwerin. Das war der Vater meines Großvaters. Durch die Fenster im zweiten Stock sah man von der Straße eine schöne Auswahl an Kinderwagen und Kinderbetten. Unten waren in drei weiteren Schaufenstern – eines rechts der Haustür, zwei links davon – Kinderzimmermöbel und Haushaltswaren ausgestellt. Ich bin nie dort gewesen, kannte aber von frühester Kindheit an die Fotografie des Ladens. Gäbe es ihn noch, würde ich ihn mühelos erkennen.
Das Foto wird in einem hellen Lederkoffer verwahrt, der hervorragend zum Selbstbild meines Großvaters passt. Die Koffermacher hatten ihn nicht nur für lange Fahrten und Überseereisen, vermutlich erster Klasse, vorgesehen, sondern auch für ein langes Leben. Er zeugt von Qualitätsbewusstsein und Berufsstolz: doppelte Nähte, glänzende Metallschlösser, millimetergenau schließender Deckel. Meine Großeltern kauften immer nur das Beste. Neben allerlei Familienurkunden und alten Briefen enthält der Koffer ein älteres Foto des Hauses: Das Geschäft hatte damals nur ein Schaufenster, und der Name stand lediglich auf Deutsch daran – Carl. Das ist ein Beweis für den wirtschaftlichen Aufschwung und für die Hinwendung zur polnischen Kundschaft, die Großvater Emil, der Vater meines Vaters, vorgenommen hatte.
Emil war seinen Bekannten als leichtsinniger und tollkühner Junge in Erinnerung. Gleich nach Abschluss der Volksschule trat er als Lehrling ins Familiengeschäft ein. Er wuchs hinein in ein neues Jahrhundert, das fantastische Neuerungen von einer Größenordnung bereithielt, wie meine Altersgenossen und ich sie bei der Erfindung des Personal Computers erlebten. Ich stelle mir meinen Großvater beim Anblick der ersten Eisenbahn, des ersten Kraftwagens, des ersten Telefonapparats vor. Das Leben schritt stürmisch voran. Er hatte Erfolg, kaufte Ware und vertrieb sie auch in deutschen Städten, und als er zweiundzwanzig Jahre alt wurde, rückte er zum Wehrdienst ins deutsche Heer ein. Jemand zeichnete ihn mit Bleistift, in Uniform, einen kleinen Schnurrbart unter der Nase und eine Schirmmütze auf dem Kopf. Er sitzt an einem Tisch und tut, was er sein Leben lang gern tat: Er liest Zeitung und trinkt Wein. Seine Miene ist ernst. Er sieht prüfend auf die Zeitung, als wäre es die Rechnung, die der Kellner ihm vorgelegt hatte. Als er zwei Jahre später aus dem Militärdienst heimkehrte, übertrug ihm sein Vater die Geschäftsführung. Im selben Jahr heiratete er die Tochter eines jüdischen Gastwirts aus Radzyń Podlask, nördlich von Lublin. Seinen beiden Söhnen gab er deutsche Namen: Kurt und Heinz. Groß und kräftig gebaut, ließ er sich gern mit seiner Stute ablichten. Er war stolz, rechthaberisch, aufbrausend und ein Chauvinist im Umgang mit Frauen.
Kattowitz gehörte zu Preußen. Die Stadt nahm einen raschen Aufschwung. Der Großvater schien familiär und geschäftlich auf Erfolgskurs zu sein. Doch dann brach der Erste Weltkrieg aus. Großvater Emil zog in Kaiser Wilhelms Heer in den Kampf. In einer Notiz heißt es, er habe »an der Front« gekämpft. Nach dem Krieg erhielt er das Eiserne Kreuz, mit farbigen Bändern verziert, aber auch sie konnten die schmerzliche Wahrheit nicht vertuschen: Wie alle kehrte Großvater Emil besiegt heim.
Nach dem Krieg war alles anders. Das deutsche Kattowitz stand vor der Übergabe an Polen und Großvater vor der Frage, ob er in seiner Heimat bleiben oder wegziehen sollte. Seine Eltern waren in jenem Jahr gestorben. Die Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde ächteten ihn und er sie. Das lag unter anderem daran, dass er einer – anscheinend ziemlich esoterischen – Gruppe angehörte, die unter dem Namen »Flamme« firmierte und für die Einäscherung von Leichnamen anstelle der im Judentum vorgeschriebenen Erdbestattung eintrat. Etwas Provokativeres hätte er sich kaum ausdenken können, aber Großvater Emil hatte seine Prinzipien: Er glaubte nicht an Gott. Und er war ein strammer Sozialist, beinahe Kommunist. Er entschied sich schließlich für Berlin. Kurz zuvor war mein Vater auf dem Schulhof von einem älteren Jungen verprügelt und von seinem großen Bruder Kurt herausgehauen worden. Den Eltern erzählten die beiden davon nichts. Es war also nicht der zunehmende Judenhass im »kleinen Berlin«, der meinen Großvater veranlasste, ins große Berlin zu übersiedeln, sondern der Wunsch nach einem Neuanfang, den viele Menschen nach dem Ersten Weltkrieg verspürten. Er war damals zweiundvierzig Jahre alt. Haus und Geschäft behielt er noch, zumindest für eine Weile.
In jüdischen Familien, die seit Generationen in Berlin ansässig waren, blickte man auf die Immigranten aus dem Osten gern herab. Der Begriff »Ostjude« war im Grunde eine Beleidigung. Die Alteingesessenen fürchteten, die Immigration aus dem Osten könnte ihre eigene Eingliederung in die deutsche Gesellschaft gefährden. Großvater Emil fand das lächerlich. Wie viele der alteingesessenen Berliner Juden sprach er wie ein Deutscher, kleidete sich wie ein Deutscher, aß und vor allem trank wie ein Deutscher und engagierte sich in der deutschen Politik. Als Anhänger der Sozialdemokratie hielt er es stets mit dem ultralinken Flügel, der USPD. Er verleugnete seine jüdischen Wurzeln nicht, trat als überzeugter Atheist aber aus der jüdischen Gemeinde aus und entrichtete keinen Mitgliedsbeitrag mehr. Gemeinsam mit einem anderen Juden, der ebenfalls aus dem Osten kam, erwarb er eine Fabrik für Damenhüte. Von dem Gewinn konnte er sich eine schöne Villa An der Rehwiese, eine der feinsten Adressen im noblen Stadtteil Nikolassee, leisten. Die Familie beschäftigte eine Zugehfrau, eine Köchin, einen Gärtner und einen livrierten Chauffeur für die amerikanische Limousine. Wie andere Deutsche ihres Standes fuhren die Schwerins in mondäne Bäder und in den Skiurlaub.
Später soll das Unternehmen hundertfünfzig Mitarbeiter gehabt haben, so notierte es mein Großvater; ich halte das für übertrieben. Ein Foto seines Büros zeigt einen raumfüllenden Schreibtisch und drei Sekretärinnen. Am Schreibtisch sitzt ein schmaler Mann in Anzug und Krawatte. Er hat etwas Gehorsames, fast Unterwürfiges an sich und ist völlig kahl. Das ist wohl sein Partner, Salo Wieruszowski, der sich vorwiegend um die Buchhaltung kümmerte. Mein Großvater steht neben dem Schreibtisch und telefoniert, ignoriert quasi die Anwesenheit des Fotografen. Er trägt eine Weste, aber kein Jackett. Zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand hält er eine Zigarre. Auch er hat eine Vollglatze, ähnelt darin sogar ein wenig seinem Partner, strahlt aber gebieterische Ruhe aus. Ein anderes Foto ist in der Fabrikhalle aufgenommen. Sieben junge Frauen sitzen um einen Tisch und nähen Glockenhüte. Die Arbeitsbedingungen sind annehmbar, wie es sich für das Unternehmen eines Sozialisten gehört: Mein Großvater gewährte kein Miteigentum an seinen Produktionsgütern, aber die Halle hatte große Fenster und Zentralheizung. Er scheint ein anspruchsvoller, aber anständiger Chef gewesen zu sein. Irgendwie hatte er die große Inflation überstanden und daraus gelernt: Damen tragen immer Hüte. Das galt durchaus auch für die ersten Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft. Alles Blödsinn, meinte Großvater Emil daher: Die Nazirüpelei würde genauso schnell verschwinden wie sie begonnen hatte. So dachten viele, auch jüdische Deutsche.
Ich konnte niemals verstehen, warum meine Großeltern so lange blieben. Es war kein überhebliches Befremden – wer weiß, wie ich an ihrer Stelle gehandelt hätte –, aber trotzdem: Wie konnten sie dort ausharren ? Einmal habe ich Josef Burg gefragt, der dreißig Jahre lang als Minister in israelischen Regierungen saß. Wie mein Großvater stammte er aus Oberschlesien und war fast bis zum letzten Moment in Deutschland geblieben: Sechs der zwölf Nazijahre hatte er dort verbracht. Wie sei das gekommen, fragte ich ihn, denn anders als mein Großvater sei er doch überzeugter Zionist. Anstelle einer Antwort diktierte Dr. Burg mir die Nummer des Telefonanschlusses in seinem Elternhaus in Dresden und vergewisserte sich, dass ich jede Ziffer richtig notiert hatte, als könnte man dort noch anrufen und fragen, ob er zu Hause sei.
Großvaters Traum
Mein Großvater fürchtete, die Nationalsozialisten würden die deutsche Wirtschaft ruinieren, und spielte daher mit dem Gedanken, seine Hutfabrik in ein anderes, stabileres Land zu transferieren, zum Beispiel nach Großbritannien oder zumindest in eines der Länder im britischen Hoheitsbereich. Das Nächstliegende war Palästina. Man sollte es zumindest prüfen, dachte er und fuhr mit meiner Großmutter hin. Ich weiß nicht, wen sie vor Ort getroffen haben, aber offenbar sind sie mit dem erstbesten Schiff wieder heimgefahren, in Hitlers Berlin. Die Menge an Damenhüten, die seine Fabrik pro Monat herstellte, überstieg die Anzahl der Hüte, die die Damen des gesamten Nahen Ostens im Verlauf eines Jahres kaufen würden, kalkulierte mein Großvater, daher müsste man entweder verrückt oder Zionist sein, wenn man sich im Land Israel niederließ. Er spendete großzügig für die Rote Hilfe Deutschlands, eine Untergrundorganisation, die Regimegegnern zur Flucht verhalf, und glaubte, es würde sich schon alles regeln. Doch die Nationalsozialisten stabilisierten ihre Macht in Windeseile, und mein Großvater erkannte allmählich, dass das Leben sich änderte. Als er von der Verhaftung meines Vaters erfuhr, rief er umgehend den Frankfurter Polizeipräsidenten an und versuchte sogar, den Oberbürgermeister zu erreichen: So eine Unverschämtheit, seinen Sohn zu verhaften.
Eines Nachts träumte Großvater Emil dann, Reichspropagandaminister Joseph Goebbels statte seiner Hutfabrik unerwartet einen Besuch ab. Der Traum wurde in den Sammelband Das Dritte Reich des Traums von Charlotte Beradt aufgenommen, der viele Jahre später in Deutschland und den USA erschien. Unter großer seelischer Anspannung und körperlicher Anstrengung gelingt es Großvater darin, seinen Widerwillen zu überwinden und den Minister ordnungsgemäß mit deutschem Gruß zu empfangen. Alle Mitarbeiter, die auf Goebbels’ Befehl hin in Zweierreihen Aufstellung genommen haben, verfolgen seine minutenlangen Anstrengungen. Goebbels, der ihn ebenfalls beobachtet, sagt schließlich kühl: »Ich wünsche Ihren Gruß nicht«, und geht. 1938 verkaufte Großvater die Fabrik.
Ich verwende absichtlich das neutrale Verb »verkaufte«. Scheinbar war es ein rechtmäßiges Handelsgeschäft. Eines Tages erschienen SA-Männer in der Fabrik und forderten meinen Großvater auf, sie an »arische« Eigentümer zu verkaufen. Sie hatten gleich einen Interessenten mitgebracht, einen gewissen C. Heinrich Müller. Das war gängige Praxis. Mein Großvater und sein Partner weigerten sich. Die Nazirüpel versuchten zunächst, die beiden zu überreden, dann gingen sie zu Drohungen über, und schließlich schleppten sie seinen Partner ins KZ Sachsenhausen, wo er ihr Angebot überdenken sollte. Ab und zu erlaubten sie seiner Frau, ihn zu besuchen, und schließlich verlangten sie, dass die Kinder mitkamen, »um von ihm Abschied zu nehmen«. Sie folgten der Aufforderung, und als sie gegangen waren, prügelten die SA-Männer ihn tot. Mein Großvater unterzeichnete den Kaufvertrag.