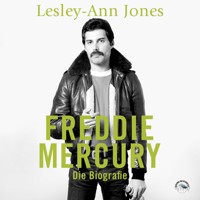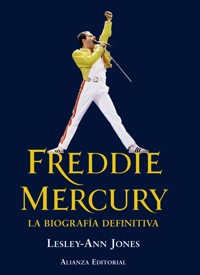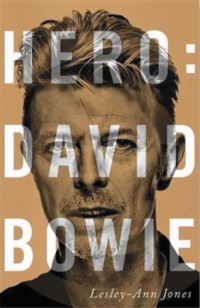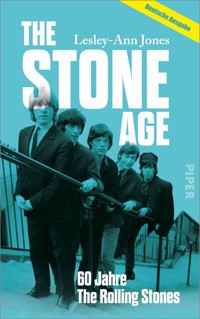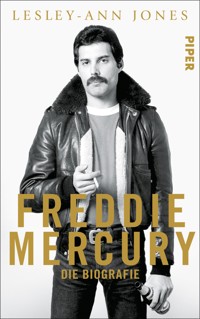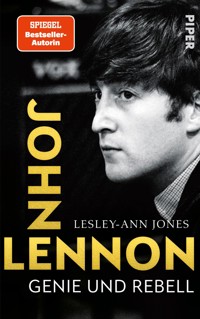
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
John Lennon gründete mit den Beatles die erfolgreichste Band der Musikgeschichte, er schuf mit "Let It Be", "Help!" oder "Imagine" Songs, die jedes Kind kennt und war das Gesicht der Friedensbewegung. Die Erfolgsbiografin Lesley-Ann Jones beleuchtet Lennons Leben aus heutiger Perspektive ganz neu. Sie bereiste von Liverpool über Hamburg bis New York und Tokyo alle wichtigen Stationen in seinem Leben und machte zahlreiche Weggefährten ausfindig – darunter auch solche, die sich bisher nicht öffentlich geäußert haben, wie Andy Peebles: Der BBC-Journalist führte zwei Tage vor Lennons Ermordung das letzte Interview mit ihm. Ein Buch für eine neue Generation von Fans und für alle, die noch genau wissen, wo sie am Tag von Lennons Ermordung waren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür Dad:The fighter still remains.Kenneth Powell Jones11. Oktober 1931–26. September 2019Übersetzung aus dem Englischen von Conny LöschThe moral rights of the author have been asserted.© Lesley-Ann Jones, 2020Originally published in the English language in the UK by John Blake Publishing, an imprint of Bonnier Books UKTitel der Originalausgabe: »Who Killed John Lennon? The lives, loves and deaths of the greatest rock star«Deutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2020Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Norman Parkinson/Iconic ImagesSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Echo
1 Come Together
2 Verlassen
3 Julia
4 Trabanten
5 Mona
6 Inferno
7 Brian
8 spielmacher
9 Amerika
10 Alma
11 Lebensjahre
12 Der Heiland
13 Yoko
14 Treibsand
15 Offenbarung
16 Metamorphose
17 Kyoko
18 May
19 Auferstehung
20 Neues Spiel
21 Finale
Anhang
DAYS IN THE LIVES – CHRONIK DER WICHTIGSTEN EREIGNISSE
MIT ANDEREN WORTEN …
MUSIK
AUSGEWÄHLTE LITERATUR
Websites
WEITERE EMPFEHLUNGEN
DANKSAGUNG
BILDTEIL
BILDNACHWEIS
ANMERKUNGEN
in memoriam
JOHN WINSTON ONO LENNON
9. Oktober 1940–8. Dezember 1980
»Ich habe eine Bestie, einen Engel und einen Wahnsinnigen in mir.«
Dylan Thomas
»Gesegnet seien die Seltsamen –Dichter, Sonderlinge, Schriftsteller, Mystiker, Ketzer, Maler und Troubadoure –Denn sie lehren uns, die Welt …… mit anderen Augen zu sehen.«
Jacob Nordby
»Es ist besser, jung in Glanz und Gloria abzugehen.«
Simon Napier-Bell
Echo
Die Rhythmen von Geist und Gedächtnis ähneln Gezeiten. Ständig verändern sie ihre Gestalt. Selbst wer dabei war, John Lennon persönlich kannte und erlebt hat, vergisst manches. Einige erfinden die Geschichte neu, wollen Lücken füllen, und es sei ihnen vergeben. Vierzig Jahre sind ein Leben. Jedenfalls waren sie das für John. Dennoch scheint er kaum in die Ferne gerückt. 2020 ist ein Jahr voller Marksteine – zum vierzigsten Mal jährt sich seine Ermordung, zum fünfzigsten Mal das offizielle Datum der Auflösung der Beatles[1], zum sechzigsten Mal die Ankunft der Band in Hamburg und zum achtzigsten Mal seine Geburt in Liverpool – und so scheint es an der Zeit zu sein, noch einmal alles zu überdenken und dem Menschen nachzuspüren. Wer unter fünfzig ist, war noch nicht auf der Welt, als die Beatles sich trennten. Wer jünger ist als vierzig, war noch nicht geboren, als John starb. Unvorstellbar? Kommt es einem nicht so vor, als wäre er immer noch da? Mir jedenfalls.
Es gibt ebenso viele Versionen seiner Geschichte wie Stimmen, die sie erzählen. Wo Wahrheit zur Ansichtssache wird, können Fakten und Zahlen unbequem sein. Werden Erinnerungen durch Mutmaßung und Theorien verzerrt, können sie Verwirrung stiften. Wo solchen Vermutungen Irrtümer entwachsen, fällt rationales Denken der Spekulation zum Opfer. All dies verstellt den Blick. John selbst hat es mit einer Textzeile in »Beautiful Boy (Darling Boy)« auf Double Fantasy, seinem letzten, zu Lebzeiten veröffentlichten Album, auf den Punkt gebracht: »Life is what happens to you while you’re busy making other plans.«[2]
John hat vieles gesagt in seinem vollgepackten halben Leben. Immer wieder hat er sich auf eigene Texte und Aussagen bezogen, die eigene Geschichte, seine Ansichten und Denkweisen neu dargestellt. Die Chronistin wird mit ebenso großer Gewissheit widerlegt wie all die widersprüchlichen Berichte und unterschiedlichen Erinnerungen jener, die ihm nahestanden oder seinen Weg kreuzten. Andere vor Rätsel zu stellen ist typisch John. Verwirrt? But I’m not the only one.
Wir wissen, wie es ausging. Es geschah am Montag, dem 8. Dezember 1980 in New York. Die Nacht war stürmisch und für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. John und Yoko ließen sich nach einer abendlichen Session im Record-Plant-Aufnahmestudio in einer Limousine nach Hause fahren und erreichten das Dakota Building um circa 22:50 Uhr Eastern Standard Time. Ein gerade erst angereister gebürtiger Texaner stellte sich ihnen bewaffnet mit einer Charter-Arms-Pistole Kaliber .38 und einer Ausgabe von J. D. Salingers Der Fänger im Roggen entgegen. Der fünfundzwanzigjährige Mark Chapman hatte auf sie gewartet und feuerte nun seelenruhig fünf Mal auf John. Vier Schüsse trafen. Polizisten brachten den Verletzten ins Roosevelt Hospital an der 59th Street, Ecke Central Park, wo Dr. David Halleran, ein damals neunundzwanzigjähriger Allgemeinchirurg im dritten Berufsjahr, eine Herzmassage vornahm und still um ein Wunder betete.
Doktor wer? War den Berichten nicht zu entnehmen, Stephan Lynn und Richard Marks hätten versucht, Johns Leben durch eine Operation zu retten? Dr. Lynn gab zahlreiche Interviews, schmückte seine Erinnerungen immer weiter aus und behauptete außerdem, Yoko habe sich zu Boden geworfen und wie von Sinnen den Kopf aufgeschlagen. Nachdem er sich jahrelang die Schilderungen anderer Ärzte angehört hatte, meldete sich David Halleran 2015 endlich »um der historischen Genauigkeit willen« zu Wort. In einem Interview für »Media Spotlight Investigation« auf Fox TV gab er an, weder Lynn noch Marks hätten je Hand an John gelegt. Seine Aussage wurde von Dea Sato und Barbara Kammerer bestätigt, zwei Krankenschwestern, die in jener tragischen Nacht gemeinsam mit ihm in Raum 115 im Einsatz waren. Auch Yoko meldete sich zu Wort, stritt hysterisches Kopfschlagen ab und beharrte, sie sei wegen des gemeinsamen fünfjährigen Sohnes Sean ruhig geblieben. Sie bestätigte Dr. Hallerans Schilderung der Ereignisse. Warum hat er sich nicht früher zu Wort gemeldet?
»Es wirkt einfach ungehörig, wenn sich ein Arzt hinstellt und sagt, ›Hi, ich bin Dave Halleran, ich habe John Lennon behandelt‹«, sagte er. »Damals hätte ich mich am liebsten irgendwo verkrochen, ich wollte nur nach Hause, war bestürzt, tieftraurig. Man fühlt sich irgendwie verantwortlich, fragt sich, ob man etwas hätte anders machen können.«
Waren Sie zu der Zeit zufällig in Amerika? Gehörten Sie zu den zwanzig Millionen Fernsehzuschauern, die das Spiel der New England Patriots gegen die Miami Dolphins zu Hause am Bildschirm auf ABC verfolgten, als der Kommentator Howard Cosell seinen Bericht mit der Nachricht unterbrach, dass John erschossen wurde? Gehörten Sie zu den vielen weiteren Millionen, die daraufhin die Nachrichten auf NBC und CBS schauten? Gehörten Sie zu den Tausenden, die sich auf den Weg zur Upper West Side machten und sich der Mahnwache anschlossen? Oder befanden Sie sich anderswo auf der Welt, haben im Fernsehen mitverfolgt, wie Scharen trauernder Fans im Central Park im Matsch versanken, Blumen an das Geländer vor dem Dakota flochten, »Give Peace a Chance«-Chöre anstimmten? Haben Sie gehört, dass eine Instrumentalversion von »All My Loving« über die Anlage des Krankenhauses lief, in dem Augenblick, in dem Yoko die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhielt? Der Fernsehproduzent Alan Weiss hat es gehört. Er lag auf einem fahrbaren Bett im Krankenhausflur, wartete nach einem Motorradunfall darauf, behandelt zu werden. Zufälle gibt’s …[3]
Sollten Sie schon auf der Welt und möglicherweise in England gewesen sein, als es geschah, schliefen Sie vermutlich tief und fest. John starb am 8. Dezember um circa 23 Uhr Eastern Standard Time (die Angaben zum genauen Todeszeitpunkt weichen voneinander ab), was ungefähr vier Uhr morgens Greenwich Mean Time am Dienstag, den 9. Dezember entspricht. Tom Brook, Auslandskorrespondent der BBC in New York, funkte die Meldung über den Atlantik, nachdem er durch den ehemaligen Popmogul und Songwriter Jonathan King, damals ebenfalls in New York ansässig, davon erfahren hatte. Brook raste zum Dakota und meldete sich in der Sendung »Today« auf Radio 4 aus einer Telefonzelle. Damals gab es noch kein Frühstücksfernsehen, die meisten hörten morgens Radio. Tom wurde gebeten, um 6:30 Uhr zurückzurufen, zum Beginn der an diesem Tag von Brian Redhead moderierten Sendung. Brook schraubte den Telefonhörer auf und verband ihn mit einem Kabel, um seine aufgezeichneten O-Töne zu übermitteln – kein Internet, keine E-Mails, keine Handys –, und ließ sich live von Redhead zu den Vorfällen befragen. Als wir aufstanden, um in die Schule, ans College, zur Arbeit oder mit dem Hund Gassi zu gehen, hatte sich die Kunde des Unfassbaren bereits wie ein Lauffeuer verbreitet.
Wo waren Sie, als Sie es erfahren haben?
Das ist hier die Frage. In Anspielung auf den berühmten Hamlet-Monolog wahrscheinlich die entscheidende Frage unserer Zeit.[4] Vertreter der Silent Generation, die zwischen dem Beginn der Zwanziger- und dem Ende der Vierzigerjahre geboren wurden, erinnern sich ebenso wie die Baby Boomer der Nachkriegszeit meist, wo sie waren und was sie getan haben, als sie vom Attentat auf Präsident John F. Kennedy erfuhren. Zu Beginn der Recherchen für dieses Buch kam ich mit meinen drei Kindern darauf zu sprechen. »Ihr müsst verstehen«, sagte ich, »dass John Lennon unser JFK war.« »Wieso?«, fragte mein studierender Sohn. »Was hat denn ein Flughafen damit zu tun?«
Millennials und Post-Millennials, beziehungsweise Generation Y und Z, beziehen diese Frage häufig auf den Tod von Diana, Prinzessin von Wales, auch wenn sie, als diese verunglückte, noch Babys oder gar nicht auf der Welt waren. Es ist die sogenannte Generation X, die gegen Ende der Sechziger auf den Plan trat und mit dieser Zeit wohl am wahrscheinlichsten John Lennon verbindet.
Es handelt sich in jedem der genannten Fälle um einen sinnlosen Tod, und vielleicht haben sie mehr gemeinsam, als zunächst auf der Hand liegt. Auch halten sich jeweils hartnäckig Verschwörungstheorien. Als der dreiundfünfzigste Präsident der Vereinigten Staaten am 22. November 1963 im texanischen Dallas einem Attentat zum Opfer fiel, wurde viel spekuliert. Hatte der mutmaßliche Attentäter Lee Harvey Oswald alleine gehandelt? Oder im Auftrag der Mafia? Gab es einen Zusammenhang mit Kuba? Wie viele Schüsse wurden abgegeben? Von hinten, aus einem Fenster im sechsten Stock eines Gebäudes oder von dem berühmten »Grashügel« aus, auf den sich der Konvoi zubewegte? Selbst die Ermittlungsergebnisse sind umstritten. Knapp sechzig Jahre sind vergangen, und nichts hat sich daran geändert. Nachdem Diana und Dodi Fayed am 31. August 1997 in einer Pariser Unterführung starben, stand ein mysteriöser weißer Fiat Uno im Zentrum der Ermittlungen. Hundertfünfundsiebzig Hinweise auf eine Verschwörung wurden geprüft. Der Hauptkläger, der ägyptische Milliardär Mohamed al Fayed, vertrat die schwerwiegendste Verschwörungstheorie: Die Prinzessin sei einem Auftragsmord zum Opfer gefallen, weil sie von seinem Sohn und Erben schwanger war. Viele glauben bis heute, eine Sondereinheit der britischen Armee habe sie umgebracht.
Auch in Johns Fall wurde lange darüber spekuliert, ob es einen Zusammenhang zwischen seinem Tod und der CIA oder dem FBI gebe, die ihn infolge seines früheren linken Aktivismus überwacht hatten. War der verurteilte Mörder Mark Chapman ein gehirngewaschener Attentäter, ein »Manchurian Kandidat«? Oder war José Perdomo, der inzwischen verstorbene Pförtner des Dakota und kubanischer Exilant, 1961 an der fehlgeschlagenen Militäraktion in der Schweinebucht beteiligt? Kein Verschwörungstheoretiker gibt sich mit einfachen Wahrheiten zufrieden. Siehe auch »Klimawandelleugner«, »Obamas Geburtsurkunde« oder »kontrollierte Zerstörung des World Trade Center, 9/11«. Experten sprechen vom sogenannten »Proportionality Bias«, erklären Verschwörungstheorien als Bewältigungsstrategie für unerträgliche Ereignisse. Auf der Flucht vor der Vernunft haben Menschen das Bedürfnis, etwas Größerem die Schuld zuzuschieben.
Waren Sie 1980 schon geboren? Sind Sie alt genug, sich an Ernő Rubiks Zauberwürfel zu erinnern, an Margaret Thatcher, Ronald Reagan und den Unbekannten, der auf J. R. schoss? Erinnern Sie sich an die Einführung von CNN, des ersten Nachrichtensenders, der rund um die Uhr gesendet hat? Haben Sie die olympischen Winterspiele in Lake Placid verfolgt? Haben Sie über Tim Berners-Lee gelesen, einen Computerwissenschaftler, der mit der Arbeit an etwas begann, das sich später zum World Wide Web entwickelte? Und obwohl wir das damals nicht wussten, war es auch das Jahr, das uns Macaulay Culkin, Lin-Manuel Miranda und Kim Kardashian beschert hat; das Jahr, in dem wir zu »Call Me« von Blondie, »Rock With You« von Michael Jackson, »Coming Up« von Paul McCartney und »Crazy Little Thing Called Love« von Queen getanzt haben, und das darüber hinaus von David Bowie und Kate Bush, Diana Ross und Police geprägt wurde; in dem Jean-Paul Sartre, Alfred Hitchcock, Henry Miller, Peter Sellers, Steve McQueen, Mae West und John Bonham von Led Zeppelin von uns gingen – und Beatle John.
Waren Sie in diesem Jahr am Freitag, den 24. Oktober im Plattenladen und haben sich seine neue Single gekauft, (Just Like) Starting Over? Haben Sie den Song vielleicht auf dem Weg zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit im Radio gehört und gedacht: Geht das nur mir so, oder klingt das ein bisschen nach »Don’t Worry Baby« von den Beach Boys? »Starting Over«, das drei Tage später in den Vereinigten Staaten erschien, sollte Johns größter Solohit dort werden. Wie sich herausstellte, war es seine letzte Single-Veröffentlichung zu Lebzeiten. Am 6. Januar 1981 befanden sich drei Lennon-Singles in den britischen Top Five: die bereits erwähnte auf Platz fünf, »Happy Xmas (War is Over)« auf dem zweiten und »Imagine« an der Spitze. Gebrochen wurde dieser Rekord erst fünfunddreißig Jahre später.[5]
Achtunddreißig Jahre später im Dezember 2018 befinden wir uns in der O2 Arena in Greenwich, London, wo Sir Paul McCartney sein siebzehntes Studio-Album Egypt Station vorstellt. Es ist die jüngste Station seiner »Freshen up«-Tournee. Obwohl Paul früher alles daransetzte, sich von seinem Beatles-Vermächtnis fernzuhalten, und möglichst ausschließlich eigene Stücke spielte, wird heute Abend das gesamte Repertoire gefeiert, von den Beatles über Wings bis zu Solo-Paul. »A Hard Day’s Night«, »All My Loving«, »Got To Get You Into My Life«, »I’ve Got a Feeling«, »I’ve Just Seen A Face«. Jeder Refrain ein Höhepunkt, gesteigert durch ein euphorisch mitsingendes Publikum. Im Hintergrund erscheinen riesengroße Fotos von John und George. Sogar »In Spite Of All The Danger«, die erste Platte der Quarry Men, ist dabei. Dann »Here Today«, Pauls traurige Würdigung für John. Ronnie Wood springt auf die Bühne, »lass uns doch einen Song zusammen spielen«. Das ist das Stichwort für einen vitalen Achtundsiebzigjährigen, der jetzt zu dem Beatle und dem Stone auf die Bühne joggt. »Ladies and Gentlemen«, spricht Paul heiser ins Mikro, »der stets fantastische Mr Ringo STARR!« Letzterer setzt sich ans Schlagzeug, während Ron sich eine Gitarre umhängt. Gemeinsam legen sie mit »Get Back« los. Das Stadion kocht. »Fotografiert das mit euren Augen«, wispere ich meinen Kindern zu. »Die Hälfte der Beatles auf der Bühne, ein halbes Jahrhundert nach ihrer Trennung, das werdet ihr nicht noch mal erleben.«
Haben wir, die wir die Sechziger gerade so noch erwischt, aber die wahre Magie der Beatles verpasst haben, weil wir noch Kinder waren, diesen Umstand später bedauert, oder hat es uns kaltgelassen? In meinem Fall Letzteres. Ich stieg bei Wings ein und entdeckte die Beatles spät – erst als ich schon mit dem College fertig war und mich in Bolan und Bowie verliebt, von Lindisfarne, Simon & Garfunkel, den Stones, Status Quo, James Taylor, Roxy Music, Pink Floyd, den Eagles, Queen, Elton John und allen möglichen Künstlern, Bands und Musikrichtungen hatte verzaubern lassen, von all jener unendlichen Musik, die meine Teenagerjahre prägte. Wie schwer nachzuvollziehen muss es sein, welche Wirkung sie auf die Welt hatten, wenn man selbst nicht dabei war. Während ihrer Zeit gab es nichts auch nur annähernd Vergleichbares. Die ältere Generation ist gut versorgt mit einer Fülle an umfänglichen Werken, die sich mit ihrer Jugend beschäftigen. Mit Ausnahme der Erinnerungen von Johns erster Frau Cynthia und denen seiner Halbschwester Julia Baird wurden sämtliche angesehene Lennon-Biografien von Männern verfasst. Sie lassen die Zeit wiederaufleben, die sie in Gesellschaft der Beatles verbrachten und bauschen die eigene Rolle in deren Geschichte manchmal ein bisschen auf (es gibt nur noch wenige, die ihre Darstellungen hinterfragen könnten). Einem jüngeren, emotional engagierteren Leser, der mehr erwartet als endlose Fakten, Daten und althergebrachte Ansichten, haben sie aber kaum etwas Neues zu sagen. Kann man sagen, dass sich der Lennon, mit dem die jüngeren Fans bekannt wurden, in den vier Jahrzehnten, die seit seinem Tod vergangen sind, immer weiter von dem tatsächlich existierenden John entfernt hat, sodass er praktisch wie ein ganz anderer Mensch erscheint?
Erst nach seinem Tod bin ich Personen begegnet, die Anteil an Johns Leben hatten. Paul, George und Ringo. Maureen Starkey, Ringos erster Frau, die eine Zeit lang zur Freundin wurde. Linda McCartney, mit der ich begann, an ihren persönlichen Erinnerungen zu arbeiten, »Mac the Wife«. Eine tolle Geschichte, und ich bedaure bis heute sehr, dass sie nie beendet oder veröffentlicht wurde. Dann Cynthia Lennon, die mich bat, ihr zweites Buch zu ghosten. Ihr erstes, A Twist of Lennon, war 1978 erschienen. Frustriert durch Johns Weigerung, mit ihr zu kommunizieren, nachdem er sie und ihren gemeinsamen Sohn Julian Yoko Onos wegen verlassen hatte, hatte sie in einem »langen offenen Brief« an ihn alles rausgelassen. Rückblickend räumte sie ein, sie würde es inzwischen anders machen. Jetzt, wo sich die Aufregung wieder gelegt hatte, wollte sie es noch einmal versuchen. Doch dann kam ein zum Scheitern verurteiltes Restaurant-Projekt dazwischen, und die geplante Veröffentlichung wurde verschoben. Jahre später, 2005, legte sie mit John ein zweites, sehr viel mutigeres und ehrlicheres Buch vor. Als Journalistin begleitete ich Julian Lennon in den Achtzigerjahren zum Montreux Rock Festival. Schließlich traf ich Yoko in New York.
Über ein halbes Jahrhundert ist seit der Trennung der Beatles vergangen, und wir rätseln immer noch. Was war das eigentlich? Wie haben sie das gemacht? Sie waren das kulturell und sozial größte Phänomen überhaupt. Ihre Bekanntheit und ihre Musik erreichten in den Sechzigerjahren ebenso viele über den gesamten Erdball verteilte Menschen wie die Apollo-11-Weltraummission und die Mondlandung im Juli 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins wurden zu Superstars und reisten anschließend durch die Welt, um ihre Leistung zu feiern. Aufs Ganze gesehen aber war die Mondlandung schon am Tag danach Schnee von gestern. Was war ihr Vermächtnis? Eine verblichene Flagge auf einem fernen Himmelskörper. Stiefelabdrücke im Staub. Eine Tafel, die künftige Spaziergänger auf dem Mond über einen beispiellosen historischen Moment unterrichtete – dass »wir« dort waren.
Aber die Beatles sind nicht Geschichte. Ihre Songs leben, sie atmen. Sie sind uns so vertraut wie unsere eigenen Namen. Die Musik garantiert ihren Schöpfern andauernde Bedeutung. Obwohl mit sehr einfachen technischen Geräten aufgenommen, haben die wunderbaren Originalaufnahmen – ungeachtet zahlloser Überarbeitungen, Remixe und Wiederveröffentlichungen in immer wieder neuen Aufmachungen – ihre Frische bewahrt. Die Musik der Beatles hatte nichts Vorgefertigtes. Abgesehen von einigen wenigen Coverversionen texteten und komponierten sie selbst, spielten die Instrumente. Sie gehörten zu den Ersten, die ihr eigenes Plattenlabel gründeten, Apple, und damit auch anderen Künstlern einen Karrierestart ermöglichten. Von ihren eigenen Veröffentlichungen verkauften sie eine Milliarde Einheiten, wobei vor allem durch Downloads immer noch täglich weitere hinzukommen. Siebzehn ihrer Single-Veröffentlichungen gelangten an die Spitze der britischen Charts: Mehr hat bis heute kein anderer Künstler geschafft. Auch mit ihren Alben führten sie die britischen Charts öfter an und blieben dort länger als jeder andere Künstler. Ebenso verkauften sie in Amerika mehr als sonst jemand. Ihre weltweite Popularität scheint ungeschmälert. Sie wurden mit sieben Grammys und fünfzehn Ivor Novello Awards ausgezeichnet.
Als einflussreichste Künstler aller Zeiten inspirieren sie noch immer mehr Musiker, als sonst jemand von sich behaupten kann. Three Dog Night, The Bonzo Dog Doo-Dah Band, Lenny Kravitz, Tears for Fears, Kurt Cobain, Oasis, Paul Weller, Gary Barlow, Kasabian, The Flaming Lips, Lady Gaga und die Chemical Brothers, um nur einige wenige zu nennen, standen und stehen allesamt im Bann der Fab Four. Man höre sich das von Noel gesungene »Setting Sun« der Gallagher-Brüder an – er macht Textanleihen bei seinem eigenen Song »Comin’ on Strong« (ebenfalls Beatles-beeinflusst) – und vergleiche es mit »Tomorrow Never Knows« auf dem Album Revolver. Tausende Sänger und Sängerinnen aller Generationen und Altersstufen quer durch jedes erdenkliche Genre haben Beatles-Songs aufgenommen. Gaga merkte übrigens außerdem an, wir hätten den Beatles neben ihrer Musik auch die weibliche sexuelle Revolution zu verdanken. Für mich kommt das hin.
Warum sind wir hier? Die Frage aller Fragen bewegt Künstler und Wissenschaftler seit jeher. Sie hat uns den Antrieb gegeben, auf den Mond zu fliegen. Und die Beatles dazu gebracht, Songs zu schreiben. Als sie schnulzige Zeilen über Mädchen verfassten und inspiriert von den ersten Erfahrungen mit körperlicher Liebe Textzeilen kritzelten, war ihnen das vielleicht noch gar nicht bewusst. Aber sie sollten schon bald dorthin kommen. Wir sind der Lösung der großen philosophischen Probleme nicht näher gekommen, jenen Aspekten des Lebens, die sich möglicherweise der Reichweite menschlichen Begreifens ewig entziehen werden. Phänomenales Bewusstsein, das Dilemma des Determinismus, die Existenz oder Nichtexistenz Gottes, das Rätsel unserer Zukunft und die Wahrscheinlichkeit eines Lebens nach dem Tod beziehungsweise einer Wiedergeburt haben seit Tausenden von Jahren intellektuelle und kreative Prozesse angestoßen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Beatles auch Entdecker waren. Sie haben sich weit nach vorne gewagt, auf nie da gewesene Weise Neues erschaffen, obwohl sie sich zunächst ihres Talents dafür gar nicht bewusst waren. Sie ließen sich im televisuellen Zeitalter auf ihr großes Abenteuer ein, als erstmals eine massenhafte Verbreitung von Musik und dazugehöriger Botschaft möglich war – aber vor der Computerrevolution, es gab noch kein Internet und dadurch weniger sofort verfügbare Informationen. Kein Sender brachte rund um die Uhr Nachrichten. Man musste täglich die Zeitung lesen, um auf dem Laufenden zu bleiben, wenigstens die Schlagzeilen. Und deshalb erfuhren die Menschen in ihrer Mehrheit von den Beatles, weil die großen, weltbewegenden Dinge von allen zur Kenntnis genommen wurden. Die Beatles waren und sind ein perfekter Spiegel der Kultur und des Klimas ihrer Zeit. Obwohl es in den Sechzigerjahren vor überragenden Persönlichkeiten nur so wimmelte – Bob Dylan, »der Mozart und Shakespeare seiner Zeit«; Muhammad Ali, dreimaliger Weltmeister im Schwergewichtsboxen, außerdem Wehrdienstverweigerer im Vietnamkrieg; John F. Kennedy; die Bürgerrechtler Martin Luther King und Malcolm X sowie die legendären Vertreter des klassischen Hollywood Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Cary Grant, Doris Day, John Wayne und der ganze Rest – die Beatles stellten sie alle in den Schatten. Konnte das daran liegen, dass sie Menschen mühelos einten, ihren unwiderstehlichen Charme über Klassen, Rassen, Generationen und die Geschlechter hinweg ausübten? Weil sie den Soundtrack des Jahrzehnts lieferten? Weil sie echt waren, anfassbar, ganz normale Jungs, die gemeinsam eine überirdische Chemie entwickelten, an der die gesamte Menschheit teilhaben wollte? Werden wir jemals wieder etwas Ähnliches erleben?
Ehrlich gesagt, ich bezweifle es. Weil es bei den Beatles niemals »nur« um die Musik ging. Ihre Wirkung entstand aus dem Zusammentreffen zahlreicher Faktoren, die sich zu einem historisch beispiellosen Kapitel kristallisierten. Da die Gelegenheiten, ein großes Publikum zu erreichen, seltener waren und weniger Künstler auf demselben Gebiet konkurrierten, war man, wenn man in den Sechzigerjahren berühmt war, meist ungeheuer berühmt – wenn auch vielleicht nur für einen Moment. In Großbritannien gab es, als die Beatles antraten, nur zwei Fernsehsender: BBC und ITV. BBC2 kam erst im April 1964 dazu. 1960 gab es in den meisten amerikanischen Haushalten einen Fernseher, aber nur drei Sender: ABC, CBS und NBC. Es gab also Anlässe, bei denen die große Mehrheit der Zuschauer alle gleichzeitig dasselbe sahen. Jetzt, wo es in jedem Land praktisch unzählige Sender gibt, ist der Fokus weniger konzentriert, und die Einschaltquoten sind nur noch ein Bruchteil der früheren. Gehörte man nicht zu den vierundsiebzig Millionen Amerikanern, die am 9. Februar 1964 den ersten Auftritt der Beatles in der »Ed Sullivan Show« auf CBS verfolgten, hatte man sonst nicht viel zu gucken. Die meisten Menschen wurden daher schon aus Mangel an Alternativen Teil des Zeitgeists. Auch die Anzahl der Radiosender war begrenzt. In Großbritannien gab es das BBC Light Programme, aber selbst BBC Radio 1 wurde erst im September 1967 eingeführt, um den Jugendmarkt zu bedienen, der bis dahin von Offshore-»Piratensendern« – Radio London, Radio Caroline, Swinging Radio England – und Radio Luxembourg beherrscht wurde.
»Radio London war die Beatles«, erinnert sich BBC-Moderator Johnnie Walker. »Clever und adrett, der Radiosender, den man beim Tee mit der eigenen Mutter einschalten konnte. Caroline war definitiv die Stones – verlottert, anarchisch, nonkonformistisch und rebellisch … er sollte der kreativ-künstlerischen Explosion der Sechzigerjahre Freiräume und Ausdrucksmöglichkeiten bieten.«
Von 1963/64 liefen in den Top-40-Sendern der meisten Großstädte in den Vereinigten Staaten Beatles-Platten. FM veränderte 1967 das breit gefächerte Spektrum, was dazu führte, dass sehr viel mehr kleinere, spezialisiertere Musiksender entstanden. Heutzutage gibt es kaum noch Künstler, die sich einer ähnlich massenhaften Beliebtheit erfreuen. Adele, Taylor Swift, Justin Bieber, Ed Sheeran, Stormzy, Lizo und Billie Eilish sind die Ausnahmen. Hip-Hop ist inzwischen die musikalische Richtung, die alles durchdringt, und hat einige Stars hervorgebracht – zum Beispiel Kanye West, Beyoncé und Jay-Z. Im Vergleich zu dem, was die Beatles erreichten, scheint ihre Bedeutung verschwindend gering. Sie können Tracks veröffentlichen, die vielleicht das Gegenteil zeigen, aber ich würde behaupten, dass ihre Musik nicht annähernd so populär ist und an den allgegenwärtigen Einfluss der Beatles nicht heranreicht.
Die Einführung des preiswerten Transistorradios war, was häufig übersehen wird, ebenfalls eine ganz entscheidende Entwicklung. Die meisten Jugendlichen konnten sich eins leisten oder bekamen eins geschenkt, trugen es in ihren Hosen- oder Schultaschen mit sich herum, gingen sogar nachts damit ins Bett, um unter der Decke weiter Musik zu hören. Ich habe das so gemacht. Das eigene Gerät zum Musikhören erwies sich als wichtiger Wendepunkt in Hinblick auf den Musikkonsum Jugendlicher. Heutzutage wird Musik meist im öffentlichen Nahverkehr über Smartphones und Ohrstöpsel oder Kopfhörer gehört. Jugendliche können sich kaum noch vorstellen, dass ihre Eltern und Großeltern einst oben in einem Doppeldeckerbus saßen, auf ein Transistorradio stierten und kaum Einfluss darauf hatten, welche Musik sie zu hören bekamen. Ab den Sechzigerjahren konnten die meisten einschalten und am Ball bleiben, Teil einer Gemeinschaft der treuen Anhänger ihrer Lieblingssänger und Bands werden.
In Hinblick auf Marketing und Massenmedien waren die Beatles die erste Popgruppe, die sich vermittels der boomenden Branche einer neuen demografischen Schicht empfahl: der riesigen und wachsenden Masse an Teenager-Konsumenten. Die jungen Leute, von denen viele im Zuge des amerikanischen Rock ’n’ Roll der Fünfzigerjahre aufbegehrten, nahmen neue Identitäten an, übernahmen Mode, Musik und andere Aspekte eines Lebensstils, der dem ihrer Eltern zuwiderlief. Sie rebellierten gegen viktorianische Traditionen und die Enthaltsamkeit der Jahre nach dem Krieg. Rocksäume wanderten nach oben, Pillen wurden geschluckt und Jugendkultur zur vorherrschenden, turbulenten Kraft. In den Vereinigten Staaten gab es sechsundsiebzig Millionen sogenannte Babyboomer, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Zuge der seit 1946 landesweit steil angestiegenen Geburtenrate, zur Welt gekommen waren. Dort war die Hälfte der Gesamtbevölkerung unter fünfundzwanzig. Die Beatles wurden gezielt und mit denselben Methoden an sie vermarktet wie Spielzeug, Süßigkeiten und Jeans. Als sich die Sozialstruktur in den Ländern der »ersten Welt« änderte, verlangten entsprechend viele »neue« Stimmen, gehört zu werden, unter anderem die von Frauen, der Arbeiterklasse und ethnischer Minderheiten. Auch spielten technische Fortschritte nach dem Krieg, bevorstehende Atomkatastrophen, der zermürbende Vietnamkrieg und andere Faktoren eine Rolle.
Und die Kurzfassung? Also schön. Die Beatles standen für Wandel. Sie waren die Vorboten eines Richtungswechsels, und sie warben für alternative Denkmodelle, ohne lange drum herumzureden. Sie teilten unverhohlen ihre Sichtweise mit, missachteten Vorschriften, veralberten sich und andere und wirkten nie aufgeblasen oder verlogen. Ihr Liverpooler Geplänkel, ihr Witz und ihr Humor konnten süchtig machen. Während sich die Welt in den Sechzigerjahren scheinbar stolpernd auf einem Pfad der Selbstzerstörung bewegte, achteten die Beatles auf ihre leisere, innere Stimme. Sie wurden sentimental und verliehen ihren wahren Gefühlen Ausdruck – sprachen und sangen ihre Wahrheit.
Einige Kommentatoren führten die Ermordung Kennedys als den für den Durchbruch der Beatles in den Vereinigten Staaten entscheidenden Faktor an. Die bestürzten und fassungslosen Amerikaner brauchten etwas, dem sie sich zuwenden konnten, das sie von der Tragödie ablenkte und ein Gegengewicht zu ihrer unerträglichen Trauer bildete. Genau zum richtigen Zeitpunkt tauchten vier vorlaute Briten auf, die sich ganz offenkundig nichts aus Konventionen und Autoritäten machten.
JFK hatte Amerika mit seiner »Mann des Volkes«-Haltung, seiner Persönlichkeit, seinem Glamour und seinem Charme verzaubert. Jetzt waren die Beatles dort gelandet, um Unterschiede zu überbrücken und im Zuge der später so bezeichneten britischen Invasion ein ähnliches Kunststück zu vollbringen. Während ihr Selbstbewusstsein wuchs und ihr Songwriting sich weiterentwickelte, Spiritualität und Philosophie ebenso einschloss wie andere Disziplinen und Dimensionen, an die sich vorangegangene Vertreter reiner Popmusik niemals herangewagt hätten, wuchsen ihre Fans mit ihnen. Man brütete über jedem einzelnen Aspekt ihres Images. Jede Nuance ihres Privatlebens (das so »privat« war, wie es damals eben sein konnte) wurde durchdrungen und zerpflückt. Als Verkörperungen einer furchtlosen, freien Jugend hatte man sie praktisch heiliggesprochen. Klingt alles weit hergeholt? Liebe Leserinnen und Leser, so war’s.
Freunde, die sich an jene verrückten Zeiten erinnern, grübeln noch immer über das Was und Wie. Sie sind inzwischen Ende fünfzig oder bis zu achtzig Jahre alt und schwärmen von dem Glück, das sie hatten, in eine Zeit geboren worden zu sein, in der sie die Fab Four höchstpersönlich erleben durften. Einige halten ihre Generation allein aufgrund dieses Umstands für »anders« oder »etwas Besonderes«. Jenen, die »zu spät geboren« wurden, begegnen sie häufig fast mit Herablassung. Na so was. Jüngere Popfans, darunter auch meine eigenen Kinder, reagieren häufig verblüfft auf die globale Herrschaft der Beatles. Warum, fragen sie, hält man die Beatles immer noch für die vollkommenste und einzige unüberbietbare Kraft in Pop und Rock, wo doch die Musikbranche anschließend Queen, David Bowie, Michael Jackson, Madonna, U2, Prince, George Michael und viele andere fantastische Künstler hervorgebracht und uns in jüngerer Zeit One Direction, The Wanted, BTS (die südkoreanische Gruppe Bangtan Boys) und, sagen wir mal, Little Mix beschert hat? Das liegt daran, dass die Beatles mithilfe ihrer Musik, ihrer Looks und Persönlichkeiten immer wieder die Schallmauer durchbrachen. Sie veränderten den Lauf der Geschichte, indem sie sich als erste Popband überhaupt in die Herzen und Köpfe Hunderter Millionen Menschen auf der ganzen Welt spielten. Sie machten Pop zu einer universalen Sprache. Hauptsächlich durch ihre Platten, in geringerem, aber durchaus bedeutendem Ausmaß auch durch ihre Filme, Aufnahmen von ihren Liveauftritten und zahllose Interviewmitschnitte beeinflussen und infizieren sie nach wie vor neue Anhänger. Mag sein, dass das niemals aufhört.
John Lennon, der Launische, Clevere, Schlagfertige und unfassbar Talentierte, war der beliebteste Beatle. Er war mit der wohl besten Stimme gesegnet, auch wenn er selbst dies bestritten hat, und verkörperte ihr Leben und ihre Zeit am besten. Er war außerdem der komplexeste und widersprüchlichste; derjenige, den der eigene Ruhm am nachhaltigsten verstörte und der am meisten damit haderte. Darüber hinaus aber war er alle möglichen Johns. Er war ein Wirrwarr an Widersprüchen. Eben noch verschmitzter Komiker, im nächsten Augenblick verbitterter Narr, gemeiner Grobian oder auch Heulsuse. Übermäßig selbstbewusst, unbeholfen, phlegmatisch, paranoid – er konnte wahnsinnig extravagant, aber auch erstaunlich zurückhaltend sein. Er war hämisch und trotzdem sanft. Gemein, aber großzügig. Verunsichert, dabei scharfsichtig. Hartherzig und gleichzeitig voller Selbstvorwürfe. Auf McCartneys ungeheure melodische Virtuosität war er unendlich neidisch. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Paul war er nie wieder so außerordentlich kreativ wie in der gemeinsamen Zeit seit ihren Anfängen als Teenager, als die Chemie zwischen ihnen stimmte, frisch und wunderbar war (Paul ebenso wenig). John hatte das, was man früher als »Attitüde« bezeichnet hätte. Er war Vertreter des Mottos carpe diem. Beschädigt, gestört und aufsässig suchte er sich einen Weg in der Welt. Was andere von ihm hielten, hat ihn nie interessiert. Ihn reizte das Inakzeptable, das Ungenießbare, die unausgesprochene Wahrheit. Sein Leben wurde auf seinem Zenit ausgelöscht. Er hatte erst die halbe Wegstrecke hinter sich. Im Tod vollendet sich der Mythos und wird für alle Zeit konserviert. Und obwohl wir heute um die meisten seiner Fehler und Schwächen wissen, verzeihen wir sie ihm. Die Erinnerung an ihn ist heilig. Mehr als jeder andere Künstler gilt John Lennon gleichermaßen als Symbol wie auch als Inbegriff seiner Zeit. Aber wer war er?
Meiner Ansicht nach zeigt er sich am plausibelsten und zuverlässigsten durch die beeindruckenden Frauen in seinem vier Jahrzehnte umfassenden Leben, unabhängig davon, ob sie ihn liebten, vernachlässigten, aufbauten oder beschädigten, stärkten oder schwächten, förderten oder hemmten, bereicherten, bestahlen oder ihm gleichgültig gegenüberstanden. Seine vermeintlich »zügellose«, »unbürgerliche« Mutter Julia, die ihn in Wirklichkeit vergötterte und in die er vollkommen vernarrt war, habe ihn zweimal verlassen, sagte er. Zum ersten Mal, als sich seine Eltern trennten, sein Vater das Weite suchte und seine Mutter ihn an ihre Schwester »fortgab« (wirklich?), noch bevor er fünf Jahre alt wurde. Das zweite Mal »verließ« ihn seine Mutter, wie er erklärte, als Julia in der Straße, in der er lebte, von einem Polizisten außer Dienst überfahren wurde und starb. John war erst siebzehn. Der Schauplatz, an dem sich der Unfall ereignete, war von seinem Schlafzimmerfenster aus zu sehen. Jeden Morgen, wenn er aufwachte, hatte er diese Aussicht vor Augen, und er hörte nie auf, von Julia zu fantasieren. Laut seinem Therapeuten Arthur Janov ertappte er sich irgendwann sogar dabei, sie sexuell zu begehren, und er habe mit dem Gedanken gespielt, sie zu verführen. Johns Halbschwester Julia Baird hat sich öffentlich empört über die Inzest-Unterstellung geäußert. Freud führte 1899 das Konzept der ödipalen Fantasie aus, und ehrlich gesagt sind nur wenige männliche Teenager davor gefeit. Die meisten würden allerdings lieber sterben, als sich dazu zu bekennen. John hat einfach nur gesagt, was in ihm vorging.
Seine Tante Mimi, Julias gebieterische ältere Schwester, zog ihn tadellos auf. Cynthia, seine erste Frau, studierte mit ihm Kunst, wurde schwanger und »musste« ihn heiraten, er war gerade mal einundzwanzig und noch lange nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wurde John in späteren Jahren von Schuldgefühlen geplagt, wenn er daran dachte, wie Cynthia sich durchschlagen musste, nachdem die magere Abfindung aufgebraucht war, die sie nach der Scheidung erhalten hatte? Sie verfasste kitschige Enthüllungsgeschichten, eröffnete ein Speiselokal, entwarf billige Bettwäsche und heiratete einen Chauffeur, um über die Runden zu kommen. Auch sein erster inoffizieller Manager und Förderer war eine Frau: Mona Best. Seine erste heimliche Liebe war die Sängerin Alma Cogan, deren früher Krebstod ihn an Selbstmord denken ließ. Yoko Ono, die verführerische, ehrgeizige, anhängliche japanische Künstlerin, kam genau zur richtigen Zeit. Sie war Johns Seelenverwandte und wurde seine Respekt einflößende zweite Ehefrau. Ihre gemeinsame Assistentin May Pang fungierte vorübergehend, auf Yokos Vorschlag hin, als seine Gefährtin und Geliebte. Seine Stieftochter Kyoko, die er vergötterte, wurde von ihrem leiblichen Vater entführt, als sie acht Jahre alt war. John hatte sie geliebt wie ein eigenes Kind, bekam sie aber nie wieder zu Gesicht.
Er verbrachte sein zu kurzes Leben mit der Überkompensierung der eigenen Verletzlichkeit und der Bildung eines undurchdringlichen Panzers. Früh schon entdeckte er seine Begabung, über Gefühle zu schreiben. Mit nur vierundzwanzig Jahren komponierte er zum Beispiel »Help!«, entblößte seine fragile Psyche, verpackte dies aber als fröhliche Popnummer. Mit dem Manager der Beatles, Brian Epstein, wurde er intim. Aus Neugier, mehr nicht. Er erklärte seine Band für beliebter als den Sohn Gottes, woraufhin sich deren Ansehen in den Staaten in Rauch auflöste.
Johns Geheimnisse, Leben und Lieben laden seine Anhänger weiterhin zu ausführlichen Pilgerfahrten ein. In Liverpool besuchen sie Mendips, Mimis Haus; seine Schule und das Kunst-College; die Clubs, in denen er auftrat, unter anderem den Casbah und den Cavern Club (nicht mehr das Original, aber der neue tut es auch); sowie andere Orte, die in den beliebtesten Songs der Beatles eine Rolle spielen, darunter der Kreisverkehr, die Bushaltestelle und den Friseurladen an der Penny Lane, Strawberry Field, das Heim der Heilsarmee, sie fahren die Busstrecke, die John mit »In My Life« beschrieb, von der Menlove Avenue bis in die Innenstadt ab und suchen den Friedhof der St. Peter’s Parish Church in Woolton, wo sich das Grab einer gewissen Eleanor Rigby befindet. Es hatte McCartney den Anstoß gegeben zu einer Klage über das Leid alter Menschen und enthält eine der sinnbildlich stärksten Zeilen, die je geschrieben wurden: »… wearing the face that she keeps in a jar by the door«. Im Gemeindesaal gegenüber hatte John bei einem Sommerfest im Juli 1957 Paul McCartney kennengelernt.
Fans strömen immer noch nach Hamburg, wo die Jungs von 1960 bis 1962 verschiedene Engagements wahrnahmen und die zehntausend Bühnenstunden hinter sich brachten, die sie als Band zusammenschweißten. Die Fotomotive am Beatles-Platz, vor dem Indra und dem Kaiserkeller sind unwiderstehlich, ebenso die Orte, wo sich früher der alte Star-Club und das Top Ten befanden. Nirgendwo auf der Welt standen sie mehr Stunden live auf der Bühne als hier. Unten am Hafen versammeln sich die Getreuen vor dem Gebäude, in dem einst die alte Seemannsmission untergebracht war und sie morgens Cornflakes oder ein billiges Mittagessen bekamen und ihre Unterwäsche wuschen. Sie machen kurz bei Gretel und Alfons halt auf ein Bier, der Kneipe, die Erinnerungen an jedes x-beliebige Pub in der Heimat wachruft und wo ihre Idole nach dem Auftritt gerne noch entspannten, bis die Müdigkeit einsetzte.
In London lauern immer noch Scharen vor den Abbey Road Studios, wo die Beatles von 1962 bis 1970 fast all ihre Alben und Singles aufnahmen. Sie schießen Selfies auf dem berühmtesten Zebrastreifen der Welt, wandern vom London Beatles Store zum Bahnhof Marylebone, wo die Eröffnungsszene von A Hard Day’s Night gefilmt wurde; dann zum Montagu Square 34, Ringos ehemaliger Wohnung, die zu einer Art Beatles Notunterkunft wurde. John und Yoko hatten sie gemietet und wurden hier wegen Drogenbesitzes festgenommen. Heute gehört sie Freunden von mir und ist mit einer blauen Gedenktafel versehen; weiter zum London Palladium, wo die Gruppe einen berühmten Auftritt hatte, dann zum Sutherland House nebenan, von wo aus Brian Epstein einst sein Unternehmen NEMS leitete; anschließend in die Savile Row 3, dem Haus, in dem die Büros und das Studio von Apple Corps untergebracht waren und auf dessen Dach sie am 30. Januar 1969 zum allerletzten Mal live auftraten.
Auch das Fünfsternehotel St. Regis in der 5th Avenue in New York, John und Yokos erstes Zuhause dort, befindet sich auf dem Stadtplan eines Beatle-Fans; ebenso wie die Bank Street 105 im West Village, der ersten festen Bleibe der beiden in Amerika; und natürlich das Dakota an der Ecke 72nd Street und Central Park West, ihre letzte. Dort vor dem Haus wurde John niedergeschossen. Yoko lebt noch immer dort. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Am ehemaligen Standort der alten Hit Factory, Ecke W48th und 9th, stehen nach wie vor Fans und erinnern sich an John und Yokos letztes gemeinsames Album, Double Fantasy. Mr Chow’s Chinese in der E57th war das Lieblingsrestaurant der Lennons. Im Central Park gegenüber vom Dakota befindet sich Johns ewiges Denkmal, der nach seinem Tod dort angelegte Garten Strawberry Fields.
Selbst Japan wurde zum Ziel für Lennon-Ausflügler, wegen der glücklichen Familienurlaube, die John dort mit seiner Frau, seinem jüngsten Sohn und seinen Schwiegereltern verlebte. In Kameoka in der Präfektur Kyoto besuchen sie die heißen Quellen von Sumiya, »weil John das gemacht hat«; in Karuizawa findet sich das Mampei Hotel, Lennons Lieblingszufluchtsort; außerdem besuchen Fans den Tokioter Stadtteil Ginza auf der Suche nach einer der besseren Beatles-Tribute-Bands. Es gibt Hunderte dort.
Wer kann sich vorstellen, wie es war, John Lennon zu sein? Vielleicht nicht einmal John. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms und der Bedeutung der Beatles wurde er sich entsetzt seiner inneren Leere bewusst. Eine tiefe Enttäuschung und Unzufriedenheit über die materiellen Dinge, die sein Reichtum mit sich brachte, waren seine ständigen Begleiter. Weder Anerkennung noch finanzielle Entlohnung lieferten ihm Antworten auf die Fragen, die ihn seit seiner Kindheit quälten. Krank vor Angst, dass »das hier schon alles ist«, liebäugelte John mit Religion. Einmal bat er Gott sogar um »ein Zeichen«. Als dieses ausblieb, zog er sich in seine Vorstellungswelt zurück und schlussfolgerte, »Gott« sei schlicht eine vermutlich freundliche Energie, die auf ewig im Universum pulsiert. Trotzdem sehnte er sich nach einem roten Faden, einem Kodex, an dem er sein Leben ausrichten konnte und der seinem Dasein Form und Sinn verleihen würde. Durch Drogen, hauptsächlich LSD, gelangte er so zum Konzept der Liebe.
Als die Beatles eingeladen wurden, im Juni 1967 bei der ersten internationalen, über Satelliten übertragenen Fernsehsendung live vor vierhundert Millionen Zuschauern aufzutreten, bot John dies die perfekte Gelegenheit, für sein neues Anliegen zu werben. Er fiel auf seine eigene Publicity herein, begab sich auf eine verblendete Mission zur »Besserung der Menschheit«, und das Ergebnis war der Song, den die Beatles bei der historischen TV-Übertragung spielten, »All You Need is Love«. Will man die Welt retten, sollte man zuerst selbst seine Sauerstoffmaske aufsetzen. Denn was ist Liebe anderes als das Verlangen, geliebt zu werden? Johns neue Geisteshaltung stand im Missklang mit einem Charakterzug, der es ihm lange ermöglicht hatte, seine geistige Gesundheit zu bewahren: sein angeborener Zynismus. Er hielt trotzdem daran fest wie eine Klette am Hosenbein, bis Yoko die Marktlücke erkannte und für ihn zum personifizierten Hosenbein wurde. Obwohl die Welt und die Beatles sie als eigenartigen asiatischen Eindringling ablehnten, wurde sie zu seiner Konstante, dem einzig Wahren in seinem Leben. Und so tanzten sie Hand in Hand in den Sonnenuntergang und warben für Weltfrieden.
Heute würde man sie vielleicht auslachen und aus der Stadt jagen. Aber das waren damals andere Zeiten, vor der Erfindung der political correctness. Es war noch möglich, eigennützig handelnde Machthaber der Korruption zu überführen, ohne Vergeltung fürchten zu müssen. John, die friedliebende Kurzstreckenrakete, pries die menschliche Vorstellungskraft als den Schlüssel sowohl zum kollektiven wie individuellen Heil. »Imagine«, sein wohl bekanntester Song, war das Destillat seiner persönlichen Strahlkraft und aller Themen, die ihn bislang beschäftigt hatten. In dem Versuch, Menschen in allen Lebenslagen auf der ganzen Welt zu beflügeln und Hindernisse jeglicher Art zu überwinden, griff er nach den Sternen. Es musste einfach mal gesagt werden, auch wenn die Aussage extrem idealistisch klang. Doch dadurch änderte sich nichts. Aber auch das konnte John nicht von seiner leidenschaftlichen Überzeugung abbringen, dass Popmusik sehr viel wichtigere Aufgaben hatte, als lediglich zu unterhalten.
John war ein Künstler von großer Integrität, er hinterfragte alles. Selbst sein eigenes Songwriting. Dieses vielleicht sogar ganz besonders. Er war der Erste, der einräumte, dass seine frühen Texte sexistisch waren. In späteren Jahren korrigierte er seinen Ansatz entsprechend seinem neuen feministischen Bewusstsein. Er ging Risiken ein, scheiterte häufig, schien sich aber immer treu zu bleiben … oder wenigstens so treu wie möglich.
Die Beatles überboten alle anderen, weil sie Regeln brachen: bei den Songstrukturen, den Texten, im persönlichen Erscheinungsbild und in zahllosen anderen Aspekten. John war das Tüpfelchen auf ihrem i, sein scharfer Verstand und beißender Sarkasmus, sein Talent für Rätsel, Sprüche und Wortspiele und seine sehr eigene Einstellung zum Leben hoben ihre Musik in bis dahin ungehörte und ungeahnte Sphären. Er experimentierte mit dem Unmöglichen, packte unterbewusste Botschaften in seine Songs und reicherte sie mit kontroversen Stimmungen und Gedanken an, bis sie kaum noch auszuhalten waren. Hören Sie sich »Strawberry Fields Forever« und »Across the Universe« noch einmal genauer an. Das sogenannte »White Album«, das eigentlich The Beatles heißt, zeigt John von seiner vielleicht verbittertsten, wütendsten, frustriertesten, engagiertesten, wahnsinnigsten, traurigsten, scharfzüngigsten, politischsten und nachdenklichsten Seite. Aber wie sieht es andererseits mit John Lennon/Plastic Ono Band aus? Darauf ist seine vernichtende Anklage gegen die Beatles zu finden – »The Dream is Over« (»God«) – ebenso wie die Akustik-Ballade »Working Class Hero«, Johns niedergeschlagene Betrachtung all dessen, was er aufgrund seines weltweiten Ruhms und unvorstellbaren Reichtums nicht mehr sein konnte. Insofern er überhaupt je in derart ärmlichen Verhältnissen gelebt hat. Mimi hatte Wert darauf gelegt, die Dienstbotenglocke über der Tür des »Morning Room« in ihrem Haus »Mendips« nicht abzumontieren – das sollten wir nicht vergessen. Schließlich »Watching the Wheels« auf der letzten LP seines Lebens, Double Fantasy, wo er erklärte, warum er während seiner Zeit als »Hausmann« keine Musik gemacht hatte. Er hatte seinen Himmel auf Erden gefunden – häusliches Glück mit Yoko und dem gemeinsamen Sohn – »I just had to let it go«.
Was, wenn er heute hier wäre? Here Today? Was würde der nun achtzigjährige ehemalige Beatle von einer ökologisch und politisch zerrütteten Welt mit schmelzenden Gletschern halten? Was würde er dagegen unternehmen? Würde er überhaupt etwas unternehmen? Würde er eine Rolle spielen? Wäre seine Meinung relevant? Hätte er noch Bedeutung?
Ich denke ja. Weil er eine Stimme des Gewissens war. Einer, der aufgestanden ist. Rechter Populismus, das Leitmotiv in der heutigen Politik, befindet sich im Aufstieg. Ich glaube, John hätte sich von seinem Hintern erhoben und dagegen gewettert. Auch mit achtzig Jahren, vorausgesetzt, er wäre bei guter Gesundheit geblieben. Dass McCartney sich in Politik einmischt, werden wir nicht erleben, womit ein fundamentaler Unterschied zwischen den beiden zutage tritt. Ich denke, John hätte bis heute über die Dinge gesprochen, die seinen Zorn entfachten. Würde er immer noch Platten machen? Möglich. Wobei man sich fragen muss, ob er musikalisch nicht den Schwung verloren hätte. Auf Double Fantasy sind einige gute Stücke enthalten – »Watching the Wheels« und »Woman« zum Beispiel, auch »Beautiful Boy« ist ganz wunderbar –, aber wäre das Album ebenso erfolgreich gewesen, hätte er überlebt?
Wäre er überhaupt noch am Leben, wäre er nicht ermordet worden?
»Vielleicht nicht«, sinniert der ehemalige Melody Maker-Autor und Redakteur Michael Watts. »Und wenn, dann denke ich, wäre er ein gutes Stück zurückhaltender geworden, trotzdem bin ich davon überzeugt, dass er in irgendeiner Weise eine öffentliche Gestalt geblieben wäre. Er hätte seine Meinung zu wichtigen Themen kundgetan. Er war so berühmt und mächtig, Yoko und er wären ständig im Fernsehen gewesen, hätten Sendungen und Filme produziert, hätten sich im Radio zu Wort gemeldet, Podcasts veröffentlicht, sich in den sozialen Medien getummelt. Ich denke, insgeheim hätte er diese Rolle gehasst, aber er hätte sich darauf eingelassen. Vielleicht hätte er sich allzu ernste Predigten verkniffen und auf witzige Weise darüber gesprochen. Er hätte auf Trump eingedroschen, und die Zeitungen und die Presse hätten sich auf alles gestürzt, was er über The Donald zu sagen gehabt hätte. Eine solche Stimme fehlt jetzt in den britischen Medien. Der Guardian berichtet zum Beispiel von einem liberalen, antipopulistischen Standpunkt und argumentiert entschieden gegen rechts, dort wären seine Aussagen garantiert auf der Titelseite erschienen. ›Trump ist ein Arsch‹, so was in der Richtung – vermutlich eingebettet in mildere Formulierungen. Das hätte John gemacht. Er hätte sich nicht zurückgehalten, sondern Farbe bekannt. Wer tut das jetzt? Politiker wäre er niemals geworden, er hätte sich niemals einer Parteilinie untergeordnet. Im britischen Unterhaus könnte man sich ihn nicht vorstellen, das geht gar nicht, oder? Ich denke, er hätte als kreative Kraft an Einfluss verloren, aber weiterhin als Wortführer überzeugt. Und zwar zusammen mit Yoko, sie wären ein hervorragendes Team gewesen. Sie hätten den Mund aufgemacht. Deshalb brauchen wir ihn.«
Wären John und Yoko denn heute noch zusammen? Oder wäre er zu May Pang zurückgekehrt, die ihn während seines »Lost Weekend« begleitete – sie und andere sind davon überzeugt. Oder hätte er sich ein jüngeres Modell gesucht, weil Rockstars das nun mal so machen? Hätte er auch in seiner Beziehung zu Paul dem Frieden eine Chance gegeben? Wären die Beatles fünfzehn Jahre nach ihrer Trennung beim Live-Aid-Konzert im Juli 1985 noch einmal zusammen aufgetreten? So weit hergeholt ist die Vorstellung nicht. Bob Geldofs Überredungskünste waren ausgefeilt wie nie. Er bekam The Who. Led Zeppelin lenkten ein. Und McCartney trat auf. Warum nicht auch die größte Band aller Zeiten? Und danach? Ein Comeback-Album? Eine Reunion in der Abbey Road mit Produzent George Martin? Eine erneute Welttournee – keine Konzerte mehr vor ohrenbetäubend laut kreischenden Teenagern (sie beschlossen im August 1966, keine Livekonzerte mehr zu geben, da sie sich auf der Bühne selbst nicht mehr spielen, singen oder denken hörten), sondern vor erwachsenen Fans, die tatsächlich zugehört hätten, ausgestattet mit der allerneuesten Bühnentechnik, woran sie vielleicht sogar Freude gehabt hätten …? Wäre eine Magical Mystery Tour der Beatles bis zum Tod von George Harrison 2001 denkbar gewesen? Ich würde darauf wetten …
Hätte John sich über solche Vorstellungen lustig gemacht? Hätte er versucht, die Global Jukebox im Wembley Stadion an sich zu reißen und eine »JohnandYoko«-Friedensdemo daraus zu machen? Eins steht fest: Es hätte ihm nicht gefallen, als abgehalfterter ehemaliger Star zu enden, der nichts Aufregendes mehr mitzuteilen hat und sich ein Bein ausreißen muss, um noch einigermaßen relevante Songs zu produzieren, der verzweifelt versucht, an alte Hits anzuknüpfen, und durch fünf Kontinente zieht, um eine »allerletzte« Tour nach der anderen zu spielen und bis zum Umfallen immer weiterrockt.
Wenn schon, dann sollten wir’s richtig angehen. Wir sollten fragen: Wer, oder was, hat ihn ermordet – und wann ist der »wahre« John Lennon gestorben? Die Schüsse des Attentäters haben sein Schicksal nur endgültig besiegelt. Warum war das so? Wurde Johns jugendliche Unbeschwertheit durch den Tod seiner Mutter Julia ausgelöscht? Oder war er bereits nach dem Ableben seines Uncle George, der als Erster die Kreativität in ihm weckte, bereits so angeschlagen und am Boden zerstört, dass er in seinem eigenen Leben keinen Sinn mehr sah? Oder doch erst nach dem Verlust seines besten Freundes Stuart Sutcliffe, der in Hamburg an einem Hirntumor starb? War das schlechte Gewissen, das ihn quälte, weil er Stu schikaniert und veralbert hatte, der Auslöser für Johns Eigensabotage? Er hatte sich als ledertragender Rocker geriert – was veranlasste ihn, diese Version seiner selbst so schnell wieder aufzugeben und zuzulassen, dass die draufgängerische Band, die er gegründet hatte, zu pilzkopfschüttelnden Anzugträgern umgestylt wurde? Warum ließ er sich in das Korsett eines Teenie-Popstars pressen, auf den marionettenhaften Schatten seines wahren Ichs reduzieren?
Auf dem Höhepunkt des Beatles-Ruhms warf John alles hin; er entdeckte noch einmal den Rock für sich; und erfand sich neu als musikalischer Aktivist und Peacenik. Aber war seine Philanthropie am Ende nicht mehr als ein zynischer Deckmantel seines Desinteresses an der Menschheit? Sich vorzustellen, es gäbe keine Besitztümer auf der Welt, während man selbst Viehherden, einen Kühlschrank für seine Pelzmäntel und Immobilien in Manhattan, auf Long Island und in Florida im Wert von mehreren Millionen Dollar besitzt? Ist etwas dran an den komplexen Verschwörungstheorien, die über die Jahrzehnte immer weiter verbreitet wurden? Warf John seine selbst auferlegte Rolle als Hausmann und Erzieher nach nur fünf Jahren wieder hin, weil sich die traditionell Frauen zugewiesenen Aufgaben im Haushalt doch als stumpfsinnig und langweilig entpuppten (worauf er auch hätte kommen können, hätte er darüber nachgedacht, was er vermutlich getan hat)?
Die Geschichte wurde bis zum Abwinken immer wieder aufgeschrieben, umgeschrieben und neu erfunden. Johns Persönlichkeit und Werdegang wurden so unablässig immer wieder durchgekaut, dass bestimmte Dichtungen zu Wahrheiten und Wahrheiten verzerrt wurden oder in den Hintergrund gerieten. Es gibt immer Einzelheiten, die zurechtgerückt oder ausgebügelt werden sollten. Wurde Sam Taylor-Wood, inzwischen Taylor-Johnson, gewarnt: »Du kannst den Film ›Nowhere Boy‹ nicht drehen, weil das alles schon mal gesagt wurde?« Großartige Geschichten – zum Beispiel über den Tyrannosaurus Rex, Tutanchamun oder Caesar, von Dickens oder Shakespeare – halten es aus, immer wieder erzählt zu werden, und die des größten Rockstars nicht weniger.
Entscheidend ist die Perspektive. Zeit vergeht. Wir besinnen uns, blicken zurück. Es gibt immer Raum für neue Ansichten. Es gibt Enzyklopädien zu diesem Thema, ganze Bibliotheken voller Bücher, Studenten widmen ihre Abschlussarbeiten dem Thema der Beatles und ihrer Musik, und trotzdem verlangen die Experten und Historiker immer mehr. Erinnerung, Kontext und Toleranz sind nicht statisch und waren es nie.
Ich hatte keine Lust, eine weitere konventionelle Biografie über John zu schreiben. Und es ist auch keine geworden. Ich begebe mich vielmehr zu Ehren des doppelten Jahrestages, vierzig-achtzig, auf ein paar Streifzüge durch sein Leben, sein Lieben und sein Sterben. Es ist ein Kaleidoskop, ein Sinnieren, ein Reflektieren: Wer war er überhaupt? Was hielt er von gewissen Dingen? Ich möchte seine Widersprüche begreifen; herausfinden, wann und warum er starb. Das ist nicht überflüssig. Wir wissen bereits, dass es mehr als einen John gab, also wer oder was hat das Original getötet? Die verschiedenen Versionen seiner selbst? Wer war der John, den wir kennengelernt haben, und wofür steht er im 21. Jahrhundert? Was könnte er darüber hinaus bedeuten? Kann man sich eine Zeit vorstellen, in der John Lennon nicht mehr gehört, diskutiert, debattiert oder zerpflückt wird? Wann werden wir es müde, so wie er in seinem Song »In My Life«, an die Orte zurückzukehren, an die er sich erinnerte, zu den Menschen und Dingen von früher, den Erfahrungen, die seine Sichtweise geprägt haben? Wann wird uns das »Wie alles begann …« nicht länger interessieren?
Natürlich gab es lange bevor Lennon und McCartney aufeinandertrafen Musik in Johns Leben. Wenn etwas Johns Lebensweg bestimmte, dann vor allem diese. Nur wenige besitzen wahre Kreativität und sind in der Lage, sie auch auszudrücken, aber alle schätzen sie und lassen sich davon berühren. Jedermanns Leben wird durch Musik, die universellste und zugänglichste Form von Kunst, erhöht. Selbst Taube spüren den Rhythmus ihres Herzens.
So furchtbar es ist, dies auszusprechen, aber John ist inzwischen lange genug tot und weit genug entrückt, um als historische Figur zu gelten. Zum Glück gibt es ein hörbares Vermächtnis, das noch genauso lebendig und wunderbar klingt wie damals bei seiner Entstehung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tag kommt, an dem sein Leben, sein Lieben und sein Sterben, seine Songs, sein Einfluss auf die Musik und auf andere Musiker sowie auf Milliarden gewöhnlicher Sterblicher auf der ganzen Welt keine Geltung mehr haben sollen.
Tumbling blindly through broken light, begebe ich mich auf die Suche nach ihm.[6]
Was ist Rock ’n’ Roll, wenn nicht Mythologie und Übertreibung? Open the doors and let ’em in: Die Vorlauten, die Außerirdischen, die Todesmutigen, all die unter Strom stehenden Peter Pans. Die grüblerischen Gesetzesbrecher, die im freien Fall Erstarrten, die Risikoträger, die trotz aller Widrigkeiten Erfolg Suchenden. Die spektakulärsten Erschaffer, die intensivsten Individualisten, die dunkelsten, mutigsten, leichtsinnigsten, exzentrischsten, unkonventionellsten, bohemistischsten Gewinner und Verlierer, die sich alles nehmen, einfach unter den Nagel reißen. Wir projizieren unsere extremsten Träume und wildesten Fantasien auf den Rock ’n’ Roll und die, die für ihn stehen, mehr als bei jedem anderen Genre der Unterhaltungsindustrie. Millionen gelten Rockidole als die ultimativen Superhelden. Sie geben unserer Vorstellungskraft Zunder und scheinen über Wasser zu gehen. Ganz offensichtlich können sie fliegen. Wir zerbrechen uns die Köpfe über ihr zupfendes, stampfendes, schreiendes Genie, ihre Beats, Melodien und Harmonien, ihren hinreißend aufrührerischen Sex-Appeal und denken, wir selbst könnten auch teilhaben an ihrem fieberhaften Tanz. Auch wir könnten Kandidaten sein. Als wäre das so einfach. Nichts, am allerwenigsten der durchschnittliche Rockstar (den es natürlich gar nicht gibt), ist je so, wie es scheint.
Ich war mein ganzes Leben lang verrückt nach Rockstars. David Bowie begegnete ich zum ersten Mal mit fünf Jahren, und mit elf stand ich bei ihm vor der Tür, wollte ihn interviewen. Auf dem Weg zu seiner legendären Haustür begegnete ich den elfenartigen Gestalten, die später Siouxsie Sioux, Boy George, Billy Idol werden sollten. Ich besuchte dieselbe Schule wie einst auch Beatles-Produzent George Martin, studierte an dem Londoner College, aus dem auch Pink Floyd hervorgingen. Als unerfahrene Assistentin von DJ Roger Scott von Capital Radio flog ich nach Florida zu einem Treffen mit dem wiederauferstandenen Dion DiMucci, dem Teenie-Idol der Fünfziger- und Sechzigerjahre, der inzwischen seine Berufung darin gefunden hatte, an den Straßenecken der Bronx a capella zu singen. Roger verehrte ihn zutiefst: Der erste Hit seiner Band Dion & The Belmonts »I Wonder Why« hatte sie zu Pionieren gemacht. Dion überlebte 1959 die Tour, auf der Richie Valens und Buddy Holly tödlich verunglückten, und war bereit, davon zu erzählen. Seine Solohits »Runaround Sue« und »The Wanderer« galten Roger Scott als Klassiker. In New York begleiteten wir Billy Joel an die Tür der Mercer Street 142 in SoHo, wo das Coverfoto für sein Rock-Tribut-Album An Innocent Man geschossen wurde. In New Orleans lernten wir die Neville Brothers kennen, Keith Richards stellte ihnen Roger vor. Der Stone spielte 1987 auf deren Album Uptown. 1989 veröffentlichten sie Yellow Moon, was vielleicht das Album war, und darauf ganz besonders das Stück »Healing Chant«, das Roger aufmunterte, als ihn später der Speiseröhrenkrebs in die Knie zwang. Zu dieser Zeit war er bei BBC Radio 1, waltete über die Sendungen am Samstagnachmittag und in der späten Sonntagnacht. Seine unermüdlichen Reisen um die Welt hatte er bereits aufgegeben, und er hoffte, obwohl es nichts mehr zu hoffen gab. Er starb am 31. Oktober 1989, nachdem er mir Geschichten über seine Zeit als »Friend of The Beatles«, als der er im amerikanischen Radio über die Band berichten durfte, sowie wichtige Einzelheiten über die Ereignisse im Queen Elizabeth Hotel in Montreal im Mai/Juni 1969 verraten hatte, als John und Yoko im Rahmen ihres Bed-In For Peace »Give Peace A Chance« aufnahmen und er dabei sein durfte.
Als Fleet-Street-Journalistin habe ich die bekanntesten Rockstars interviewt, die einem so auf Anhieb einfallen. Viele habe ich auf Tournee begleitet und Hunderte von Stunden in ihrer unmittelbaren Umgebung verbracht, sie berührt, mit ihnen gesprochen, dieselbe Luft geatmet wie sie. Meine Erfahrungen und Beobachtungen verdichten sich zu der Vermutung, dass ihnen allen einige Eigenschaften, Charakterzüge, Geisteshaltungen und Sichtweisen gemeinsam sind. Trotz ihrer gegensätzlichen Sounds und Visionen, der Vielzahl an unterschiedlichen Stilen im Songwriting und der Performance entstammen doch die meisten von ihnen demselben Schmelztiegel. Sie mussten zu viel beweisen, waren entsetzlich unsicher und sehnten sich nach Anerkennung wie sonst nur Verhungernde nach Brot. Kaum bohrte man ein bisschen tiefer, war deutlich die Quelle ihrer Kunst zu erkennen. Für sie war das eine ohrenbetäubende Woge, eine erschreckende innere Flutwelle, der tiefe und unüberwindbare Abgrund, den Vernachlässigung, Missbrauch oder andere Traumata in ihrer Kindheit hinterlassen hatten. Möglicherweise sind Rockstars die gequälteste, gepeinigtste Spezies überhaupt.
Seit Jahren habe ich mich mit ihnen beschäftigt, und zwar nicht nur mit den Männern, denn natürlich entpuppen sich ebenso viele Künstlerinnen als Opfer. Auf jeden Johnny Cash – der als Kind misshandelt wurde und Not leiden musste, sein gesamtes Leben lang gegen Sucht und Traumata ankämpfte und so verstört war, dass er in seinem gefeierten Song »Folsom Prison Blues« davon sang, einen Mann in Reno erschossen zu haben, nur weil er habe sehen wollen, wie er stirbt – kommt eine Christina Aguilera, die extreme physische und emotionale Grausamkeit durch ihren Vater erfuhr und sich der Musik zuwandte, um den Schmerz zu lindern. Auf jeden Prince, der die Trennung seiner Eltern mit zwei Jahren überstand, indem er sich in Widersprüche kleidete, der als Epileptiker gemobbt wurde und sich zu seiner Sexsucht bekannte, bevor er Trost in der Religion fand – kommt eine Adele, die drei Jahre alt war, als ihr Vater ihre Mutter sitzen ließ. Mark Evans versuchte sich wieder anzubiedern, als er merkte, was aus seiner Tochter geworden war. Aber Adele wollte nichts davon wissen. Auf jeden Jimi Hendrix, der als Kind einer alkoholkranken Mutter geboren wurde, bei seinem alleinerziehenden Vater aufwuchs und täglich häusliche Gewalt erlebte – kommt eine in ihrer Familie unverstandene Janis Joplin, die in der Schule wegen ihres Gewichts, ihrer Akne und ihrer Liebe zu schwarzer Musik gehänselt wurde. »Pearl« wurde als »Schwein« und »Hure« verschrien und mit ihrer Flasche Southern Comfort aus der Stadt gejagt. Schließlich hat sie aber nicht der Alkohol umgebracht, sondern das Heroin. Auf jeden Eric Clapton, der bis er neun Jahre alt war glaubte, seine Großmutter Rose sei seine Mutter und seine Mutter Patricia seine Schwester; als Patricia heiratete und nach Kanada zog, weitere Kinder bekam, aber ihren Erstgeborenen nicht zu sich holte, fühlte er sich erneut abgewiesen; heroinsüchtig verliebte er sich in die Frau seines besten Freundes George Harrison und überredete Pattie Boyd schließlich, ihn zu heiraten, doch das Paar konnte keine Kinder bekommen, und er setzte dem Elend die Krone auf, indem er zwei andere Frauen schwängerte, die größte Tragödie seines Lebens aber ereignete sich im Jahr 1991, als eines seiner Kinder, der vierjährige Connor, aus dem offenen Schlafzimmerfenster eines Apartmenthochhauses in Manhattan fiel – kommt eine Rihanna, die auf Barbados von einem gewalttätigen, missbräuchlichen, alkohol-, crack- und kokainsüchtigen Vater aufgezogen wurde und diesen Verhältnissen mit nur fünfzehn Jahren in Richtung Weltruhm entkam. Auf jeden Eminem, der noch ein Baby war, als sein Vater die Familie verließ, und der von seiner Mutter Debbie Nelson misshandelt und mit einem Enthüllungsbuch hintergangen wurde (als sie an Krebs erkrankte, zahlte Eminem trotzdem ihre Arztrechnungen) – kommt eine Amy Winehouse, die nie darüber hinwegkam, dass ihr geliebter Vater ihre ebenso geliebte Mutter wegen einer anderen Frau verließ. Amy suchte Zuflucht in der Selbstzerstörung, in Drogen und Alkohol, bis sie daran zugrunde ging. Auf jeden Michael Jackson – dem vorgeworfen wurde, als Erwachsener Minderjährige sexuell missbraucht zu haben, nachdem er in seiner Kindheit selbst missbraucht worden war – kommt eine Sinéad O’Connor, die behauptet, von ihrer inzwischen verstorbenen Mutter in einer Folterkammer zu Hause sexuell misshandelt und gezwungen worden zu sein, mantraartig zu wiederholen »Ich bin nichts«, und die als Erwachsene mehrere Nervenzusammenbrüche erlitt.
Richard Starkey wurde als Kind eines häufig abwesenden betrunkenen Vaters und einer überfürsorglichen Mutter geboren, litt als Kind ein Jahr lang an den Folgen einer Blinddarmentzündung und konnte, kurz bevor er das Erwachsenenalter erreichte, noch kaum lesen und schreiben. Er fand seine Rettung in der Musik, in Ruhm und Reichtum als Ringo Starr. Paul McCartney und sein jüngerer Bruder Michael verloren ihre Mutter, die Hebamme Mary, die im Oktober 1956 im Alter von nur siebenundvierzig Jahren starb.
Sie sehen, Rockstarruhm musste von jeher in unzähligen berühmten und auch weniger berühmten Fällen als Gegengift gegen Not und Elend herhalten.