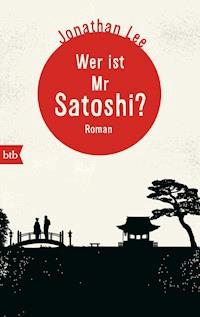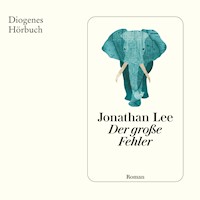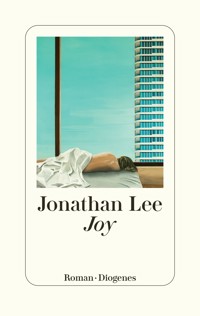
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Joy Stephens' Leben lässt wenig zu wünschen übrig: Mit Mitte dreißig steht sie kurz vor der Ernennung zur Partnerin in ihrer Londoner Anwaltskanzlei, sie ist der Inbegriff einer erfolgreichen, attraktiven Karrierefrau und führt eine offene, aber verlässliche Ehe. Trotzdem bereitet Joy ihren Abgang bei Hanger, Slyde & Stein vor – bis sie bei ihrer Dankesrede vor aller Augen zehn Meter in die Tiefe stürzt. Hat ihr Anwaltskollege und Ex-Lover Peter etwas damit zu tun? Oder übt dieser funkelnde Glaspalast inmitten der flirrenden Lichter Londons einen ganz eigenen Abwärtssog aus?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jonathan Lee
Joy
Roman
Aus dem Englischen von Cornelia Holfelder-von der Tann
Diogenes
Für Amy
»Glück ist das Licht auf dem Wasser. Das Wasser ist kalt, dunkel und tief.«
William Maxwell
ERSTER AKTTraumlogik
»… Atzen Fledermäuse Katzen? …«
Lewis Carroll,Alice im Wunderland
01:00
Warum steht die Tür offen? Die Haustür dürfte nicht offen stehen. Ein Uhr morgens im Stadtteil Angel, Müdigkeit surrt in Joys Kopf wie eine eingesperrte Fliege, und die Tür steht offen. In einem gewissen Stadium des Lebens wird jede Einzelheit komplex.
Sie checkt ihren Blackberry. Nichts Neues. Nicht, seit sie ihn gerade eben im Taxi gecheckt hat. Keine E-Mail, keine Sprachnachricht, keine SMS von Dennis, die erklären würde, warum die Tür nicht zu ist. Während das schwarze Taxi, das sie abgesetzt hat, davonschnurrt, fährt sie mit der Zeigefingerkuppe über die Zähne ihres Haustürschlüssels, des Schlüssels, der jetzt überflüssig ist, und fühlt scharfe kleine Urteilsscheren schnippschnapp durch ihr Bewusstsein schneiden: unverantwortlich – gefährlich – hat er schon mal gemacht – Tür offen gelassen beim Zubettgehen – Zubettgehen mit seinem Mitternachtstoast – ägyptische Baumwolle, und er isst Toast! Kribbelnder, schmerzender Ärger übernimmt, noch verstärkt durch das, was sie jetzt bemerkt: ein auf dem Boden deponiertes Präsent von Zorro, dem offenkundig inkontinenten Cockerspaniel der Nachbarn, umstrahlt von einer Aura spöttischen Mondlichts.
In letzter Zeit ist Joy bemüht, sich Kraftausdrücke zu verkneifen, aber jetzt fühlt sie, wie einige ihre Kehle empordrängen; Hitze steigt ihr in die Ohren und Augen, und ihre Haut gibt einen Hauch Parfüm ab. »Du bist zu streng mit den Menschen«, hat ihr Vater immer gesagt, und sie hat dran gearbeitet, nicht so streng mit anderen und sich selbst zu sein, hat sich vorgenommen, den letzten Tag ihres Lebens in einem ätherischen Zustand der Gelassenheit zu verbringen, ihre absurdesten High Heels zu tragen und Fremden ein breites Lächeln zu schenken, aber jetzt steht die Tür offen, steht um ein Uhr an diesem letzten Freitag erkennbar offen (schon fast sperrangelweit offen – gähnend, aufklaffend), und die Atkinsons haben noch nie was von Hundekotgreifern gehört, und die Luft vor ihrem Haus ist eine tierische Wolke von Kotgestank, Gestank, der durch die floralen Noten ihres Parfüms etwas Billig-Süßliches bekommt, und tiefe Runzeln bilden sich auf ihrer Stirn, der auch der fransige, seidige Pony darüber und die immer glänzenden Augen darunter den Ernst nicht nehmen können.
Sie schluckt ein Arsch und ein Sack hinunter, landet bei einem fast lautlosen Trottel. Den eigenen Mann Trottel zu nennen, das Wort in der Januarluft ein rasch verfliegendes Wölkchen, tut überraschend gut. Reduziert den Nebel im Kopf. Reduziert die Frustrationen der Woche, die Toastkrümel der Woche, die an ihrer Haut kleben. Nach einer Arbeitsphase wie der, die sie gerade hinter sich hat – einer absurd langen Reihe von Meetings, durchsetzt mit Stress und Koffein, sechzehn Stunden zermürbender Diskussionen über Lebensmittelgesetze und die Frage, was man in Hühnerbrüste injizieren darf und was nicht, sechzehn Stunden nicht allzu verstohlener Blicke auf ihre Brüste von Männern mit breitgequetschten B-Körbchen-Füllseln unter klebrigen, gelbstichigen Hemden –, fühlt es sich wie ein überaus prägnantes Schlusswort zu ihrem Donnerstag an: Trottel.
Ein Tier huscht zwischen parkenden Autos hindurch, rötlich im Schummerlicht der Straßenlaternen. Über diesen Straßenlaternen sind viktorianische Dächer mit Antennen gespickt, und eine Mondsichel hängt im Dunkel. Den Kopf in den Nacken gelegt, im Bewusstsein der Tatsache, dass sie den Mond nie wiedersehen wird, und entschlossen, seine abstrakte Eleganz zu würdigen, hört sie dann das leise Surren von Rädern – ein Fahrradlicht erhellt das Gesicht des Fuchses – und streckt, des Herumstehens auf der Straße müde, die Hand nach dem Türknauf aus; das Leder ihrer Handtasche flirtet mit ihrem Rock, als sie in die tiefe Düsternis des Hauses tritt. Ihr Ziel für die nächsten Stunden? Nicht zu viel zu denken, ihren Plan auf jene ruhige, systematische Art auszuführen, die ihr Arbeitgeber, taub für die unvermeidliche Abkürzung, als Kombination aus Selbstdisziplin, Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt wertet (»Zeig mal ein bisschen mehr SEGS«, sagen Joys Kollegen, »die Partner stehen auf SEGS«), aber irgendwie ist es nicht –
Knarrr-ck.
Sie stutzt – was ist das?
Stille, während der Moment sich verdichtet, dann wieder Knarrr-ck. Irgendwo zwischen Knarren und Knacken und – halt – war das anders?
Ja.
Anders.
Eingestreut zwischen die Knarrr-cks hört sie ein Geräusch, das mit mehr Luft verbunden ist, ein … Wu-wuuh? Fast wie der Background bei diesem einen Stones-Song, dem, den Peter so mag, Sympathy for the Irgendwas – Wu-wuuh – Devil. Komisch. Beängstigend. Nur sie und Dennis benutzen diese Haustür, die Einliegerwohnung auf der Hangseite ihres terrassierten Hauses hat einen eigenen Eingang. Von dort oben hört sie nichts, hört sie nie etwas. Dieser merkwürdige Mix aus zwei Geräuschen kommt aus Richtung ihrer Küche, ihres Wohnzimmers.
Knarrr-ck.
Wu-wuuh.
Wahrscheinlich nichts weiter … es sei denn … wahrscheinlich nichts …
Sie streift die Schuhe ab und schleicht in Zeitlupe durch den Flur. Die Luft ist trotz der offenen Haustür sirupdick von der Zentralheizungswärme. Angespannt und ängstlich nimmt sie in der Hitze ihre Umgebung überdeutlich wahr: den staubgrünen Teppich, die schattendunklen Wände, die Staubflusen unter dem Heizkörper. Es ist doch idiotisch, sich zu fürchten. Knarrr-ck. Wenn ein psychopathischer Einbrecher herausstürzt und sie umbringt – dann erspart er ihr doch nur die Mühe, es selbst zu tun. Wu-wuuh. Aber wenn er ihr nur wehtut, nur wehtut …
Sie zögert. Fragt sich, ob sie umkehren soll. Die Atkinsons wecken? Mit Zorro wiederkommen?
Dann, inmitten der Unentschlossenheit, eine Welle von Selbsthass: Also bitte. In den kommenden Stunden ist Mut gefragt, und die Atkinsons sind Lateinlehrer, das einzig Fürchtenswerte an Zorro ist sein Hinterteil.
Ein Schritt, ein zweiter, ein dritter. Vorbei an der Küchentür, also müssen die Geräusche aus dem Wohnzimmer kommen. Sie bleibt wieder stehen. Konzentriert sich. Ruft Dennis’ Namen. Heraus kommt ein leises Krächzen, ein Streichholzflämmchen in weitem Dunkel. Sie erwägt, die Lampe auszustöpseln. Sie als Waffe zu benutzen. Wo ist ihr Tennisschläger? Sonst ist ihr Schläger immer unter dem Tisch mit der Lampe, die in Ermangelung des Schlägers vielleicht die beste Waffe halbwegs in Reichweite ist.
Knarrr-ck.
Wenn sie diese Begegnung mit dem Einbrecher überlebt, sich aber herausstellt, dass er ihren Tennisschläger gestohlen hat, wird es nichts mit ihrem Mittagspausen-Tennismatch.
Wu-wuuh.
Was nicht gut wäre, weil es das letzte Tennismatch ihres Lebens sein sollte und insofern etwas Zeremonielles, denn für Joy war, auch wenn sie im Ganzen ein authentischer und unprätentiöser Mensch ist, durch das ganze Traditionsgehabe – all die Präjudizien, Präambeln, hochachtungsvollen Grüße und Dienstwagen mit Chauffeur, die eine Juristenkarriere ausmachen – das Zeremonielle ein Teil ihrer Person geworden. Und sie ist Joy, immer noch Joy, trotz ihrer Zweifel in letzter Zeit – dem nagenden Gefühl, dass sie in der falschen Haut steckt, dass selbst ihre Gefühle geborgt oder falsch sind.
Während das Adrenalin durch ihren Körper schießt, verhakt sich ihr Denken an der verblüffend banalen Frage, ob sie, wenn ihr der Einbrecher den Tennisschläger (nicht aber das Leben) nimmt, das Tennis mit Christine absagen und stattdessen eine letzte Fitnesssession mit ihrem Personal Trainer in der Firma machen soll, aber sie hat auf die Gesellschaft einer Freundin gehofft, und sie will auf keinen Fall jemanden enttäuschen, der immer so nett zu ihr war wie Chri –
KNARRR-CK.
Lauter jetzt und damit klarer, sind die beiden Geräusche nicht mehr so ineinander verflochten, und Joy denkt darüber nach, konzentriert sich auf das unmittelbare Problem und findet es lustig, echt lustig, dass das eine Geräusch so hauchig-menschlich klingt und das andere mehr wie irgendein knarrendes Möbelstück und – könnte es sein –
Sie spürt irgendwo in ihrem angstvernebelten Hirn das lautlose Herangleiten einer neuen Idee.
WU-WUUH.
Die Geräusche. Das ist. Das hat bestimmt etwas mit Dennis’ neuem Fitnessding zu tun.
Sie atmet aus. Heiliger. Alles okay. Himmel. Seit er dieses Sabbatjahr macht, ist Dennis – der solide, verlässliche Dennis – ständig dabei, sich vor Fitness-DVDs zu verrenken und Zeug zu trinken, das die Konsistenz von nassem Zement hat. Ältere Männer. Sie müssten mit Warnhinweisen versehen sein. Als sie geheiratet haben, war er noch einigermaßen jung, aber niemand hat ihr gesagt, dass der Abstand irgendwie immer größer werden würde, dass für einen Mann über vierzig jedes Jahr ein Hundejahr ist, verbunden mit Flatulenz, Paranoia, regelmäßigen Nickerchen und vehementem Bellen am falschen Baum.
KNARRR-CK.
In Joys Kopf hat sich jetzt ein Bild geformt: Er macht irgendwelche albernen, mit Wu-Wuuh verbundenen Ich-sehe-nicht-aus-wie-fünfundvierzig-Trizeps-Dips, die Fersen in den teuren Teppich gegraben, sein ganzes Körpergewicht auf der Sitzkante des knarrr-ckenden Jacobson-Sofas abgestemmt, und mit diesem Szenario kann sie leben, das kann sie tolerieren, weil es ein Szenario ist, in dem sie nicht die Mühe auf sich nehmen muss, die Lampe auszustöpseln und einen Einbrecher zu erschlagen, nur Stunden, bevor Hanger’s ihr die Partnerschaft anzutragen gedenkt, bevor sie ihr die Papiere zur Unterschrift vorlegen und ihr eine Kapitaleinlage abluchsen, ihre Finanzmittel binden wollen – eine Ehre, durch die sich das Geschäft des Sterbens als genauso kompliziert entpuppt, wie sich das Geschäft des Lebens in still-beharrlicher Überzeugungsarbeit erwiesen hat. Sie will gehen, wie sie es geplant hat, heute Nachmittag, an dem Datum, an dem ihr Leben in die Brüche gegangen ist, will auf eine Art und Weise gehen, die so wenig Wirbel wie möglich macht, ja gar keinen Wirbel.
Im Halbdunkel des Flurs flackert eine Erinnerung auf. Sie sieht sich und ihren Neffen in einem Zelt. Ein Zelt mitten im Esszimmer ihrer vorigen Wohnung, hastig auf dem Teppichboden aufgebaut, in der Hoffnung, dass es die Unterlippe des Kleinen vom Zittern abhält. Klar, er vermisste seine Eltern, die mit Freunden in Südfrankreich zelten waren. Als Babysitterin wie als Zeltaufbauerin, stellte sie fest, hatte sie noch eine Menge zu lernen. Eigentlich als selbsttragendes Gebilde gedacht, benötigte das Zelt, um stehen zu bleiben, doch improvisierte Spannleinen – an Bücherregalen und Tischbeinen verzurrte Stücke von Paketschnur, die jeweils umschichtig erschlafften, wenn das Kind, aufgekratzt wegen des Taschenlampenstrahls, den Joy über die Zeltinnenwände gleiten ließ, das Fiberglasgestänge ins Wackeln brachte. »Tante Joy, kann ich die Taschenlampe lenken?«, sagte er … oder so ähnlich, eine Formulierung jedenfalls, die … seiner Frage etwas seltsam Präzises gab. Seine Rolle als Mini-Gott, der Licht und Dunkel kontrollierte, amüsierte ihn eine Weile, aber dann wurde es ihm langweilig, und er wollte noch mehr Cornflakes …
Jetzt, wo sie in all dem Knarrr-ck und Wu-wuuh einfach nur reglos dasteht und sich mit einer Brille auf der Flurkonsole einen Starrwettkampf liefert, ist ihre Angst in Langeweile umgeschlagen. Alles, was sie dort drinnen erwartet, ist eine lästige Debatte über offen stehende Türen und spätnächtliche Fitnessübungen. Der Zyklus von Kritteln und Grummeln ist unschön, aber gewohnt, ein sicheres Plätzchen, an dem sie sich einkuscheln kann. Wahrscheinlich ist es für Dennis mit dem Fitnesstraining genauso. Er macht seine Übungen vor dem Schlafengehen, weil sie den Tag auf etwas herunterdimensionieren, mit dem er umgehen kann. Und wenn sie ehrlich ist: Es gibt schlimmere Gewohnheiten. Man nehme nur mal die Jungs in der Firma, Typen, die vermutlich höhnisch über sie herziehen werden, wenn sie nicht mehr da ist. (War dem einfach nicht gewachsen! Hat den Druck nicht verkraftet!) Typen wie Peter, der seinen Arbeitstag gern damit beendet, in den Spiegel bei dem klobigen Cola-Automaten zu schauen, so angetan von sich selbst, dass man es förmlich hört, ein Frequenzrauschen, ein erregtes Statikknistern. Dennis berauscht sich wenigstens nicht an seinem eigenen Spiegelbild, sondern versucht nur – auf halbwegs männliche Weise – fit zu bleiben.
So besehen, war Trottel vielleicht ein bisschen zu hart.
Nur dass … komisch. Als sie Kopf und Oberkörper etwas nach vorn neigt, um über die Brille und die Konsole hinweg ins Unterwasserlicht des Wohnzimmers zu spähen, gerät etwas Neues in ihr Sichtfeld. Ein Fetzen Stoff auf dem Teppich, die Farbe schattengedämpft. Ist das – ein Slip?
Peter
Wenn man hundert Monate immer denselben Flur entlanggeht und Tastaturgeklapper und Teeschlürfgeräusche hört, weiß man, was es heißt, sich sicher zu fühlen. Da ist es ja wohl verständlich, wenn selbst ein Mann von meiner Visionskraft und Erfahrung das Büro als Refugium betrachtet, als einen Ort, wo die Welt übersichtlicher und besser ist als dort draußen. Schöne Frauen. Ansprechendes Mobiliar. Ein Sortiment wohlschmeckender Kekse. Ja: Hanger, Slyde & Stein war – bis letzten Freitag – eine Art Paradies. Und ich will Ihnen sagen, was das wirklich Beunruhigende ist: Wenn dieses Paradies aus den Fugen gerät, wenn Kollegen anfangen, sich selbst und anderen Schreckliches anzutun, bleiben sie äußerlich gleich. Wenn Leute zu Monstern werden, wachsen ihnen keine Hörner oder zusätzlichen Augen. Nein. Sie bleiben wohlduftende Wesen in Bleistiftröcken.
Was haben Sie gesagt?
Oh, verstehe. Röcke, Anzüge, Kilts – ich wollte da nicht spezifizieren. Ich habe hier meine Frau kennengelernt und, was im Moment näher am Thema ist, Joy, also habe ich bestimmt nichts gegen den weiblichen Teil der Belegschaft. Apropos Joy, haben Sie irgendwas gehört? Über ihren Zustand?
Natürlich. Versteht sich. Vertraulichkeit ist mir ja nichts Fremdes. Obwohl, wenn ich Ihnen ein Betriebsgeheimnis verraten darf: Hier bei Hanger’s gilt Vertraulichkeit als gemeinwohlschädigend. Anwaltskanzleien sind Netzwerke von Menschen, die sich jede private Kleinigkeit einverleiben wollen. Besonders groß ist der Appetit auf Demütigendes, auf die Filetstücke an Schmach oder Peinlichkeit. Vor ein paar Jahren kursierte ein Handy-Video von Nigel Beast, wie er beim jährlichen Partner-Dinner einnickte. Sein Kopf sank immer tiefer auf kerzenbeleuchtete Petit-Fours herab, und sein berühmt-berüchtigtes Nasenhaar, das sich rollt und kräuselt wie Geschenkband, geriet in Reichweite einer Flamme. Wie ein Feuerwerk, hieß es. Bengalisches Feuer. Der Durchschnittszuschauer nimmt es mit seiner Metaphorik nicht so genau, aber Sie haben sicher eine ungefähre Vorstellung. Nigel Beasts versengte Schweinchennase war fast ein Jahr lang Gesprächsthema Nummer eins. Sich eine Peinlichkeit zu leisten, wurde lange »den Beast machen« genannt, bis etwa ein Jahr später eine Frau vom Immobilienrecht nackt in der Damentoilette im vierten Stock dabei erwischt wurde, wie sie einen bodygebuildeten Repro-Assistenten Koks von ihrer Klitoris sniffen ließ. Natürlich amüsiert das, was Joy passiert ist, niemanden. Das will ich damit nicht sagen. Aber der Vorfall ist trotzdem Gemeingut. Es ist ein Beastgate, nur mit mehr Blut, ein Clitgate, nur mit weniger Schnee. Gute Firmenangestellte sind wie gute Bürger – neugierig. Sie werden drüber reden. Sie werden sich eine Geschichte zusammenstricken.
Ich muss zugeben, ich war schon ein bisschen gespannt auf Sie. Man kennt das ja aus all diesen amerikanischen Fernsehsendungen – haben Sie wenigstens in Ihrem normalen Sprechzimmer eine Couch? –, aber man rechnet ja nicht damit, dass der eigene Arbeitgeber den Gesundheitsschutz so ernst nimmt. Im Sinne der Wahrheitsfindung habe ich mir gedacht, ich schaue mal als Erster rein und sage Hallo. Damit Sie zum Einstieg jemand Erfahrenes und Vernünftiges haben. Ich fürchte, nach letztem Freitag haben manche Beschäftigten und vor allem natürlich Dennis ihre fünf Sinne nicht ganz beisammen.
Dennis.
Hat Ihnen noch niemand von Dennis erzählt?
Möglicherweise! Möglicherweise! Sie nehmen dieses Vertraulichkeitsding wirklich ernst, was?
Nur um eventuelle Unklarheiten auszuräumen, er ist Joys Ehemann. Die Sorte Eliteinternatsschnösel, die ins Parlament gehört, auch wenn er faktisch in einer anderen verknöcherten Institution beheimatet ist: der Universität. Er war dabei, als es passiert ist, und – blinzeln Sie zweimal, wenn es stimmt – die Firma hat auch ihm Ihre Dienste angeboten? Man hat ihn gestern herbestellt, um ihn davon in Kenntnis zu setzen, und hinterher, beim Kaffeeumrühren in der Teeküche, hat er mich festgenagelt und mit einem seiner Klagemonologe überzogen, wegen des Überwachungsvideos, das die Runde macht. Ich habe ihm zu erklären versucht, dass es ganz normal ist, wenn die Leute neugierig sind. Ist sie gesprungen? Ist sie gefallen? Wird sie wieder aufwachen? Ich habe ihm gesagt, das seien doch alles legitime Fragen.
Sie sind sich nicht sicher, ob sie legitim sind, oder nicht sicher, ob sie gestellt werden sollten?
Natürlich. Alles im Leben ist eine Frage der Perspektive. Selbst ausgesprochene Nischenaktivitäten – etwa die Benutzung von Gemüse zur analen Penetration einer geliebten Person – sind eine Frage der Perspektive. Aber bringt uns unerschütterlicher Relativismus wirklich weiter? Hilft er uns in irgendeiner Weise zu verstehen, warum die gemeine Gurke, die poplige Pastinake als erregend empfunden werden können?
Tja, also, nein, besonders gut kamen meine Ausführungen nicht an. Es folgte angespanntes Schweigen, wobei ich mir einbildete, Damon Turner vom Finanzrecht rülpsen zu hören. Damon hat so eine Art, sich breit vor einem aufzubauen, wenn er einen Rülpser kommen fühlt, eine richtige Show draus zu machen. Aber ich ignorierte sowohl das Vordergrundschweigen als auch das Hintergrundrülpsen und setzte meine Bemühungen fort, Dennis zu erklären, wie eine internationale Großkanzlei funktioniert. Das ist nämlich eine meiner Stärken: effektive Ausdrucksfähigkeit auch unter Druck. Ich bin zwar formal im Konfliktlösungsteam, aber meine eigentliche Spezialität ist Insolvenzrecht. Kennen Sie überhaupt irgendwelche Insolvenzrechtler?
Nein. Dachte ich mir. Aber wenn Sie welche kennen würden, wüssten Sie, dass wir immer hart am Abgrund operieren. Vorstände sind in akuter Panik, schreddern die Vergangenheit und versuchen, ihren Allerwertesten vor zukünftigen Forderungen in Sicherheit zu bringen. Mein Job ist es, da hineinzubohren, in den Druck, das Risiko, in die Lagerstätten von Lügen, dorthin, wo sich wahres Zeugnis verbirgt. Täuschung erzeugt einen Kreativitätssog – wenn man ein Detail zurechtbiegt, wird man auch das benachbarte ändern –, denn die Lagerstätten können ganz schön tief und eng vernetzt sein.
Als ich nach dem unerfreulichen Gespräch mit Dennis in mein Büro zurückkam, war die hübsche Jess, meine Trainee, nicht da. Das gab mir Gelegenheit, Peter den Großen auszupacken und unterm Schreibtisch heraushängen zu lassen. Er kommt gern mal an die Luft, und es hilft mir zu entspannen. Einen Nachteil hat es, wenn man sein Büro mit einer heißen Braut teilt: Man kann nicht immer richtig relaxen. Wenn ich allein und ein bisschen erregt bin, probiere ich immer mal aus, wie viele Gummiringe ich um den alten Jungen hängen kann. Mein persönlicher Rekord? Hundertneunundzwanzig. Die dicke Sorte aus dem Schrank im dritten Stock natürlich. Auch ganz amüsant ist es, sich Papierclips an die Ohrläppchen zu klipsen, aber das geht eigentlich nur nach fünf, wenn das Sekretariat leer ist.
Tiny Tony O erschien in meiner Tür. Das ist kein feinsinnig-ironischer Spitzname. Der Mann ist ein ausgewiesener Winzling. Außerdem ist er möglicherweise schwul und eindeutig Asiate – der feuchte Traum jeder Personalabteilung. Er ließ eine seiner Ausfragesalven vom Stapel, aber damit will ich Sie nicht belästigen. Ich merke schon, Sie kann man schnell schockieren, und außerdem ist das ja nicht unser Thema, stimmt’s?
Alles, was mir hilfreich erscheint? Also, Sie haben wirklich eine eigenartige Ausdrucksweise. Ich glaube, ich werde Sie Doctor Odd nennen. Finden Sie das einen guten Spitznamen? Doctor Odd?
Na ja, Doctor Who war vermutlich auch keiner, und trotzdem hat sich der Name gehalten. Also, es war ungefähr so. Sie müssen entschuldigen, Stimmenimitation ist nicht meine größte Stärke.
Oi, oi, sagte Tony, hab ich sie verpasst? Scheibenhonig aber auch, muss sie echt verpasst haben. Wollte zu unserer Jessmeister, und alles, was ich sehe, bist du. Sie macht ein bisschen was für mich in der Atomsache, der mit dem AKW, das sich Sicherheitspersonal aus dem Altenheim geholt hat. Wird langsam wirklich schwiiiierig. Noch ein Glas im Fox nach der Arbeit? Hab gehört, Sutcliffe haben sie an die Luft gesetzt. Von mir weißt du aber nichts. Er weiß es noch nicht. Wer hätte gedacht, dass sie noch mehr Senior Associates feuern, obwohl die gute Joy Stephens im Koma liegt? Mann, diese Zähne vermisse ich echt. Gibt nichts Schöneres auf der Welt als eine Garnitur perfekte Zähne. Weißt du schon, dass wir noch ein paar Junior-Anwälte auf Secondment kriegen? Das Letzte, was wir brauchen, sind diese kleinen Wichser mit ihren Roben und Perücken. Ich habe dringend Urlaub nötig, sehe aber nicht, wie das gehen soll, wenn uns diese Atomsache um die Ohren fliegt. Mein Magen, Mann, das Kantinenessen wird bei Gott immer schlimmer, die Würste, diese Bratwürste, wollten mir doch echt erzählen, dass es Firmenphilosophie ist, sie halb roh aufzutischen! Apropos, Kennedy glaubt, dass er als Nächster dran ist. Ich persönlich kann mir ja nicht vorstellen, dass Dada-Brian ihn gehen lässt, solange die Tabaksache noch qualmt. Gott, Kennedy ist ja so ein Pinsel. Un-fass-bar. Ich muss zugeben, Peter, der Schlips mit dem Hemd, das kommt gut. Wenn ich nicht bald mal eine Zeit lang freihabe, stürze ich mich irgendwo runter. Fakt ist, Jessmeister schmeißt sich ganz schön ran, und du bist ein verheirateter Mann. Hast du irgendwas über mich gehört, ich meine, du weißt schon, über meine Zukunft?
Ich sagte nichts.
Und sonst, sagte Tony, wie steht’s?
Eine Frage, der es angesichts meiner Rekordbemühungen unter dem Schreibtisch an Ironie nicht fehlte.
Geht so, sagte ich. Busy?
Hochgradig, sagte er. Womit er meinte: Ich hoffe, der nächsten Entlassungsrunde zu entgehen.
Ich auch, sagte ich. Ich werde jetzt doppelt rangenommen, weil sie mir auch noch Projekt Hähnchenfleisch untergeschoben haben, womit ich meinte: Meine Belastungen sind ganz klar sexueller Natur, meine Vorgesetzten wollen und begehren mich, ich habe einen Job auf Lebenszeit.
Dann wurde es richtig heikel. Er fragte mich, wie meine Frau Christine das Ganze verkrafte. Sie und Joy sind nämlich eng befreundet. Wir haben alle gemeinsam hier angefangen. Waren eine glückliche Familie, wir drei, bis letzten Freitag. Eine glückliche Familie auf eine dysfunktionale Art, wie die meisten Familien. Und was mich an der nachfolgenden Fragerei echt irritierte, war die implizite … na, egal, das war’s so ungefähr, was Tony gesagt hat. Eine impressionistische Skizze, wenn Sie so wollen. Zum Glück hatte er’s irgendwann satt, mich auszufragen, und ging rüber ins Sekretariat, um Olivia Sullivan dabei zuzugucken, wie sie den Laserjet-Farbdrucker mit Papier bestückte. Überall hier im Haus stößt man auf gebückte, kniende, kauernde Mädels. Wenn die Sie mal aus diesem Behelfstherapiezimmer rauslassen, sollten Sie einen kleinen Rundgang machen. In jedem Großraumabteil und jedem Treppenhaus, jeder Teeküche und jedem Eckbüro werden Sie prachtvolle Brustwarzenschatten unter engen weißen Blusen sehen. Wie gesagt, es ist eine Art Paradies, bis es keins mehr ist.
Was ich sagen will, ist, seit letztem Freitag ist klar geworden, dass eine Menge Leute hier etwas zu verbergen haben. Vor allem dieser asiatische Typ aus unserem Fitnessstudio und Barbara und selbst Dennis – Leute, die möglicherweise auch hierher eingeladen sind, zu diesen … wie würden Sie das nennen?
Unterhaltungen! Ha! Sie gefallen mir immer besser, wirklich, Sie haben definitiv einen postmodernen Humor.
Der Punkt ist, wenn man sich das Überwachungsvideo genau anschaut, sind diese drei die Ersten, die auf Joy zueilen. Es ist nur Sekunden, nachdem wir ihre Knochen auf dem Marmorboden knacken gehört haben, aber sie zwängen sich schon durch die Menge zu ihr. Und auf den wackligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen halten alle drei bereits den Kopf gesenkt, als ob sie nicht nur Angst hätten, sondern sich auch schämen.
Ich? Ich bin wohl auch zu ihr geeilt, das Sektglas in der Hand. Ich fühlte mich ganz seltsam. Ich hatte vorher nichts mitgekriegt. Es war doch der Tag, an dem sie Partner bei Hanger, Slyde & Stein werden sollte. Durchsetzungsfähig, erfolgreich und leidlich wohlhabend, vielleicht die begabteste und attraktivste Frau im Konfliktlösungsteam. Auf einem Steinfußboden, ohne irgendein Lebenszeichen.
An den Tagen seither habe ich Leute sagen hören, schon vor dem Sturz sei Joys Gesicht seltsam leer gewesen. Sie sagen, der Aufschlag war wie eine Bassdrum in ihrem Kopf. Sie sagen, ihre Gesichtszüge hätten vage und diffus ausgesehen. Und sie habe wie ein kaputter Stuhl gewirkt, als sie da lag: ein Designermöbel, das darauf wartet, entsorgt zu werden.
Natürlich haben sie das erfunden. Aber je öfter sie das Geschehen in Worte fassen, desto ausgefeilter wird die kollektive Erinnerung. Das ist das Problem an uns Londonern, finden Sie nicht? Wir reden so viel Zeug, nur um klarzukommen! Wir ertragen es nicht, dass unsere Ängste wiederkehren, wenn wir allein sind, also treffen wir uns und reden. Wir analysieren endlos dieses stumme Etwas in ihren Augen während der Rede, die unheimliche Unfokussiertheit oder die unheimliche Fokussiertheit in den Pupillen – die Angst vor einem vergeudeten Leben oder die Überlegung, was es zum Abendessen geben sollte. Permanente Deutung. Gemurmelter Konsens. Klangvolle Geschichten. Nehmen Sie’s nicht persönlich, aber ich finde diese Keiner-soll-mit-seinen-Gefühlen-allein-bleiben-Psychomasturbation extrem langweilig. Und das sage ich als jemand, der eigentlich ein großer Freund von …
Ob ich glaube, dass es ein Selbstmordversuch war? Ich persönlich, meinen Sie?
Ich weiß positiv, dass sie in der Nacht vorher bis nach Mitternacht gearbeitet hat. Ja, genau genommen, hatte sie das die ganzen letzten Wochen schon getan. Sie war überarbeitet, aber das sind wir alle. Also muss ihr Privatleben eine Rolle gespielt haben. Wenn man nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt, reicht manchmal eine Kleinigkeit – die Schlaftabletten sind alle, oder die Milch ist sauer –, um einen in irgendeine dunkle Ecke des eigenen Selbst zu katapultieren. Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Was wohl passiert ist, als Joy in den frühen Morgenstunden dieses Freitags nach Hause kam. Ich nehme an, die Polizei und die Presse werden sich dranmachen, diesen letzten Tag zu rekonstruieren, von der ersten Minute bis zu dem Sturz um siebzehn Uhr.
Geht die Uhr da richtig?
Tatsache?
Ich muss zu einem Senior-Associates-Forum über die Frage, wie sich der Anteil der Frauen unter den Partnern erhöhen lässt. Nichtkomatöser Frauen vermutlich. Ist Teil einer Diversitätsinitiative.
Nein, Diversität. Das neue Wort der Firma für Scheiße-wir-sind-ein-reiner-Männerclub.
Sie sind wie meine Trainee, Doctor Odd. Nonstop am Mitschreiben. Nur dass Sie anscheinend lose Blätter bevorzugen. Ich persönlich hätte da die Befürchtung, dass die Seiten durcheinandergeraten. Ich bin nämlich ein totaler Strukturfreak.
Was ist denn Ihr Gummiringestand?
01:10
»Das sieht jetzt sicher ungut aus, Joy-Joy. Nicht dass ich, na ja, doch, zu einem gewissen Grad schon – ja – zugegeben, das muss jetzt wirklich ungut aussehen.«
Dennis steht da, die Hände in den Hüften, den Hals verdreht, um sie sehen zu können.
»Ich meine, mir ist bewusst, dass das eine gewisse Abweichung von der Norm ist.«
Er ist nackt, bis auf die Socken an den Füßen und das Kondom auf dem erschlaffenden Penis.
»Sie ist hier aufgetaucht, wobei ich mit ›sie‹ diese, nun ja, immer noch kniende Dame hier meine … und wir haben uns einfach nur in aller Harmlosigkeit einen Drink genehmigt, um die Zeit herumzubringen (wobei die natürlich auch so herumgegangen wäre, versteht sich, also Gin Tonic mit Limette), aber du entschuldigst ja sicher meine unpräzise Ausdrucksweise in einer Situation wie … und da bin ich mehr oder weniger versehentlich –«
»Mit dem Schwanz voran in ihre Vagina gefallen?«
Sein Adamsapfel hüpft, um einem Schlucken stattzugeben. »Du verstehst dich auf prägnante Formulierungen, Joy-Joy, hast du immer schon, aber was ich sagen wollte, ist –«
Mistkerl. Gar nicht zuhören, diesem Mistkerl. Der da steht und mit zusammengekniffenen Arschbacken irgendeine Erklärung vorbringt. Hängearschiger Mistkerl, mit seiner Tussi hier im Wohnzimmer. Knackiges junges Ding, auf allen vieren auf dem Jacobson – dem Jacobson! –, das glänzende offene Haar wie die Blätter von etwas Hübschem, einem Baum, einer hübschen, sonnendurchfluteten jungen Birke, und der Hintern straff und makellos, dem Becken des Mistkerls entgegengereckt, und dieses, igitt, Himmel, bananenartige schwarze Ding, das in ihr steckt, und er, der immer noch irgendwas zu erklären versucht, während das Kondom herabhängt – erschöpft, runzlig, reif für den Ruhestand.
»Du, äh«, fährt er fort, »starrst der Dame auf den … verlängerten Rücken, Joy-Joy, sorry, sorry, weiß, ich sollte nicht unsere richtigen … Von wegen Leute anstarren ist unhöflich und so weiter, haha.«
Joy weiß, alle Objekte der Begierde erscheinen einem abstoßend, wenn man keine Lust darauf hat – Austern sind nur eklige klebrige Dinger, wenn man Kuchen will –, aber Dildos fand sie immer schon aus jedem Blickwinkel widerwärtig. Weil das Mädchen so schlank und geschmeidig ist, wirkt dieser hier besonders scheußlich, wie ein Folterinstrument oder das überdimensionale Ventil einer Aufblaspuppe. Mit Sexpuppen treibt er’s noch nicht, aber in eine Affäre mit Luft und Plastik hineinzuplatzen, wäre immer noch besser als dieser eindeutig mensch-zu-menschliche Betrug. Sie war nie eine sklavische Anhängerin konventioneller Beziehungsregeln, aber das hier, diese Endphase ihres Auseinanderdriftens, lässt die Möbel im Rhythmus ihres Pulsschlags zucken und aufglimmen.
»Äh, Liebes? Vielleicht könntest du ja den Slip dort herüberwerfen, und die junge Frau hier könnte vielleicht diese Position verlassen und ihre Blöße bedecken?«
»Ich vergleiche ihren Hintern gerade mit deinem«, sagte sie mit adrenalingespeister Aggressivität. »Der in letzter Zeit ganz schön fett aussieht.«
»Fett?«
»Wie ein Schweinehintern«, sagt sie.
»Aha«, sagt er.
»Eine Serie von Fleischsäcken.«
»Hoho! Trotz des Workouts, meinst du.«
»Mini-Arschbacken und Maxi-Arschbacken.«
»Hm.«
»Chinchillaartig.«
»Chinchilla, ah, du meinst –«
»Tier. Fleischig. Übergroß. Grau.«
»Okay. Okay, verstehe. Deinen Mann mit einem dämmerungsaktiven Nagetier zu vergleichen, das … Tut mir leid«, sagt er.
Die Entschuldigung, und sei sie noch so minimal, besänftigt sie etwas. Gegenstände verlieren ihren flüssigen Schimmer, alles im Raum stabilisiert sich wieder. Will sie fünf Jahre Ehe mit einem großen Krach beenden? Sie mag ihn, so wie man ein lange getragenes Kleidungsstück mag – wenn die Farben verblasst und die Flauschigkeit weg sind, gehört es einem erst richtig, samt Fleck am Saum und allem, macht es durch Vertrautheit wett, was es an Attraktivität eingebüßt hat –, aber jetzt macht er auch das noch kaputt, indem er anfängt, die Regeln zu brechen, sie wie eine Idiotin dastehen lässt, zu dumm, um das Knarrr-cksen und Wu-wuuhen mit ihrer heimlichen Donnerstagabendbeschäftigung in Verbindung zu bringen, dem Ritual, das zwar beschämend, aber (unbedingt!) als ein gemeinsames gedacht ist.
Noch immer auf allen vieren, bricht die dildobestückte Besucherin jetzt ihr Schweigen. Ihre Worte kommen im einförmigen Tonfall einer Professionellen, die das hier im Schlaf könnte und wahrscheinlich auch manchmal tut: »Würdet ihr euch jetzt mal einigen, Leute, oder gehört das zum Spiel?« In einer einzigen fließenden Bewegung, die die Haut über ihren Rippen spannt, zieht sie den Dildo mit einem irritierenden Schmatzgeräusch heraus und setzt sich hin, die Knie zusammen, die Füße auseinander, wobei die Arme diese schüchterne Pose spiegeln, sodass die vier Gliedmaßen ein X bilden.
»Liebes«, sagt Dennis, ohne auf die Einmischung einzugehen, »vielleicht magst du auch einen Gin Tonic als Friedensgabe? Da sind Limettenschnitze und Eis.«
»Auf dem Noguchi-Couchtisch. Danke. Besten Dank. Du hättest ihr absagen sollen, Dennis. Grässlicher Tag, du weißt doch, total hektisch. Ich dachte, du wärst ein Einbrecher, und dann … ich hielt es für deine Fitnessübungen.«
»Na ja, in gewisser Weise …«
»Lass es.«
»Es ist doch Donnerstagabend. Unser Abend, Joy-Joy.«
»Und wenn es einer von uns canceln will?«
Schweigen, sein Blick fällt auf das schmelzende Eis, und als ob ihn dieser Anblick milder stimmt, ist sein Ton, als er wieder spricht, ruhiger als vorher. »So ist die Regel, ich weiß, so ist die Regel. Und ich wollte es ja abblasen, als ich hörte, dass du mit deinem Fall so viel um die Ohren hast. Aber ich bin heute Nachmittag einfach nicht dazu gekommen, Joy-Joy, ich war abgelenkt, als du mich angerufen hast, ich habe nämlich im Zug diese sagenhaft berühmte Autorin getroffen, und weil ich dadurch so beflügelt war, sind die Ideen in mir nur so gesprudelt, wild gesprudelt, eine kreative Eruption, das war es wirklich, so wie wenn ich Gewichte drücke und eine Ladung Extra-Energie in meine Adern schießt und ich übermenschlich bin, Super-Dennis, und dann hat die Agentur gesagt, sie sei schon unterwegs, und sie kam um die übliche Zeit und –«
»Zieh dich einfach an«, sagt sie müde und verlagert dann, dem Gebot der Etikette gehorchend, ihre Blickachse auf das Mädchen. »Wir sind sonst nicht so.« Sie erntet ein schlichtes Achselzucken, was so unmittelbar nach Dennis’ wortreicher Rechtfertigung als erstaunlich ökonomische Äußerungsform erscheint. Seine umschweifige Art zu reden war eine der Eigenheiten, die ihn einst so liebenswert anders machten – ein altmodischer Akademiker in einem London voller eindimensionaler Karrieristen, langweiliger, geleckter Typen mit Cellostimmen und cellofarbener Solariumsbräune. Seine Umständlichkeit gab ihm – wie auch sein Strubbelhaar – etwas Menschliches. Doch nach fast fünf Ehejahren, in denen jedes exzentrische Detail eingehender Inspektion ausgesetzt war, hat ihr Mann – im Licht dieser Nacht – weniger von Hugh Grant und mehr von einem Dorftrottel.
Die gedungene Hilfskraft hat mit einem Portemonnaie voller Fünfziger das Haus verlassen, als der Dorftrottel schließlich wieder erscheint. In der regelmäßig umgestalteten Küche, zwischen der tomatenroten Kühl-Gefrier-Kombination, dem gelbgrün karierten Tischtuch und dem Stillleben mit valenzianischen Orangen an der Wand, dort, wo einst die Familienfotos hingen, ist er das einzig Farblose. Sein Äußeres, so wie es sich in letzter Zeit präsentiert, weckt in ihr Ärger, aber auch Bewunderung – Ärger, weil er sich keine Mühe gibt, und Bewunderung, weil ihm Makellosigkeit kein Anliegen ist.
»Bett, Liebes?«, fragt er und kratzt sich dabei nervös eine stoppelige Wangenpartie.
»Nein.«
»GT?«
»Von diesem Tonic kann ich nicht schlafen. Wie ich dir schon mehrfach erklärt habe.«
»Wein?«
»… Okay.«
»Und darf ich fragen, welchen der köstlichen –«
»Rot.«
Teurer Wein, teure Kühl-Gefrier-Kombination, teure Callgirls. Wann sind sie eigentlich dieser Konsumgier verfallen? In ihrem empfindlichen, überfrachteten Zustand fühlt sich das ganze Haus wie ein einziger irriger Impulskauf an, ein weiterer Fehler, der schwer auf ihrem Gehirn lastet.
Während er den Merlot eingießt, denkt sie darüber nach, es ihm zu sagen. So viele Wochen hat sie wach gelegen und überlegt, wie sie es ihm sagen könnte. In keinem dieser Szenarien kamen Callgirls, Sexspielzeug oder Streitereien über Limettenschnitze vor. Sie gingen eher in Richtung Duftkerzen, erlesenes Essen und klassische Musik. Sie hat sogar im Geist eine passende Playlist erstellt, unter sorgsamer Vermeidung düsterer Akkorde, Psycho-mäßiger Kreischtöne, zitternder Geigenklänge. Sie will ihm sagen, will es entschiedener als je zuvor, dass schon die ganzen letzten Jahre mit ihr nichts mehr stimmt. Jeder Morgen beginnt mit einem übelkeitsähnlichen Schrumpfgefühl tief drinnen. Der Weg ins Bad ist ein Hindernisparcours voller Geister. Das Gesicht, das ihr aus dem Spiegel entgegenblickt, ist weniger ein Gesicht als ein willkürliches Arrangement von Reueauslösern – die Nase, die einen ehebrecherischen Kuss empfangen hat, die Augen, die so vieles aus dem Blick haben geraten lassen –, und ihre Lippen werden faltig und schlaff, als ob sie in einem finsteren Märchen tagtäglich durch das vergiftet würden, was sie berühren. Mit Replenishing Balm und Spezial-Gloss glättet sie sie für den kommenden Tag, durch die Anstrengung des Lächelns schafft sie es, sie so straff zu ziehen wie die Laken des Gästezimmerbetts. Doch jeden Abend sind sie wieder schlaff, hängen die Mundwinkel. Das wollte sie ihm irgendwann sagen, wollte ihm erklären, dass ihr Selbstmord etwas Rationales sein würde, etwas Dezentes, Ruhiges, das ihrem Gemüt eher entsprach als das Stakkato-Funkeln des normalen Lebens, aber die Zeit ist ihr davongelaufen, und außerdem weiß sie, was er sagen würde. Quatsch, Joy, du kannst dir kein sauberes, ästhetisches Ende genehmigen. Du bist hinterher nicht in der Lage, dir dafür auf die Schulter zu klopfen. Du kannst den Tod nicht perfektionieren, als wäre er ein renovierungsbedürftiges Zimmer oder ein zu überarbeitender Schriftsatz. Du schaffst es gerade mal in The Lawyer, nicht in die Times. Shakespeare ist nicht da, um ein Drama über deinen letzten Tag zu schreiben. Die Geschichte wird dich nicht vermissen, aber ich, und das wäre egoistisch von dir. Er würde es nicht so kurz und bündig formulieren, aber unterm Strich würde es darauf hinauslaufen.
»Trink was, Joy-Joy«, drängt Dennis. Er macht ein Gesicht, das kindlich und trotzig ist – und ihm gut steht, muss sie zugeben. »Das entspannt dich, und das mit dem Mädchen tut mir wirklich leid.«
»Sie war sehr jung.«
»Quatsch. Paarundzwanzig, aber jünger nicht, nicht jünger als andere, die wir hier hatten. Korkt er? Man kann krank davon werden, wenn er korkt, habe ich heute gelesen, wusstest du das, dass es einen krank machen kann?«
Sie zuckt die Achseln und stellt fest, dass Achselzucken weniger wirkungsvoll ist, wenn man selbst derjenige ist, der es tut.
»Sorry wegen der Hitze, die Heizung spinnt immer noch, hatte die Haustür aufgemacht, damit es hier drin kühler wird, und dann nicht mehr dran gedacht, an die Tür, meine ich.«
»Ich bin müde«, sagt sie, und ihr Kopf sinkt an seine Brust.
»Du arbeitest zu viel«, sagt er und nimmt sie in die Arme.
»Andere Frauen in der Firma haben Kinder, um die sie sich kümmern müssen. Sie sind Anwältin und Mutter.«
»Ja, gut, okay, aber ich wette, also, ich meine, wenn ich ein wettender Mensch wäre, würde ich wetten, dass sie entweder schlechte Anwältinnen oder schlechte Mütter sind.«
»Und was hieße das?«, fragt sie und entzieht ihren Kopf dem Nest, das er aus Armen und Pullover gebildet hat. »Eine schlechte Mutter zu sein?«
»Joy-Joy, lass gut sein, du arbeitest zu viel.«
Sie arbeitet zu viel. Sie hat sich verausgabt. Sie nimmt unhinterfragt hin, dass Dennis in letzter Zeit keine Lust mehr auf Sex mit ihr allein hat. Sie lässt unhinterfragt zu, dass seine vor Jahren auf einer schmuddeligen Party geweckten Fantasien ihr Selbstwertgefühl untergraben. Vor seinem Sabbatical hat er sich manchmal beschwert, dass durch die Universität der Geruch des Todes weht, ausgehend von Literaturtheoretikern, die seine Lieblingsbücher dekonstruieren, und genauso muss es mit ihr sein. Sie ist dreiunddreißig, aber kaum noch vorhanden; er riecht den Tod in ihrem Haar, er braucht jemanden, der Leben in ihr Schlafzimmer bringt. Früher hat sie geglaubt, dass Traumata Menschen mit der Wucht nackter Gewalt töten, wie ein ins Gehirn getriebener Nagel, aber inzwischen sieht sie ihr gesammeltes Versagen als eine chronisch-degenerative Krankheit, ein langsames Abgleiten in Dunkel und Kälte. Der düstere Geruch des Todes muss die Ursache dafür sein, dass Dennis sich immer sofort auf die andere Seite dreht und tiefes Durchschlafen mimt. »Mimt« insofern, als sie jeden Morgen ein verklebtes Kleenex auf seiner Bettseite findet, und es ist ja auch nichts dabei, sagt sie sich, bei den morgendlichen Papiertaschentüchern wie auch bei den Donnerstagsmädchen, nichts dabei. Und doch ist sie hellfühlig für das Beben der Matratze geworden. Als ob die Erde selbst bebt.
»Hast du beim Reinkommen die Haustür zugemacht, Joy-Joy? Ich sollte wohl besser – ja, ich glaube –, ich gehe mal eben und mache die Tür zu.«
Sie horcht seinen Schritten hinterher, hört das Quietschen der Angeln, fragt sich, wie jung das Mädchen wirklich war, schaut auf die Uhr und wird dran erinnert, dass der Freitag sie schon erfasst hat, und als die Verriegelung klickt und der erste Riesenschluck Merlot ihre Lippen trocken hinterlässt, dreht sie sich zur Spüle um und übergibt sich.
Von Rotwein kotzen: Es gibt kaum etwas Schlimmeres auf der Welt. Danach schüttelt es einen vor Selbstekel.
Dennis
Tja, also, Doctor, es kommt drauf an, ob Sie die Zeit haben, aber der Punkt, an dem ich gern anfangen würde, ist der Tag vor dem Unfall meiner Frau, und das beinhaltet ein paar Dinge, die scheinbar nicht zum Thema gehören (meinen Studenten sage ich immer, sie sollen meine Redeweise dahingehend interpretieren, dass sie die Fußnoten und Parenthesen, die ich im Schriftlichen so schätze, unmittelbar inkorporiert), aber falls Sie die Zeit haben, könnte es (das, was ich über den Donnerstag zu sagen hätte) doch vielleicht einen sinnvollen Hintergrund für das liefern, was am Freitag mit Joy-Joy passiert ist und was fortwährend mit mir und in mir passiert, was meinen Sie?
Zu freundlich, und danke, ja, ich glaube, ich werde mir einen nehmen. Die verlangen ihren Anwälten hier ja viel ab, aber die Dienstleistungen und die Erfrischungen können sich sehen lassen, finden Sie nicht?
Also. Dreimal bin ich bisher 1. Klasse Bahn gefahren. Beim ersten Mal war nichts1, wohingegen ich beim zweiten Mal feststellte, dass ich (wenn man sich den Mittelgang einmal wegdenkt) neben dem Ex-Parteichef der Konservativen, William Hague, saß. Er war kürzlich wieder unter die Hinterbänkler gegangen2, und nachdem ich über zwei Drittel der Strecke London–York im Stillen mögliche feingeistige Gesprächseröffnungen erwogen hatte, sprach ich ihn schließlich an.
Tolle Mütze, sagte ich. Baseball, oder?
Danke, sagte er und lugte über seine Zeitung hinweg. Stimmt.
Ich sehe Ihnen an, was Sie jetzt denken, Herr Doktor, und Sie haben recht, vollkommen recht, ich hatte in der Tat vor, ihn (William Hague) zu fragen, wie es sein konnte, dass er nur Monate nach seinem Rücktritt als konservativer Parteichef ganz allein im Zug nach York saß, ohne Sicherheitsleute oder engsten Beraterkreis, auf den Knien einen Aktenkoffer, der nicht rot war und noch nicht mal richtig abschließbar aussah, aber – und das ist der Punkt – aus seiner kurz angebundenen Reaktion auf meine Bemerkung über seine Kopfbedeckung (die Baseballkappe) ging deutlich hervor, dass er den erdrutschartigen Sieg der Labour-Partei (2001) immer noch nicht verwunden hatte, und deswegen und angesichts des unwirschen Stirnrunzelns unter der hohen Glatze verkniff ich es mir und stellte mich während der restlichen Fahrt schlafend.
Bei meiner dritten 1.-Klasse-Fahrt saß ich einer sehr berühmten Schriftstellerin direkt gegenüber. Das war letzten Donnerstag, am Tag vor dem Sturz meiner Frau, nur Stunden bevor sie von der Arbeit kam und die Haustür offen fand und mich im Wohnzimmer mit … halt, Dennis, langsam, eins nach dem anderen, wie es sich – gemeinhin – gehört.
Verstehen Sie mich recht, ich habe volles Vertrauen zu Ihnen, selbstredend habe ich das, und ich sehe auch keinen Interessenkonflikt, wie meine Frau sagen würde, keinerlei Interessenkonflikt darin, dass Sie einerseits in einer Art fürsorgepflichtigem Arzt-Patient-Verhältnis zu mir stehen und andererseits in einem klassischen Lohn-und-Brot-Verhältnis zu den geschätzten Staranwälten, in deren Räumlichkeiten wir derzeit weilen, aber ich habe immer sorgsam darauf geachtet, über vertrauliche Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren, ja, mir zur Lebensregel gemacht, keine solchen vertraulichen Angelegenheiten preiszugeben, und deshalb werde ich die berühmte Schriftstellerin Beverley Badger nennen. Was natürlich kein echter Name ist.3 Doch obwohl es nicht ihr echter Name ist, könnten Sie, wenn Sie sehr pfiffig sind, darauf kommen, dass der Nom de plume, den ich für besagte Autorin kreiert habe, in annähernd anagrammatischer Weise auf ihre berühmteste weibliche Hauptfigur und damit – letztlich – auf ihre wahre Identität (die der berühmten Schriftstellerin) hinweist. Ich fürchte, das ist der einzige Tipp, den ich Ihnen geben kann.
Sehr gut, sehr vernünftig, dass Sie sich das notieren, auf die gute alte handschriftliche Art, wie es sich für einen richtigen Doktor gehört!
Sie sind kein …?
Aber vielleicht so was wie PhD?
Okay, verstehe, verstehe, dann wäre Ihr korrekter Titel also, auch wenn das ein bisschen nach einem schnurrbärtigen Gemeinderatsmitglied klingt …?
Alles klar, Counsellor. Also, meine beiden vorausgegangenen 1.-Klasse-Unternehmungen waren von der Universität bezahlt worden, diese aber nicht. Selbst wenn eine 240-Meilen-Hin-und-Rückreise, um einen Freund-Schrägstrich-Rivalen eine Postgraduiertenvorlesung halten zu hören, erstattungsfähig im Sinne der Kostenerstattungsordnung der Abteilung Englische Literatur von 2011 (Unterabschnitt: Reisen; Unterunterabschnitt: Bahn; Paragraf 2b) wäre, was sie streng genommen vermutlich nicht ist4, bin ich doch durch meine sabbaticalbedingte Langzeit-Freistellung von der Dozententätigkeit aller in jenem Dokument festgelegten Erstattungsrechte verlustig gegangen. Daher besaß ich an dem Tag, an dem ich Beverley Badger (die, wie gesagt, nicht wirklich so heißt) traf, ein im Voraus erworbenes Supersparpreis-Ticket, nicht gültig während der Stoßzeiten, mit Sitzreservierung in der Standard-Klasse. Hätte ich nicht beim Einsteigen in Bristol Temple Meads meinen reservierten Platz besetzt vorgefunden, und wäre er nicht von einer Frau mit einem netten, offenen Gesicht und einem schreienden Säugling an der kaum verhüllten Brust okkupiert gewesen, und wäre der Zug nicht für die Tageszeit überraschend voll gewesen, und hätte nicht der Schaffner mein Ticket kontrolliert, während ich eingequetscht zwischen der ständig auf und zu gehenden Toilettentür und dem kaum zu öffnenden Fenster stand und mein Buch zu lesen versuchte, und hätte es nicht sein Mitleid erregt, dass ich für einen reservierten Sitzplatz gezahlt hatte und trotzdem stand, tja, dann wäre ich wohl nicht in der 1. Klasse vis-à-vis von Ms Badger gelandet.
Ich nehme an, der Grund für meine Platzwahl war, neben der Tatsache, dass er (der Sitz) frei war, auch der Umstand, dass sie (Ms Badger) auf jene kultivierte, nicht bedrohliche Art, wie sie üppigen Frauen eigen ist, attraktiv wirkte. Wer die Wahl hat, setzt sich doch zweifellos in die Nähe des besten verfügbaren Genpools, meinen Sie nicht? Die Mutter meiner Frau ist New Yorkerin, und als Joy-Joy und ich das erste und einzige Mal hinflogen, vorgeblich, damit Joy-Joy nach jahrelanger Funkstille den Versuch machen konnte, wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen, letztlich jedoch einfach, um Alkohol zu trinken und Cupcakes zu essen, war der Genpool an Bord der 767 der Continental Airlines mehr als abschreckend, Counsellor, wirklich. Aber, jedenfalls, erst als ich diese üppige Frau im 1.-Klasse-Waggon mit Bleistift in ihrem Buch herumkritzeln sah und auf dem Deckel dieses Buchs die Worte Unkorrigiertes Fahnenexemplar las, wurde mir klar, wer sie war und wie gut mich mein Sitzplatzwahl-Sensorium geleitet hatte, und da ich aus der Willam-Hague-Sache gelernt hatte, knüpfte ich ein Gespräch über ihre Arbeit an (nicht etwa – auch wenn sie keine trug – über ihre Kopfbedeckung).
Nach nervösem Beginn unterhielten wir uns die nächsten eindreiviertel Stunden angeregt und praktisch ununterbrochen.5 Es war ein fantastisches Gespräch. Sie erzählte mir viele faszinierende Dinge über das Verlagswesen, die ich allesamt in mein hervorragendes Gedächtnis einspeiste für den Fall, dass ich irgendwann Gelegenheit hätte, sie zu recyceln und auf diese Weise einen literarischen Agenten dafür zu interessieren-Schrägstrich-gewinnen-Schrägstrich-ködern, mein eigenes in der Entstehung begriffenes Werk zu vertreten.
Verzeihung, Counsellor?
Oh, ganz recht! Ja. Ja, genau das meinte ich. Sie haben den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf getroffen. Dieses mein Sabbatical widme ich der Arbeit an einem Buch über Shakespeare – ein Sachbuch, aber nicht so streng wissenschaftlich wie meine bisherigen Publikationen, die im Universitätsverlag erschienen sind. Nein, dieses Buch wird Shakespeare den Menschen nahebringen. Es wird eine völlig unprätentiöse, fesselnde und überaus verkäufliche Hommage an den Barden.
Ja, klingt doch wirklich interessant, oder? Danke für Ihr freundliches Feedback. Und wenn ich mir auch nicht anmaßen würde, über Ihre Einstellung zu diesem Thema zu spekulieren, ist es doch meine persönliche Meinung (meine Frau würde da widersprechen, und Ms Badgers Opus nehme ich begründetermaßen aus), dass fiktionale Literatur heutzutage durchweg, zuweilen, gelegentlich einen gewissen Wahrheitsgehalt vermissen lässt, finden Sie nicht? Dass sie es nicht immer schafft, adäquat wiederzugeben, wie im wirklichen Leben das Lächerliche und das Ernste, das Dreckige und das Saubere, das Ausschweifende und das Asketische durcheinandergehen und gemeinsam einen beunruhigenden, aber amüsanten Wirrwarr bilden? Natürlich geht bei gewissen Arten von fiktionaler Literatur – in der ersten Person erzählten Romanen zum Beispiel – jeder Leser davon aus, dass es sich um ein verkapptes Memoire handelt. Und bei einem Memoire wiederum hat jeder automatisch den Verdacht, dass es reine Fiktion ist. Wenn ich aber sage, ich bevorzuge Non-Fiction, die wirre Wahrheit, dann ist es nicht das Memoire, das ich meine, im Gegenteil, das Memoire als solches finde ich immer schon eine Spur egozentrisch – muss es nicht eine arrogante literarische Gattung sein, die schon in ihrem Namen die Wörter me und moi vereint? –, nein, wenn ich über die Vorzüge der Non-Fiction spreche, denke ich an Biografien, historische oder literaturwissenschaftliche Betrachtungen. Ein Buch über Shakespeare, das zwanglos mäandernd, leserfreundlich und wahr ist: Diesem Projekt widme ich meine Tage.
Ob es schwer ist? Sie meinen … mit der Konzentration?
Natürlich … ich … ein bisschen schon. Das Buch ist in den letzten Tagen ziemlich in den Hintergrund getreten.
Ach, i wo! Nein, schon gut, geht schon, alles in Ordnung, danke der Nachfrage.
Es ist einfach nur schwer, mit dem Buch richtig in Fahrt zu kommen, wo doch sonst immer, wenn ich einen Satz oder Absatz zu Ende zu bringen versuchte, meine Frau anrief oder irgendwelche von ihr bestellten Küchenutensilien ins Haus geliefert wurden oder ich – spätabends – ihren Schlüssel im Haustürschloss hörte. Da waren diese äußeren Kräfte, die an den Schutzmauern meiner Konzentration nagten und dadurch einen kreativen Gegendruck von innen erzeugten, eine Abwehrkraft, um die Welt auf Distanz zu halten, und jetzt ist da nichts mehr, gar nichts, und ich habe alle Zeit der Welt, um über mein Buch nachzudenken (oder über die Verfallsdaten bestimmter Lebensmittel), und doch muss ich feststellen, dass meine Sätze platt auf dem Papier liegen, erdrückt von ebenjenen Eigenschaften, die laut Lawrence tödlich für den freien Vers sind – zu geschliffen, zu glatt, keine impulsiven Ecken und Kanten, kein rebellisches, nacktes Pulsen, keine widerborstige erlebte Erfahrung –, sowie den diffusen Gerüchten und den Tiefkühllebensmitteln, die meine Tage ausmachen und denen ebenfalls eine abgelagerte Einsamkeit innezuwohnen scheint, die ich nicht erklären kann.
Zum Beispiel das Gerücht, es sei ein Suizidversuch meiner Frau gewesen. Counsellor, ich kenne meine Frau, ich bin jetzt fast fünf Jahre mit ihr verheiratet, und es mag ja in ihren schwierigen Zwanzigern Tiefpunkte gegeben haben, da war, wie Sie vielleicht schon gehört haben, die Sache mit ihrem Neffen, aber das ist jetzt alles Vergangenheit, und ich glaube, dass sie (meine Frau) die zurückliegenden Fehler und Schicksalsschläge verarbeitet hat, und ich finde diese Unterstellung, die Unterstellung, dass sie keinen Abschiedsbrief hinterlassen würde, dass jemand mit ihrer Gewissenhaftigkeit und ihrem Vorstellungsvermögen dem eigenen Mann keinen Brief hinterlassen würde und dass sie es (den Suizid) in aller Öffentlichkeit versuchen würde – vor mir und wie vielen Kollegen, zweihundert? –, ausgesprochen absurd. Ja, ich finde Suizid per se absurd, beängstigend in seinem retrospektiven Glamour, seinem Versuch, den Tod auszuspielen, die natürlichen, wenn auch abschreckenden Verfallserscheinungen des Alters zu vermeiden, seinem gierigen Grapschen nach dem philosophischen Vorteil, und was ist, wenn man es bereut, wenn Celan, Plath, Woolf, Hemingway, Gertler, Berryman, Pavese, van Gogh, Rothko, Pollock es allesamt bereuten, im Moment, als der Abzug klickte oder die Wirkung der Pillen einsetzte, wie es ja wohl jeder vernünftige Mensch tun würde? Nein, nicht Joy-Joy, die Selbstmordtheorie ist absurd. Aber wiederum auch nicht absurder als einige der Verschwörungstheorien.
Warum sollte ich das nicht näher ausführen wollen? Sie gehören ja schließlich nicht zu den Lügenverbreitern, Counsellor.
Ich denke da (bei den Verschwörungstheorien) zum Beispiel an die, die sich auf ihre Freundin Christine bezieht. Die Unterstellung, dass Christine, nur weil sie Joy noch nicht im Krankenhaus besucht hat, etwas mit den Geschehnissen vom Freitag zu tun haben könnte, jenen Geschehnissen, die auf meine 1.-Klasse-Fahrt mit B. Badger folgten. Ich halte das für überaus unwahrscheinlich. Christines Mann Peter hingegen, auch ein Hanger-Mitarbeiter, ein zynischer