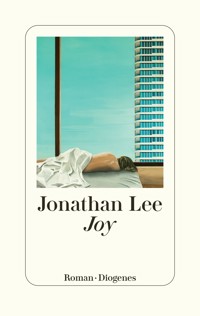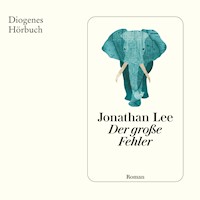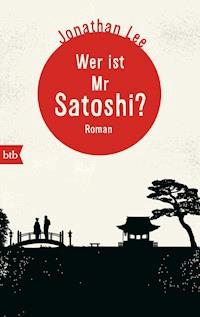
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Dieses Päckchen ist für Mr Satoshi. Wenn wir seine Adresse herausfinden.« So lauten die letzten Worte von Foss’ Mutter, während sie liebevoll einen abgeschabten Schuhkarton tätschelt. Und so entschließt sich der von Panikattacken heimgesuchte Fotograf, den rätselhaften Mr. Satoshi zu finden. Seine Reise führt ihn in die ebenso schrille wie geheimnisvolle Welt Japans. Bei seiner Suche entdeckt Foss, dass die Vergangenheit seiner Mutter mit einem herzzerreißenden Ereignis im Jahr 1946 verbunden ist. Aber weshalb will keiner darüber reden? Unterstützt von der pinkhaarigen Chiyoko deckt Foss die Lebens- und Liebeslügen seiner Eltern auf - und kommt der Frage, was im Leben wirklich zählt, ein ganzes Stück näher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jonathan Lee
Wer ist Mr Satoshi?
Roman
Aus dem Englischen von Cornelia Holfelder-von der Tann
Die englische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Who is Mr Satoshi?« bei William Heinemann, London.
1. Auflage
Copyright © 2010 by Jonathan Lee
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Satz: Uhl + Massopust
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock / Seita; Silhouette Lover
ISBN 978-3-641-15830-9www.btb-verlag.de
Für meine Eltern
Ich zweifle nicht daran, dass jedes Innere ein Inneres hat und jedes Äußere ein Äußeres und dass jedes Sehen ein anderes Sehen in sich birgt …
»Assurances«, Walt Whitman
Zur Pointe dieser Geschichte wird schließlich die Äußerung eines amerikanischen Akademikers zu Beckett: »He doesn’t give a fuck about people. He’s an artist.« In diesem Moment setzt sich Becketts Stimme über das Geklapper des Fünfuhrtees hinweg, und er ruft: »But I do give a fuck about people. I do give a fuck!«
Beckett Remembering: Remembering Beckett,Hg. James and Elizabeth Knowlson; Lawrence Held(Bloomsbury Publishing)
1
An einem Nachmittag im Oktober, auf dem Beton ihrer Terrasse, stürzte meine Mutter.
Das Geschehen spult sich immer wieder in meinem Kopf ab wie ein alter Film. Das Bild wackelt, die Perspektive verschiebt sich, die Schärfe schwankt. Damals sah ich sie ganz klar. Sie hob sich so deutlich von ihrer Umgebung ab. Aber jetzt nicht mehr. Im Film in meinem Kopf verschwimmen die Züge meiner Mutter mit dem Hintergrund: den Schatten, dem Rasen, dem sepiafarbenen Himmel.
Sie war dort draußen, weil sie mit ihren achtzig Jahren jeden Morgen mit dem einen Ehrgeiz erwachte: diese Terrasse unkrautfrei zu halten. Immer wieder spross Unkraut zwischen den Betonplatten, und immer wieder riss sie es aus. Die Instandhaltung war Sache des Heims, aber das war meiner Mutter egal. Das Betreuungspersonal wurde weggescheucht, und wenn ich meine Hilfe anbot, wurde mir befohlen, drinnen zu bleiben. Also blieb ich drinnen. Ich saß in ihrem Wohnzimmer im Finegold Mews und trank. Draußen war ein klarer Herbsttag. Zwischen uns war eine Schiebetür; ein feiner Lichtstrahl laserte sich durch die Scheibe, fiel in das Glas in meiner Hand und brachte die Eiswürfel zum Vibrieren. Hören konnte ich nur leise Flurgeräusche: das Gebrummel anderer Bewohner, die vorbeischlurften, Sachen fallen ließen, sie wieder aufhoben.
Es war der dumpfe Schlag, der erste von zweien, der mich aufschreckte. Im Moment, als ich ihn hörte, beobachtete ich gerade, wie das Licht das Eis schmolz. Ich sah auf und erkannte sofort, in welcher Gefahr sie war. Ihre Handfläche war an die Scheibe gepresst. Ihr ganzes Gewicht schien darauf zu lasten. Ihre Fingerspitzen, zuerst dunkel-, dann hellgrau, rutschten quietschend über das Glas. Ich stand auf und rief: »Mutter!« Jahrzehntelang hatte ich sie »Mum« genannt, aber es war das Wort »Mutter«, das sich in meiner Kehle staute und ins Zimmer ergoss. Seit ihrem Tod ist es das Wort, das sich aufdrängt.
Die folgenden Sekunden sind ein Stakkato von Schwarz-Weiß-Bildern. Sie hängt in der Schwebe. Schmale, verschobene Schultern. Hochgezogene Brauen und abwärts gerichtete Augen. Grazil gedrehter Hals. Und die geäderte Hand. Nur dieses Alien-Wesen, runzlig und pockennarbig, das sie noch hält. Finger, die zentimeterweise abwärtsrutschen, bis sicher scheint, dass sie fällt.
Doch dann schlägt die Szene um. Die Hand hört auf zu rutschen. Kaum zu glauben, aber sie löst sich ganz vom Glas, fällt wie ein verwitterter Stein in die Bauchtasche der Schürze. Meine Mutter erlangt Fassung und Gleichgewicht wieder. Sie schluckt, reckt das Kinn, atmet tief durch. Es ist eine stolze, trotzige Pose. Nur die Amsel über ihr kann sehen, wie schütter ihr Haar ist.
Als der zweite dumpfe Schlag kam, schien die Sache schon ausgestanden. Im Rückblick ist klar, dass dieser Moment, in dem die Gefahr gebannt schien, der entscheidende war. Ich stand in ihrem Wohnzimmer und schaute durch die Glastür, noch immer den Drink in der Hand. Ich hätte fünf große Schritte machen, die Tür öffnen und sie hereinholen können. Oder, wenn das nicht zu machen gewesen wäre, weil sie mich für einen fremden Störenfried gehalten hätte, waren da ja noch die kleinen orangefarbenen Dreiecke an den Zugschnüren. Oder der Notfallknopf an der Wand. Ein Einundvierzigjähriger kann ohne große Anstrengung so ein Dreieck oder einen Knopf erreichen. Einen Moment lang hätte ich jede dieser Möglichkeiten wahrnehmen können.
Ich verweile hier, in diesem eingefrorenen Moment, weil es der letzte ist, in dem ich noch irgendwelche Optionen hatte.
Wie war es überhaupt gekommen, dass ich dasaß und ihre Not mitansah? Minuten, bevor es passierte, war ich noch in der Küche. Ließ gerade Eiswürfel in ein Glas klimpern.
Sie kam herein und nahm ihre Gartenhandschuhe aus einer Schublade mit der Aufschrift »Gartensachen«, bekam aber gar nicht mit, dass ich dastand, zwei Gläser Butterscotch-Schnaps, das einzig Alkoholische, das ich finden konnte, hinunterkippte und drei rosa Pillen schluckte. Seit die Demenz eingesetzt hatte, bekam sie die meisten Dinge nicht mehr mit.
Sie ging mit ihren Handschuhen ins Wohnzimmer. Ich goss mir noch einen letzten Butterscotch ein, stellte die Flasche wieder weg und sah mich nach einem Snack um. Fand aber nichts Brauchbares. Man merkte, dass sie in der Nachkriegszeit einen Haushalt zu führen gelernt hatte. Der Schrank mit dem Klebeschildchen »Medizin« war vollgepackt mit Magensäurebinder, Erkältungsbalsam, Rheumabad, antiseptischer Salbe. Im Kühlschrank gab es ein Fach »rationiert«, gefüllt mit Butter, Schmalz, Margarine, Käse, Eiern. Eine kleine Kammer am Flur (mit dem Etikett »Speisekammer«) enthielt wacklige Stapel von Konservendosen – Fisch, Tomaten, Fleisch, Suppen, Gemüse, Rübensirup. Außer den Dosen lagerten da noch Zucker (Streu-, Puder-, Rohr-), Mehl (Haushalts-, Konditor-, selbstgehend), Linsen, Nudeln, Reis. Und nicht zu vergessen die Kompottgläser, die Kisten mit Braeburn- und Bramley-Äpfeln, die Sirupflaschen. Meine Mutter hatte erlebt, was Mangel ist, und das vergaß sie nie.
Als ich mich mit meinem Drink auf dem Sofa niederließ, drang vom Gemeinschaftsflur der Geruch von Essen auf Rädern herein. Mir wurde bewusst, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte. Am Morgen war ich beim Gedanken, meine Wohnung zu verlassen und mich all den Gefahren der Welt da draußen zu stellen, so nervös gewesen, dass ich kein Frühstück hinunterbrachte.
»Warum lässt du mich das nicht machen?«, sagte ich. Sie humpelte über den Teppich in Richtung Glastür. »Lass mich doch das Unkraut zupfen, wenn es dich so stört.«
Sie antwortete nicht. Stattdessen schien ihr etwas Wichtiges einzufallen, und sie machte einen Abstecher zum Fernseher in der Ecke. Es war ein klobiges, altes Ding, ein Relikt aus Zeiten, als Bilder nicht so wichtig waren. Sie hielt sich an einer der abgerundeten Ecken fest, langte hinter den Apparat und zog einen Schuhkarton hervor. Sie stellte den Karton auf den Fernseher, tätschelte ihn liebevoll und machte sich auf den Weg zur Terrasse.
Ich sagte: »Was ist in dem Karton, Mum?«
Sie schob mit kolossaler Anstrengung die Glastür auf, blieb dann eine ganze Weile stehen und sann über meine Frage nach. Kalte Luft drang ins Zimmer. Dann antwortete sie. Ich erinnere mich noch an den genauen Wortlaut. Seit damals höre ich diese Worte mit immer mehr Nachhall in meinem Kopf.
Sie sagte: »Der Plan ist, ihn Mr Satoshi zukommen zu lassen.«
»Wer ist Mr Satoshi?«, fragte ich.
Und sie sagte: »Vor allem das Päckchen ist für Mr Satoshi. Wenn wir seine Adresse herausfinden.«
Ihre Stimme war leise, aber ich verstand jedes Wort ganz deutlich. Dann packte sie den Türgriff plötzlich so fest, als ob jemand Unsichtbares sie hinauszöge, und sagte: »Und wenn du hier irgendwas zu sagen hast, dann sorg dafür, dass mir die Betreuerin vom Hals bleibt.«
Sie machte die Schiebetür hinter sich zu, und ich ließ mich in die klumpigen Polster zurücksinken. Die Gartenhandschuhe lagen verwaist neben mir.
Einen Herzschlag später, als ich gerade meinen widerlich süßen Butterscotch in dem Strahl Nachmittagssonne schwenkte, hörte ich den dumpfen Schlag. Es klang wie ein Keulenhieb. Ich staunte, dass jemand so Winziges ein solches Geräusch verursachen konnte, und eine Sekunde dachte ich, die Glasscheibe würde nachgeben. Ich ging in Habachtstellung, aber die Scheibe hielt. Ihre Hand war immer noch daran festgesaugt. Weiß und klebrig und mit jeder Menge Druck darauf. Ihr Kopf neigte sich, ihr Körper sackte zusammen, ihre Hand rutschte langsam tiefer. Und dann das Wunder – ihr Körper, der sich wieder aufrichtete, ihr Kinn, das sich himmelwärts reckte, die Hand, die sich von der Scheibe löste.
Ein Ticken der Uhr genügt, dass sich alle Optionen, die man hat, in nichts auflösen.
Der entscheidende Moment. Ich fühlte mein Herz in meinem Schädel pochen. Mein Mund war plötzlich trocken, die ätzenden Auflösungsbläschen einer rosa Pille versengten irgendeinen verborgenen Winkel meiner Speiseröhre. Doch ich ignorierte diese Zeichen. Ich wollte glauben, dass der Schrecken vorbei war. In dieser leeren Sekunde, dieser Blankostelle der Zeit, wusste ich, dass ich Aktionsmöglichkeiten hatte. Aber ich war mir sicher, muss mir ja wohl sicher gewesen sein, dass keine Handlungsnotwendigkeit bestand. Warum sonst hätte ich wie angewurzelt dastehen sollen, als sie sich – durch die wundersame Wende von eben beflügelt – wieder vorbeugte, wild entschlossen, ihn zu kriegen, diesen schurkischen Löwenzahn in der Ritze zwischen zwei Betonplatten?
Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und bückte sich, tiefer, viel tiefer als eben, um der perennierenden Geißel ihrer hübschen, adretten Plattenfläche den Garaus zu machen. In der verschwommenen Graustufenversion, die ich jetzt sehe, beugt sie sich über ein riesiges Schachbrett. Und dann sehe ich es kommen. Ich sehe, dass der Löwenzahn, den sie umklammert hält, sich nicht rührt. Die gut verankerte, kräftige Wurzel löst sich nicht aus dem harten Boden. Das Einzige, was den Halt verliert, ist sie.
Diesmal kam der dumpfe Schlag nicht von ihrer Hand, sondern von ihrer Schulter. Die krachte gegen die Scheibe. Rutschte. Ihre Knie knickten ein, als sie der Zentripetalkraft des Unkrauts erlag, die sie in eine unentrinnbare Abwärtsbahn zwang.
Ich glaube nicht, dass sie, während sie dem Boden entgegenstürzte, noch mitbekam, wie schön die Pusteblume aussah. Die schneeflockenzarten Samenschirmchen waren atemberaubend. Zuerst saßen diese Schirmchen noch als dichte Kugel fest auf dem Stiel. Dann verschwanden sie ganz, verschluckt von ihrem Schatten. Doch im Moment des Aufschlags stoben die Samen aus dem Dunkel auf. Es war eine regelrechte Explosion. Ein Feuerwerk von grellweißen Atomen, ein Magnesiumblitz, der das Bild auf den Film brennt.
Und ich hörte nicht, wie ihr Kopf auf dem Beton aufschlug. Ich hörte Stille, zerrissen von meinem kurzen, entsetzten Lachen. Ich watete zum Fenster. Ließ unterwegs mein Glas fallen. Statt zu zerschellen, hüpfte es absurd herum. Draußen verdichteten sich zarte Oktoberwölkchen zu tief hängender Düsternis. Warfen einen Grauschleier über den Garten. Sie lag als formloses Häufchen da. Ihre Hand zuckte mechanisch, und ich gab ein dümmliches Wimmern von mir. Die Schürze hatte sich um ihren Hals gestaut, und ihr verbrauchtes Gesicht lugte darüber hinweg. Schwarzes Blut sickerte aus dem sichtbaren Ohr.
Ich stand da, bis ich sicher war, dass sie nicht mehr lebte. Ich presste mich an die Scheibe. Stirn und Hände am Glas, die Augen geschlossen, blieb ich lange Zeit einfach so stehen, überließ mein ganzes Gewicht der kalten Oberfläche. Irgendwann begann es zu regnen. Ich ging wieder zum Sofa, setzte mich hin, beobachtete, wie durchsichtige Tropfen zufallsgelenkt miteinander verschmolzen und ruckweise abwärtsliefen. Eine Pfütze von trübem Wasser bildete sich um den Leichnam. Wenn ich jetzt die Augen zumache, sehe ich immer noch dieses Wasser, dramatische Wolkenspiegelungen, eingefangen im sanftgrauen Schimmern einer Kameralinse.
Schließlich, nachdem ich noch mehr Pillen geschluckt hatte, rief ich den Rettungswagen. Als es klopfte, dachte ich einen Moment lang, es sei Mr Satoshi.
Natürlich war er’s nicht. Es war nur der grüne Ansturm von Rettungssanitätern. Bald schon konnte ich meine Mutter gar nicht mehr sehen. Die dicht gedrängten Fremden legten sie auf eine Trage und bedeckten sie mit einem Baumwolltuch.
Seither ist ihr Gesicht verhüllt.
2
Am darauffolgenden Montag stand ich in einer schattigen Bank ganz hinten in der Kirche von Longcross und sah zu, wie ihre Nachbarn mit Zeitlupenmundbewegungen Kirchenlieder sangen. Das Haar klebte mir am Kopf, und die Krawatte schnürte mir schier die Luft ab. Die Fugen und die Maserung im Glas der hohen Fenster fingen und formten das Licht, illuminierten die Bänke vor mir in Gelb, Rot und Grün, doch die schwarz gekleideten Menschen nahmen keine der Farben an. Sie wirkten jeder wie der Schatten seines Nachbarn.
Ich war der einzige Vertreter der Familie Fossick, aber die Bewohner des Finegold Mews waren massenhaft erschienen, um die Orgeltöne in den Pfeifen schwingen zu hören. Es war schwer, die Lippen im Gleichtakt mit ihren zu bewegen. Beim Anblick der blakenden Kerzen, der Blumenarrangements und des perlmuttartig schimmernden Weiß der Buntglasfenster drängte sich mir immer wieder ein Gedanke in den Kopf, eine Frage, die die Verspannung meiner Kiefermuskeln bewirkte: Waren ein paar Jahre in einer betreuten Einrichtung die Lösung, um irgendwann bei meiner Beerdigung eine anständige Trauergemeinde zusammenzukriegen? Ich fragte mich, ob mein Vater wohl käme, erpicht darauf, den trotz aller Entfremdung tief trauernden Elternteil zu geben. Oder nur ein, zwei gute Freunde, aus der Zeit meiner Ehe.
In einer Pause zwischen zwei Kirchenliedern sagte der Priester etwas von Hirten und dem Tod als großem Gleichmacher, als Erinnerung daran, dass wir unter unseren Kleidern alle nur Menschen sind. Ich bekam diese Predigt nur vage mit. Ich dachte über die Saat dieses Todes nach und darüber, wann genau sie gelegt worden war.
Virginia Road Nummer 17. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und in dem Alice Fossick ganz plötzlich alt wurde. Dort fielen mir vor mehr als zehn Jahren bei einem meiner Besuche erstmals die kleinen weißen Klebeetiketten auf.
»Rote Servietten«, »weiße Servietten«, »rot-weiße Servietten«.
Zunächst beunruhigte es mich nicht weiter. Meine Mutter hatte immer schon alles aufgeschrieben. Bevorstehende Geburtstage, Rezepte aus dem Fernsehen, das nächste Frauenvereinstreffen.
Doch binnen Kurzem vermehrten sich die Etiketten übers ganze Haus, an jeder Schublade und jeder Schranktür klebte eins: »Teller für täglich«, »Waschmitteltabs«, »kaputtes Porzellan«.
Warum wirfst du das kaputte Porzellan nicht einfach weg, Mum?
»Kaputtes Porzellan (für Müllabfuhr)«, lautete der aktualisierte Aufkleber, eingequetscht zwischen »Spülmaschinensalz« und »Prospekte/Garantiescheine/Gebrauchsanweisungen«.
Die Aufkleber waren nur Aufkleber, es sollte noch schlimmer kommen. Sie schrieb einen Leserbrief ans Lokalblatt, um sich über die Schließung der Post zu beschweren. »Es ist eine Schande«, schrieb sie, »dass elementare Dienstleistungen, auf die der ganze Ort angewiesen ist, einfach eingestellt werden, ohne Rücksprache mit den Einwohnern.« Sie zeigte mir den Entwurf, fragte, was ich davon hielt. Ich wusste, es war ein guter Leserbrief, aber ich wusste auch, dass die Post nach wie vor in Betrieb war. Als ich mit ihr hinging, um es ihr zu beweisen, lachte sie. »Hab dich nur auf den Arm genommen«, sagte sie. »Ich bin noch nicht plemplem.«
Es war schwer einzuschätzen. Sie hatte immer noch eine Fülle an Dingen im Kopf, die das Gedächtnis der meisten Menschen überfordert hätte: die Namen sämtlicher Leute im Dorf, alle sechsundsechzig Monarchen in der Reihenfolge ihrer Thronbesteigung, die verschiedenen Unkrautvertilger und die Böden, für die sie geeignet waren. Sie konnte die Fotografen nennen, die ich bewunderte, erinnerte sich, wo Fotos von mir veröffentlicht oder ausgestellt worden waren.
Es kam dahin, dass ich mittags vorbeischaute und sie sich gerade bettfertig machte oder dass mitten in der Nacht mein Telefon klingelte, weil die Dunkelheit sie verwirrte. Immerhin weiß sie meine Telefonnummer noch, dachte ich. Wenn Nachbarn sie auf einer vertrauten Straße stehen und den Stadtplan studieren sahen, erklärte sie, sie wolle sich nur mal orientieren.
»Das ist das Alter«, sagte sie. »Mit über siebzig kommt man eben manchmal ein bisschen durcheinander.«
Ich fragte sie, ob sie wisse, wie meine Frau heiße.
»Chloe«, sagte sie beleidigt.
Ich zuckte die Achseln und lachte. Sie hatte Chloe immer gemocht. Jahre später, als Chloe starb, war es meine Mutter, die am meisten weinte, die sich der Trauer ganz hingab.
»Also, was ist die nächste Testfrage?«, sagte meine Mutter.
Ich fragte, ob sie wisse, wie der Premierminister heiße. Ich gab mir Mühe, es als Scherz zu verkleiden.
»Ha!«, sagte sie. »Der alte Rotchinese. A. T. Lee! Gebt mir Churchill wieder, sage ich nur.«
»A. T. Lee« nannte sie Clement Attlee.
»Der sitzt schon eine ganze Weile nicht mehr in der Downing Street, Mum.«
»Da bin ich aber schön. Bin ich aber froh.«
»Kann es an ihrem Herzmedikament liegen?«, fragte ich den Arzt. Sein Gesicht hatte den gleichen apologetisch leeren Ausdruck wie das meiner Mutter, die gleiche Mischung aus Sich-Auskennen und Verwirrung.
»Hmm«, sagte er und zog ein Thermometer aus seiner Brusttasche. »Manchmal können die Symptome, die Ihre Mutter aufweist, andere Ursachen haben – Schilddrüsenprobleme, Vitaminmangel, sogar Depression. Wir gehen allen Möglichkeiten nach. Schließen nichts von vornherein aus.«
Auf dem Heimweg von der Praxis ging ich noch in einen Bioladen, Lebensmittel kaufen. Meine Mutter wartete draußen. Als ich wieder rauskam, streichelte sie gerade einen ungleichmäßig gebräunten Dackel.
Mum sagte: »Hast du an die Zeitung für deinen Vater gedacht?«
Ich sagte: »Dad ist vor Jahren ausgezogen, Mom, das weißt du doch.«
»Ich erinnere mich an meinen Vater«, sagte sie.
Das Finegold Mews war die ideale Lösung. Sie wohnte bereits ganz in der Nähe des Heims, sodass sie in ihren klaren Momenten die Gegend kennen würde. Hinzu kam, dass man dort auf Wunsch eine kleine Wohnung haben konnte statt nur eines winzigen Zimmers. Ich schaffte es sogar, ihr ein Erdgeschossapartment reservieren zu lassen, mit Blick in den Garten und eigener Terrasse.
Die Terrasse gab den Ausschlag. Im Dezember 1999, kurz bevor die Menschheit in all ihren Formen und Farben den Schritt in ein neues Jahrtausend tat, siedelte ich sie um. Ich weiß noch, wie ich am Steuer des Miettransporters dachte, dass ihr Gesicht auf einmal anders aussah, dass die Augen- und Mundwinkel hingen, als ob bisher gehegte Hoffnungen schwänden. Ich erinnere mich, dass ich bereute, sie nicht öfter fotografiert zu haben, ehe ihre Züge diesen Abwärtstrend entwickelt hatten.
Das Kirchenlieder-Medley endete, und ich eilte zum Ausgang. In einem stillen Winkel des Friedhofs, hinter einer Silberbirke versteckt, zündete ich mir eine Zigarette an.
Durch ein Gewimmel aus trotzigen Trieben und dreieckigen Blättern konnte ich das verunkrautete Alice-Fossick-Gedächtnisloch sehen. Noch unbelegt. Nur von Spaten zerhackte Wurzelstöcke und gewendete Erde. Ringsherum waren schiefe, bemooste Grabsteine mit kaum lesbaren Namen und Daten. Die Trauernden, beinern im bleichen Licht, arbeiteten sich über einen Hindernisparcours aus Fußstapfen und Grasbüscheln zum Plätzchen meiner Mutter vor.
Ich wandte mich ab, doch in das Vakuum in meinen Ohren strömte überlautes Füßescharren und Husten und das Quietschen der Absenkvorrichtung für den Sarg. Minutenlang, bis ich es schaffte, mein Gehör herunterzudrehen und Erinnerungsbilder aus der Kinderperspektive vor mir zu sehen. Die niedrigen Fliederhecken von Nummer 17. Einen Eingangsvorbau, tapeziert mit zitronengelben Sonnenquadraten. Ordentliche Reihen von Schnittrosen. Ich drückte die Zigarette aus, zündete mir eine neue an und brachte die Rosen zum Verschwinden.
Ein alter Mann, den ich noch nie gesehen hatte, kam über den Rasen angewieselt und überrumpelte mich. Er packte meinen Zigarettenarm und quetschte ihn.
»Ah«, sagte er, während er mir ins Gesicht starrte. »Sie sind das! Der einsiedlerische Fotograf!«
»Ich bin’s«, sagte ich verdattert.
»Schöner Trauergottesdienst! Geht’s gut?«
»Ganz gut, danke.«
»Prima«, sagte er und wieselte davon.
Der Sarg war versenkt, alle hatten sich zum Parkplatz begeben, und ich sah dem Mann nach, wie er zu ihnen stieß. Ich rauchte konzentriert, gierig nach dem analgetischen Qualm. Es würde sich doch bestimmt gleich auflösen, dieses Gewirr aus Gehstöcken, Rollatoren, Bifokal- und Trifokalbrillen, dunkelgrauen Mänteln mit leeren Schultern. Die Mitgift des Alters. Die Sonne, die während des Gottesdiensts noch geschienen hatte, verschleierte sich jetzt. Der milchige Himmel gerann, unstete Schatten breiteten sich aus und verfestigten sich zu einem allgemeinen Düstergrau. Ich beschloss, bis fünfundzwanzig zu zählen. Wenn die Beerdigungsgäste bis dahin nicht verschwunden waren, auch egal. Ich würde wortlos an ihnen vorbeimarschieren, in den Zug nach London steigen, mich in meiner Wohnung einigeln, meine Alltagsroutine wieder aufnehmen. Ich zählte bis fünfundzwanzig. Da war immer noch eine Schar von Trauergästen, die auf dem Parkplatz ihr schwarzes Gefieder plusterten und aufgedreht schwatzten, über Trauer und Tod und wer wohl der Nächste sein würde. Ich zählte wieder bis fünfundzwanzig, langsamer als vorher, zermalmte meine Kippe mit der Schuhsohle und gelobte mir, diesmal wirklich hinter dem Baum hervorzutreten und zum Bahnhof zu gehen. Und wenn mich jemand anspräche, würde ich ein paar höfliche Worte wechseln und weitergehen, selbstsicher und ohne zu schwitzen, weil nur Kinder und Psychopathen versuchen, durch Zählen Dinge erscheinen oder verschwinden zu lassen. Doch als ich bei fünfundzwanzig war und dann wieder bei fünfundzwanzig, drückte ich nur das Pillenfläschchen in meiner Manteltasche und linste durch die Blättertarnung, bis die Leute entschwanden.
Da gingen sie hin: Pipi machen, Teebeutel in heißes Wasser hängen, mit Staubwedeln in dunklen Ecken herumtitschen, gestärkt durch das Wissen, dass alle anderen genau das Gleiche taten.
Der Moment schien günstig, war es aber nicht. Als ich den kürzesten Weg über den Parkplatz nehmen wollte, kam eine lange, dünne alte Frau auf mich zugehastet. Sie schwang ihren Stock wie eine Abrissbirne. Ihre Gliedmaßen fuhrwerkten mit ungerichteter Energie umher, ein Weberknecht, der über einen Teppich torkelt, trunken von letztem Sommerlicht. Ich fand mich gegen eine tomatenrote Motorhaube getrieben.
Sie sagte: »Sie müssen Robert sein, Alices Sohn.«
»Rob«, sagte ich. »Oder Foss.« Ich starrte auf den Boden, in der Hoffnung, ihr auf diese Weise zu vermitteln, dass ich weder Zeit noch Kraft hatte.
Als ich ein paar Sekunden später wieder aufblickte, stand sie immer noch vor mir, den Hauptteil ihres Gewichts auf dem dünnen Holzstock, dessen Gummidämpfer nicht ganz auf dem Asphalt auflag. Ihr Gesicht erinnerte mich an das meiner Mutter: Bahnen von schlaffer, hängender Haut, so blass, dass sie schon grünlich wirkten. Sie war irgendwo in den Achtzigern.
Ich sagte: »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»O nein. So hilfsbedürftig bin ich noch nicht.«
Sie sprach mit Home-Counties-Färbung: Ihr Zungenschlag hatte etwas vom Anschlag eines Plektrums, vor allem bei den Os.
»Waren Sie auf der Beerdigung?«, fragte ich.
»O ja, ja, war ich. Ich finde, es war ein wunderbarer Trauergottesdienst. Sie nicht?«
»Doch, ich fand ihn auch gut.«
»Ihre Mutter war eine Freundin von mir. Ich bin Freddie.«
»Hallo, Freddie.«
Ihre Hand fühlte sich rau und trocken an.
»Sie wohnen auch im Finegold?«, fragte ich.
»O ja, ja, ich wohne dort. Obwohl ich noch ›voll da‹ bin. Ich kannte ihre Mutter schon sehr lange. Vielleicht hat sie ja mal von mir erzählt, obwohl, ich fürchte … Jedenfalls, ich wohne praktisch bei ihr nebenan. Sie haben die Wohnung doch noch? Ich meine, Sie haben sie doch noch nicht gekündigt?«
»Nein, ich habe sie noch.«
»Und ausgeräumt haben Sie sie doch auch noch nicht?«
»Äh … nein, es war ja noch nicht so viel Zeit.«
»Aber Sie werden sie demnächst ausräumen?«
»Ziemlich bald, denke ich. Im Moment habe ich allerdings einiges auf der Agenda.«
»Agenda?«
»Auf dem Plan. Zu tun eben. Aber ich räume die Wohnung in Kürze aus.«
»Ah.«
Ich studierte ihre rosa Tränensäcke. »Das scheint Sie zu beschäftigen.«
»Ach, es ist nur, wissen Sie, mir geht da die ganze Zeit etwas durch den Kopf, seit Ihre Mutter tot ist. Etwas, was sie zu mir gesagt hat. Eine Art Bitte. Vielleicht können wir ins Finegold fahren und dort darüber reden?«
»Ich muss wirklich nach Hause, leider. Ich wohne in London.«
»Natürlich, Sie müssen bestimmt Fotos machen.«
»Genau.«
»Ich habe früher auch fotografiert. Weiß nicht genau, warum ich es aufgegeben habe. Gab wohl nicht mehr viel zu fotografieren.«
»Freddie, ich muss jetzt wirklich los.«
»Oh, natürlich, das ist mir klar, aber die Sache ist ziemlich wichtig.«
»Inwiefern?«
»Na ja …«, Sie beugte sich, auf ihren Stock gestützt, vor und blickte sich verschwörerisch um. »Es geht um einen Schuhkarton.«
»Schuhkarton?«
Durch dünne Wirbel von weißem Haar sah ich ihre Kopfhaut. Sie war mondgrau und pockennarbig und mit winzigen rosafarbenen und silbrigen Sommersprossen übersät.
Sie sagte: »Ich glaube, es gibt da einen Schuhkarton, in dem etwas ist, das Ihre Mutter jemandem zukommen lassen wollte. Einem Mr Satoshi.«
Bei dem Namen schoss ein Stromschwall des Erinnerns durch meine Adern.
»Wissen Sie, wer das ist?«
»Vage«, sagte sie, »vage. Glaube ich zumindest. Klingt ja ausländisch, Satoshi, oder? Aber wenn ich nicht langsam senil werde, ist es nur der Spitzname Ihrer Mutter für einen Engländer, einen jungen Burschen aus Bristol, den wir mal kannten. Wollen wir nicht doch ins Finegold fahren? Ich habe das Auto hier.«
»Sie fahren Auto?«
Sie fuhr. Sie chauffierte mich in einer Ente, die so altersschwach war, dass die hinteren Türen von Klebeband zugehalten wurden. Ein Scheibenwischer war mittels eines Stücks Kleiderbügeldraht rekonstruiert. Jeder zurückgelegte Meter fühlte sich an wie ein Sieg des Willens über die Materie. Der Wagen roch wie eine Keksdose, krümelig und süß, und der in Bodenmatten und Armaturenbrett eingepresste Dreck gab ihm etwas Erdiges, die Wärme von Verrottung und Fossilisation. Ich hatte ein seltsames Gefühl der Sicherheit, wie ich es kaum je außerhalb meiner vier Wände verspürte. Ich hatte es sogar noch, als ich die diffus beleuchteten Sträßchen und schattendunklen Alleen an unserem Weg entlangblickte, ihre Anonymität an mich heranließ, sie wie schweifende Gedanken dahinmäandern sah, ohne klares Gefühl für Grenzen, für Richtung und Ziel.
3
FINEGOLD MEWS verkündeten die Kupferlettern überm Haupteingang.
Ich folgte Freddie durch die Halle, machte dabei Small Talk über alltägliche Malaisen, Widrigkeiten und Kümmernisse. Hier war alles voller Lampen, Sessel, Teppiche und Couchtische. Beim Einzug meiner Mutter waren diese Sachen neu gewesen. Für sie war das ein Problem. Es setzte Finegold Mews in schmerzlichen Kontrast zu ihrem Haus, all den alten Dingen, an denen Erinnerungen hingen. Sie hatte mich Nummer 17 verlassen sehen, um mein Studium zu beginnen. Sie hatte auch Dad ausziehen sehen, nachdem er sich zuerst in die City und dann in seine Sekretärin verliebt hatte. Aber irgendwelche guten Geister mussten geblieben sein.
»Ich gehe mal eben die Betreuerin bitten, uns reinzulassen«, sagte ich, doch Freddie schob bereits ein dünnes Plastikrechteck in den Schlitz. »Sie haben eine Schließkarte für das Apartment meiner Mutter?«
»O ja. Wir waren gute Freundinnen. Wirklich Pech, dass ich Ihre Besuche immer verpasst habe.«
»Na ja, ich bin nicht so oft dazu gekommen, wie ich gewollt hätte.«
Der Luftzug der aufgehenden Tür wirbelte drinnen reichlich Staub auf. In dem Moment wusste ich es noch nicht, aber der Staub war nur der Anfang all dessen, was durch meine Einmischung in der Welt meiner Mutter aufgewirbelt werden würde; bald schon würde nichts mehr an seinem Platz sein, nichts mehr so, wie es gewesen war.
»Setzen Sie sich doch, Freddie.«
»Oh, danke, ja.«
Das hohe Wohnzimmer meiner Mutter hatte etwas Exzentrisches. Die oben schräg zulaufenden Wände standen in keinem Verhältnis zur winzigen Grundfläche, sodass der Raum wie hochkant gestellt wirkte, weniger wie ein Zimmer denn wie eine Cornflakes-Packung. Überall hingen Fotos, penibel in gleichmäßigen Abständen platziert. Das war das Resultat eines seltsamen Projekts, das sie in ihren Siebzigern gestartet hatte: eine lückenlose Serie von Fotos zusammenzustellen, die jeweils eins ihrer Lebensjahre repräsentierten. Ein paar hatte ich gemacht, zum Beispiel das mit den vielen kleinen Quadraten, die sich, wenn man genau genug hinschaute, als lauter identische Bildchen eines menschlichen Kopfs entpuppten. Es war ein Bogen Gedenkbriefmarken, den ihr Vater bei ihrer Taufe für sie aufbewahrt hatte; ich hatte ihn ausgraben und als Erinnerung an ihr erstes Lebensjahr knipsen müssen. Das Foto ganz oben links an der gegenüberliegenden Wand war ebenfalls von mir. Irgendein alter Rugbyball, aber Symbol dafür, dass 1936, als meine Mutter sieben war, ihr Vater sich Bier auf den Schoß geschüttet hatte, als der Radiosprecher verkündete, Alex Obolensky habe einen zweiten Versuch gelegt. Zum ersten Mal hatte England Neuseeland geschlagen.
Ich ließ den Blick über diese und andere Fotos wandern, fasziniert vom polierten Glas der Rahmen. Es bewegte sich im Lampenlicht wie dünne Haut, eine lebende Barriere, eine menschliche Präsenz im Raum.
Freddie sagte: »Wissen Sie, für welches Jahr die jeweils stehen?«
»Nein. Bei den meisten habe ich keine Ahnung, was das, was drauf ist, bedeutet, welche Erinnerungen sich damit verbinden.«
Sie schien eingehend über diese Antwort nachzudenken.
»Also«, sagte ich, »der Schuhkarton.«
»O ja«, sagte sie, als hätte sie gar nicht damit gerechnet, dass der Schuhkarton zur Sprache käme. »Wie wär’s, wenn ich uns einen Kräutertee und einen Keks beschaffe?«
»Wenn Sie möchten. Da könnte noch was im Oberschrank links vom Herd sein.«
Sie erhob sich unter Ächzen und Stöhnen, den Begleitgeräuschen des Übergangs, und verpflanzte ihren Stock in Richtung Küche. Es erschien mir plötzlich ein sonderbarer Anblick: eine alte Frau, die groß und dünn war statt klein und dünn.
Sie rief: »Da, wo ›Pulver/Granulat/Beutel‹ dransteht?«
»Genau.«
Ich stand auf, ging zum Fernseher und lugte von oben dahinter. Und tatsächlich, jenseits der narbigen schwarzen Oberseite, zwischen Wand und Apparat, klemmte schief der Schuhkarton. Er musste da hineingerutscht sein, getroffen vom Ellbogen eines Sanitäters oder einer Ecke der Trage. »Der Plan ist«, hatte sie gesagt, wobei die Stille ihre Worte beinah verschluckte, »ihn Mr Satoshi zukommen zu lassen.« Und jetzt behauptete diese Freddie hier, dass der nicht nur ein Hirngespinst meiner Mutter war, ein Name von einer Cerealien-Packung oder aus einem Nachmittagshörspiel. Ich nahm den Karton mit zu meinem Sessel.
»Oh, da ist er ja!«, sagte sie aufgeregt und starrte auf meinen Schoß.
Zittrig reichte sie mir einen Becher. Am Porzellan hafteten die Mosaikteilchen irgendeiner verflüssigten Blüte.
»Also«, sagte sie, während sie sich wieder auf das Ledersofa hinabließ und ihren Stock an die mit Ziernägeln beschlagene Armlehne stellte. »Mr Satoshi. Das war noch in der Zeit, als Ihre Mutter und ich in Bristol zusammen zur Schule gingen.«
»Da kannten Sie sie schon?«
»Aber natürlich. O ja, Bristol. Ist lange her, aber ich kenne diese Stadt wie meinen eigenen Handrücken.«
Sie studierte ihre glänzend weißen Knöchel auf dem dunklen Baumwollstoff ihres Rocks.
»Unser Lieblingsstadtteil, ich meine, von Ihrer Mutter und mir, war Cotham. Clifton war schicker, aber das große Plus von Cotham war Mrs Cummings. Sie war Lehrerin an unserer Schule und eine begeisterte Briefmarkensammlerin. Schaffte es immer wieder, an seltene Marken zu kommen, die Ihre Mutter und ich nur aus dem letzten Stanley-Gibbons-Katalog kannten. Die Zehn-Rei-Marke der Njassagesellschaft gefiel mir am allerbesten.«
Es folgte eine schwärmerische Rezitation von Markensammlerlyrik: Lupen, Zähnungsmesser, Pinzetten, gummierte Albenfalze, Wasserzeichen und ihre Sichtbarmachung in kleinen grauen Schälchen mit Alkohol.
»Ich unterbreche Sie ja ungern«, sagte ich, »aber vielleicht erzählen Sie besser von Anfang an.«
Und das tat sie. Beim Reden zuckten und wackelten ihre Augen, als ob dahinter alle möglichen Erinnerungen aufstiegen. Freddies Mutter Luisa war eine gebürtige Deutsche, die dann aber in England lebte und eingebürgert wurde. Im Ersten Weltkrieg verliebte sich Luisa in einen Buchhalter aus Bristol. »Nach Kriegsende heirateten sie«, sagte Freddie, »und ließen sich in Bristol nieder, wo ich zur Welt kam.« Als Freddie sieben war, starb Luisa plötzlich und ohne Vorwarnung an Herzversagen. Freddies Vater hatte gerade eine Stelle bei der Britischen Zentralafrika-Gesellschaft in Blantyre, Njassaland, angenommen, deshalb schickte er Freddie auf ein Internat in Bristol.
»Das war die Schule, an der auch Ihre Mutter war. Und deshalb mochte ich die Zehn-Rei-Marke so. Darauf war eine Giraffe, die stand für mich für Afrika und meinen Vater.«
»Und Sie und meine Mutter wurden Freundinnen?«
Ja. Beste Freundinnen. Anfangs blieb Freddie über die Ferien im Internat. Sie hatte ja in England niemanden, zu dem sie hinkonnte. Dann spielte es sich ein, dass sich die Eltern meiner Mutter in den Ferien um sie kümmerten.
»Ich machte mit, was ihre Familie machte. Weihnachten und Ostern im Haus in Clifton, im Sommer ein paar Wochen in einem Ferienhaus am Meer, meistens in Weston-super-Mare. Ihre Mutter und ich, wir haben uns stundenlang am Strand vergnügt. Sind um die Wette am Wasser entlanggerannt, immer mit gesenktem Kopf, weil wir sehen wollten, wie die winzigen weißen Krabben in Sandlöchern verschwanden.«
»Und dann sind Sie zufällig beide hier gelandet?«
»Ich wohnte nicht weit von hier. Und als mein Sohn befand, es sei Zeit, dass ich in ein Heim ginge, wurde uns das Finegold Mews besonders empfohlen. Ich kam her, um es mir anzuschauen, und stellte zu meiner großen Freude fest, dass Ihre Mutter hier war …«
»Und sie hat sich auch gefreut, als Sie ins Finegold kamen?«
»Gefreut?«, sagte sie, und die Falten in ihrem Gesicht wurden malvenfarben. »Ach, Sie wissen ja.«
Ich sagte, ja, ich wisse wohl.
»Haben Sie Kinder, Robert?«
»Was? Nein. Meine Frau ist gestorben, aber … Es gab ein Unglück. Als wir im Urlaub waren, in Griechenland. Daher habe ich die Narbe auf der Wange.«
»Ach, die sieht man ja kaum. Sie wissen doch, wie das ist, wie sich Sachen in der Vorstellung hundertfach vergrößern. Sie als Fotograf wissen das doch sicher.«
»Ich habe schon eine ganze Weile kein brauchbares Foto mehr gemacht.«
»Ach?«
»Nein. Ich bin in der glücklichen Lage, von dem leben zu können, was mir Reproduktionen einbringen. Zwei, drei bekannte Fotos, die immer mal wieder rausgebracht werden. Es ist natürlich nicht viel Geld, aber ich brauche auch nicht viel.«
»Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben Sie Künstler fotografiert, Schriftsteller, Maler? Mit großem Erfolg offenbar. Ich habe mal was über Sie im Telegraph gelesen. Oder war’s in der Times? Ich kriege nämlich beide. In dem Artikel wurden Sie als ›genial und gut aussehend‹ bezeichnet. Es war ein Foto dabei, Sie mit ein paar dicken Schriftstellern.«
»Den Artikel hat mehr oder weniger Perry geschrieben, mein Agent. Ja, ich habe Künstler fotografiert, aber denen muss man immer nachlaufen. Irgendwann wollte ich das nicht mehr.«
»Ah, ja, verstehe. Ich habe davon gehört, ich meine, von Ihrer …«
»Müdigkeit?«
»Oh, ich wollte sagen, Abgeschiedenheit. Das hat so was Erhabenes. Unzugängliche Dinge oder Orte. Die sind heilig, denke ich immer. Wie die Vergangenheit. Romantisch. Irgendwie heiler als die Gegenwart. Die schwer erreichbaren Dinge sind doch die schönsten, meinen Sie nicht?«
»Ich weiß nicht. Es ist ganz schön lästig. Aber die letzten paar Jahre versuche ich, da rauszukommen. Meine Wohnung, meine Alltagsroutine, das ist für mich so was wie eine zweite Haut geworden.«
Ich kratzte mich am Ohr und fragte mich, warum ich ihr das alles erzählte.
»Erzählen Sie mir von Satoshi.«
»Lieber Gott, das ist mir völlig entschlüpft. Weil es so schön ist, hier zu sitzen, bei einer Tasse Tee, und zu plaudern. Ja, Mr Satoshi. Er war ein junger Bursche, den wir in Bristol kannten. Natürlich haben wir ihn nicht immer so genannt. Eine ganze Zeit lang war er einfach nur Reggie. Er war kein Ausländer, er war Engländer, aber aus irgendeinem Grund hatte er dann diesen Spitznamen weg. Ich weiß nicht, ob Ihre Mutter ihn geprägt hat oder ob sie ihn nur so begeistert benutzt hat. Wenn sie in den letzten Jahren manchmal von ihm gesprochen hat, hat sie ihn immer noch so genannt. Seit ihrem Tod versuche ich die ganze Zeit, auf seinen richtigen Nachnamen zu kommen. Ich habe mich wirklich bemüht. Aber für mich war er einfach nur Reggie oder Satoshi. Für Ihre Mutter dagegen … Na ja, es war eine Jugendliebe.«
ENDE DER LESEPROBE