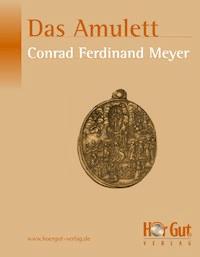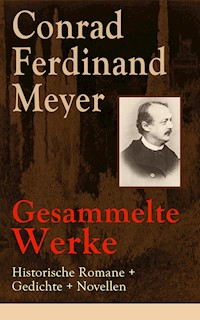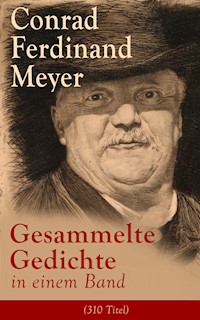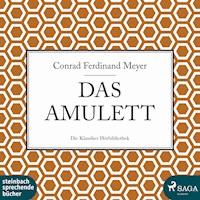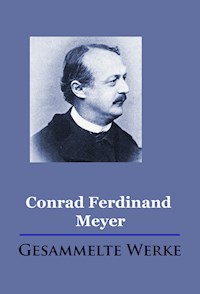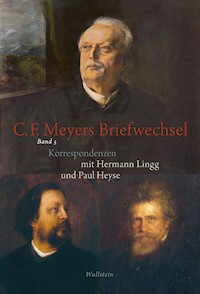Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Conrad Ferdinand Meyers historischer Roman 'Jürg Jenatsch' entführt den Leser in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert. Der Roman erzählt die dramatische Lebensgeschichte des Bündner Freiheitskämpfers und Politikers Jürg Jenatsch, der zwischen Loyalität zu seinem Volk und seinen eigenen ambivalenten Motiven hin- und hergerissen ist. Meyers detailreicher Schreibstil vermittelt dem Leser nicht nur historische Fakten, sondern auch tiefe Einblicke in die Gedankenwelt der Charaktere. Der Autor verwebt geschickt historische Ereignisse mit fiktiven Elementen, um eine packende Erzählung zu schaffen. 'Jürg Jenatsch' ist sowohl literarisch anspruchsvoll als auch historisch informativ und zeigt Meyers Meisterschaft im Umgang mit Sprache und Themen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürg Jenatsch
Inhaltsverzeichnis
Die Reise des Herrn Waser
Erstes Kapitel
Die Mittagssonne stand über der kahlen, von Felshäuptern umragten Höhe des Julierpasses im Lande Bünden. Die Steinwände brannten und schimmerten unter den stechenden senkrechten Strahlen. Zuweilen, wenn eine geballte Wetterwolke emporquoll und vorüberzog, schienen die Bergmauern näher heranzutreten und, die Landschaft verengend, schroff und unheimlich zusammenzurücken. Die wenigen zwischen den Felszacken herniederhangenden Schneeflecke und Gletscherzungen leuchteten bald grell auf, bald wichen sie zurück in grünliches Dunkel. Es drückte eine schwüle Stille, nur das niedrige Geflatter der Steinlerche regte sich zwischen den nackten Blöcken und von Zeit zu Zeit durchdrang der scharfe Pfiff eines Murmeltiers die Einöde.
In der Mitte der sich dehnenden Paßhöhe standen rechts und links vom Saumpfade zwei abgebrochene Säulen, die der Zeit schon länger als ein Jahrtausend trotzen mochten. In dem durch die Verwitterung beckenförmig ausgehöhlten Bruche des einen Säulenstumpfes hatte sich Regenwasser gesammelt. Ein Vogel hüpfte auf dem Rande hin und her und nippte von dem klaren Himmelswasser.
Jetzt erscholl aus der Ferne, vom Echo wiederholt und verhöhnt, das Gebell eines Hundes. Hoch oben an dem stellenweise grasbewachsenen Hange hatte ein Bergamaskerhirt im Mittagsschlafe gelegen. Nun sprang er auf, zog seinen Mantel fest um die Schultern und warf sich in kühnen Schwüngen von einem vorragenden Felsturme hinunter zur Einholung seiner Schafherde, die sich in weißen beweglichen Punkten nach der Tiefe hin verlor. Einer seiner zottigen Hunde setzte ihm nach, der andere, vielleicht ein altes Tier, konnte seinem Herrn nicht folgen. Er stand auf einem Vorsprunge und winselte hilflos.
Und immer schwüler und stiller glühte der Mittag. Die Sonne rückte vorwärts und die Wolken zogen.
Am Fuße einer schwarzen vom Gletscherwasser befeuchteten Felswand rieselten die geräuschlos sich herunterziehenden Silberfäden in das Becken eines kleinen Sees zusammen. Gigantische, seltsam geformte Felsblöcke umfaßten das reinliche, bis auf den Grund durchsichtige Wasser. Nur an dem einen flachern Ende, wo es, talwärts abfließend, sich in einem Stücke saftig grünen Rasens verlor, war sein Spiegel von der Höhe des Saumpfades aus sichtbar. An dieser grünen Stelle erschien jetzt und verschwand wieder der braune Kopf einer grasenden Stute und nach einer Weile weideten zwei Pferde behaglich auf dem Rasenflecke und ein drittes schlürfte die kalte Flut.
Endlich tauchte ein Wanderer auf. Aus der westlichen Talschlucht heransteigend, folgte er den Windungen des Saumpfades und näherte sich der Paßhöhe. Ein Bergbewohner, ein wettergebräunter Gesell war es nicht. Er trug städtische Tracht, und was er auf sein Felleisen geschnallt hatte, schien ein leichter Ratsdegen und ein Ratsherrenmäntelchen zu sein. Dennoch schritt er jugendlich elastisch bergan und schaute sich mit schnellen klugen Blicken in der ihm fremdartigen Bergwelt um.
Jetzt erreichte er die zwei römischen Säulen. Hier entledigte er sich seines Ränzchens, lehnte es an den Fuß der einen Säule, wischte sich den Schweiß mit seinem saubern Taschentuche vom Angesicht und entdeckte nun in der Höhlung der andern den kleinen Wasserbehälter. Darin erfrischte er sich Stirn und Hände, dann trat er einen Schritt zurück und betrachtete mit ehrfurchtsvoller Neugier sein antikes Waschbecken. Schnell bedacht zog er eine lederne Brieftasche hervor und begann eifrig die beiden ehrwürdigen Trümmer auf ein weißes Blatt zu zeichnen. Nach einer Weile betrachtete er seiner Hände Werk mit Befriedigung, legte das aufgeschlagene Büchlein sorgfältig auf sein Felleisen, griff nach seinem Stocke, woran die Zeichen verschiedener Maße eingekerbt waren, ließ sich auf ein Knie nieder und nahm mit Genauigkeit das Maß der merkwürdigen Säulen.
»Fünfthalb Fuß hoch«, sagte er vor sich hin.
»Was treibt Ihr da? Spionage?« ertönte neben ihm eine gewaltige Baßstimme.
Jäh sprang der in seiner stillen Beschäftigung Gestörte empor und stand vor einem Graubarte in grober Diensttracht, der seine blitzenden Augen feindselig auf ihn richtete.
Unerschrocken stellte sich der junge Reisende dem wie aus dem Boden Gestiegenen mit vorgesetztem Fuße entgegen und begann, die Hand in die Seite stemmend, in fließender, gewandter Rede:
»Wer seid denn Ihr, der sich herausnimmt, meine gelehrte Forschung anzufechten auf Bündnerboden, id est in einem Lande, das mit meiner Stadt und Republik Zürich durch wiederholte, feierlichst beschworene Bündnisse befreundet ist? Ich weise Euern beleidigenden Verdacht mit Verachtung zurück. Wollt Ihr mir den Weg verlegen?« fuhr er fort, als der andere, halb verblüfft, halb drohend, wie eingewurzelt stehen blieb. »Sind wir im finstern Mittelalter oder zu Anfang unseres gebildeten siebzehnten Jahrhunderts? Wißt Ihr, wer vor Euch steht?… So erfahrt es: der Amtsschreiber Heinrich Waser, Civis turicensis.«
»Narrenpossen!« stieß der alte Bündner zwischen den Zähnen hervor.
»Laß ab von dem Herrn, Lucas!« ertönte jetzt ein gebieterischer Ruf hinter den Felstrümmern rechts vom Wege hervor und der Zürcher, der unwillkürlich dem Klange der Stimme seewärts sich zuwandte, gewahrte nach wenigen Schritten den mittäglichen Ruheplatz einer reisenden Gesellschaft.
Neben einem aus dunklen Augen blickenden, kaum dem Kindesalter entwachsenen Mädchen, das im Schatten eines Felsens auf hingebreiteten Teppichen saß und ausruhte, stand ein stattlicher Kavalier, denn das war er nach seiner ganzen Erscheinung, trotz des schlichten Reisegewandes und der schmucklosen Waffen. Am Rande des Sees grasten die des Sattels und Zaumes entledigten Rosse der drei Reisenden.
Der Zürcher ging, die Gruppe scharf ins Auge fassend, mit immer gewissern Schritten auf den bündnerischen Herrn zu, während ein mutwilliges Lachen die Züge des blassen Mädchens plötzlich erhellte.
Jetzt zog der junge Mann gravitätisch den Hut, verneigte sich tief und begann:
»Euer Diener, Herr Pom…«, hier unterbrach er sich selbst, als stiege der Gedanke in ihm auf, daß der Angeredete seinen Namen auf diesem Boden vielleicht zu verheimlichen wünsche.
»Der Eurige, Herr Waser«, versetzte der Kavalier. »Scheut Euch nicht, den Namen Pompejus Planta zwischen diesen Bergen herzhaft auszusprechen. Ihr habt wohl vernommen, daß ich auf Lebenszeit aus Bünden verbannt, daß ich vogelfrei und verfemt bin, daß auf meine lebende Person tausend Florin und auf meinen Kopf fünfhundert gesetzt sind und was dessen mehr ist. Ich habe den Wisch zerrissen, den das Thusnerprädikantengericht mir zuzuschicken sich erfrecht hat. Ihr, Heinrich, das weiß ich, habt nicht Lust, den Preis zu verdienen! Setzt Euch zu uns und leert diesen Becher.« Damit bot er ihm eine bis zum Rande mit dunklem Veltliner gefüllte Trinkschale.
Nachdem der Zürcher einen Augenblick schweigend in das rote Naß geschaut, tat er Bescheid mit dem wohlüberlegten Trinkspruche: »Auf den Triumph des Rechts, auf eine billige Versöhnung der Parteien in altfrei Rhätia, – voraus aber auf Euer Wohlergehen, Herr Pompejus, und auf Eure baldige ehrenvolle Wiedereinsetzung in alle Eure Würden und Rechte!«
»Habt Dank! Und vor allem auf den Untergang der ruchlosen Pöbelherrschaft, die jetzt unser Land mit Blut und Schande bedeckt!«
»Erlaubt«, bemerkte der andere vorsichtig, »daß ich als Neutraler mein Urteil über die verwickelten Bündnerdinge einigermaßen zurückhalte. Die vorgefallenen Formverletzungen und Unregelmäßigkeiten freilich sind höchlich zu beklagen und ich nehme keinen Anstand, sie auch meinerseits zu verdammen.«
»Formverletzung! Unregelmäßigkeit!« brauste Herr Pompejus zornig auf, »das sind gar schwächliche Ausdrücke für Aufruhr, Plünderung, Brandschatzung und Justizmord! Daß ein Pöbelhaufe mir die Burg umzingelt oder eine Scheuer in Brand steckt, davon will ich noch nicht viel Aufhebens machen. Man hat mich ihnen als Landesverräter vorgemalt und sie so gegen mich verhetzt, daß ich ihnen einen bösen Streich nicht verarge. Aber daß diese Hungerleider von Prädikanten einen Gerichtshof aus der Hefe des Volks zusammenlegen, mit der Folter hantieren und mit Zeugen, die verlogener sind als die falschen Zeugen in der Passion unsers Heilandes, – das ist ein Greuel vor Gott und Menschen.«
»An den Galgen alle Prädikanten!« erscholl hinter ihnen der Baß des die Pferde zum Aufbruche rüstenden alten Knechts.
»So seid ihr aber, ihr Zürcher«, fuhr Planta fort, »daheim führt ihr ein verständiges züchtiges Regiment und bekreuzt euch vor Neuerung und Umsturz. Täte sich bei euch ein Bursche hervor wie unser Prädikant Jenatsch, er säße bald hinter Schloß und Riegel im Wellenberg, oder ihr legtet ihm flugs den Kopf vor die Füße. Von ferne aber erscheint euch der Unhold merkwürdig und eure Zünfte jauchzen seinen Freveln Beifall zu. Euer neugieriger und unruhiger Geist ergötzt sich daran, wenn die Flammen des Aufruhrs hell aufschlagen, so lange sie euern eigenen First nicht bedrohen.«
»Erlaubt –«, wiederholte Herr Waser.
»Lassen wir das«, schnitt ihm der Bündner das Wort ab. »Ich will mir nicht das Blut vergiften. Bin ich doch nicht hier als das Haupt meiner Partei, sondern um eine einfache Vaterpflicht zu erfüllen. Lucretia, mein Töchterchen, – sie ist Euch ja nicht unbekannt – kommt aus dem Kloster Cazis, wohin ich sie zu den frommen Frauen geflüchtet hatte, als der Sturm gegen mich losbrach, und ich führe sie nun auf einsamen Pfaden in ein italienisches Kloster, wo sie sich in den schönen Künsten üben soll. Und Ihr? Wohin geht Euer Weg?«
»Eine Ferienreise, Herr Pompejus, um den Aktenstaub abzuschütteln und die rhätische Flora kennen zu lernen. Seit unser Landsmann Konrad Geßner die Wissenschaft der Botanik begründet hat, treiben wir sie eifrig an unserm Carolinum. Überdies schuldet mir das Schicksal eine geringe Schadloshaltung für ein gescheitertes Reiseprojekt. Ich sollte nämlich«, fuhr er etwas schüchtern, aber nicht ohne geheime Eitelkeit fort, »nach Prag an den Hof seiner böhmischen Majestät gehen, wo mir durch besondere Gunst eine Pagenstelle zugesichert war.«
»Ihr tatet klug daran, es bleiben zu lassen«, höhnte Herr Pompejus. »Dieser klägliche König wird in kurzem ein Ende nehmen mit Schrecken und Schande. Und jetzt«, fuhr er lauernd fort, »wenn Ihr mit der rhätischen Flora vertraut seid, wollt Ihr nicht auch die des Veltlins studieren? So böte sich Euch Gelegenheit, bei Euerm Studienfreunde Jenatsch auf seiner Strafpfarre einzukehren.«
»Angenommen es fügte sich so, ich hielte es für kein Verbrechen«, versetzte der Zürcher, dem dies rücksichtslose Eindringen in seinen Reiseplan die Röte der Entrüstung auf Stirn und Wangen trieb.
»Ein nichtswürdiger Bube!« grollte Herr Pompejus.
»Mit Gunst, das ist ab irato gesprochen, Herr. Wohl mögt Ihr Euch mit Recht über meinen Schulgenossen zu beklagen haben. Ich verzichte darauf, ihn Euch gegenüber und in dieser Stunde zu verteidigen. – Erlaubt mir lieber, Euch um geneigten Aufschluß zu bitten über jene merkwürdigen Säulen dort. Sind sie römischen Ursprungs? Ihr müßt das wissen, ist doch Euer hochberühmtes Geschlecht seit Kaiser Trajan in diesen Bergen heimisch.«
»Darüber«, antwortete Planta, »wird Euch Euer gelehrter Freund, der Blutpfarrer, Auskunft geben. – Du bist bereit, Lucretia?« rief er dem Fräulein zu, das, als das Gespräch sich zu erhitzen begann, mit bekümmerter Miene still nach dem Saumpfade hinauf sich entfernt und bei den Säulen verweilt hatte, wo ihr jetzt eben Lucas eines der wieder gezäumten Pferde vorführte.
»Gehabt Euch wohl, Herr Waser!« grüßte Planta, sich rasch in den Sattel des zweiten schwingend. »Ich kann Euch nicht einladen, auf Euerm Heimwege bei mir im Domleschg einzusprechen, wie ich es unter andern Umständen gerne getan hätte. Die schuftigen Hände, die jetzt unser Staatsruder führen, haben mir, wie Ihr wißt, mein festes Haus Riedberg zugeriegelt und das durch sie entehrte Bündnerwappen auf mein Tor geklebt.«
Waser verbeugte sich und schaute eine Weile nachdenklich dem über die Hochebene davontrabenden Reisezuge nach. Dann bückte er sich nach seinem aufgeblättert am Wege liegenden Taschenbuche und warf, bevor er es schloß, noch einen Blick auf seine Zeichnung. Was war das? Mitten zwischen die zwei flüchtig entworfenen Säulen hatte eine kindlich ungeübte Hand große Buchstaben hineingeschrieben. Deutlich stand es zu lesen: Giorgio, guardati.
Kopfschüttelnd preßte er das Büchlein mit dem eingesteckten Stifte zusammen und versenkte es in die Tiefe seiner Tasche.
Unterdessen hatten die Wolken sich gemehrt und verdüsterten den Himmel. Waser setzte seinen Weg durch die sonnenlose Felsenlandschaft mit beschleunigten Schritten fort. Noch heftete sein lebhaftes Auge sich zuweilen auf die großen dunkeln, jetzt unheimlich grotesken Felsmassen, aber es bestrebte sich nicht mehr, wie am Morgen, mit rastloser Neugierde diese ungewohnten seltsamen Formen sich einzuprägen. Es schaute nach innen und suchte mit Hilfe alter Erinnerungen das Verständnis des eben Vorgegangenen sich aufzuschließen. Offenbar konnten die warnenden Worte nur von der jungen Lucretia geschrieben sein; sie mußte, als die Rede auf Jenatsch kam, des Wanderers Absicht, den Jugendfreund aufzusuchen, durchschaut haben. Offenbar hatte sie sich weggestohlen in der Angst ihres Herzens, um dem jungen Pfarrer in Veltlin ein mahnendes Zeichen naher Gefahr zu geben. Offenbar zählte sie darauf, das Taschenbuch werde ihm zu Gesicht kommen.
Von dem eben Erlebten spannen sich Wasers Gedanken an fliegenden Fäden in seine Knabenzeit zurück. Auf dem düstern Hintergrunde des Julier malte seine Seele ein farbenlustiges Bild, in dessen Mitte wiederum Herr Pompejus mit seinem Töchterchen Lucretia stand.
Zweites Kapitel
Waser sah sich in der dunklen Schulstube des neben dem großen Münster gelegenen Hauses zum Loch im Jahre des Heils 1615 auf der vordersten Bank sitzen. Es war ein schwüler Sommertag und der würdige Magister Semmler erklärte seiner jungen Zuhörerschaft einen Vers der Iliade, der mit dem helltönenden Dativ magádi schloß. »Magás«, erläuterte er, »heißt die Drommete und ist ein den Naturlaut nachahmendes Klangwort. Glaubt ihr nicht den durchdringenden Schall der Drommete im Lager der Achaier zu vernehmen, wenn ich das Wort ausrufe?« Er hemmte seinen Schritt vor der großen Wandkarte des griechischen Archipelagus und rief mit hellkrähender Stimme: »Magádi!«
Diese Kraftanstrengung wurde durch ein schallendes Gelächter belohnt, das der Magister mit Genugtuung vernahm, ohne den Hohn zu bemerken, der im Beifalle seiner belustigten Schüler mitklang. War es ihm doch verborgen geblieben, daß ihm diese alljährlich wiederholte effektvolle Szene schon längst den kriegsmäßigen Spitznamen Magaddi zugezogen hatte, der sich im Wechsel der nachrückenden Geschlechter von Klasse auf Klasse vererbte.
Heinrich Wasers Aufmerksamkeit aber wurde seit einigen Minuten von einem andern Gegenstande gefesselt. Er saß der morschen Eichentüre gegenüber, an welcher sich in längern Zwischenräumen ein zweimaliges, dreimaliges Klopfen hatte vernehmen lassen und die sich dann leise, leise auftat. Durch die Spalte wurden zwei spähende Kinderaugen sichtbar. Als der Drommetenstoß erscholl, mochte der kleine Besuch das tönende Wort für die in einer fremden Sprache an ihn ergehende Aufforderung zum Eintritte nehmen. Es öffnete sich geräuschlos die Tür und über die hohe Schwelle trat ein vielleicht zehnjähriges Mädchen mit dunkeln Augen und trotzig scheuer Miene. Ein Körbchen in der Hand näherte sie sich ohne Zögern dem würdigen Semmler, verneigte sich vor ihm mit Anstand und sprach: »Mit Eurer Erlaubnis, Signor Maëstro.« Dann schritt sie auf Jürg Jenatsch zu, den sie auf den ersten Blick in der Schülerschar entdeckt hatte.
Dieser saß, eine fremdartige Erscheinung, unter seinen fünfzehnjährigen Altersgenossen, die er um Haupteshöhe überragte. Seinem braunen Antlitz gaben die düstern Brauen und der keimende Bart einen fast männlichen Ausdruck und seine kräftigen Handgelenke ragten weit vor aus den engen Ärmeln des dürftigen Wamses, dem er längst entwachsen war. Beim Eintreten der Kleinen überflog eine dunkle Schamröte seine breit ausgeprägte Stirn. Er behielt eine ernste Haltung, aber seine Augen lachten.
Jetzt stand das Mädchen vor ihm, umschlang den Sitzenden mit beiden Armen und küßte ihn herzlich auf den Mund. »Ich habe gehört, daß du hungerst, Jürg«, sagte sie, »und bringe dir etwas… Von unserm gedörrten Fleische, das du so gerne issest!« fügte sie heimlich hinzu.
Ein unbändiges Gelächter durchdröhnte die Schulstube, das Semmlers gebieterisch erhobene Rechte lange nicht beschwichtigen konnte. Die Augen des Mädchens blickten befremdet und überquollen dann von schweren Tränen des Unmuts und der Scham, während sie Jenatsch fest bei der Hand faßte, als fände sie bei ihm allein Schutz und Hilfe.
Jetzt endlich brach sich die strafende Stimme des Magisters Bahn: »Was ist da zu lachen, ihr Esel? – Ein naiver Zug, sag’ ich euch! Rein griechisch! Euer Gebaren ist ebenso einfältig, als wenn ihr euch beigehen laßt über die unvergleichliche Figur des göttlichen Sauhirten oder die Wäsche des Königstöchterleins Nausikaa zu lachen, was ebenso unziemlich als absurd ist, wie ich euch schon eines öftern bewiesen habe. – – Du bist eine Bündnerin? Wem gehörst du, Kind?« wandte er sich jetzt mit väterlichem Wohlwollen zu der Kleinen, »und wer brachte dich hierher? Denn«, setzte er, seinen geliebten Homer parodierend, hinzu, »nicht kamst du zu Fuß, wie es scheint, nach Zürich gewandelt.«
»Mein Vater heißt Pompejus Planta«, antwortete die Kleine und erzählte dann ruhig weiter: »Ich kam mit ihm nach Rapperswyl, und als ich den schönen blauen See sah und hörte, daß am andern Ende die Stadt Zürich sei, so machte ich mich auf den Weg. In einem Dorfe sah ich zwei Schiffer zur Abfahrt rüsten, und da ich sehr müde war, nahmen sie mich mit.«
Pompejus Planta, der Vielgenannte, der angesehenste Mann in Bünden, das allmächtige Parteihaupt! Dieser Name machte auf Herrn Semmler einen überwältigenden Eindruck. Sogleich schloß er die Schulstunde und führte die kleine Bündnerin unter sein gastliches Dach, gefolgt von dem jungen Waser, der bei dem Magister, seinem mütterlichen Ohm, an diesem Wochentage das Mittagsmahl einzunehmen pflegte.
Als sie die steile Römergasse hinunter schritten, kam ihnen gestiefelt und gespornt ein stark gebauter imponierender Herr entgegen.
»Hab’ ich dich endlich, Lucrezchen!« sagte er, das Kind auf den Arm nehmend und heftig küssend. »Was fiel dir ein, mir zu entspringen, Kröte!«
Dann, ohne eine Antwort zu erwarten und ohne das Mädchen aus den Armen zu lassen, wandte er sich mit einer nur leichten Verbeugung, aber nicht ohne Anmut gegen Semmler und sagte in fließendem, doch etwas fremdartig ausgesprochenem Deutsch: »Ihr habt seltsamen Besuch in Eurer Schule erhalten, Herr Professor! Verzeiht die Störung Eures gelehrten Vortrags durch meinen Wildfang.«
Semmler beteuerte, daß es ihm zur besonderen Freude und Ehre gereiche, das junge Fräulein und durch sie den edeln Herrn Vater kennengelernt zu haben. »Tut mir die Ehre an, hochmögender Herr«, schloß er, »eine bescheidene Mittagssuppe mit mir und meiner lieben Ehefrau zu teilen.«
Der Freiherr willigte ein, ohne sich bitten zu lassen, und erzählte unterwegs, wie er Lucretias Verschwinden spät bemerkt, dann aber gleich sich aufs Pferd geworfen und die Reisende mit Leichtigkeit von Spur zu Spur verfolgt habe. Er erzählte weiter, er besitze in Rapperswyl ein Haus, das er sich auf alle Fälle hin erworben, da es in Bünden wie draußen im Reich nicht mehr ganz geheuer sei. Lucretia habe ihn dahin begleiten dürfen. Wie er dann von Semmler erfuhr, was das Kind nach Zürich getrieben, brach er in ein schallendes Gelächter aus, das aber nicht heiter klang.
Als nach beendigtem Mahle die Herren beim Weine saßen, während die Frau Magisterin sich mit Lucretia beschäftigte, erkundigte sich Planta, vom Gespräch abspringend, plötzlich nach dem jungen Jenatsch. Semmler lobte seine Begabung und seinen Fleiß und Waser wurde abgeschickt, ihn aus dem Hause des ehrsamen Schuhmachers, wo er sich in Kost gegeben hatte, abzuholen. Nach wenigen Augenblicken trat Georg Jenatsch in die Stube.
»Wie geht es, Jürg?« rief der Freiherr dem Knaben gütig entgegen und dieser antwortete bescheiden und doch mit einer gewissen stolzen Zurückhaltung, daß er sein Mögliches tue. Der Freiherr versprach, ihn bei seinem Vater zu rühmen, und wollte ihn mit einem Wink verabschieden; aber der Knabe blieb stehen. »Gestattet mir ein Wort, Herr Pompejus!« sagte er leicht errötend. »Die kleine Lucretia ist um meinetwillen wie eine Pilgerin im Staube der Landstraße gegangen. Sie hat meiner nicht vergessen und mir aus der Heimat eine Gabe gebracht, die sie mir freilich besser nicht gerade vor meinen Kameraden überreicht hätte. Doch bin ich ihr dafür dankbar und möchte ihr schon um meiner Ehre willen ein Gegengeschenk anbieten.« Damit enthüllte er aus einem Tüchlein einen kleinen, inwendig vergoldeten Silberbecher von schlichtester Form.
»Ist der Junge toll!« fuhr der Freiherr auf. Dann aber mäßigte er sich sogleich. »Was denkst du, Jürg!« fuhr er fort. »Kommt der Becher von deinem Vater?… Ich wußte nicht, daß er über Gold und Silber gebiete. Oder erwarbst du ihn selbst im Schweiße deines Angesichts mit einer Schreiberarbeit? So oder so darfst du ihn nicht wegschenken. Es geht dir knapp genug und er hat Geldeswert.«
»Ich darf darüber verfügen«, antwortete der Knabe selbstbewußt, »denn ich habe ihn mit dem Einsatze meines Lebens gewonnen.«
»Ja, das hat er, Herr Pompejus!« ließ sich jetzt der lebhafte Waser mit Begeisterung vernehmen, »der Becher kommt von mir. Er ist das Zeichen meiner Dankbarkeit dafür, daß Jürg mich beim Baden aus den Wirbeln der reißenden Sihl, die mich hinuntergezogen, mit eigener Lebensgefahr gerettet hat. Und Jenatsch und ich und Fräulein Lucretia, wir wollen alle daraus auf Euer Wohl trinken.« Sprach’s und füllte trotz eines seine unerhörte Kühnheit mißbilligenden Blickes, den ihm sein Ohm zuwarf, das Becherlein mit duftendem Neftenbacher aus dem geblümten Deckelkruge.
Jürg Jenatsch ergriff den Becher und suchte mit den Augen Lucretia. Sie hatte dem Vorgange mit brennender Aufmerksamkeit gefolgt. Jetzt machte sie sich von der Magisterin los und stellte sich ernsthaft zu der Gruppe. Jürg kostete den Wein und reichte ihn mit dem Spruche: »Auf dein Wohl, Lucretia, und auf das deines Vaters!« dem schweigenden Kinde, das langsam von dem Tranke schlürfte, als beginge es eine feierliche Handlung. Dann gab es den Becher seinem Vater und dieser leerte ihn aus Verdruß mit einem Zuge.
»Mag es denn sein, du törichter Junge!« sagte Planta, »aber jetzt mach, daß du fort kommst. Auch wir werden bald aufbrechen.«
Jenatsch schied und Lucretia wurde von der Magisterin zu den Stachelbeersträuchern in den kleinen Hausgarten geführt, um sich, wie die kinderfreundliche Frau sagte, ihren Nachtisch selbst zu holen. Während die Herren, diesmal in italienischer Sprache sich unterhaltend, noch einmal zum Becher griffen, setzte sich Waser still in eine Fensternische mit einem Orbis pictus, in den er angelegentlich vertieft schien. Der Schlaue war des Italienischen nicht unkundig, er hatte es mit Jenatsch halb spielend getrieben und ließ, mit scharfem Ohre lauschend, sich kein Wort des interessanten Gespräches entgehen.
»Ich werde dem Jungen den Kinderbecher zehnfach ersetzen«, begann Planta. »Kein übler Bursche, wenn er nicht so hoffärtigen und verschlossenen Gemütes wäre. Hochmut kleidet schlecht, wo das Brot im Hause mangelt. Sein Vater, der Pfarrer von Scharans, ist ein grundbraver Mann und spricht als mein Nachbar häufig bei mir ein. Früher häufiger als jetzt. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, Herr Magister, welch ein schlimmer Geist in unsere Prädikanten gefahren ist. Sie donnern von den Kanzeln gegen den spanischen Kriegsdienst und predigen Gleichberechtigung des Letzten mit dem Ersten zu allen Ämtern im Lande, auch zu den wichtigsten, was bei den gefährlichen politischen Konjunkturen, welche die umsichtigste Führung unsers Staatsschiffleins erfordern, notwendig zum Verderben des Landes ausschlagen muß. Von der unsinnigen protestantischen Propaganda, mit der sie unsere katholischen Untertanen im Veltlin quälen, will ich nicht reden. Ich bin wieder katholisch geworden, Herr, obgleich ich von reformierten Eltern stamme. Warum? Weil im Protestantismus ein Prinzip des Aufruhrs auch gegen die politische Autorität liegt.«
»Stellt eure Pfarrer besser«, warf Semmler behaglich lächelnd ein, »und sie werden als zufriedene und angesehene Leute dem Untertan von der notwendigen Ungleichheit der menschlichen Verhältnisse den richtigen Begriff zu geben wissen.«
Planta lachte etwas höhnisch über diese der bündnerischen Opferwilligkeit gemachte Zumutung. »Um auf den Jungen zurückzukommen«, sagte er dann, »so gehört er auf einen Kriegsgaul, nicht hinter das Kanzelbrett, und würde dort weniger Unheil stiften. Ich hab’ es dem Alten oft gesagt: Gebt den Burschen mir, es ist schade um ihn! Aber der besegnete sich vor dem spanischen Kriegsdienste, wohin ich den hübschen Jungen empfehlen wollte.«
Semmler nippte bedächtig seinen Wein und schwieg. Er schien den Widerwillen des Scharanserpfarrers gegen die seinem Sohne geöffnete Laufbahn nicht zu mißbilligen.
»Ein Weltkrieg steht bevor«, fuhr Planta leidenschaftlicher fort, »und wer weiß, wie weit es ein so verwegenes Blut bringen könnte! Tollkühn ist der Bursche über alles Maß. Da muß ich Euch doch etwas erzählen, Herr Magister! Im Sommer vor etlichen Jahren – der Junge war noch zu Hause – trieb er sich täglich mit meinem Bruderssohne Rudolf und mit Lucretia auf dem Riedberg herum. Da kommt einmal Lucretia, als ich durch den Garten gehe, im Sturm mit freudeblitzenden Augen auf mich zugelaufen. »Sieh, sieh, Vater!«ruft sie atemlos und deutet in die Höhe zu den Schwalbennestern meines Schloßturmes. Was erblick’ ich dort, Herr Magister! Ratet einmal… Den Jürg, der rittlings auf dem äußersten Ende eines weit aus der Dachluke ragenden und sich auf und nieder wiegenden Brettes sitzt. Und der Schlingel schwingt noch den Filz und begrüßt uns mit Jubelgeschrei! Der andere mochte drinnen auf dem sicheren Ende der improvisierten Schaukel hocken, und da Rudolf – ich sag’ es ungern – ein tückischer Junge ist, graute mir vor dem Wagstück. Ich erhob drohend die Hand und eilte hinauf. Als ich ankam, war alles wieder an Ort und Stelle. Ich faßte Jürg am Kragen, ihm seine Frechheit vorhaltend; er antwortete aber ruhig, Rudolf hätte gemeint, er würde sich dessen nicht getrauen, und das hätte er nicht dürfen auf sich sitzen lassen.«
Semmler, dessen Hände bei dieser Geschichte ängstlich nach den Armlehnen seines Stuhls gegriffen hatten, erlaubte sich nun das in ihm aufsteigende Bedenken auszusprechen, ob der Umgang Lucretias mit so wilden Jungen, vornehmlich mit dem durch eine unübersteigliche, mit der Zeit immer größer werdende Kluft von ihr getrennten Jenatsch, nicht die weibliche Zartheit und adelich feine Sitte des kleinen Fräuleins gefährden könnte.
»Flausen!« rief der Freiherr. »Ihr dürft Euch darüber keine Gedanken machen, daß das Kind dem Jungen nach Zürich nachgelaufen ist. Daran ist niemand als der Rudolf schuld. Er tyrannisiert das Mädchen und ängstigt es damit, daß er es seine kleine Braut nennt. – Er mag wohl derartiges von seinem Vater gehört haben, meinem Bruder wär’ es nicht unwillkommen, denn ich bin der Reichere; – aber das liegt in weitem Felde. Kurz, sie hat den stärkern Jürg, den der andere fürchtet, zu ihrem Beschützer gemacht. – Natürlich Kindereien. – Lucretia kommt nächstens zu adelicher Erziehung ins Kloster und hinter den Mauern wird sie mir sittsam genug werden, denn sie ist nachdenklichen Gemüts. – Was übrigens Eure unübersteigliche Klüfte betrifft, so meinen wir in Bünden, auch wenn wir es nicht sagen: Das ist Vorurteil. Ehre, Macht und Besitz, versteht sich von selbst, muß haben, wer um eine Planta werben will. Ob es aus Jahrhunderten stamme oder gestern errafft sei, darnach fragen wir zuletzt.« –
Hier verjagte der sausende Sturm die vor dem Blicke des jungen Wanderers gaukelnden Bilder seiner Knabenzeit. Waser war wieder um fünf Jahre älter und schritt rüstig auf dem einsamen Saumpfade des Julier abwärts. Und auf rauhe Weise wurde er in die Gegenwart zurückgeholt. Ein aus der Talöffnung des Engadins aufbrausender Windstoß riß ihm den Hut vom Kopfe, den er mit einem verzweifelten Seitensprunge gerade noch erhaschte, ehe der zweite die leichte Beute dem in der Tiefe strudelnden Wildbache zuwarf.
Drittes Kapitel
Waser drückte seinen Filz tiefer in die Stirn, schnallte sein Ränzchen fester und sprang, am jetzt steil werdenden Abhange die weiten Windungen des Saumpfades kürzend, eilig abwärts. Erst überschritt er die Wurzeln blitzgeschwärzter, seltsam verdrehter Arvbäume und die harten Rinnen ausgetrockneter Wildbäche, dann trat er weichen Rasen und plötzlich lag das sammetgrüne Engadin geöffnet ihm zu Füßen mit seinen am blitzenden Inn wie ein Geschmeide aufgereihten Bergseen. Aber es war ein letzter Sonnenstrahl zwischen Wolken, der es erhellte und talabwärts in lichter Ferne über dem See und den Weiden von St. Moritz regenbogenfarbig spielte.
Dem Niedersteigenden gegenüber ragte eine kahle dunkle Pyramide empor und daneben talaufwärts ein ebenso hoher mit grünschimmernden Gletschern behangener Grat. Hinter dem Joche, das sie verband, braute sich das Gewitter und drängte seine leise donnernden Wolken durch die Lücke, in der noch zuweilen grell ein entfernteres Schneehaupt auftauchte.
Zur Rechten des Wanderers maskierten die Berge der andern Talwand jene steile Felstreppe, die fast plötzlich durch ein tief eingeschnittenes Tal aus der leichten Bergluft in die Hitze Italiens hinunterführt. Dort hinter der Maloja quollen, vom Südwinde heraufgejagt, die schwülen Dünste wie ein Nebelrauch hervor über die feuchten Wiesen von Baselgia Maria, dessen weiße Türme hinter einem Regenschleier kaum noch sichtbar waren.
Jetzt erreichte der Saumpfad das erste Engadinerdorf, eine Gasse fester Häuser, die mit ihren Strebepfeilern und vergitterten Fensterluken kleinen Festungen glichen. Aber der junge Zürcher klopfte an keine schweren Holztüren, sondern beschloß trotz der Dämmerstunde auf der Talstraße längs der Seen rüstig südwärts zu schreiten. Sein Vorsatz war, im Hospiz der Maloja zu nächtigen, um in der Frühe des nächsten Tages über den Murettopaß nach dem Veltlin aufzubrechen; denn – Herr Pompejus hatte es erraten – es verlangte ihn, und jetzt mehr als je, seinen Schulfreund Jenatsch zu umarmen.
Zwischen den hohen Bergen war es früh Abend und kühl geworden und der Weg dehnte sich endlos neben den am Gestade plätschernden Wellen. Ein feiner frostiger Nebelregen verhüllte die Gegend und durchdrang nach und nach die Kleider des in gleichmäßigem Schritte vorwärts Eilenden. Eine Schläfrigkeit, wie er sie während der Hitze des Tages nicht gefühlt, fiel auf seine Sinne und Gedanken wie eine leichte Erstarrung. Einmal an einer Stelle, wo der Inn mit raschen Wellen in engem Bette an ihm vorüberschoß und auf dem andern Ufer der stumpfe Turm eines schwerfälligen Kirchleins erschien, glaubte er Pferdegetrappel zu vernehmen. Über die Holzbrücke zu seiner Linken flog ein Reiter, der, nach der Maloja schwenkend, vor ihm her jagte und im Abenddunkel verschwand. War diese in einen Mantel gehüllte Gestalt nicht Herr Pompejus gewesen? Nein, es war ein einzelner scheuer Nachtfalter und der Freiherr geleitete und beschützte ja sein Töchterlein, für das er gewiß die sichere Gastfreundschaft seiner Sippe in einem der vornehmen Engadinerdörfer angesprochen hatte.
Endlich, endlich war der letzte See umschritten, trat der letzte Felsvorsprung zurück. Durch den Nebel schimmernder Feuerschein und Hundegebell verkündeten die Nähe eines Hauses, das nur die Paßherberge sein konnte. Waser gewahrte, der dunklen Steinmasse zuschreitend, mit Befriedigung, daß die Pforte der Hofmauer geöffnet war, und sah den Wirt, einen hagern knochigen Italiener, die tobenden Hunde an die Kette legen, wozu ihm der Stalljunge mit einer Pechfackel leuchtete. Das versprach einen gastlichen Empfang. Jetzt ergriff der Wirt die Fackel und hielt sie dem anlangenden Wanderer vors Gesicht.
»Was verlangt der Herr? Womit kann ich dienen?« fragte er, in unangenehmer Überraschung einen leisen Fluch, die Äußerung seines ersten Gefühls, unterdrückend.
»Welche Frage!« antwortete Waser in fröhlichem Tone, »Platz an der Feuerstelle, um mich zu trocknen, Abendbrot und Nachtlager.«
»Tut mir leid, Herr, – unmöglich!« versetzte der Wirt mit einer sein Bedauern und zugleich seine Unerschütterlichkeit höchst lebhaft ausdrückenden Gebärde, »das Haus ist besetzt.«
»Was, besetzt? Ihr schient ja noch Gäste zu erwarten? Ein Obdach, wie immer beschaffen, könnt Ihr einem Reisenden in dieser Öde und in solcher frostigen Regennacht nicht unchristlich verweigern!«
Der Italiener reckte die Hand aus, gegen Süden weisend, wo der Nebel dünner war und jenseits der Wetterscheide der Maloja über zerrissenen Bergzacken die Mondscheibe durchschimmerte. »Von dorther kommt es besser«, sagte er und holte aus dem Hause einen vollen Becher Wein. »Stärkt Euch damit! Ihr kehrt am klügsten nach Baselgia zurück. Ich wünsche Euch eine gesegnete Nacht.«
Der Trank leuchtete beim Fackelscheine im Glase wie feuriger Rubin. Begierig langte Waser nach dem roten Gefunkel und erquickte sich ohne weitere Gegenvorstellung. Der Wirt drängte ihn höflich und ohne Bezahlung zu verlangen durch die Hofpforte und schob den Riegel.
Der junge Zürcher gab das Spiel noch nicht verloren. Statt einen langweiligen Rückzug auf dem eben durcheilten Wege anzutreten, stieg er, seine Lage bedenkend, den wenige Schritte entfernten Vorsprung hinan, der wie eine Warte hinausragt über das hier mit steilem Abfalle beginnende Bregagliatal, jetzt ein brodelnder Nebelkessel, aus dem mondbeglänzt die Spitzen der zu höchst am Rande stehenden Tannen auftauchten. Waser spreitete seinen kurzen Mantel aus, setzte sich darauf und lauschte.
Aus dem Stalle der Herberge erscholl von Zeit zu Zeit das Wiehern eines Pferdes, – sonst blieb alles still. Das Brausen der Wildbäche aus der Tiefe war, vom Nebel gedämpft, dem Ohre kaum vernehmbar….. Jetzt löste sich von dem feinen Rauschen ein leiser heller Ton ab, ein Geklingel, das nun verwehte – und nun nach einer Pause deutlicher emporstieg. Wieder verklang es und hub von neuem wieder an, diesmal näher und lauter, als kröche es die Bergwand herauf, den Windungen eines Pfades folgend. – Lange horchte Waser wie im Traume diesem lieblich unheimlichen Bergwunder zu; jetzt aber schlug der Ton von Menschenstimmen an sein Ohr. Offenbar waren es Reiter oder Säumer, die ihre Tiere antrieben, und – sein Schluß war rasch gezogen – die vom Wirte erwarteten Gäste.
Er legte sich flach auf die Erde, um nicht sichtbar zu werden. Er wollte wissen, wer ihn seines Nachtlagers beraube. Nach geraumer Zeit erreichten zwei Maultiere die Höhe, zwei Reiter sprangen ab, offenbar Herr und Diener, bestürmten mit einigen harten Schlägen das sofort sich öffnende Tor und wurden vom Wirte diensteifrig in das noch immer erleuchtete Haus geführt.
Unwille und Neugier stachelten den jungen Zürcher. Wie neubelebt sprang er auf und umschlich die geheimnisvolle Festung. Er erinnerte sich des Feuerscheins, der ihm bei der Ankunft entgegengeleuchtet und der nicht von der Hofseite gekommen sein konnte. Richtig, da war an der Rückseite des Hauses das einzelne Seitenfenster mit seiner durch ein schweres Eisengitter flammenden Helle. Er schwang sich auf die Ruine eines an die Hausmauer gelehnten Ziegenstalles und es gelang ihm, in die Tiefe des rauchigen Gemaches zu blicken.
Da stand am lodernden Herdfeuer eine steinalte Frau mit einem grundehrlichen Gesichte und hielt eine Eisenpfanne in der Hand, worin Bergforellen im prasselnden Fette brieten. Ein bleicher Bursche, dessen krankhaft starre Züge in dem Schwalle des dunkeln verwirrten Lockenhaares fast verschwanden, schlief, in eine Schafhaut gewickelt, auf einer Steinbank im Hintergrunde.
Jetzt galt es klug sein. Waser, als angehender Diplomat, suchte erst lauschend sich die Situation klar zu machen und dann den Punkt zu finden, von welchem aus er sich derselben bemächtigen könnte. Der Zufall war ihm günstig. Der bleiche Schläfer begann mit einem ängstlichen Traume zu kämpfen; erst warf er sich ächzend hin und her, von einer Seite auf die andere, dann richtete er sich plötzlich mit geschlossenen Augen und einem Ausdrucke stumpfen Seelenleidens auf, ballte die Faust, als umschlösse sie eine Waffe, führte einen Stoß und stöhnte mit dumpfer Traumstimme: »Du wolltest es, Santissima!«
Jetzt setzte die Alte rasch ihre Pfanne weg, faßte den Träumer unsanft an der Schulter, rüttelte ihn und rief ihn an: »Erwache, Agostin! Ich will dich nicht länger in meiner Küche. Das sind nicht die Träume des Erzvaters Jakob… Dich plagt der Böse. Fort ins Heu! Und der Herr behüte dich vor den Fallstricken der Hölle.«
Die langlockige, schmale Gestalt erhob sich mit gesenktem Haupte und entfernte sich ohne Widerrede.
»Was du für meinen Sohn, den Pfarrer Alexander in Ardenn, mitzunehmen hast, werd’ ich dir morgen in der Frühe, wenn du hier deinen Tragkorb holst, selber obenauf binden!« rief ihm die Alte nach und setzte dann kopfschüttelnd hinzu: »Eigentlich sollt’ ich dem papistischen Querkopfe das teure Erbstück nicht anvertrauen!«…
»Das könnt ich Euch besser besorgen, gute Frau«, sprach Waser mit Vertrauen erweckender Stimme zwischen den Eisenstäben hindurch ins Gemach hinein. »Ich gehe morgen über den Muretto ins Veltlin zu Pfarrer Jenatsch, dem Freunde und Nachbar Eures würdigen Sohnes, Herrn Blasius Alexander, dessen Name mir wohl bekannt ist, denn er hat ein gutes Gerücht in protestantischen Landen. Wohlverstanden, wenn Ihr mir bis zur Frühe ein trockenes Schlafplätzchen anweisen könnt, denn der Wirt hat mich andrer Gäste wegen ausgeschlossen.« –
Die Alte griff erstaunt, aber unerschrocken nach ihrer Öllampe. Das Flämmchen mit der Hand gegen den Luftzug deckend, näherte sie sich der Fensteröffnung und beschaute sich den durch das Gitter redenden Kopf Als sie das heiter kluge junge Gesicht und die wohlanständige Halskrause erblickte, wurden ihre scharfen grauen Augen sehr freundlich und sie sagte: »Ihr seid wohl auch ein Prädikant?«
»Ein Stück davon!« antwortete Waser, der in seiner Heimat nicht leicht eine Unwahrheit sagte, aber auf diesem wilden unwirtlichen Boden den Umständen etwas einräumte. »Laßt mich ein, Mütterchen, das Weitere wird sich finden.«
Die Alte nickte ihm zu, den Finger auf den Mund legend, und verschwand. Jetzt knarrte ein niedriges Pförtchen neben dem Ziegenstalle, Waser kletterte hinunter und wurde von der Alten, die seine Hand ergriff, über ein paar dunkle Stufen hinauf in die Küche gezogen.
»Ein warmes Kämmerchen findet sich wohl, – das meinige!« sagte sie, auf einer Leitertreppe neben dem Rauchfange deutend, die zu einer Falltüre in der gemauerten Decke führte. »Ich habe die ganze Nacht am Feuer zu tun, – die Herrschaften drüben setzen sich eben erst zu Tische. Haltet Euch droben still, Ihr seid dort sicher, und einen Diener am Wort werd’ ich auch nicht verhungern lassen.«
Damit reichte sie ihm die Ampel, er stieg ohne weitere Umstände die Leiter hinauf, hob mit der Rechten die Türe und trat in ein nacktes kerkerähnliches Kämmerchen. Die Alte folgte ihm mit Brot und Wein, trat dann durch das Seitenpförtchen in der Wand in ein, wie es schien, weites luftiges Nebengemach und kehrte mit einem ansehnlichen Stück gedörrten Schinkens zurück. An der Wand über einem wenig einladenden Schragen hing ein großes, massiv mit Silber beschlagenes Pulverhorn.
»Das, Herr«, sagte darauf deutend die Alte, »will ich meinem Sohne morgen schicken. Es ist das Erbe von seinem Ohm und Paten, ein hundertjähriges Beutestück aus dem Müsserkriege.«
Nach kurzer Zeit streckte sich Waser auf das Lager und versuchte zu schlafen, aber es gelang ihm nicht. Einen Augenblick war er eingedämmert, Traumgestalten bewegten sich vor seinen Augen, Jenatsch und Lucretia, Herr Magister Semmler und die Alte am Feuer, der Wirt zur Maloja und der grobe Lucas setzten sich zu einander in die seltsamsten Wechselbeziehungen. Plötzlich saßen sie alle auf einer Schulbank, Semmler hob als griechische Drommete merkwürdiger Weise das große Pulverhorn an den Mund, aus dem die unerhörtesten Klagetöne hervordrangen, beantwortet von einem aus allen Ecken schallenden teuflischen Gelächter.
Waser erwachte, hatte Mühe, sich zu erinnern, wo er sich befinde, und war im Begriffe wieder einzuschlummern, da erschollen, wie er meinte von der Nebenkammer her, in lebhafter Zwiesprache ferne Männerstimmen. Was er jetzt hörte, war kein Traumgelächter.
War es die Aufregung der Reise, war es ein die heimlich aufsteigende Furcht bekämpfender rascher Entschluß, oder war es einfache Neugier, was den jungen Zürcher vom Lager trieb? Was immer, er stand schon an der Tür des anstoßenden Raumes, überzeugte sich, erst horchend, dann sachte öffnend, daß er leer sei, und nun durchschritt er auf leisen Zehen die ganze Breite der Kammer, einem schmalen Lichtschimmer folgend, der durch die gegenüberstehende Wand drang. Der schwache rötliche Strahl kam, wie der Tastende sich überzeugte, durch die Spalte einer morschen, mit schweren Eisenbändern beschlagenen Eichentür. Vorsichtig legte er sein scharfes Auge an das klaffende Holzwerk, und was er sah und vernahm, war derart, daß er, seine eigene Lage vergessend, an seinen Posten gebannt blieb.
Es war ein enges, durch eine beschirmte Hängelampe erhelltes Gemach, in das er blickte. Der Redenden waren zwei und sie schienen sich an einem kleinen, mit Briefschaften und unordentlich zur Seite geschobenen Flaschen und Tellern bedeckten Tische gegenüber zu sitzen. Der Nähere wandte der Tür den Rücken zu und die breiten Schultern, der Stiernacken, der struppige Krauskopf des heftig Sprechenden füllten zuweilen den ganzen von der Spalte gewährten Sehkreis. Jetzt beugte er sich mit demonstrierender Gebärde vorwärts und über seiner Achsel ward in der grellsten Schärfe des Lichtes das auf die Hand gestützte Haupt des andern – Waser erschrak – des Herrn Pompejus Planta sichtbar. Wie gespannt und gramvoll sah er aus! Tief eingeschnittene Falten zogen seine buschigen Brauen zusammen über den eingefallenen, aber unheimlich blitzenden Augen. Die stolze kräftige Lebenslust war verschwunden und in seinen Zügen kämpften heißer Groll und tiefer Jammer. Er schien seit heute Mittag um zehn Jahre gealtert.
»Ich willige ungern in das Blutbad, das mir manchen früher befreundeten Mann aus meiner Sippe kostet, und noch schwerer in die dann notwendig werdende spanische Hilfe«, sprach Planta jetzt langsam und gedrückt, nachdem der andere seine sprudelnde, Waser unklar gebliebene Rede vollendet hatte, »… aber«, und hier fuhr ein Blitz des Hasses aus den Augen des Freiherrn, »muß Blut fließen, Robustelli, so vergeßt mir wenigstens ihn nicht!«
»Den Giorgio Jenatsch!« lachte der Italiener wild und stieß sein Messer in einen neben ihm liegenden kleinen Brotlaib, den er Herrn Pompejus vorhielt wie einen gespießten Kopf an einer Pike.
Bei dieser nicht zu mißverstehenden symbolischen Antwort kehrte der Italiener die Hälfte seines rohen Gesichts dem Lauscher in nächster Näher zu. Dieser fuhr zurück und fand es geraten, sich geräuschlos auf seine Lagerstätte zurückzuziehen. Die Szene gab ihm viel zu denken und bestärkte ihn in seinem Vorsatze, auf dem nächsten Wege in das Veltlin zu eilen und seinen Freund zu warnen. Wie er es ausführen könne, ohne sich selbst in diese hochgefährlichen Dinge zu verwickeln, dies überlegend entschlummerte er, von Müdigkeit überwältigt.
Das erste Morgenlicht dämmerte durch ein schmales Fensterlein, das eher eine Schießscharte zu nennen war, als Waser durch ein Klopfen an der Falltüre geweckt wurde. Er fuhr in seine Kleider und machte sich reisefertig. Die Alte trug ihm Grüße an ihren Sohn auf, hing ihm sorgfältig das Pulverhorn um, das sie als eine wertvolle Familienreliquie zu verehren schien, und beförderte ihn mit einiger Ängstlichkeit durch das Küchenpförtchen ins Freie. Hier zeigte sie ihm den in die Berge zur Linken der Maloja sich verlierenden Anfang seines heutigen Weges, den schmalen Eingang zum Talkessel von Cavelosch.
»Seid Ihr einmal drinnen«, sagte sie, »so blickt nach dem kahlen Hange zur Linken des Sees, dort schlängelt sich, weithin sichtbar, der Pfad und dort müßt Ihr ohne anders den Agostino erblicken. Er ist vor einer Viertelstunde mit seinem Tragkorbe aufgebrochen und geht wie Ihr nach Sondrio hinüber. Den sprecht an und haltet Euch zu ihm. Es ist freilich mit ihm hier«, sie wies auf die Stirn, »nicht ganz richtig, aber den Weg weiß er auswendig und ist sonst wie ein andrer.«
Waser verabschiedete sich mit herzlichem Danke und entfernte sich schnellfüßig aus dem Umkreise des noch stillen Hauses. Zwischen wilden Felstrümmern, die den Pfad kaum durchließen, betrat er bald das eiförmige, rings von gletscherbeladenen Wänden abgeschlossene Tal. Er erblickte den schmalen Steig mit dem längs dem Abhange schreitenden Agostino und eilte ihm nach.
Der junge Mann hatte die Eindrücke der Nacht noch nicht überwunden, so sehr er sich bemühte, ihrer Herr zu werden und sie in klare Gedanken zu verwandeln. Er ahnte, daß, was er geschaut, schweres Unheil bedeute und daß ihm der Zufall nur einen geringen, für ihn zusammenhanglosen und unverständlichen Teil sich vorbereitender ungeheurer Schicksale enthülle. Trotz seines leichten Jugendblutes war er davon tief erschüttert, denn zwei der hier sich feindlich entgegengetriebenen Persönlichkeiten, sein Freund und Herr Pompejus, besaßen, wenn auch auf verschiedene Weise, seine Liebe und Bewunderung.
Und wie eigen, bezaubernd und schauerlich, war diese jetzt vom Morgen gerötete Gegend. Unten eine grüne Seetiefe, umkränzt von üppig bewachsenen Vorsprüngen und buschigen Inselchen, versenkt in eine überall, überall sich zudrängende unendliche Wildnis dunkelrot blühender Alpenrosen wie in ein blutiges Tuch. Ringsum ragten senkrechte schimmernde Felswände, durchzogen von den silbernen Schlangenwindungen stürzender Gletscherbäche, und im Süden, wo der im Zickzack sich aufwärts windende Pfad den einzigen Ausgang aus dem Talrunde verriet, blendete den Blick ein glänzendes Schneefeld, aus dem rötliche Klippen und Pyramiden hervorstachen.
Jetzt hatte Waser seinen Vormann erreicht und suchte grüßend ein Gespräch mit dem Schweigsamen anzuknüpfen, der, in langsames Brüten vertieft, ihn gleichgültig kaum ansah und sich seine Gesellschaft ohne Verwunderung und ohne Neugier gefallen ließ. Er konnte ihm nur wenige Worte abnötigen, und da der Pfad ohnedies immer rauher und bald auf dem Schnee schlüpfrig wurde, gab er seine Bemühungen auf.
Schneller als Waser erwartet hatte, erreichten sie die Paßhöhe. Hier beherrschte den Ausblick nach Süden eine hochgetürmte, düstere Gebirgsmasse. Waser erkundigte sich nach dem Namen dieses drohenden Riesen. »Er hat deren verschiedene«, antwortete Agostino, »hier oben in Bünden nennen sie ihn anders als wir unten in Sondrio. Hier heißt er der Berg des Unglücks und bei uns der Berg des Wehs.« Von diesen leidvollen Namen unangenehm berührt, ließ Waser seinen wortkargen Begleiter voranschreiten, hielt eine kurze Rast und blieb dann, ohne ihn aus den Augen zu lassen, eine Strecke hinter ihm, um sich in der kräftigen Bergluft allein der freien Lust des Wanderns zu ergeben.
So ging es stundenlang abwärts längs des schäumenden, über Felsblöcke tobenden Malero, während die Sonne immer glühender in die Talenge hinunterbrannte. Jetzt begannen kräftig aus dem Wiesengrunde emporgewundene Kastanienbäume den Pfad zu beschatten und die ersten Weinlauben grüßten mit ihren schwebenden Ranken. Auf den Hügeln schimmerten prunkbeladene Kirchen und der Weg wurde immer häufiger zur gepflasterten Dorfgassse. Endlich durchschnitten sie die letzte Schlucht und vor ihnen lag im goldenen Abenddufte das breite üppige Veltlin mit seinen heißen Weinbergen und sumpfigen Reisfeldern.
»Dort ist Sondrio«, sagte Agostino zu dem jetzt wieder an seiner Seite schreitenden Waser und wies auf eine italienische Stadt mit schimmernden Palästen und Türmen, die dem aus der Einöde Kommenden wie ein Feenzauber durch den dunklen Rahmen des Felstors entgegenlachte.
»Ein lustiges Land, dein Veltlin, Agostino«, rief der Zürcher, »und dort am Felsen wächst ja, irr’ ich nicht, der löbliche Sasseller, die Perle der Weine!«
»Er ist im April erfroren«, versetzte Agostino in schwermütiger Stimmung, »zur Strafe unsrer Sünden.«
»Das ist schade«, versetzte jener, »was habt ihr denn eigentlich verbrochen?«
»Wir dulden unter uns den giftigen Aussatz der Ketzerei, aber wir werden in Kürze gereinigt und das faule Fleisch wird ausgeschnitten werden. Die Toten und die Heiligen haben in feierlicher Versammlung das Für und Wider erwogen am achten Mai um Mitternacht dort zu San Gervasio und Protasio«, er wies auf eine vor ihnen liegende Kirche, »der Wächter hat es wohl gehört und ist vor Schrecken krank geworden – sie haben scharf gestritten… aber unser San Carlo, dessen Stimme zwanzig gilt, ist Meister geworden.«
Nicht bemerkend, wie spöttisch ihn sein Begleiter von der Seite aus lachenden Augenwinkeln ansah, tat er jetzt, was er unterwegs schon immer getan, wo ein Kreuz oder Heiligenbild am Pfade stand, er setzte, vor einem bunten Schreine der Muttergottes angelangt, seinen Tragkorb nieder, warf sich auf die Kniee und starrte mit brennenden Augen durch das Gitter.
»Saht Ihr, wie sie mir winkte?« sagte er nach einiger Zeit im Weitergehen wie geistesabwesend.
»Ja wohl«, meinte der Zürcher lustig, »Ihr scheint bei ihr gut angeschrieben zu sein. An was hat sie Euch denn erinnert?«
»Meine Schwester umzubringen!« erwiderte er mit einem schweren Seufzer.
Das war dem jungen Zürcher zu viel. »Lebt wohl, Agostino«, sagte er. »Auf meiner Karte steht ein Seitenweg nach Berbenn, da ist er ja schon, nicht wahr? Ich kann abkürzen.« Und er drückte dem leidigen Gesellen ein Geldstück in die Hand.
Waser wandte sich zwischen den Mauern der Weinberge rechts um den Fuß des Gebirges und erblickte nach kurzer Wanderung das unter dem schattenden Grün der Kastanien fast verborgene Dorf Berbenn, sein Reiseziel. Ein halbnackter Bube wies ihm die Pfarre. Ein ärmliches Haus – aber an seiner Vorderseite umhangen und beladen mit einem so reichen Prunke von Blättern und Trauben, mit so üppigen Kränzen von übermütigem Weinlaube, daß sein dürftiger Bau darunter verschwand. Ein breites Gitterdach auf morschen Holzsäulen bildete die schwache Stütze dieses lastenden Reichtums und die Vorhalle des Häuschens. Oben spielten die letzten Strahlen der Abendsonne auf den warmen goldgrünen Blättern, darunter lag alles im tiefsten Schatten.
Während Waser diese noch nie geschaute freie Fülle bestaunte, erschien eine leichte Gestalt in der Tür, und als sie aus dem grünen Schatten trat, war es ein schönes noch mädchenhaftes Weib, das einen Krug zum Wasserholen auf dem Kopfe trug. Der nackte Arm stützte leicht das auf den dicken braunen Flechten ruhende Gefäß, sie bewegte sich in schwebender Anmut mit gesenkten Wimpern heran, und als nun Waser in achtungsvoller Haltung höflich grüßend vor ihr stand und sie die sanften leuchtenden Augen auf ihn richtete, war ihm, er habe noch nie im Leben einen solchen Triumph der Schönheit gesehen.
Auf seine Erkundigung nach dem Herrn Pfarrer zeigte sie ruhig mit der freien Hand durch die Weinlaube und den dunkeln Flur nach einer Hintertür des Hauses, wo die goldene Abendhelle eindrang. Von dorther scholl zu Wasers Verwunderung kriegerischer Gesang.
»Kein schönrer Tod ist in der Welt, Als wer vorm Feind hinscheidt…«
Das Lied des deutschen Landsknechts, das so todesfreudig und doch so lebensmutig klang, konnte, daran war kein Zweifel, nur aus der kräftigen Kehle seines Freundes kommen. In der Tat, da kniete er im Schatten einer mächtigen Ulme, und womit beschloß der Pfarrer von Berbenn sein Tagewerk? er schliff am Wetzsteine einen gewaltigen Raufdegen.
Vor Überraschung blieb Waser einen Augenblick wortlos stehen. Der Knieende gewahrte ihn, stieß das Schwert in den Rasen, sprang auf, breitete die Arme aus und drückte mit dem Rufe »Herzenswaser!« den Freund an seine breite Brust.
Viertes Kapitel
Nachdem sich der Ankömmling aus der Umschlingung des Pfarrers losgewunden, maßen sie sich gegenseitig mit fröhlichen Augen.
Waser war etwas verblüfft; aber es gelang ihm, nichts davon merken zu lassen. Er fühlte sich ein wenig gedrückt neben der athletischen Gestalt des Bündners, von dessen braunem, bärtigen Haupte ein Feuerschein wilder Kraft ausging. Er ahnte es, die Gewalt eines unbändigen Willens, die früher in den düstern, fast schläfrigen Zügen seines Schulgenossen geschlummert haben mochte, war geweckt, war entfesselt worden durch die Gefahren eines stürmischen öffentlichen Lebens.
Jenatsch seinerseits war von der fertigen und saubern Erscheinung seines zürcherischen Freundes, der mit klug bescheidenen Blicken, doch in seiner Weise sicher vor ihm stand, sichtlich befriedigt, und offenbar erfreut, mit einem Vertreter städtischer Kultur in seiner Abgeschiedenheit zu verkehren.
Der Bündner lud seinen Gast mit einer Handbewegung zum Sitzen ein auf die rings um den Stamm der Ulme laufende Bank und rief mit tönender Stimme:
»Wein! Lucia.«
Das schöne, stille Weib, dem Waser beim Eintritte in das Haus begegnet war, erschien bald mit zwei vollen Steinkrügen, die sie mit einer lieblich schüchternen Verneigung zwischen die Freunde auf die Holzbank setzte, demütig sich gleich wieder entfernend.
»Wer ist das holdselige Geschöpf?« fragte Waser, der ihr mit Wohlgefallen nachschaute.
»Mein Eheweib. Du begreifst, daß hier mitten unter den Götzendienern«, Jenatsch lächelte, »ein protestantischer Priester nicht unbeweibt bleiben durfte. Es ist einer unserer Hauptsätze! Überdies schärfte mir das jetzige laue Regiment, das mich aus dem Wege haben wollte und mich auf diese einsame Strafpfarre beförderte, ausdrücklich ein, so viele Seelen als möglich aus dem Pfuhle des Aberglaubens zu ziehen. Das war mein redlicher Vorsatz. Aber bis jetzt ist mir nur eine Bekehrung gelungen, die der schönen Lucia. Und wie? Indem ich meine eigene Person dafür verpfändete.«
»Sie ist aus der Maßen schön«, bemerkte Waser nachdenklich.
»Gerade schön genug für mich!« sagte Jenatsch, seinem Gaste den einen Krug überreichend, während er den andern an die Lippen setzte, »und die Sanftmut selbst, – sie hat von ihren katholischen Verwandten meinetwegen viel zu leiden. Aber was hast du da für ein stattliches Pulverhorn, Freund? das ist ja das Erbstück aus der Familie der Alexander!… Richtig, der Alte in Pontresina ist gestorben und nun kommt es an den wackern Blasius, meinen Kollegen in Ardenn. Darum könnt’ ich ihn beneiden. Doch wie in aller Welt kommst gerade du dazu, es ins Veltlin zu bringen?«
»Das gehört zu meinen Reiseerlebnissen, die ich dir später des nähern berichten werde«, erwiderte Waser, der mit sich selbst noch nicht im klaren war, wie weit er das warnende Abenteuer der Maloja enthüllen könne, ohne gegen seinen Vorsatz von dem heißblütigen Freunde aus der einen Mitteilung in die andere fortgerissen zu werden. »Aber jetzt, lieber Jürg, kläre mich vor allen Dingen auf über die merkwürdigen Ereignisse, die in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit aller Politiker auf dein Vaterland lenkten. Quorum pars magna fuisti! Du warst dabei die Hauptperson.«