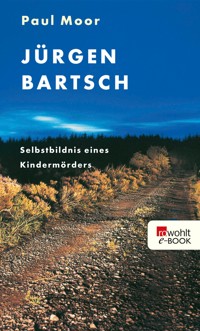
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Juni 1966 berichteten alle deutschen Zeitungen auf Seite eins über die Verhaftung eines 19-jährigen Metzgergesellen, der auf unvorstellbar grausame Weise vier Schuljungen missbraucht und zu Tode gequält hatte. Paul Moor nimmt als Korrespondent und Berichterstatter an dem Prozess teil und beginnt eine Korrespondenz mit dem Angeklagten. Und Jürgen Bartsch fasst Vertrauen. Er antwortet und schreibt sich alles von der Seele, was ihn zum Opfer und zum Täter gemacht hat. In über 8 Jahren, bis kurz vor Bartschs Tod, sammelt Paul Moor Hunderte von Briefen – das erschütternde Selbstbildnis eines vierfachen Kindermörders, wie es die Literatur nicht kannte und das einen Einblick in die Untiefen der menschlichen Psyche ermöglicht und uns erkennen lässt, warum Menschen morden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Paul Moor
Jürgen Bartsch – Selbstbildnis eines Kindermörders
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Zitate
1 Vorwort
2 Untermalung zu einem Selbstbildnis
3 Der erste Prozeß
4 Einleitung zu den Briefen
5 Briefe I
6 Einleitung zum psychogenen Inventar
7 Psychogenes Inventar des Jürgen Bartsch
8 Briefe II
9 Briefe III
10 Briefe IV
11 Briefe V
12 Die Hölle
13 Der Revisionsprozeß
14 Briefe VI
15 Briefe VII
16 Entr’acte
17 Briefe VIII
18 Briefe IX
19 Briefe X
20 Briefe XI
21 Briefe XII
22 Das Ende
23 Nachspiel
Postskriptum
Literaturverzeichnis
Personenregister
IN MEMORIAM
Klaus Jung
1954–1962
Peter Fuchs
1952–1965
Ulrich Kahlweiss
1953–1965
Manfred Grassmann
1954–1966
*
Jürgen Bartsch
1946–1976
Das Leben lehrt uns, weniger mit uns
Und andern strenge sein; du lernst es auch.
Goethe: Iphigenie auf Tauris
Ich verachte Niemanden, am wenigsten wegen
seines Verstandes oder seiner Bildung, weil es in
Niemands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder
kein Verbrecher zu werden, – weil wir durch
gleiche Umstände wohl Alle gleich würden,
und weil die Umstände außer uns liegen.
Georg Büchner an seine Familie
Ich bin mit der Zeit immer ehrlicher geworden,
bis ich zum Schluß ganz ehrlich war… ich bin
stolz (!) darauf, schon lange nicht mehr gelogen
zu haben.
Jürgen Bartsch an Paul Moor
1 Vorwort
Mensch bin ich, nichts Menschliches
ist mir, glaub’ ich, fremd.
Terenz: Heauton timorumenos
Im Juni 1966 lebte ich schon siebzehn Jahre in Europa, fünfzehn Jahre in Deutschland und zehn Jahre (als Korrespondent der amerikanischen Zeitschriften Time und Life und als Mitarbeiter von CBS, dem Radiosender Columbia Broadcasting System) in Berlin. Sieben Tage in der Woche las ich frühmorgens einen ganzen Stapel von Zeitungen aus Ost und West. Im Juni 1966 erschienen auf Seite eins fast jeder Zeitung in der Bundesrepublik und West-Berlin besonders ausführliche Berichte über die Verhaftung eines neunzehnjährigen Metzgergesellen namens Jürgen Bartsch in Langenberg bei Essen.
Am Dienstag, dem 21.Juni, hatte ihn die Langenberger Polizei verhaftet. Bis dahin hatten seine Mitmenschen wenig Notiz von Jürgen Bartsch genommen; in der Siedlung «Glaube und Tat», wo er und seine Eltern wohnten, war er nie aufgefallen, weil er – wie seine Eltern – einen langen Arbeitstag und wenig Freizeit hatte. Buchstäblich über Nacht wurde Jürgen Bartsch nun als «der Kirmesmörder» einer der bekanntesten Menschen der Bundesrepublik. Zum Beispiel berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung:
«Der neunzehnjährige Metzgergehilfe Jürgen Bartsch aus Langenberg hat gestanden, in den Jahren von 1962 bis 1966 vier schulpflichtige Jungen mißbraucht und ermordet zu haben. Gegenüber dem ersten gab sich Bartsch am 31.März 1962 auf dem Kirmesplatz in Essen-Huttrop als Detektiv aus. Er versprach dem Jungen einen Auftrag, den er bezahlen wollte. In einem Stollen erschlug er das Kind mit einer Schreckschußpistole, die er später fortwarf. Die Leiche verscharrte er im Stollen. Erst am 5.August 1965 will der ‹Kirmesmörder› sein nächstes Opfer gefunden haben. Bartsch berichtete, er habe den Jungen mit nach Langenberg genommen. Unweit vom Stollen hielt er an und fesselte den Jungen, ehe er ihn schließlich im Stollen erwürgte. Die Leiche verscharrte er erst am 14.August 1965 mit dem leblosen Körper seines nächsten Opfers. Dieses Kind wurde von Bartsch ebenfalls im Lieferwagen vom Kirmesplatz zu dem Stollen transportiert, hier dann mit Steinbrocken erschlagen. Einen vierten Jungen erwürgte Bartsch in dem Stollen. Seine Leiche verscharrte er nur oberflächlich und bedeckte sie mit Steinen und Holzbalken. Obenauf legte er die Kleider seines Opfers.»
Ich weiß nicht mehr, wie viele solche Berichte über Jürgen Bartsch ich an jenem Dienstag in meinen Zeitungen las. Je mehr ich las, desto unfaßbarer wurde mir der Fall psychologisch. Da wurde in allen Blättern über ein anständiges, fleißiges Ehepaar berichtet, in dessen Haus das arme Waisenkind Jürgen das große Glück gehabt hatte, ein Zuhause zu finden, wo ihn seine biederen katholischen Adoptiveltern mit Stofftieren, Plattenspieler, Fotoapparat usw. in jeder denkbaren Weise verwöhnten. Schon die Berichterstattung dieses ersten Tages machte mir klar: Da stimmte etwas nicht.
Etwa neun Monate früher, im September 1965, hatte ich eine Psychoanalyse abgeschlossen. Eine solche Therapie geht niemals schnell, aber in meinem Fall hatte sie ungewöhnlich lange gedauert. Ich hatte sie 1946 im Alter von zweiundzwanzig Jahren in New York begonnen, mußte sie aber nach anderthalb Jahren aus finanziellen Gründen abbrechen. Erst neun Jahre später, in Berlin, konnte ich sie bei einem angesehenen, schon älteren Analytiker fortsetzen – einige Jahre, bis Dr.Boehm starb. Um die Analyse abschließen zu können, mußte ich mir meinen dritten Analytiker suchen. In diesen langen «Lehrjahren auf der Couch». (Tilmann Moser) habe ich nicht nur über mich, sondern über meine Mitmenschen, über alle Menschen einiges gelernt.
Ich wußte nur zu gut, was es bedeutete, ein todunglückliches, emotional mißbrauchtes, mit elf Jahren sexuell verführtes und mißhandeltes Kind zu sein, und ich wußte auch, welche Narben, welche nie ganz verheilenden Wunden solche Erlebnisse im späteren Leben werden konnten. Meine eigenen Kindheitserlebnisse hatten mich, im Gegensatz zu Jürgen Bartsch, nicht einmal in die Nähe von Mord geführt, aber mir war allzu vertraut, was es hieß, das Kind einer unglücklichen Ehe zu sein – einer Ehe, die nie hätte zustande kommen sollen, zwischen einem primitiven, brutalen, tyrannischen, verachtungsvollen Vater und einer prüden, höchstwahrscheinlich frigiden, hysterisch religiösen Mutter. Ich sah in mir zwar keinen Vorgänger des zwanghaften Kindermörders Jürgen Bartsch, aber ich sah mich doch als einen Menschen, der unter noch ungünstigeren Umständen ein solcher Verbrecher hätte werden können. Goethe wird der Satz zugeschrieben: «Ich habe nie von einem Verbrechen gehört, das ich nicht hätte begehen können.»
Ich hatte während meiner zwei Jahre in Paris, den fünf Jahren in München und dann den zehn Jahren in Berlin immer wieder feststellen können, daß die alten, aber immer noch beliebten und häufig zitierten Mutmaßungen über Nationalcharakter, «Erbmasse» usw. in Fällen wie dem meinen – und in dem von Jürgen Bartsch – einfach nicht stimmten. Sigmund Freud zitierte gern den heiligen Augustinus: «Inter urinas et faeces nascimur» – und zwar wir alle, egal wer, egal wo. Aus meinen Jahren auf der Couch wußte ich, daß das untadelige Bild der Familie Bartsch, das meine Kollegen da in den Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen malten, einfach nicht stimmen konnte. Und noch etwas: Während jeder Analyse lernt man eine Menge über das Wesen der Homosexualität – eine Grundkomponente in jedem Menschen. Also mußten mich die zahlreichen Andeutungen in den Presseberichten, daß nur ein Homosexueller die Taten von Jürgen Bartsch hatte begehen können, daß der Ursprung, die Ursache seiner Verbrechen in seiner Homosexualität zu suchen sei, sofort alarmieren, weil ich wußte, daß auch das nicht stimmte.
Für Hellhörige allerdings gab es von Anfang an schwache Zwischentöne, die die klischeehafte Harmonie der Berichterstattung störten. Zum Beispiel: die Adoptivmutter habe ihren Sohn bis zum Tage seiner Verhaftung selber gebadet – da war der vierfache sadistische Kindermörder Jürgen Bartsch neunzehn Jahre, fünf Monate und fünfzehn Tage alt. Dieses Detail ließ mich einen allerersten Einblick nehmen in den Abgrund des katastrophalen Familienlebens hinter der Fassade des hübschen kleinen Zweifamilienhauses im Finkenweg der Langenberger Siedlung mit dem harmonischen Namen «Glaube und Tat». In einer Familie, wo so etwas geschehen kann, wird ohne Zweifel mit der psychischen Hygiene eine ganze Menge nicht in Ordnung sein.
Ich wußte damals wenig über die Psychologie des Mordes – so gut wie gar nichts–, aber ich wußte doch genug von der menschlichen Natur, um zu wissen, daß Mörder keine glücklichen Menschen sein können. Aus der Psychoanalyse wußte ich auch, daß das Mörderische in jedem von uns Sterblichen nur schlummert und daß viele Mörder – vielleicht die meisten – ganz andere Menschen töten als diejenigen, die sie eigentlich tot sehen wollen. Ich fragte mich damals, was für eine Kindheit hatte Jürgen Bartsch zu solchen bestialischen Taten führen, ja sogar zwingen können. In meiner Unerfahrenheit hatte ich damals noch nie von einem Mörder gehört, dem das Töten sexuelle Befriedigung verschafft. Was hätte Jürgen Bartsch denn gegen die vier unglücklichen Kinder überhaupt haben können, die er in so unbeschreiblich grausamer Weise schlachtete? Und wenn er gegen seine Opfer nichts haben konnte, wen wollte er dann eigentlich tot sehen?
Einen Prozeß gegen Jürgen Bartsch, las ich damals, sollte es in etwa einem Jahr, wahrscheinlich in Wuppertal, geben. Meine Arbeit für Time-Life International beschränkte sich normalerweise auf Berlin und den Ostblock, auch hatte ich noch nie in meinem Leben Gelegenheit gehabt, über ein Strafverfahren zu berichten; aber ich dachte mir, den Termin für diesen Prozeß sollte ich im Auge behalten. Es erschienen noch einige Zeitungsberichte über den «Kirmesmörder», dann las man monatelang nichts mehr über Jürgen Bartsch. Beruflich hatte ich in und um Berlin viel zu tun, und ich hatte Bartsch fast vergessen, als die Berichterstattung über die Eröffnung seines Prozesses am 30.November 1967 in Wuppertal plötzlich explodierte. Was ich da las, bestätigte und konturierte mein intuitives Bild von der psychologisch tiefkranken Familie Bartsch in Langenberg. Einen ganzen Mittwoch hatte der «dezent angezogene», «liebenswürdige», «nett aussehende», «sympathische» junge Mörder da im Wuppertaler Gerichtssaal mit dem Mikrophon in der Hand gestanden und angefangen, seine eigene Geschichte in allen Einzelheiten endlich bloßzulegen. Die sensationellen Berichte darüber waren lang, aber für mich war klar, daß sie trotzdem nur an der Oberfläche bleiben mußten. Dieser Prozeß erforderte ja wesentlich mehr als nur die übliche journalistische Sachkenntnis.
Im Bonner Hauptbüro von Time & Life arbeiteten mehrere Kollegen, die für das Bundesgebiet verantwortlich waren, aber nach reiflicherer Überlegung habe ich doch den dortigen Chef Hermann Nickel angerufen und mich angestrengt, ihn davon zu überzeugen, daß der Prozeß in Wuppertal eine psychologische und soziologische Fundgrube werden würde und daß er diesen Auftrag mir zuteilen solle. Er erklärte mir, die wöchentliche Nachrichtenkonferenz habe gerade am Vortag in New York stattgefunden; wir müßten nun also die sechs Tage bis zur nächsten Redaktionskonferenz abwarten.
Das Gericht in Wuppertal tagte in Sachen Bartsch nur montags, mittwochs und freitags und hatte an einem Mittwoch angefangen. Ich mußte also nicht einen, sondern zwei Tage warten, ehe die Berichte über den zweiten Prozeßtag erschienen. Sie waren vielleicht noch ausführlicher als die ersten; je mehr der Angeklagte erzählte, desto ungeheuerlicher und unglaublicher wurde seine Geschichte. Ich habe Hermann Nickel noch einmal angerufen und gesagt, dieser Stoff sei einfach zu wertvoll, um auf eine Entscheidung aus New York zu warten. Ich hatte schon die Aussagen von zwei unersetzlichen Tagen versäumt; um nicht noch mehr zu verpassen, würde ich auch ohne Auftrag nach Wuppertal fahren. So geschah es, daß ich – als einziger Ausländer, soviel ich merkte – dem Prozeß in Wuppertal vom dritten Verhandlungstag an beiwohnte und mir darüber umfassende Notizen machte.
Fast alle Sitzungen des Prozesses fanden unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt; bei einer Sitzung mußten auch wir Presseleute, auf Antrag des Angeklagten, den Saal verlassen. Am Tage meiner Ankunft in Wuppertal hatte ich mich dem Gerichtsvorsitzenden Dr.Walter Wülfing persönlich vorstellen müssen, um meine Zulassung zum Prozeß zu bekommen. Ziemlich bald lernte ich auch den Verteidiger Heinz Möller und seinen Referendar Hartwig Kolbe kennen. Ein Ortskundiger erzählte mir, Gerhard Bartsch, Jürgens Vater, sei mit den Problemen seines Sohnes zu Rechtsanwalt Möller gegangen, weil der ihn in irgendeiner kleinen Verkehrsangelegenheit schon einmal vertreten hatte. Nicht nur Heinz Möller – ein kluger, gutherziger, gewissenhafter, sympathischer Anwalt, Familienvater mit vier Kindern, absolut ohne jegliche Erfahrung in solchen Alpträumen wie dem Fall Bartsch – war durch diesen Prozeß überfordert. Ich glaube, ich war der erste, der ihm vorschlug, als zusätzlichen Gutachter einen Psychoanalytiker beizuziehen. Er stellte zwar einen entsprechenden Antrag (es handelte sich um den damals bekanntesten Analytiker in Deutschland, Alexander Mitscherlich), aber das Gericht lehnte diesen – wie so viele Anträge der Verteidigung – schroff ab.
Irgendwann im Laufe des Prozesses wurde ich plötzlich, völlig ohne Vorwarnung, selber zum Teilnehmer. Heinz Möller hatte eine einschlägige wissenschaftliche Arbeit in englischer Sprache gefunden und versuchte sie, mit hörbarer Mühe, vorzulesen. Mit einer dramatischen Handbewegung rief der Vorsitzende: «Halt! Wir haben ja einen Amerikaner unter uns. Bitte, Mister Moor!» Ein anderer Richter erinnerte den Vorsitzenden daran, daß ich zunächst als Gerichtsdolmetscher vereidigt werden müßte. Ehe ich wirklich wußte, was los war, stand ich da unten neben Heinz Möller, und jeder Anwesende – auch der Angeklagte, natürlich – musterte den Exoten. So kam es, daß Jürgen Bartsch, als ich ihm einige Wochen später meinen ersten Brief schickte, wenigstens einen visuellen Eindruck von mir hatte.
Am 15.Dezember 1967 ging der Prozeß nach zwei dramatischen Wochen zu Ende. Kurz zuvor hatte ich Heinz Möller gebeten, seinem Mandanten zu sagen, ich sei daran interessiert, ein ganzes Buch über ihn und diesen Prozeß zu schreiben. Als ich das Gericht um die Genehmigung ersuchte, den verurteilten Jürgen Bartsch zu interviewen, hat der Gerichtsvorsitzende Dr.Wülfing abgelehnt.
Meine eigenen Briefe an Jürgen Bartsch habe ich leider nicht aufgehoben – damals hatte ich nicht daran gedacht, daß das Interesse für den «Fall Bartsch» bis zum heutigen Tage andauern würde–, aber der erste Brief, den ich von ihm erhielt, trägt das Datum 23.Januar 1968 und fängt an: «Lieber Herr Moor! Zuerst einmal den allerherzlichsten Dank für Ihre liebe Karte vom 9.1.68 und auch für das Weihnachtstelegramm vom 24.12.67, daß [sic]1 mir sehr viel Freude gemacht hat.» Damals konnte ich nicht ahnen, was aus diesem Briefwechsel werden würde und was für eine Verantwortung ich mir da ungewollt aufgebürdet hatte.
Irgendwann im Laufe von Monaten wurde mir klar, daß diese Verantwortung wesentlich gewichtiger war als ursprünglich angenommen. Am klarsten wurde diese Entdeckung im Frühling 1968 in New York beim Dinner mit meinem ersten Analytiker und dessen Frau, auch einer Analytikerin. Am Schluß eines längeren Gesprächs über den Fall Jürgen Bartsch und über meinen Briefwechsel mit ihm blickte mich mein Gastgeber lange an, ehe er schließlich sagte: «Vielleicht bist du dir noch nicht darüber im Klaren, aber de facto bist du der Therapeut dieses jungen Mannes geworden.»
Betonen möchte ich, daß ich mir niemals angemaßt habe, Jürgen Bartsch zu «behandeln», psychoanalytisch oder sonstwie; aber eine von mir naiverweise nicht vorausgesehene psychoanalytische Entwicklung ist trotzdem nicht lange ausgeblieben: das, was Freud die Übertragung nannte. In der Übertragungssituation erlebt der Analysand eine unendlich breite Skala von Emotionen, die zwischen Haß und Liebe pendeln. Mehr als einmal seit 1968 bekam ich mehr oder minder deutlich vermittelt, ich hätte mich wohl in Jürgen «verliebt». Daß ich ihn geliebt habe, verneine ich nicht: Er war immerhin mein Spiegelbild, in dem ich sah, wie ich unter Umständen sehr leicht selber hätte werden können. Als ein solches Alter ego liebte ich Jürgen und hatte unendlich Mitleid mit ihm. Lieben konnte ich ihn, ja. Aber verlieben in ihn? Nein.
Es gibt viele körperliche Krankheiten mit schrecklichen, ekelerregenden Symptomen, aber gewissenhafte Ärzte und Krankenschwestern überwinden ihre spontane und verständliche Abscheu, um solchen Patienten zu helfen. Bei psychisch Kranken gibt es manchmal genauso schreckliche und ekelerregende Symptome – zum Beispiel Kindesmord; aber um solch einem Menschen helfen zu können, muß man die wissenschaftliche Grundhaltung beibehalten, dann kann man zwischen Tat und Täter differenzieren und seine Abscheu gegen die Tat überwinden, um den Täter wirklich zu verstehen und – vielleicht – ihm zu helfen.
Die Korrespondenz zwischen Jürgen Bartsch und mir dauerte insgesamt etwas mehr als neun Jahre. Seinen letzten Brief an mich hat er am 21.April 1976 geschrieben; eine Woche später, neunundzwanzig Jahre alt, ist er an Herzversagen gestorben.
Der Revisionsprozeß gegen ihn ging am 6.April 1971 in Düsseldorf zu Ende. Einige Monate vorher hatte das ZEITmagazin die ersten Auszüge aus Briefen von Jürgen Bartsch an mich veröffentlicht. Bis dahin hatte er schon fast tausend nachhakende, heikle, psychoanalytisch orientierte Fragen von mir ausführlich beantwortet; auf dem Papier hatte ich ihn besser – sogar intimer – kennengelernt als manchen persönlichen Freund.
Bald nach dem Revisionsurteil habe ich ein Manuskript mit dem Titel Das Selbstporträt des Jürgen Bartsch geschrieben. Als das Taschenbuch erschien, hatte ich insgesamt nur drei halbe Stunden mit Jürgen verbringen dürfen, und zwar in Gegenwart eines Justizbeamten.
Nach dem Urteil lief die Korrespondenz selbstverständlich weiter. Solange Jürgen Bartsch im Düsseldorfer Untersuchungsgefängnis saß, wurde er einmal in der Woche von einer mutigen Ärztin, Margret Suhr-Effing, psychotherapeutisch behandelt. Sie und ihr Mann (auch Arzt) und ich haben uns kennengelernt und spontan einen freundschaftlichen Kontakt zueinander gefunden. Bald danach hat Jürgen Frau Suhr und mich von unserer beruflichen Schweigepflicht entbunden, damit wir enger zusammenarbeiten konnten. Irgendwann damals hat ihr Jürgen gesagt, sie sollte mir ausrichten, daß ich für ihn der wichtigste Mensch geworden sei und sie der zweitwichtigste.
Ein erfahrener Analytiker hätte wahrscheinlich mit dieser Entwicklung gerechnet, während ich damals mit Überraschung reagierte. Mir wurde klar, daß dies kein einfacher Austausch von freundlichen Briefen mehr war, sondern eine äußerst ernst zu nehmende persönliche Verantwortung, die im Leben eines so kranken Menschen eine entscheidende Bedeutung bekommen konnte. Jürgen Bartsch ist 1946, ich bin 1924 geboren; seine Briefe bezeugen, daß er mich nicht nur als Freund, sondern auch als Vaterfigur betrachtete. Es dürfte keinen überraschen, wenn ich ihn hier nicht Bartsch oder Jürgen Bartsch, sondern Jürgen nenne.
Am 15.November 1972 – fast sechseinhalb Jahre nach seiner Verhaftung und neunzehn Monate nach dem endgültigen Urteil – kam er als Patient in die geschlossene Abteilung des Landeskrankenhauses in dem kleinen westfälischen Nest Eickelborn, zwischen Soest und Lippstadt, wo er endlich offiziell, nach dem Buchstaben des Gesetzes, richtig behandelt werden durfte. Seine Briefe an mich dokumentieren, wie seine verzweifelten Wünsche nach Behandlung dort scheiterten, scheitern mußten.
Ich habe leider nie ein Tagebuch geführt, aber viele Male habe ich Jürgen in Eickelborn besucht. Der Direktor des Krankenhauses, Dr.Schneller, kannte mein Taschenbuch, hatte eine positive Meinung darüber und behandelte mich in der Frage der Besuche wie einen Familienangehörigen. Ich wohnte weiterhin in Berlin, aber jedesmal, wenn ich Gelegenheit hatte, mit dem Wagen in die Bundesrepublik zu fahren, versuchte ich es einzurichten, den Nachmittag und den Vormittag des nächsten Tages mit Jürgen zu verbringen und dazwischen in Soest oder Lippstadt zu übernachten. Das habe ich mehrmals gemacht. Es strengte mich unbeschreiblich an, schien aber für ihn besonders wichtig zu sein. Dadurch habe ich ihn natürlich viel gründlicher kennengelernt als zu dem Zeitpunkt, da ich das Taschenbuchmanuskript schrieb.
Es gibt einen weiteren Grund, jetzt dieses große Buch über Jürgen Bartsch zu schreiben. Abgesehen von einem kurzen Artikel über den ersten Prozeß in Time, ist mein erster Bericht über diesen Fall – «Jürgen Bartsch– Mörder ohne Grund?» – in der Zeitschrift Der Monat erschienen. Von Anfang an habe ich versucht, Jürgen Bartsch aus der Perspektive der Psychoanalyse einigermaßen verständlich zu machen, aber damals verfügte ich hauptsächlich über meine eigenen Erfahrungen als Analysand. Der erste Bericht im Monat, dann die im ZEITmagazin veröffentlichten Briefauszüge, dann das Taschenbuch brachten mich in immer engeren Kontakt mit psychologischen, psychiatrischen und psychoanalytischen Kapazitäten in Deutschland und im Ausland, die sich für diesen fast einmaligen Fall interessierten. So kam es, daß ich in Berlin vom Institut für Psychotherapie und, ein Jahr später, vom Berliner Psychoanalytischen Institut zur «informatorischen» Ausbildung angenommen wurde. Am ersten Institut studierte ich ein Jahr, am zweiten sechs, bis ich 1981Europa, nach zweiunddreißig Jahren, verließ. «Informatorische Ausbildung» bedeutete Zugang zu allen theoretischen Seminaren, nicht aber zu den technischen oder klinischen. Schon bei meiner Antragstellung hatte ich freiwillig eine Art Eid unterschrieben, daß ich mich nie Psychoanalytiker nennen oder Patienten mit psychoanalytischen Methoden zu behandeln versuchen würde. Dank dieser theoretischen Ausbildung fühle ich mich heute wesentlich besser qualifiziert, über Jürgen Bartsch zu schreiben, als ich es früher war.
Während meiner Arbeit an dem vorliegenden Buch schrieb mir Hermann Gieselbusch, seit meiner 1974 erschienenen Euthanasie-Studie mein Freund und Lektor beim Rowohlt Verlag: «Bartsch ist ein Jahrhundertfall; Deine Korrespondenz mit ihm ist eine Singularität, die für alle Zeiten in einer unanfechtbaren Form auch für wissenschaftliche Zwecke aufbereitet werden muß. Ich denke nicht an die sehr strengen Kriterien der philologischen Textkritik. Aber gerade weil Jürgen Bartsch ein sehr origineller, auch schriftstellerisch begabter Mensch war, der eine manchmal eigentümliche, selbstgeschaffene Rechtschreibung kreiert hat, bin ich dafür, die Abweichungen von der durch den Duden geregelten Umgangssprache wohl bis in die Einzelheiten beizubehalten. Gerade für Interpretationen auf dem Boden der Psychoanalyse sind ja sogenannte ‹Fehlleistungen› oftmals von abgründiger Bedeutsamkeit und dürfen keinesfalls um der formalen Korrektheit willen verfälscht werden…
«…ich möchte, daß Du wahrnimmst; wie hoch ich dieses kommende Bartsch-Buch in meiner Vorstellung rangieren lasse. Ich sehe darin ein klassisches Werk wie etwa die Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken von Schreber junior [worüber Sigmund Freud eine seiner bekanntesten Arbeiten schrieb]. Dein Bartsch-Buch wird eben auch in hundert Jahren noch ein Standardwerk sein. Unter diesem Aspekt können Autor und Verlag nur die allerstrengsten Maßstäbe an ihre gemeinsame Arbeit an diesem Buch legen.»
Es gibt verhältnismäßig wenige Fehlleistungen in den Briefen und so gut wie keine von tieferer psychologischer Bedeutung; die letzteren habe ich hier selbstverständlich beibehalten. In meinen Computer habe ich sämtliche Briefe ungekürzt und ungeändert eingespeichert; ein vollständiger Satz Disketten – einschließlich der dreiundzwanzig Kapitel eines «Büchleins», das Jürgen Bartsch in den letzten Monaten vor seinem Tode schrieb – steht zukünftigen Forschern im Berliner Psychoanalytischen Institut, in der Abteilung für Sexualwissenschaft des Klinikums der Universität Frankfurt am Main und im Hamburger Institut für Sexualforschung zur Verfügung. Viel faszinierendes, wissenschaftlich sehr wichtiges Material, das ich im vorliegenden Buch aus Platzmangel nicht ausbreiten konnte, findet sich in meinem 1972 erschienenen Taschenbuch «Das Selbstporträt des Jürgen Bartsch».
Durch meine Beschäftigung mit Jürgen bin ich um einige neue Freunde reicher geworden. Dazu gehörte von Anfang an der hervorragende Psychoanalytiker Tobias Brocher. Margret Suhr-Effing, die Ärztin, die Jürgen wöchentlich in seiner Gefängniszelle neun Monate lang psychotherapeutisch behandelte, habe ich wegen ihres Mutes besonders bewundert. Mit dem Ärzte-Ehepaar Suhr verband mich, solange die beiden lebten, eine enge Freundschaft; heute fehlen sie mir sehr. Bei dem bald nach dem Revisionsprozeß nach Berlin umgezogenen Ehepaar Rasch habe ich an mehreren Abenden Gastfreundschaft genießen dürfen; unsere Gespräche konzentrierten sich auf die verschiedensten Aspekte von Jürgens Persönlichkeit. Herr Rasch hat mir bei der Vorbereitung meines Taschenbuchs wie kein anderer geholfen. Dietrich Wilke, den ich als jungen Sozialarbeiter des Jugendamts während des ersten Prozesses kennengelernt und beim Revisionsverfahren wiedergesehen habe, ist bis heute ein hilfreicher und zuverlässiger Freund geblieben. Christiane Detje vom Rowohlt Verlag hat mir mehrmals mit Recherchen in Deutschland geholfen, die für mich aus San Francisco, wo ich seit 1982 wohne, unmöglich gewesen wären. Und Hermann Gieselbusch kann ich für seine Unterstützung, seinen Beistand und für seine unentbehrliche Hilfe kaum genug danken; nach seiner redaktionellen Bearbeitung lesen sich meine Texte sogar so, als ob ich tatsächlich anständiges Deutsch schreiben könnte.
Zur Vorbereitung dieses Buches habe ich sämtliche Briefe, Postkarten und sonstige Schriftzeugnisse von Jürgen Bartsch – es sind Hunderte – mit meinem Computer buchstabengetreu erfaßt und alle Dokumente chronologisch geordnet. Komplett hätte die Textmenge ein doppelt so umfangreiches Buch ergeben. Also habe ich eine Auswahl treffen müssen und manche Briefe nur auszugsweise wiedergeben können. Bedenkt man, wie bildungsfern Jürgen aufgewachsen ist, so wird man über seine Begabung für differenzierten sprachlichen Ausdruck nur staunen. Sogar seine Orthographie und Interpunktion waren beachtlich sicher. Die wenigen, psychologisch belanglosen Kleinigkeiten wie die Verwechslung von «das» und «daß» oder von «bez. W.» mit «bzw.» habe ich in den meisten Fällen stillschweigend korrigiert, weil sie den Leser eventuell irritieren und vom Inhalt des Geschriebenen ablenken könnten. Denn wie leicht sind wir alle geneigt, von bloß formalen Patzern auf gewichtige innere Mängel des Schreibenden zu schließen.
Aus unzähligen Mosaiksteinchen entsteht hier ein in der ganzen Weltliteratur einmaliges Selbstbildnis eines jungen Menschen, dem (in den prägnanten Worten von Gerhard Mauz) «überlebenden, verzweifelten Opfer von vier Kindern, die ihm zum Opfer fielen».
2 Untermalung zu einem Selbstbildnis
Das im Kern unzerstört erhaltene Städtchen Langenberg liegt in der Nähe von Essen. In diesem Industrierevier nimmt sich Langenberg – im Deilbachtal, umgeben von Wiesen, Weiden, Bach und Wald – idyllisch aus: eine heile Welt. Auf der Heeger Straße kann man an einem alten Luftschutzbunker vorbeigehen, ohne es überhaupt zu merken: Vor Jahren hat man den Eingang zum Stollen betoniert. Heute weiß nur der Kenner, daß vier der scheußlichsten, grausamsten Morde der Kriminalgeschichte zwischen 1962 und 1966 in diesem Bunker begangen worden sind. Nicht weit von hier steht an der Heeger Straße ein Schild: «Zehn Minuten Fußweg zur Gaststätte Haus Senderblick». An dieser Stelle mündet ein steiler Fußweg, den Jürgen Bartsch nachts immer nehmen mußte, wenn er aus seinem Elternhaus oben am Hang hinunter zum Tatort schlich.
Die Langenberger Polizei hat Jürgen Bartsch am 21.Juni 1966 verhaftet. Am 29.November 1967 fing sein erster Prozeß in Wuppertal an; fünf Tage später, am 4.Dezember, kam ich hinzu. Um die Zeitlücke von anderthalb Jahren zwischen seiner Verhaftung und seinem ersten Brief an mich zu füllen, habe ich aus verschiedenen Quellen Material gesammelt, das unmittelbar mit Jürgen Bartsch zu tun hat.
Am linken und unteren Rande einer vergilbten Fotokopie seiner Geburtsurkunde (Nr.882, vom 8.November 1946) sieht man eine Menge Hinzugekritzeltes, mitunter den Namen Bartsch; hier ging es offensichtlich um seine Adoption. Da liest man:
Die Elisabeth Anna Sadrozinski geborene Liedtke
wohnhaft in Essen, bei ihrem Ehemann
Ehefrau des Bergmanns Friedrich Sadrozinski
wohnhaft in Essen, Katernberger Straße 315
hat am 6.November 1946 um 9Uhr 50Minuten
zu Essen, in den Städtischen Krankenanstalten
einen Knaben geboren. Das Kind hat die Vornamen erhalten:
Karl Heinz.
Der Standesbeamte
In Vertretung: [Unterschrift unleserlich]
Eheschließung der Eltern am 8.5.1943 in Essen
Standesamt Essen-Stoppenberg Nr.140/1943
Buchstäblich schon im Augenblick seiner Geburt befand sich Jürgen Bartsch in einem pathologischen Milieu: Er wurde sofort nach der Entbindung von seiner tuberkulösen Mutter, die wenige Wochen später starb, getrennt. Eine Ersatzmutter für das Baby gab es nicht. In Essen, noch 1971 im Dienst auf der Wöchnerinnenstation, fand ich Schwester Anni, die das Kleinkind noch deutlich in Erinnerung hatte:
«Es war so ungewöhnlich, Kinder mehr als zwei Monate im Krankenhaus zu behalten. Jürgen blieb aber elf Monate bei uns.» Seit Sigmund Freud, und besonders seit René A.Spitz, weiß die moderne Psychologie, daß das erste Jahr im Leben eines Menschen für seine Entwicklung mit Abstand das allerwichtigste ist: Mütterliche Wärme und körperlicher Kontakt haben einen unersetzlichen Wert für die spätere Entwicklung des Kleinkindes. Am 21.Juli 1969 schrieb mir Jürgen im Alter von zweiundzwanzig Jahren: «Wenn ich Krankenhaus-Luft rieche, wird mir sofort schlecht, und ich muß mich hinlegen. Vielleicht hat das ein wenig zu tun damit, daß ich über ein Jahr ‹von Anfang an› im Krankenhaus gelebt habe.»
Aber schon in der Krankenhauskrippe begann die ökonomische und soziale Einstellung der späteren Adoptiveltern das Leben des Babys zu bestimmen. Schwester Anni erzählte mir: «Frau Bartsch hat extra bezahlt, damit er hier bei uns bleiben konnte. Sie und ihr Mann wollten ihn adoptieren, aber die Behörden zögerten, weil sie Bedenken über die Herkunft des Kindes hatten. Wie er war auch seine Mutter außerehelich geboren. Sie hatte auch eine Zeitlang bei der Fürsorgeerziehung verbracht. Man wußte nicht genau, wer der Vater war. Normalerweise schickten wir elternlose Kinder nach einer gewissen Zeit auf eine andere Station, aber Frau Bartsch wollte das nicht zulassen. Auf der anderen Station gab es ja alle möglichen Kinder, auch von asozialen Eltern.»
«Ich erinnere mich noch heute, was das Kind für strahlende Augen hatte! Er lächelte sehr früh, verfolgte, hob das Köpfchen, alles sehr, sehr früh. Einmal entdeckte er, daß die Schwester kommen würde, wenn er auf einen Knopf drückte, und das machte ihm großen Spaß. Er hatte damals keine Eßschwierigkeiten. Er war ein völlig normales, gediegenes, ansprechbares Kind.»
Andererseits aber tauchten pathologisch frühe Entwicklungen auf. Die Schwestern auf der Station mußten Ausnahmemethoden erfinden, da ein so großes Kind auf der Entbindungsstation eine Ausnahme bildete. Zu meinem Erstaunen hörte ich, daß die Schwestern das Baby schon mit weniger als elf Monaten «sauber» gekriegt hatten. Schwester Anni fand mein Erstaunen offensichtlich merkwürdig. «Vergessen Sie nicht, wie das damals war, nur ein Jahr nach einem verlorenen Krieg. Es gab überhaupt keinen Schichtwechsel für uns.» Meine Frage, wie sie und ihre Kolleginnen das geschafft hätten, beantwortete Schwester Anni ein bißchen ungeduldig: «Wir haben ihn einfach auf das Töpfchen gesetzt. Das fing mit sechs oder sieben Monaten an. Wir hatten Kinder hier im Krankenhaus, die schon mit elf Monaten laufen konnten, und auch die waren schon fast ‹sauber›.» Unter den gegebenen Umständen wird man nicht von einer deutschen Krankenschwester jener Generation, nicht einmal von einer so gutherzigen Frau wie Schwester Anni, aufgeklärte Kindererziehungsmethoden erwarten dürfen: Die Nazis hatten ja solche angeblich verweichlichenden Methoden aus Deutschland verbannt.
Es besteht kein Zweifel, daß die Eheleute Bartsch sich damals nach einem Kind sehnten, besonders Gerhard Bartsch. Als er kurz nach dem Kriege Dänemark besuchte, brachte er von dort ein Paar kleine Lackschuhe mit, obwohl kein Kind unterwegs war.
Kurz nach der Entbindung der Kriegerwitwe Sadrozinski mußte die spätere Adoptivmutter Gertrud Bartsch in dieselbe Klinik, wo eine «Totaloperation» alle Wünsche nach eigenen Kindern zunichte machte. Sie und ihr Mann lernten in dieser traurigen Zeit den kleinen blonden Jürgen (damals noch Karl-Heinz) kennen. Das Baby befand sich in einer Phase, über die René A.Spitz ausführlich geschrieben hat; solche verlassenen Kinder «entwickeln sich zuerst rascher und sind kontaktfähiger als andere, bis sie dann, wenn die dauernde mütterliche Zuwendung fehlt und die Notreserven des Kleinkindes erschöpft sind, zurückfallen hinter diejenigen, die sich in der mütterlichen Wärme Zeit lassen konnten mit der Entfaltung ihrer Bildungsfähigkeiten.»
Nach elf langen Monaten dieser pathogenen Existenz – fast das ganze, nie kompensierbare erste Jahr – kam das Kind, jetzt Jürgen genannt, zu den Adoptiveltern Bartsch. Jedem, der Frau Bartsch näher kennt, fällt sie als «Putzteufel» auf. Kurz nach der Verpflanzung aus dem Krankenhaus in sein neues Zuhause wurde das anomal früh auf «sauber» dressierte Baby rückfällig, und das erfüllte Frau Bartsch mit Ekel.
Bekannte der Familie Bartsch sahen damals, daß das Baby immer wieder Blutergüsse aufwies. Frau Bartsch hatte jedesmal eine neue Erklärung für die häßlichen dunklen Flecken, aber ihre Erklärungen wirkten wenig überzeugend. Mindestens einmal während jener Zeit hat der bedrückte Vater Gerhard Bartsch einem Freund bekannt, daß er eine Scheidung erwäge: «Sie schlägt das Kind so, ich ertrage es einfach nicht mehr.» Ein anderes Mal, als er sich eilig verabschiedete, entschuldigte sich Herr Bartsch mit der Begründung: «Ich muß nach Hause, sonst schlägt sie mir das Kind tot.»
In Anne-Eva Braunecks Buch Allgemeine Kriminologie liest man: «Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Junge schon in seiner Bindungsfähigkeit beeinträchtigt, als er mit elf Monaten zum erstenmal die Gelegenheit zu einer stabilen menschlichen Beziehung bekam; allermindestens mußte dieser letzte Wechsel ihn verstören. Zur Entwicklung seiner Bindungsfähigkeit hätte es darum einer außerordentlich warmherzigen und großzügigen Mutter bedurft, statt einer so eingeengten Frau wie Frau Bartsch, die nicht mehr jung war, nie eigene Kinder gehabt hatte, sich für kinderlieb hielt, weil sie sich in einen Engel verliebt hatte, und einen schweren Schock erlitt, als er sich als kleines Menschentier mit einem lebhaft tätigen Unterleib entpuppte. Dies Erlebnis war für Frau Bartsch vermutlich eine wirkliche Bedrohung.»
Aus der Perspektive des Psychoanalytikers schreibt Franz Alexander: «Das erste Verbrechen, das alle Menschen ausnahmslos begehen, ist die Übertretung der Reinlichkeitsgebote. Und unter dieser Herrschaft der Kriminaljustiz der Kinderstube lernt der Mensch die Repressalien der Umwelt gegen seine ursprünglichen Triebregungen zum ersten Male kennen. Mit Recht spricht Ferenczi von der Sphinktermoral als dem Anfang und der Grundlage jeglicher Moral. Für gewisse unzugängliche Kriminelle, die in einer trotzigen Ablehnung der Sozietät verharren, könnte das Vorbild ein auf seinem Töpfchen thronendes Baby sein, das allen Beeinflussungen einen unzugänglichen Widerstand entgegensetzt und triumphierend sich in dieser souveränen Situation dem Erwachsenen überlegen fühlt. In dem Augenblick, wo das Kind zum ersten Male die Hemmungstätigkeit seines Sphinkters selbständig vornimmt, hat es den ersten entscheidenden Schritt zur Anpassung an die Umwelt getan. Es hat in einem Teil seiner Persönlichkeit eine Hemmungsinstanz aufgerichtet, die von dem übrigen Teil seiner Persönlichkeit verlangt, was bisher die Außenwelt von ihm verlangt hat… Auch Störungen dieses Anpassungsvorganges können die Grundlage für Störungen in der echten sozialen Anpassung werden, da diese Reinlichkeitsdressur für spätere Triebeinschränkungen vorbildlich wird.»
«Die von Freud, Jones und Abraham beschriebenen analen Charakterzüge enthalten in ihren Übertreibungen einen großen Teil der dissozialen und kriminellen Eigenschaften. Der Ausdauer und Beharrlichkeit, diesen Sublimierungsergebnissen des infantilen analen Trotzes entspricht in ihren asozialen Übertreibungen die starrsinnige Verbohrtheit mancher Rechtsbrecher. Der Eigensinn des analen Charakters steigert sich bei den meisten Kriminellen zu selbstherrlichem, unzugänglichem Trotz gegenüber der gesamten Menschheit.»
Schon in Jürgens ersten Briefen an seinen Verteidiger Heinz Möller findet man einen ganzen Schwall bedeutungsvollen Materials. Möller erzählte mir einmal, es sei ihm – dem Vater von vier Kindern – nicht leichtgefallen, einen solchen Mandanten zu verteidigen («Die Entscheidung hat mich auch manche Träne gekostet»), aber mit der Zeit entwickelte sich zwischen ihm und Jürgen eine ungezwungene, starke Bindung. Jürgen mochte ihn und betrachtete ihn als zuverlässigen Freund. Zu Beginn des Prozesses haben es einige Reporter als Verteidigungstaktik gemeldet, daß Möller seinen Mandanten mit dem Vornamen ansprach und ihn duzte. In der Tat war es ein authentisches Zeichen der Unreife des Neunzehnjährigen, daß er innerhalb der ersten Minuten seinen Anwalt gebeten hatte, ihn zu duzen. Am 2.Juli 1967 hat er in einem Brief an Möller erwähnt, daß sogar der Staatsanwalt Körner ihn duzte. In Möller fand Jürgen endlich, nach so vielen Jahren, einen sympathischen Freund, dem er alles, ohne Vorbehalt, erzählen konnte.
Am 14.September 1966 erhielt Heinz Möller den ersten Brief von Jürgen. Er schrieb äußerst sorgfältig, in einer auffallend «korrekten» Schuljungenhandschrift, wesentlich größer als in den späteren Briefen an mich, und die vielen Ausrufezeichen verkünden seinen inneren Zustand.
Schon in diesem ersten Brief kommen mehrere wichtige Themen zum Vorschein, die man aber zum damaligen Zeitpunkt, da sie von einem geständigen vierfachen Kindermörder kamen, äußerst skeptisch betrachtete. Ohne die Tatsachen zu kennen, haben ihn viele Zeitungsleser als «undankbares Kind» abgetan. Das wichtigste Thema aber findet man in der Behauptung, die Jürgen noch oft wiederholen wird, daß seine Eltern – egal, wie sie ihn behandelten, egal, was sie ihm antaten – ihn trotzdem liebten. Schon in den ersten Sätzen des allerersten Briefes sagt er, wie sehr seine Eltern ihn lieben, obwohl sie das «nicht zeigen können».
Viele neurotische Kinder können sich buchstäblich nicht vorstellen, daß ihre Eltern sie nicht lieben, denn ein Kind kann nicht begreifen, daß in materiellen Aufmerksamkeiten, und seien sie noch so üppig, nicht Liebe zum Ausdruck kommt, sondern oftmals gerade der Mangel an Liebe in der Gestalt von Schuldgefühlen. Fast jedes Kind, auch das mißhandelte, findet es schier unmöglich, die Tatsache anzuerkennen, daß seine Eltern es nicht lieben. Die bloße Möglichkeit erschreckt so tief, daß Kinder sie energisch ablehnen, weil sie einfach nicht wahr sein darf. Für ein Kind ist das ja das Furchtbarste, was es auf der Welt geben kann, und in jeder Lebenslage, auch in der schlimmsten, muß das Kind, um zu überleben, mit halbwegs plausiblen Erklärungen sich vom Gegenteil überzeugen, um diese schrecklichste und unerträglichste aller Wahrheiten abzuwehren.
Wuppertal, Sept. 1966
Lieber Herr Möller!
Da ich nun Ihre Adresse habe, kann ich mich endlich einmal dazu aufraffen, Ihnen zu schreiben!
Wie ich es mir dachte (wir sprachen auch schon andeutungsweise darüber), sagten meine Eltern, sie hätten alles für mich getan. Dies gilt allerdings nur für die materielle Seite, das muß ich sagen, wenn ich ganz ehrlich sein will! Das soll nun wiederum nicht heißen, daß meine Eltern mich nicht geliebt hätten. Denn dann wäre ihre jetzige Haltung vollkommen unsinnig. Nur eines ist eine unumgängliche Tatsache:
«Es ist mir nicht bewiesen, bzw. gezeigt worden».
Nun weiß ich sehr gut, daß Sympathie, wenn sie übermäßig zur Schau getragen wird, sehr affig, ja peinlich wirkt. Doch wäre das «zuviel» trotzdem das kleinere Übel gewesen! Das «zuwenig», oder «überhaupt nicht», ist viel schlimmer! Ich muß es Ihnen einmal ganz deutlich sagen: Ein Filmapparat, ein Radio, Plattenspieler, viele Bücher, kostspielige Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten, Fahrrad usw., sind allein noch keine Liebe! Das Gefühl einer Zuneigung, das man für jemand empfindet, kann man nicht allein auf derartige «Zuwendungen» abwälzen. Das soll kein Undank sein, sondern nur eine nüchterne Feststellung! Liebe will erkannt sein.
Sie will ausgedrückt sein in ein paar guten, lieben Worten und Gesten. Diese einzigen, wirklichen Beweise habe ich bei meiner Mutter nur äußerst selten und von meinem Vater, ich muß es leider sagen, gar nicht, erhalten. Wir alle wissen es: Ein Kind braucht Liebe! Einem Kind nutzt keine Liebe, die tief im verborgenen blüht und manchmal recht seltsame Blüten treibt. Nein, sie muß für das Kind vor allem spürbar sein. Schon als kleiner Junge wußte ich um diese Dinge, und das Fehlen des wirklichen Geborgenseins hat mir immer sehr weh getan. Sie wissen, daß ich mich größtenteils zu Hause aufhalten mußte! Was aber erwartete mich dort? Krach zwischen meinen Eltern. Wenn es mal zwei Tage ohne abging, war das schon viel! Krach, weil ich angeblich zu viel fernsah! Aus diesem Grunde habe ich in den letzten Monaten kaum noch ferngesehen. Krach, wenn mein Vater mich im Laden vor Kunden wieder mal «den Dösigen» genannt hatte, und ich mich aus verständlichen Gründen dagegen auflehnte. Krach, wenn ich eine viertel Stunde zu spät nach Hause kam. Krach, wenn ich mal in’s Kino wollte! Dazu kam natürlich mein Unbehagen, daß meine Mutter mich in meinem Alter noch badete, und u.a. nicht zuließ, daß ich mir ein Wäschestück zum Anziehen oder ein paar Schuhe selbst zurechtlegte. Daraus folgte dann ein Krach mit meinem Vater, der behauptete, ich könne mich in meinem Alter noch nicht allein anziehen.
Dazu kam, daß wir nie Besuch hatten. Warum? Mein Vater konnte sich nie beherrschen, und mußte seine Frau und mich jedesmal vor dem Besuch regelrecht «mies» machen! Ist sowas schon dagewesen? Aber es war so. Die Folge: Meine Mutter und ich verzichteten auf Besuche, außerdem kam sowieso keiner mehr! Eine Familie ganz ohne gesellschaftliche oder freundschaftliche Verbindungen! Und der Sohn fast immer gezwungen, mit den äußerst schlechtgelaunten Eltern zusammen zu sein, also quasi in einem Gefängnis! Können Sie sich etwas Einsameres vorstellen? Und praktisch jeden Sonntag mußte ich mit nach meiner Oma fahren! Der Sonntagsnachmittag in Werden spielte sich in der Regel so ab: Vater (liest mürrisch Zeitung), Mutter (redet ununterbrochen auf die Oma ein, und zum Unglück noch jeden Sonntag dasselbe), Jürgen (sitzt in einer Ecke und kämpft manchmal mit den Tränen der Verzweiflung). Ich habe meine Oma immer sehr gern gehabt, das wissen Sie ja, aber was zuviel ist, ist zuviel. Über das Biertrinken und das Ausgehen, falls man das in meinem Fall nicht allenfalls mit «Luftschnappen» bezeichnen muß, haben wir ja schon gesprochen. Mit wem ich zusammen sein dürfte, wenn ich mal draußen war, wurde mir von meiner Mutter vordiktiert. Mindestens die Hälfte aller Jungen und Mädchen waren «kein Umgang für mich». Mein herzliches Verhältnis zu allen Angestellten wurde mir vorgeworfen. Zum Beispiel konnte mein Vater nicht verstehen, daß ich nicht den «gebührenden Abstand wahrte». Solche Äußerungen konnten mich wirklich auf die Palme bringen. So z.B. auch, daß er behauptete, die Kinder der Putzfrau «fräßen sich bei ihm durch». Von dem, was die beiden Kinder aßen, ist er gewiß nicht ärmer geworden! Sie sehen, manchmal grenzten die Redensarten, die ich zu hören bekam, hart an Gehässigkeit. Und für dergleichen war ich absolut nicht zu haben. Was mir dann natürlich auch prompt wieder Krach einbrachte!
Wie Sie sich denken können, kann in einem solchen Betriebsu. Familienklima keine Häuslichkeit, Geborgenheit oder gar ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufkommen. Auch kein, was wichtig ist, Vertrauen!!!
Und sollte wieder mal jemand kommen und behaupten: «Der hat ja
alles
gehabt!»………………,
So täte man gut daran, mich festzuhalten!!!
Ihr sehr ergebener «Junger Rechtsfreund» Jürgen Bartsch
***
13.9.66
… In meinen Briefen an meine Eltern habe ich, so gut ich es konnte, und soweit, wie es eben noch einem normalen Menschen zumutbar ist, «ausgepackt». Über die Beweggründe, verstehen Sie? Lassen Sie sich die Briefe doch ruhig einmal zeigen. Ich habe in ihnen auch, soweit ich es vermag, meine innere Einstellung zu allem Geschehenen erklärt. Klar genug, wie ich glaube.
«Seine Tränen kommen zu spät», schrieb Der Mittag; nur weiß der elende Schmierfink nichts von all den Tränen, die ich schon vorher vor Reue und Verzweiflung geweint hatte. Sie hätten sie sehen sollen, als sie mit bald hundert Mann vor mir standen und riefen: «Blaß geworden, Junge!» «Jetzt aber schön die Handschellen hoch!» «Aber nicht doch, Junge, nicht so ein Gesicht, lächeln, lächeln!» So gut ich die Empörung in der Allgemeinheit verstehen konnte und kann, so wenig vermag ich diese Menschen zu verstehen. Wenn auch ich als letzter das Recht habe, jemanden zu kritisieren, so sind doch Leute, die mit Entsetzen Scherz treiben, für mich keine Menschen, sondern Hyänen.
Du lieber Gott, es tat und tut mir doch so leid! Ich darf gar nicht zuviel an die armen Würmer denken, das ist nicht gut. Warum denn? Warum? Hatte mich meine Veranlagung so richtig in ihren Fängen, war eben alles aus, da gab es kein Entgegenstellen oder gar einen eigenen Willen! Und weil ich Kinder eigentlich immer so gern hatte, bin ich natürlich mit der Zeit seelisch vollkommen kaputtgegangen. Zum Schluß durfte mich doch bald keiner mehr ansprechen, dann ging ich schon in die Luft. «Reaktion» nennt man das wohl. Ich hatte eben, grob gesagt, keine Gewalt über diesen verdammten Trieb, der auch nicht nur einer war, sondern aus mehreren bestand. Und manches gibt es da noch, das ich beim besten Willen nur einem Arzt sagen kann und werde!
Und nun habe ich also mein «Päckchen», das ich mein Leben lang zu tragen habe. Wie lange aber, so frage ich, hält das ein Mensch aus, der trotz allem sein Herz und sein Gewissen nicht verloren hat?
***
Eine einmalige, nämlich eine gute Rolle in Jürgens Leben spielte die Schwester seines Adoptivvaters, seine Tante Maria-Theresia, die er Tante Marthea nannte. Sie war es, die sich von einer befreundeten Ärztin ein kleines Aufklärungsbuch empfehlen ließ, das Buch kaufte und es ihrer Schwägerin für Jürgen schenkte, als er in die Pubertät kam.
Ich darf diese bewunderungswürdige, herzensgute Frau immer noch nicht beim Namen nennen: Ihrer Tochter ist es lieber, ihre Verwandtschaft mit dem Kindesmörder zu verheimlichen. Diese Tante hat den Mut aufgebracht, im zweiten Prozeß gegen Jürgen als wichtige, von der Familie Bartsch als die einzige Zeugin auszusagen. Das hat sie auch einiges gekostet. Im August 1988 schrieb sie mir:
«Von meinem Bruder und seiner Frau bin ich nicht im ‹Bilde›, wie man so genau sagt. Wie meine Schwägerin erzählt, bin ich eine ‹schlimme› Frau, die Jürgen nur aushorchte, um es weiterzuerzählen. Aber ich lebe auch so gut und in meinem Frieden. Man muß eben auch Gutmütigkeit ‹bezahlen›. Sie wissen, wie ich zu Jürgen stand. Bei Ihnen brauche ich mich nicht reinzuwaschen.»
Im Oktober 1966 schrieb Jürgen an seine geliebte Tante Marthea:
«Ja, oft war ich bei Euch! Und sehr gern. Ihr konntet es gar nicht merken, denn da war nichts, was meinen Trieb angeregt hätte. Nur ein paarmal war es schwer für mich, als der kleine H. da war. Und ich war damals sehr froh, daß ich nie mit ihm allein war. Auf ihn sprach mein Trieb nämlich ziemlich an. Das ändert nichts an der Tatsache, daß ich ihn sehr gern hatte. Ich habe überhaupt Kinder eigentlich sehr gern! Klingt das absurd? Auf den ersten Blick sicher. Doch natürliche Kinderliebe ist eine Sache und Triebhaftigkeit eine andere. Nicht jeder wird es mir glauben, vielleicht niemand außer Dir und meinen Eltern, aber ich denke sehr viel an die Kinder und auch an die Eltern der Kinder. Ich habe das Gefühl, daß das meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist. Gewiß, ändern kann man nun nichts mehr! Doch wenn einem die Lebenden nie verzeihen können, vielleicht können es die Toten.
So viele Leute haben mich gefragt, was ich denn nun denke, was werden soll. Ich habe darauf nichts gesagt. Ich habe einen solchen Haß auf mich selbst entwickelt, daß ich diese Frage gar nicht stelle. Ich finde, ich habe es nicht verdient, daß nochmal irgendwann etwas ‹aus mir werden› sollte.
‹Du bist doch noch so jung!›, sagen sie.
Ja, um Himmels willen waren die Kleinen denn nicht erst recht jung? Es klingt so hoffnungslos, wie ich bin: Ich erwarte vom Leben nichts mehr!
O ja, einen Wunsch habe ich doch, einen großen sogar! Einmal noch möchte ich etwas für Kinder tun! Ob es jemals erfüllt wird? Entschuldige bitte, aber ich kann jetzt nicht mehr, ich muß schleunigst etwas rauchen und lesen.»
***
Am 4.November 1966 an Heinz Möller:
Es war eben so, daß ich innerlich vollkommen gespalten war und es heute noch bin. Mein eigentliches Wesen und meine «Krankheit» waren wirklich zwei ganz verschiedene Dinge. Ich konnte mich selbst nicht verstehen und wußte doch genau, daß es bis zum bitteren Ende weitergehen würde, daß es niemals ein Zurück von meinem Trieb geben würde. Genau wußte ich, daß es eines Tages keine Rettung mehr geben würde, kein Pardon. Abgesehen davon, daß man bei uns zu Hause (traurig, aber wahr!) sowieso nie feiern konnte, konnte ich auch in mir selbst nicht das geringste feierliche Gefühl entdecken. Sicher, woher auch noch? Weihnachten war es immer besonders schlimm, ich dachte an andere Dinge, nicht nur Weihnachten. An Dinge, die mir niemals aus dem Sinne gehen werden. An das Haus in der Herwarthstraße, das ich sogar aufgesucht hatte, ich weiß bis heute nicht warum. Ich suchte auch, bis ich den Namen «Jung» an einer Klingel fand. Dann sah ich an dem Haus hoch und sah den Vater aus dem Fenster schauen. Woher ich das wußte? Darauf gibt es eine einfache und klare Antwort: Man konnte es sehen! Ich dachte an das Haus in Gelsenkirchen, das Elternhaus von Peter Fuchs. Es war das Haus, in dem bis zum 21.6., bis zum Tage meiner Festnahme, keine Tür je abgeschlossen wurde! Das war der arme Junge, den ich auf dem Rückweg aus den Ferien aufgriff. Ohne Umschweife: Ich sah sofort, daß der Kleine sich in Essen verlaufen hatte und nicht wußte, wohin er sich wenden sollte. Ich nutzte das sofort aus. Der Junge hatte seit morgens nichts gegessen, und ich sehe noch heute sein vor Glück strahlendes Gesicht vor mir, als ich ihm meine Hilfe anbot.
Das hätte mich doch um Himmels willen rühren müssen? Das sage ich mir heute und das sagte ich mir damals! Doch in dem Stadium konnte mich nichts mehr halten, nichts mehr erbarmen. Man konnte mich dann (und das ist mein Ernst) nur noch mit einem Raubtier vergleichen, das sein Opfer schon in den Fängen hat. Solch ein Raubtier stirbt eher, als es seine Beute freigibt. Auch ich wäre in der Zeit eher gestorben, als auch nur einen Schritt zurück zu tun! Etwas ganz Anderes war es, wenn ich hinterher daran dachte, ja dann war ich mir bewußt, was ich war, und nannte mich auch so. Doch wehe, wenn ich dann wieder durch die Straße fuhr und Jungen sah. Dann war es aus mit der Reue, mit dem Schmerz, ja mit dem Mitleid und dem Weinen. Es war furchtbares Weinen, denn es war sinnlos. Denn es konnte weder den Kindern noch mir helfen. Ja, es war sinnlos, doch es tat weher, viel weher als normales Weinen, denn ich war mir der grausamen Tatsache gewiß, daß ein Teil der Tränen im voraus gegossen wurde. Ja, so war es wirklich. Und ich mußte mich zwingen, nicht daran zu denken, daß der Vater des Peter Fuchs für die Rückkehr seines Jungen den langersehnten Fußball und auch Fußballschuhe gekauft hätte. Doch wer ein Gewissen und ein Herz hat, solange er normal denken kann, der kann sich dem nicht verschließen!
Ja, ich sah den kleinen Ulrich im Auto neben mir sitzen, und ich hörte ihn sagen, «Nein, ich will kein Geld von Ihnen haben, bestimmt nicht, Sie haben doch auf der Kirmes schon so viel für mich ausgegeben!» Und das Furchtbarste: die letzte Minute des kleinen elfjährigen Manfred. Wie er die Augen noch einmal aufschlägt und mich fragt, ja mich fragt, ohne Haß, ohne Schmerz und ohne Angst, und ich lese in diesen Augen und finde das darin, das ich nie, niemals begreifen werde: Verzeihung, ja sogar Mitleid mit mir! Und das bestätigt seine schwache Frage: «Kommst du jetzt hinter Gitter?» Dann ist es aus.
Ich weiß nur noch, daß ich mich auf die Steine geworfen habe und geheult wie ein Schloßhund. Wie lange? Genau weiß ich das nicht. Weinen Sie jetzt? Ich auch. Wissen Sie, wenn ich nicht von meinem Trieb beherrscht bin (was ja immer auch hier nicht aufgehört hat), ertappe ich mich immer dabei, daß ich mir sehnlichst wünsche, mit den Kindern sprechen zu können, sie um Verzeihung zu bitten. Doch das habe ich mir für ewig selbst verdorben. Und das peinigt mich von Tag zu Tag und das wird nie aufhören. Ich würde so gern den einzigen Jungen, der noch lebt, nicht um Gnade, sondern um Verzeihung bitten. Doch auch das muß ich mir versagen. Du lieber Himmel, wie würde es ausgelegt werden!
***
22.11.1966
Das Endergebnis (der eigene unterdrückte Wille) rührt nicht daher, daß der betreffende Mensch sich «gehen gelassen» hat, sondern einfach daher, daß es etwas gab, das stärker war! Also gibt es scheinbar doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen läßt. Woher ich dies alles so genau weiß? Man darf es mir glauben, aus trauriger Erfahrung! Und noch etwas kann ich Ihnen guten Gewissens versichern: Niemals habe ich mich «gehen lassen», nicht einmal! Denn ich bin immer gegangen worden!
Nutzt mir der Wille gar nichts? «Das sei ferne», um es einmal mit Paulus zu sagen: Der Wille kann in diesen Fällen, den scheinbar aussichtslosen Situationen, noch viel vollbringen! Nur: In solch schweren Fällen muß dieser gute Wille mit ärztlicher Hilfe gekoppelt werden, denn er alleine schafft’s nicht. Nicht, wenn die Seuche solchen Umfang angenommen hat!
Heilung wäre vonnöten, denn ich bin krank, krank und nochmals krank!!!
Das mußte gesagt werden, verstehen Sie, denn ich glaube, man darf eine richtige, ja sogar teuflische Krankheit nicht allein mit Willensschwäche abtun.
Am guten Willen fehlt’s mir doch wirklich nicht.
Die Ärzte sind für mich die letzte Hoffnung. Doch hat das noch gute Weile, wenn überhaupt, denn wir dürfen nicht vergessen, daß diese für mich wirklich lebenswichtige Entscheidung von anderen Leuten abhängen wird.
Schauen Sie mal, ich will wirklich nichts beschönigen; doch habe ich mit Erschrecken in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, wie gefährlich einfach es sich viele Leute machen, über diese Verbrechen sich eine Meinung zu schaffen. Doch noch eine Frage wird ewig offen bleiben, daran ändert alle Schuld nichts: Warum muß es überhaupt Menschen geben, die so sind? Sind damit meist geboren? Lieber Gott, was haben sie vor ihrer Geburt verbrochen?
***
13.12.1966
Ich habe nicht die Absicht, in diesem Brief «irgend jemandem» Vorwürfe zu machen. Sollten doch welche auftauchen, so ergeben sie sich allein aus den Tatsachen.
Warum die Angst, von der ich schrieb? Nicht so sehr vor der Beichte, als vor den anderen Kindern. Sie wissen ja nicht, daß ich der Prügelknabe der ersten Klasse war, was sie alles mit mir angestellt haben. Wehren? Tun Sie das mal, wenn Sie der Kleinste in der Klasse sind! Ich konnte vor Angst in der Schule nicht singen und auch nicht turnen! Ein paar Gründe dafür: Klassenkameraden, die außerhalb der Schulzeit nicht gesehen werden, werden nicht anerkannt, nach der Parole: «Der hat’s wohl nicht nötig!» Ob er aber nicht will oder nicht kann, darin machen die Kinder keinen Unterschied. Ich konnte nicht. Paar Tage nachmittags bei meinem Lehrer Herrn Hünnemeier, paar Tage in Werden bei meiner Oma auf dem Boden geschlafen, restliche Tage nachmittags in Katernberg im Laden. Endergebnis: überall und nirgends zu Hause, keine Kameraden, keine Freunde, weil man niemanden kennt. Das sind die Hauptgründe, doch kommt noch etwas Wichtiges hinzu: bis zum Schulanfang eingesperrt fast ausschließlich in dem alten Gefängnis unter Tage, mit den vergitterten Fenstern und mit Kunstlicht. Drei Meter hohe Mauer, alles da. Man darf nur an der Hand der Oma raus, mit keinem anderen kleinen Kind spielen. Sechs Jahre nicht. Man könnte sich ja dreckig machen, «und außerdem ist der und der nichts für dich!» Bleibt man also ergeben darin, aber drin ist man nur im Wege und wird von einer Ecke in die andere gestoßen, kriegt Schläge, wenn man sie nicht verdient hat, und keine, wenn man sie verdient hat. Die Eltern haben keine Zeit. Vor dem Vater hat man Angst, weil er sofort schreit, und die Mutter war damals schon hysterisch. Vor allem aber: Kein Kontakt zu Gleichaltrigen, weil, wie gesagt, verboten! Wie also sich einordnen? Die Schüchternheit austreiben, was mir beim Spiel geschehen kann? Nach sechs Jahren ist es zu spät!
Dann Internate. Zwei Jahre keine Mädchen gesehen. In der Küche von Aulhausen arbeiteten Mädchen, die haben wir nie gesehen! Dauernde Predigten: «Wenn wir zwei dabei erwischen, dann fliegen sie!» Es waren damit allerdings nun Jungen gemeint! Aber kann es etwas Schwereres geben, als das nicht zu tun, was die Lehrer verbieten? Na also! Sie erreichten also genau das Gegenteil von dem, was sie wollten.
Doch zurück zu den «Frauen»: Einmal gab in der Turnhalle eine Artistengruppe ein Gastspiel. Da waren Mädchen in leichter Kleidung bei. Der Priester, der neben mir saß, bekam einen roten Kopf, sagte «Jesus, Maria!» und hielt sich das Gebetsbuch vors Gesicht. Das wirkte auf uns Kinder damals natürlich anders als heute. Und bei manchen grub es sich ein. Nun ja, wenn man mal eine Methode zur Züchtung von Homosexualität sucht, werde ich Aulhausen vorschlagen. Sicher, sie wollten das Beste. Doch manchmal erreicht man das Gegenteil.
Es soll niemand sagen, daß ich mich nicht um Freunde bemüht hätte. Ich sehnte mich mit ganzem Herzen danach und konnte nie jemanden finden. Hatte ich mal jemanden, wurde ich nur ausgenutzt. Ich suchte immer Liebe, Wärme, und fand sie nicht. Zu Hause? Sicher, Sie brauchen mir nicht zu sagen, wie sehr mich meine Eltern liebten und lieben. Aber, und das müßten Sie auch wissen, ich merkte nichts davon, zu spüren war da nichts. Also suchte ich diese Wärme, diese Geborgenheit darin, wenigstens einen Freund zu finden. Und suchte vergebens.
Sicher, auch ich habe später, als es gar nicht klappen wollte, viel falsch gemacht. Hatte ich mal kurz jemanden, beanspruchte ich ihn ganz für mich. Aber woher? Weil ich mich mit der Kraft der Verzweiflung an diesen einen klammerte, denn kein anderer Klassenkamerad wollte etwas mit mir zu tun haben. Zum Schluß kam, unausbleiblich, die Resignation: «Dich will ja niemand haben!» Und, es ist zwar nicht bewußt, doch halte ich es für möglich, daß sich die Liebe, die aufrichtige Zuneigung, die ich immer, mein ganzes Leben lang, für Schulkameraden empfand, innerlich, und von mir nicht direkt bemerkt, in das genaue Gegenteil verwandelte. Ersparen Sie mir das Wort!
Also nicht nur sexuell? Nein, vielleicht nicht nur. So kann es gewesen sein, so vermute ich es nach vielem Nachdenken. Ja, ich habe sie sehr geliebt, die Kinder, die damals meine Kameraden waren. Und ich liebe auch heute noch Kinder sehr. Denn das, das Furchtbare, was geschehen ist, und das können Sie mir glauben, das kam nicht von meiner Seele. Nein, aus der Seele nicht! Denn sie ist nicht mit mir groß geworden. Sie ist hübsch klein geblieben.
Die Mimose, dies empfindliche Ding, welkt, wenn keine Sonne sie bescheint, denn schließlich ist sie ja eine Mimose. Kann sie etwas dafür? Eine solche Blume konnte in meinem Elternhaus nicht wachsen.
Und es nagt und nagt immer weiter an dieser kleinen Seele, die nie größer wird, weil die Liebe, die in ihr wohnte, niemals diejenigen erreichen konnte, denen sie, ach so lange schon, galt. Und wird diese Liebe nie, niemals Nahrung finden, so wird sie sterben, so muß sie sterben. Und dann stirbt auch die kleine Seele, die von Schmerzen verkümmerte Seele, weil die große und doch zärtliche Liebe, die in ihr wohnte, nie, niemals diejenigen erreichen konnte, denen sie galt.
Den Freunden, die es nicht gab;
Den Kameraden, die es nicht gab;
Den Kindern!
Gewiß, die vier Kinder sind tot, daran kann auch die kleine Seele nichts ändern. Sie würde es ja so gerne tun, zumal sie genau weiß, daß das Furchtbare nicht ihr Werk war. Denn sie war immer nur voll Liebe, voll zärtlicher, unerwiderter Liebe. Sie hat einen aussichtslosen Kampf gekämpft, von Anfang an. Sie hat nie aufgegeben, obwohl sie dazu Grund genug gehabt hätte. Und sie wird nie aufgeben, das Teuflische, nämlich die Krankheit, die in mir sitzt, zu bekämpfen. Doch wenn ihr dabei nicht ein ganz klein bißchen wenigstens unter die Arme gegriffen wird, steht sie auf verlorenen Posten. Doch aufgeben, nein, das wird sie nicht und das kann sie nicht, da sie ja nur aus dieser Liebe besteht. Doch hat sie ihren Kampf nicht schon verloren? Denn dann ist sie zum Tode verurteilt, und niemand kann ihr mehr helfen.
Bitte, bitte, kann ihr denn wirklich niemand helfen?
***
Januar 1967
Ich war nicht in allem ein Feigling, und ein solcher wäre ich gewesen, hätte ich mein Leid irgend jemanden merken lassen. Mag sein, daß das falsch war, doch so dachte ich jedenfalls. Denn jeder Junge hat ja seinen Stolz, das wissen Sie sicher. Nein, ich habe nicht jedesmal geheult, wenn ich Prügel bezog, das fand ich «memmenhaft», und so war ich wenigstens in einem Punkt tapfer, nämlich, meinen Kummer niemand merken zu lassen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, zu wem hätte ich denn gehen, wem mein Herz ausschütten sollen? Meinen Eltern? So gern wir sie haben, müssen wir doch mit Schrecken feststellen, daß sie in dieser Richtung nie, aber auch noch nie, auch nur ein Tausendstelgramm Sinn entwickeln konnten. Konnten sage ich, nicht haben, daran sehen Sie bitte meinen guten Willen! Und, was auch kein Vorwurf ist, sondern eine einfache Tatsache: Ich bin der ernsten Überzeugung, ja, habe es am eigenen Leib erfahren, daß meine Eltern niemals mit Kindern umgehen konnten.
Woher ich das so genau weiß? Weil ich meine Tante [Marthea] kenne, weil ich weiß, wie gut es gehen kann, wenn ein Mensch versteht, ein Kind zu führen, nicht nur zu rügen und zu schlagen und dann bei jeder Gelegenheit noch zu jammern, daß man doch noch «viel zu gut» sei und noch viel zu viel durchgehen ließe. Und noch etwas allen Ernstes: Ein Kind braucht kein Kino und keinen Plattenspieler, aber es braucht etwas Liebe und Verständnis. Und allein Verständnis, so leid es mir tut, war nie, niemals da.
«An anderen geht die gleiche Kindheit, wie ich sie hatte», schreiben Sie, «spurlos vorüber.» Dem kann ich nicht zustimmen. Erstens glaube ich nicht, daß noch irgend jemand «genau so» wie ich aufgewachsen ist, das halte ich für schier unmöglich, wenn ich alles zusammennehme. Und zweitens brauchen wir (ich bitte jetzt schon um Verzeihung) uns nur meinen Vater anzusehen. Ich habe ihn sehr gern, bestimmt, doch gerade darum hat mir manches so weh getan, schon als Kind. Was ist das für ein Mann, der zwar «hart im Leben steht», gut, aber fast kein gutes Wort hat für sein Kind und auch für sonst keinen Menschen? Man kann keinen Besuch einladen, weil er ewig über Frau und Kind herzieht, man kann nirgendwo mit ihm hingehen, weil er immer sooo ein Gesicht macht und jede heitere Stimmung der anderen ihm auf den Magen zu schlagen scheint? Der mit Vorliebe an Geburts- und Feiertagen Streit beginnt? Der am Heiligabend alles verdirbt und die Geschenke nicht anschaut und noch nicht einmal auspackt, die sein Kind ihm gekauft hat? Dafür gibt es für mich keine Erklärung, und das kann nicht allein Schuld von seiner Mutter sein. Das ist nicht normal, und ich bin der Ansicht, daß seine Jugend auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen ist!
***
28.3.1967
In Köln hat mich ein, sogar zwei Gutachter [Dr.Paul Bresser und Prof.Werner Scheid] untersucht. Wir haben uns persönlich sehr gut verstanden (auch heute noch!), doch der Gutachter, der meistens bei mir war, sagte in Köln schon zu mir, daß er noch gar nicht recht wisse, wie mir dann zu helfen sei. Bald danach wurde eine elektrische Hirnstrommessung vorgenommen, mit dem Ergebnis «organisch völlig normal». [Gutachter im zweiten Prozeß sollten das später bestreiten.] Am letzten Tag meines Aufenthaltes in Köln fragte ich den Gutachter, was er von einer Kastration halte. «Gar nichts!», sagte er, «und zwar darum, weil die Beweggründe, die Sie zu den Taten getrieben haben, sozusagen einzig sind.». (Zur Erläuterung: Trieb ist noch lange nicht gleich Trieb!) Dann fragte er mich, was ich vom Jugendgefängnis halten würde. Ich wußte es noch nicht. «In einer Anstalt kann ich mir Sie nicht vorstellen», sagte er und meinte außerdem, daß ich da so gehalten würde, daß ich dann nur vollkommen eingehen würde.





























