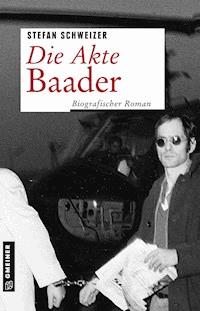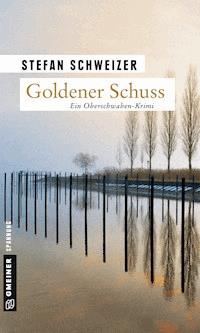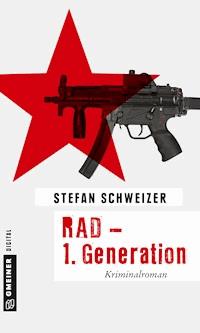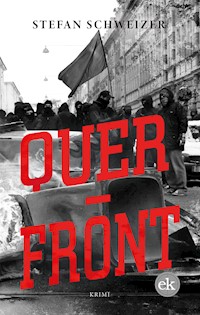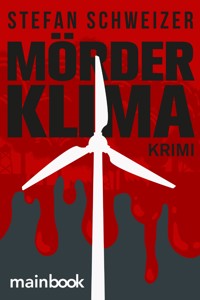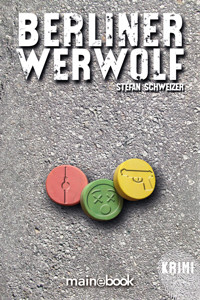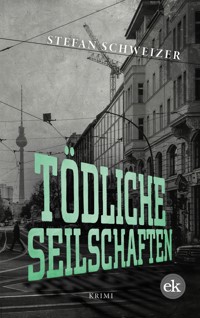Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis mit Privatermittler Hardy
- Sprache: Deutsch
Privatdetektiv Hardy Hacke soll dem schwerreichen US-Unternehmer Owen helfen, seine Tochter Eve zu finden, die in Berlin promoviert. Eve soll bald eine wirtschaftlich wichtige Ehe mit dem Spross einer US-Industriellen-Dynastie eingehen. Doch Eve scheint das libertäre Berlin zu genießen und bleibt verschwunden. Hardy muss bei seiner Suche sowohl in die ihm fremde Welt der Universität eintauchen als auch die Party-Szene der Hauptstadt durchforsten. Welche Rolle spielt eine zwielichtige Sekte bei Eves Verschwinden? Was als einfacher und lukrativer Suchauftrag begann, stellt sich als lebensgefährliche Mission mit etlichen Toten heraus. Ein Muss für alle Fans von zeitgemäßen, knallharten Kriminalromanen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Stefan Schweizer
Kaltes Metall
Krimi
Schweizer, Stefan: Kaltes Metall. Hamburg, edition krimi 2022
1. Auflage 2022ISBN: 978-3-948972-73-8
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.ePub-eBook: 978-3-948972-74-5
Lektorat: Bernhard StäberSatzherstellung: Rebecca Riegel, 3w+p Typesetting Automation ExpertsKorrektorat: Monika Paff, LangenfeldUmschlaggestaltung: Annelie Lamers, HamburgUmschlagmotiv: pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die edition krimi ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,Hermannstal 119k, 22119 Hamburg: https://www.bedey-thoms.de
© edition krimi, Hamburg 2022Alle Rechte vorbehalten.https://www.edition-krimi.deGedruckt in Deutschland
1
Die große Krise war beinahe so plötzlich vorbei, wie sie aus heiterem Himmel gekommen war. In Pandemie-Zeiten, in denen jeder, angestachelt durch Nachrichten und Politik, seinen Arsch zu retten versuchte, bestand offensichtlich recht wenig Bedarf für einen Privatermittler. Dennoch hatte es wenige kleinere Fälle gegeben, und die Maske war mein ständiger Begleiter geworden. Was aber nicht half, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren.
Obwohl die Regierung quasi mit Flugzeugen über Deutschland geflogen war und 100- und 50-Euro-Scheine regnen ließ, hatte ich nicht einmal drei Fuffis aufgefangen. Der Rest landete wie immer bei der Wirtschaft. Wer oder was auch immer das genau war. Die Großkopferten hielten also in der Krise schön ihre Hände auf, während die Kleinen elendiglich verreckten, und die internationalen Börsen verzeichneten Rekordwerte. Ich war aber zu stolz, um die Hände in Richtung Staat zu öffnen – der Staat scherte sich einen Dreck um mich und ich mich um ihn.
Damit befand ich mich im krassen Gegensatz zu vielen Anderen, die im großen Stil ihnen gar nicht zustehende Finanzhilfen abschöpften. Ich wollte aber weder ein Betrüger noch ein Bedürftiger sein. Also half ich mir selbst, über die Runden zu kommen, und wunderte mich über alle, die lieber rumheulten, als ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ob meine Selbsthilfeaktionen alle ganz »astrein« waren, fragen Sie lieber nicht.
Aus dem vorerst Gröbsten waren ich und der Rest der Republik also heraus. Was nicht bedeutete, alles sei auf einen Schlag wieder gut gewesen. Aber immerhin war wieder Land in Sicht und vielleicht demnächst mal ein Urlaub drin ohne tagesaktuelle Zertifikate, jede Menge Nachweise und streng dreinblickende Polizisten. Mein dringendstes Problem war aber zunächst, die nötigen Moneten für den Urlaub herzukriegen.
Mein Blick wanderte begierig Richtung Fensterbrett. Die Pils-Flasche passte haarscharf auf den kleinen Sims, und draußen herrschte typisches Frühlingswetter. Keine besonders stabile Ausgangssituation. Eine Windböe jagte die nächste. Ich war einigermaßen verzweifelt. Die einzige Flasche Bier, die ich nach verzweifeltem Durchsuchen in einem der zahlreichen Umzugskartons gefunden hatte, wies bestenfalls Zimmertemperatur auf, und der Kühlschrank hatte kurz vor meinem Umzug den Geist aufgegeben, was für den Rücken gut, für den Durst aber schlecht war. Falls alles gut lief, knallte die braune Flasche mit dem leckeren Gerstensaft auf den Bürgersteig, explodierte und benetzte am Ende die Hose eines Anzugträgers mit Schaum. Im schlimmsten Fall konnte die Geschichte böse ins Auge gehen, wenn sie auf dem Kopf eines Passanten landete. Dessen war ich mir bewusst.
Aber erstens geht lauwarmes Bier überhaupt nicht, und zweitens birgt das Leben eben gewisse Risiken, die es einzugehen gilt. Dabei war ich mir nicht sicher, wie ein Richter den Sachverhalt einordnen würde. Eine Art Notwehr wegen stechenden Dursts und einer Aversion gegen zu warme Biere kamen sicherlich nur bedingt in Betracht, auch wenn es vielleicht in dieser Hinsicht verständnisvolle Richter gab. Aber wenn ich unter Tränen meine jahrzehntelange Alkoholsucht zugab und mich bei einer Psychologin aufs Sofa legte, wo ich beteuerte, an einem Entzugsprogramm teilzunehmen, konnte ich vielleicht mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Langsam, aber sicher wurde mir das Spiel doch zu gefährlich, denn ich wollte niemanden auf meinem Gewissen haben.
Als ich das Fenster öffnete, schaukelte die Flasche bereits bedenklich, da die Frühlingswinde aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig angebraust kamen. Beherzt griff ich zu und hielt die sich auf den freien Fall vorbereitende Flasche fest. Mit meinem Klappmesser öffnete ich den Kronkorken und gönnte mir einen ersten Schluck meines flüssigen Mittagessens. Der Wärmegrad würde mich nicht umbringen, war aber meilenweit von den idealen 7 °C entfernt.
Das Biermalheur passte irgendwie ins bescheidene Gesamtbild. Das Büro war so groß, dass ich locker eine Minigolfanlage hätte installieren können, um die Nachbarschaft zum Turnier einzuladen. Die einzigen Dinge, die aufgebaut und funktionsbereit waren, bestanden in meinem alten Schreibtisch, meinem Chefsessel und einem orangefarbenen Plastikstuhl, den ich meiner Kundschaft anbieten konnte. Ansonsten verloren sich in den Weiten meines neuen Büros wenige Kisten, die noch jungfräulich dastanden.
Nachdem ich das Bier heruntergewürgt hatte und abwog, ob ein Urlaub oder ein Kühlschrank wichtiger sei, verspürte ich noch weniger Lust als vorher, mich ans Auf- und Ausräumen zu machen. Besondere Bauchschmerzen bereiteten mir zwei nigelnagelneu verpackte IKEA-Pakete, in denen sich Bücher- und Aktenregale befanden. Vielleicht konnte ich für einen Zwanni jemanden von der Straße weg anheuern, der diese verhasste Aufgabe für mich übernahm. Allerdings war ich mir nicht sicher, wie gut Junkies mit schwedischen Aufbaumöbeln zurechtkamen. YouTube-Anleitungen waren zwar eine Zwischenlösung, funktionierten erfahrungsgemäß aber nicht bei allen Zusammensteckmöbeln.
Der Gedanke an zwanzig Euro ließ mich wieder durstig werden, und ich warf der geleerten Bierflasche einen vorwurfsvollen Blick zu. Trotz angestrengter Suche kramte ich in Geldbeutel und Hosentaschen gerade mal 17,47 Euro zusammen. Für heute würde das noch reichen – eine halbe Kiste Bier aus dem Späti, der sich unten im Haus befand, war gesichert. Dabei konnte ich schon einmal zarte Bande zu meinem neuen Nachbarn knüpfen – dem Namensschild zufolge ein Mensch, der aus dem ganz großen Vaterland stammte. Vielleicht musste ich einen russischen Opa erfinden, damit er mir einen Zettel zum Anschreiben gewährte. Denn danach sah es zwangsläufig aus. Meinen Kontostand kannte ich in- und auswendig.
Während ich also in Gedanken damit haderte, warum ich keinem anständigen Beruf nachging und mich als Privatermittler herumschlug, war ich bereits bei der Türe angelangt, um nach unten zu gehen. Immerhin hing bereits mein Firmenschild »Hardy H. Private Ermittlungen« an seinem Platz. Und im Internet war ich auch präsent. Nur dass mein Büro mindestens genauso unaufgeräumt wie mein Seelenzustand war.
2
Alexei war ein Klassetyp, das hatte ich bereits nach den berühmten ersten dreißig Sekunden festgestellt. Wir schienen uns prächtig zu verstehen. Ich kaufte zwei Flaschen Bier einer der besseren Berliner Sorten und kam mir großartig vor, dass ich damit alles für eine gute Umweltbilanz tat und kurze Wege vom Erzeuger zum Verbraucher vorbildlich förderte.
»Nimmst du auch noch mit – auf gute Nachbarschaft!« Kein Zweifel mehr möglich, der Mann war definitiv nicht von hier, denn ein Berliner hätte mir zur Begrüßung erst einmal eine halbe Stunde eine Standpauke über irgendetwas gehalten, um sich danach vorzustellen.
Aber mehr noch, denn mit diesem Spruch hatte mir der Inhaber der Spätis noch zwei weitere Biere »aufs Haus« und eine 0,5-Liter-Flasche Wodka ohne Etikett in die Hände gedrückt. Unser Abschiedslächeln war das zweier Männer, die wussten, dass der jeweils andere kapierte, wie die Welt funktionierte.
Die gut gemeinte Tat brachte mich ein wenig in Nöte, denn wenn ich lauwarmes Bier vermeiden wollte, musste ich die Biere zeitnah trinken. Was eigentlich kein Problem sein sollte. Der Wodka ohne jegliche Aufschrift erzeugte bei mir Fragezeichen im Kopf – entweder war das Wodka at its finest schwarzgebrannt oder aber eine Art Flugbenzin, das manche Russen angeblich gegenüber jeder anderen Form von Alkohol bevorzugten, und das, wie viele behaupteten, aus gutem Grund: Es knallte einfach ohne Ende.
Als ich im vierten Stock angekommen war, herrschte bei mir latente Atemnot. Nun gut, die Treppen würden mich vielleicht körperlich fit halten. Vor der Bürotür stutzte ich. Hatte ich sie tatsächlich einen Spalt weit offen gelassen? Mir war, als ob ich sie geschlossen hätte, aber manchmal traute ich mir selbst nicht über den Weg, und das aus gutem Grund. Kurz überlegte ich, wo Stupsi, mein Revolver, lag. Natürlich einsatzbereit in der Schreibtischschublade. Würde mir also überhaupt nichts nutzen.
Notgedrungen klemmte ich die vier Bierflaschen unter den linken Arm und hielt den Wodka am oberen Flaschenhals in der Rechten. Mir fielen eine Zillion von Rechnungen ein, die ich aus Sicht der anderen vielleicht noch offen hatte: angefangen beim Innensenator über Ex-Stasi-Topagenten bis hin zu Clanmitgliedern. Wer auch immer mich erwartete, würde die Wucht russischen Wodkas zu spüren bekommen. Im Notfall konnte ich mein angezündetes Zippo-Feuerzeug hinterherwerfen – ein Molotow-Cocktail vom Feinsten. Dann würde der Angreifer sich in eine brennende Fackel verwandeln, die ich immer noch mit Bier zu löschen versuchen konnte.
Leise öffnete ich die Türe, doch sie ächzte bei jedem Millimeter, sodass auch ein Schwerhöriger zusammengeschreckt wäre. Ich will nicht sagen, dass mein Puls Rekordgeschwindigkeit anpeilte, aber mir ging die Muffe. Allerdings umsonst.
Denn über der Rückenlehne meines Besucherstuhls erblickte ich einen gigantischen Schädel mit grau melierter Tonsur. Langsam drehte sich der riesige Kopf in meine Richtung und offenbarte ein hageres Gesicht mit einem schwarzen Brillengestell auf der Nase.
Der Mann, der in feinem Zwirn steckte, hatte auf den ersten Blick geschätzt die fünfzig Jahre bereits überschritten, was sich nicht zuletzt an den vielen Falten auf der Stirn und um die Augenpartie herum zeigte. Er schien unentschlossen, was er tun sollte. Aufspringen, um mir beim Tragen meines kostbaren Guts zu helfen? Oder gar mir entgegenlaufen, um mir eine Hand hinzustrecken, wobei entweder Bier oder Wodka zwangsläufig auf der Strecke bleiben mussten?
Zum Glück wendete er den Kopf wieder zurück in seine Ausgangsposition. Ich umrundete möglichst leichtfüßig den Schreibtisch und stellte die Alkoholika ein wenig verschämt an die Seite, doch die Augen des Mannes hafteten auf den Flaschen, als ob es sich um Striptease-Tänzerinnen handelte. So groß, wie seine Augen wurden, hatte ich beinahe Angst, mein soeben erworbenes Gut wieder zu verlieren, oder aber, dass er es nehmen und auf dem Boden zerschmettern würde.
Aber nichts dergleichen geschah, denn er erhob sich von seinem Platz, und ich bewunderte einen schwarzen Anzug, der sicherlich mehr als mein durchschnittliches Monatseinkommen gekostet hatte. Unter dem Anzug trug er ein lilafarbenes Hemd, das sich mit dem Orange meines Sessels biss. Bevor er ein Wort sagte, reichte er einen dünnen Arm über den Schreibtisch, und seine schlanke Hand deutete in meine Richtung. Ich ergriff sie. Wir schüttelten uns die Hände. Auf einer Skala von eins bis zehn war sein Händedruck maximal eine 5,5, aber ich ließ mich nicht täuschen, denn seine blaugrauen Augen musterten mich eingehend.
»Hardy Hacke, Privatermittler. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?«
Meine zackige Vorstellung schien ihm zu imponieren, denn seine blutleeren, äußerst dünnen Lippen formten sich zu etwas, das man mit etwas Wohlwollen als Lächeln hätte bezeichnen können.
»Moses Owen. Unternehmer aus Pittsburgh, USA.«
Zwar war der US-amerikanische Akzent unüberhörbar, aber sein durchaus gutes Deutsch überraschte mich. Wir versicherten uns, wie sehr wir uns freuten, gegenseitige Bekanntschaft zu machen.
»Sie sind gerade umgezogen?«
Seine Frage klang wie eine Feststellung. Ich zuckte mit den Schultern.
»Ja, gerade erst gestern«, log ich. Dass die Kisten über eine Woche lang müßig in dem Raum lagerten, musste ich ihm nicht unbedingt unter die Nase reiben.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, wiederholte ich meine Frage und deutete gleichzeitig einladend auf die Bierflaschen und den einsamen Wodka.
Owen sah mich an, als ob ich der Teufel in Person wäre, und hüstelte. Als er »Ich trinke nie« sagte, fragte ich mich, ob ich es mit einem trockenen Alkoholiker oder einer Spaßbremse auf Europareise zu tun hatte. Obwohl ich die noch vorhandene Kälte des Biers ausnutzen wollte, ließ ich es stehen, um es mir nicht mit einem potenziellen Kunden zu verderben. Für Geld machte sich schließlich jeder zur Prostituierten, und ich war einfach eine billige Miethure, die für ein paar Scheine in jedem Drecksloch des Universums herumschnüffelte.
»Also, was kann ich für Sie tun?«
Diese Frageformulierung gefiel ihm. Aus der Art, wie er selbstbewusst in dem Sessel saß, mich musterte und den Dingen vorläufig ihren Lauf ließ, vermutete ich, dass er Old-School-Unternehmer war.
»Im Internet habe ich Ihre Anzeige gesehen: ›Wer suchet, der findet.‹ Dieses Wort von Jesus, unserem Herrn, hat mich dazu gebracht, Sie und nicht einen Ihrer Kollegen aufzusuchen.«
Innerlich amüsierte ich mich, denn ein Kneipenfreund hatte mich auf die Idee mit der Bibelspruchwerbung gebracht, die wirklich zu meinem Job passte. Ich faltete andächtig die Hände, setzte ein seliges Lächeln auf und warf einen Blick nach oben, wo alle gläubigen Christen ihren Herrn und Erlöser vermuteten.
»Ja«, meinte ich, wobei ich versuchte, meine Stimme ein wenig pastoral klingen zu lassen, »uns sündigen Menschen kommt ständig etwas abhanden. Und wenn es im schlimmsten Fall unser Glauben ist. Aber unser Herr Jesus Christus hat uns allen Mut auf Erlösung und ewige Glückseligkeit gemacht, nicht wahr?«
Zu meinem Erstaunen veränderte sich seine Mimik bei diesem Geschwurbel, und er verdrehte glückselig die Augen, als hätte er einen populären US-Wanderprediger persönlich gehört. Es folgte über einige Minuten eine Litanei, deren Quintessenz darin bestand, dass es nur der allmächtige und gnädige Gott gewesen sein konnte, der uns beide hier zusammengeführt hatte. Nur das Amen fehlte.
Dass ich das anders sah und die Verantwortung eher auf meine Anzeige im Internet schob, verschwieg ich wohlweislich. Nachdem wir uns also in Glaubenssachen offiziell angenähert hatten, konnten wir meines Erachtens endlich zum Kern der Sache kommen. Voller Wehmut sah ich Glastropfen an den Flaschen herunterrinnen, nahm all meinen Mut zusammen und fragte Owen, ob es ihm etwas ausmache, wenn ich eine Flasche alkoholfreies Bier tränke – nebenbei fabulierte ich noch etwas von den wichtigen Isotonen des Kaltgetränks und dem 0,0 Prozentgehalt, wobei ich innerlich stark hoffte, dass er nicht nach einer Flasche griff, um den Wahrheitsgehalt meiner Angabe zu überprüfen.
Aber nichts dergleichen geschah. Mit zusammengekniffenen Lippen, aber einem gönnerischen Lächeln wies er mit beiden Händen auf die Flaschen. Erleichtert griff ich eine, öffnete sie mit dem Messer und behauptete, dass mein Innendesigner erst am Wochenende Zeit habe, da er momentan in der Berliner Szene total angesagt sei.
3
»Herr Hacke«, begann Owen, nachdem er mir zwei tüchtige Schlucke gegönnt hatte, »ich fürchte, es geht um Leben oder Tod.«
Ich hatte so ziemlich alles erwartet, aber nicht solch eine dramatische Eröffnung.
»Werden Sie bedroht?«
Owen schüttelte beinahe bedauernd den Kopf. »Nein, ich weiß mir zu helfen«, antwortete er. »Ich bin Veteran der Special Forces. Wer sich mit mir anlegt, muss sich warm anziehen.«
Bei der hageren Gestalt konnte ich es mir nur schwer vorstellen, dass es sich um einen ehemaligen US-Elite-Soldaten handelte, aber ich wusste auch, dass es ein fataler Fehler sein konnte, rein nach Äußerlichkeiten zu urteilen.
»Es geht um meine Tochter Eve«, fuhr er fort, und seine ansonsten selbstsichere Stimme wurde ein wenig brüchig und etwas zu laut. »Sie hat an einem Austauschprogramm von Doktoranden zwischen der Princeton-Universität und der Humboldt-Universität Berlin teilgenommen. Ihr Austauschjahr neigt sich in zwei Monaten dem Ende zu, und seit zwei Monaten habe ich kein Lebenszeichen mehr von ihr erhalten.«
Ich blickte ihn schockiert an und suchte in meinen Schreibtischschubladen nach einem Stift und Block. Als ich beides gefunden hatte, notierte ich mir Stichwörter, da das einen professionellen Eindruck machte und ich mitunter meinem Gehirn nicht ganz über den Weg traute. Nebenbei spülte ich den Gaumen und überlegte mir eine Reihe von Fragen.
»Alter?«
Seine Antwort, dass Eve zweiundzwanzig Jahre alt war, überraschte mich, aber dann fiel mir wieder ein, dass sich das amerikanische Schul- und Universitätssystem von demjenigen in Deutschland gravierend unterschied. Doktortitel Anfang zwanzig waren in den Vereinigten Staaten von Amerika keine Seltenheit.
»Fürs letzte Sommersemester ist sie nach Berlin gereist. Wir hatten ihr eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe der Jägerstraße gesucht.«
Im Kopf berechnete ich die Miete und beneidete einmal mehr alle Menschen, die mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wurden, anstatt wie ich im Rinnsal einer Gosse, die jeder anständige Bürger mied.
»Eve war anfangs glücklich. Sie schrieb uns, rief an, wir skypten, und so weiter. Natürlich bin ich erwachsen genug, um zu wissen, dass sie kein Kind mehr ist. In den USA hatte sie sich verlobt. Moses, so heißt ihr Verlobter, ist ein ebenso ernsthafter wie gläubiger junger Mann. Ich hatte für meine Tochter bereits eine glückliche Ehe vorhergesehen, zumal Owen einen ähnlich guten familiären Hintergrund wie Eve besitzt.«
Die letzte Aussage machte mich neugierig, da das nach ziemlichem Eigenlob, zumindest vor allem dynastischer Hochzeit klang.
»Voller Begeisterung erzählte sie uns von der tollen Stadt Berlin, die ja so ganz anders als alles in den Vereinigten Staaten sei. Ich verstand sie nur zu gut, denn schließlich war ich in meinen Jugendjahren auch genug in der Welt herumgekommen und hatte einiges erlebt. Und da ich weiß, dass meine Tochter grundanständig, sehr gläubig und auch mir gegenüber sehr loyal ist, machte ich mir am Anfang keine zu großen Sorgen.«
Innerlich erzählte ich mir die nächsten fünf Kapitel seiner Geschichte weiter, denn es war klarer als destilliertes Wasser, dass nun der Teil folgen würde, in dem Eve versuchte, sich aufgrund der räumlichen Distanz und der neuen Eindrücke von ihrem alten Herrn freizuschwimmen, wobei ich es ihr wahrlich nicht verdenken konnte, aus dem christlich-evangelikalen und zugleich bourgeois-unternehmerischen Hintergrund ausbrechen zu wollen – zumal in der Partystadt Deutschlands schlechthin.
»Sie schreibt ihre Doktorarbeit über ›die wissenschaftshistorische Einordnung des Deutschen Idealismus‹, wobei sie den Fokus auf Kant, Fichte, Schelling und Hegel legt.«
Die Namen sagten mir alle was, auch wenn ich mich nicht gerade als Experte auf diesem Gebiet bezeichnen würde. Der inhaltliche Zuschnitt der Dissertation ließ mich ein wenig im Dunkeln, was aber hoffentlich für die Ermittlungen keine weitere Rolle spielen würde. Ich beugte mich über den Schreibtisch.
»Kennen Sie die Namen der sie hier betreuenden Professoren, ihrer Kommilitonen, ihrer Freunde, oder haben Sie sonstige Ansatzpunkte?«
Doch Owen hob abwehrend die Hände – einen Moment, so weit bin ich noch nicht. »Hin und wieder sandte sie mir Kapitel ihrer Doktorarbeit, und wir diskutierten dann darüber«, nahm er den Faden wieder auf. »Eve war immer ein Kind, das meine Nähe suchte. Sie teilte alles mit mir, ihre Sorgen, Ängste, aber auch ihre Freude, Lust und Erfolge.«
Hier schossen mir Fragezeichen durch den Kopf, was er damit genau sagen wollte, insbesondere mit Lust, aber ich beschloss, das Thema Inzest erst einmal in den verborgenen Regionen meines Gehirns zu verbarrikadieren, zumal Owen diesen Eindruck nicht vermittelte. Um mein sündiges Gehirn reinzuwaschen, leerte ich die Bierflasche.
»Kann ich Ihnen ein Glas Leitungswasser anbieten?«, fragte ich und verfluchte einmal mehr, dass ich so ungeschmeidig im Umgang mit Kunden war. »Ich finde, die frische Frühlingsluft wirbelt ziemlich viel Staub auf.«
Owens Blick wanderte rüber zu dem kleinen Waschbecken, das auch auf die Entfernung hin wenig vertrauenswürdig und zudem ein wenig schmutzig aussah. Während er freundlich den Kopf schüttelte, versuchte ich in einer Undercover-Aktion die nächste Flasche so unauffällig wie möglich zu öffnen, aber da hatte ich die Rechnung ohne einen evangelikalen Christen und Exsoldaten der US Special Forces gemacht. Einen Moment lang schien er zu überlegen, ob er sich nicht doch lieber an jemand anderen wenden sollte, blieb dann aber doch brav sitzen und ließ sich nicht von seinem Erzählstrang abbringen. Vermutlich half die Bibel-Werbung über erste Verunsicherungen hinweg. Auch die radikalsten Christen wussten, dass der Mensch aus Fleisch und Blut bestand und deshalb ein Sünder war.
»Nach einiger Zeit riss unser Kontakt ab. Das begann mit weniger Telefonaten, ausgefallenen Skype-Terminen und versprochenen Mails, die nie ankamen. Es hatte den Anschein, als ob sie versuchte, sich zu verstecken. Die wenigen Male, die wir miteinander kommunizierten, irritierten mich zutiefst. Eve schien eine gravierende Persönlichkeitsänderung durchlaufen zu haben. Ich spürte keine Nähe mehr, kaum noch Liebe, ja vielleicht sogar am Schlimmsten: reines Desinteresse.«
Zum ersten Mal sackte der Mann, der tapfer und wie ein Stock auf dem Plastiksessel gesessen hatte, ein wenig in sich zusammen. Seine Blicke wanderten ins Niemandsland.
»Natürlich machte ich mir Sorgen. Denn dass Eve sich so verhielt, signalisierte mir einen radikalen Lebenseinschnitt. Natürlich weiß ich, was Sie alles entgegnen könnten: Kinder benötigen ihre Freiheit, sie lösen sich, werden eigenständig. Natürlich. Gerade dann, wenn eine große räumliche Nähe zu den Eltern herrscht, sind das beinahe zwangsläufige Folgen. Beim letzten Skypen wirkte ihr Gesicht aufgedunsen. Sie machte einen abwesenden Eindruck und schien sich enorm verändert zu haben.«
»Drogen?«, warf ich in den Raum und dachte an Eve, die sich vielleicht dafür entschieden hatte, einmal anders Spaß in ihrem Leben zu haben, anstatt die Hände zu falten und fromme Sprüche runterzuleiern.
»Gott behüte, vermutlich ist da tatsächlich etwas dran. Aber ich denke nicht, dass das alles war. Bestimmt, sie ist unter den Einfluss von Personen gekommen, die sie beherrschen.«
Damit meinte er wohl offensichtlich jemand anderen als ihn.
»Und was wollen Sie, dass ich für Sie unternehme?« Ich wollte ihn nicht drängen, aber so langsam begann ich den Sachverhalt zu verstehen, und mein leeres Konto wurde durch reines Palaver auch nicht voller.
Er seufzte. »Vor zwei Monaten brach der Kontakt dann völlig ab. Da ich mit der Geschäftsführung meiner Firma sehr in Anspruch genommen bin und auch viele soziale Verpflichtungen in unserer Gemeinde und anderswo habe, versuchte ich eine Zeit lang, das Ganze einfach zu verdrängen. Aber ein Vater ist ein Vater, und irgendwann hilft alles Verdrängen nichts mehr. Außerdem meldete sich der Vater meines Schwiegersohns in Spe und teilte mir mit, dass Eve sich bei seinem Sohn Moses auch nicht mehr meldete. Spätestens jetzt läuteten alle Alarmglocken. Denn Eve und Moses sind füreinander bestimmt. Es ist eine Fügung des Himmels, dass die beiden sich gefunden haben. Natürlich ist das für Moses ein Schlag ins Gesicht, aber ich weiß, wie gottesfürchtig und gläubig er ist. Ihm ist klar, dass unser Herr alle Geschicke zu unserem Besten lenkt, auch wenn wir nicht immer genau wissen, weshalb er das tut, und uns häufig leiden lässt.«
Seine Augen wanderten an die Decke und die Lippen machten stumme Bewegungen, sodass ich daraus schloss, dass er betete. Nach der kurzen Andacht setzte er sich wieder kerzengerade auf, und seine eindringlichen graugrünen Augen fixierten mich.
»Zwei Monate sind viel zu lang. Wir müssen herausfinden, was Sache ist. Die Hochzeit von Eve und Moses ist für den August dieses Jahrs terminiert. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Alle Verwandten und Bekannten wissen Bescheid. Das Ganze darf auf keinen Fall in einer Katastrophe enden. Sie müssen Eve finden und sie zu einem Gespräch mit mir überreden. Denn ich bin mir sicher, dass es nicht mehr als eines wohlwollenden väterlichen Gesprächs bedarf, um alles wiedergutzumachen.«
Ich zweifelte an seiner simplen Vorstellung des Reset-Knopf-Drucks, der alles in den Ausgangszustand zurücksetzte, wollte mir aber den Auftrag nicht durch zu große Skepsis vermasseln.
»Sie müssen sie so schnell wie möglich finden, unter allen Umständen, koste es, was es wolle.«
Der letzte Halbsatz ließ mein Herz vor Freude hüpfen. Ich würde ihn glatt beim Wort nehmen.
»Unternehmen Sie alles in Ihrer Macht Stehende, Eve aus dem zu befreien, in was auch immer sie hineingeraten ist. Eine innere Krise, schlechte Kreise, die sie nicht ziehen lassen wollen, oder was auch immer es sei.« Er strahlte mich beinahe an. »Ich nehme an, dass wir im Geschäft sind.«
Anstatt einen wilden schamanischen Freudentanz aufzuführen, setzte ich mein Pokerface auf. »Vermissten-Aufträge sind in der Regel gefährlich und aufwendig.«
Owen nickte verständnisvoll.
»Deshalb weicht das Honorar von meinem Regelsatz bei dieser Art von Auftrag ein wenig ab. 600 Euro Tagessatz plus Spesen und 50 Cent pro Kilometer«, legte ich meine recht überzogenen Forderungen offen.
Owen bleckte die Zähne. Ihre Ebenmäßigkeit und strahlende Weiße verrieten, dass sie so echt waren wie die Titten der meisten modernen Pornostars. Dann lächelte er wie ein Hai, griff in die blaue Innentasche seines Anzugs und holte ein dickes Geldbündel heraus. »Das sind 10.000 Euro Anzahlung«, behauptete er, und ich glaubte ihm, ohne das Bedürfnis zu spüren, das auf dem Schreibtisch liegende Geld sofort nachzuzählen und abzuknutschen. »Sobald Sie Eve gefunden haben, rechnen wir ab, und ich garantiere Ihnen zusätzlich eine 5000-Dollar-Erfolgsprämie.
Mich katapultierte es aus dem Sessel nach oben, und ich streckte die Hand über den Schreibtisch aus, wobei ich beinahe eine leere Bierflasche umwarf. »Deal!«
»Deal!«
Wie zwei Staatsmänner verbündeter Staaten schüttelten wir uns die Hände. Danach ließ ich den Haufen Bargeld möglichst elegant in einer meiner Schreibtischschubladen verschwinden, bevor er es sich doch noch anders überlegte. Ich kramte den gängigen Standardvertrag heraus, änderte die Honorarzahlen deutlich nach oben und bat Owen, mir alle wichtigen Details über Eve, ihre Verwandlung und ihr Verschwinden zu erzählen, was er machte, ohne allzu viele Details auszulassen.
Als die Tinte auf dem Dokument getrocknet und Owen wieder gegangen war, öffnete ich die vierte Flasche des heutigen Tages, packte die kleine Stanmore-Anlage aus einem der Kartons aus, stöpselte sie an die Steckdose an und ließ meine Lieblingsplaylist laufen. Draußen regnete es Sturzbäche, doch was ging mich das an? Für mich war gerade die Sonne aufgegangen. Hätte ich allerdings auch nur ansatzweise geahnt, wie sehr es dieser Fall in sich hatte, wäre ich Owen nachgelaufen und hätte ihm sein Geld zurückgegeben und um sofortige Auflösung des Vertrags gebeten. Zumindest aber hätte ich statt meiner Lieblings-Playlist einige Requiems laufen lassen.
4
Ich stand vor der Jägerstraße 5. Herr Owen hatte mir ohne Weiteres zu verstehen gegeben, dass er über keinen Zweitschlüssel der Wohnung verfügte. Die Wohnung hatte Eve bereits von Amerika aus gemietet. Ihr alter Herr hatte trotz des horrenden Preises tapfer die Zähne zusammengebissen, um seiner Tochter nicht den Promotionsaufenthalt in dem Land zu verderben, in dem er vor Jahrzehnten seinen Militärdienst geleistet hatte. Inzwischen hatte der Wind sich abgeschwächt. Nur hin und wieder fiel ein vereinzelter Tropfen vom Himmel, und die Sonne schaute immer häufiger zwischen den am Firmament umherflatternden Wolken heraus.
Das Haus gehörte definitiv nicht zu den exklusivsten in der Gegend, sah aber immer noch nobel genug aus, um für ein unteres sechsstelliges Jahreseinkommen zu teuer zu sein. Die Nachbarhäuser waren teilweise neuer und die Fassaden richtig schön herausgeputzt. Ich tippte, dass dort die Versicherungs-, Bank- und Managertypen wohnten, für die es zu einer Villa in Grunewald oder Dahlem noch nicht ganz reichte. Vielleicht mochten auch ein paar der Bewohner das Berliner Innenstadtflair und setzten deshalb einen Haufen auf eine Villa im Grünen. Hätte ich genauso gemacht, aber mein Geld hätte weder hier noch dort für eine Besenkammer gereicht.
Für eine Doktorandenbude war das Haus in etwa so nobel wie die Örtlichkeiten des Vatikans für einen Bettelmönch. Und hinzu kam das Einmaleins der Immobilienbranche: Lage, Lage, Lage. Gendarmenmarkt, Brandenburger Tor, Regierungsviertel und nicht zuletzt die Humboldt-Universität in Laufweite, solange man nicht unter Gehbehinderungen litt. Viel besser ging es nicht.
Aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, dass Eves Wohnhaus der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert entstammte. Das weiß gestrichene Gebäude mit grauer Grundierung zwischen Keller und Erdgeschoss hatte drei Stockwerke und Dachgeschosse. Zwischen den Stockwerken befand sich aufwendige Stuckarbeit.
Nach Owens Angaben hatte seine Tochter im zweiten Stock gewohnt. Ich seufzte und malte mir aus, was ich mit reichen Eltern alles hätte studieren, erforschen und für die Welt hätte tun können. Doch dann fiel mir wieder ein, dass das Hauptproblem nicht nur das fehlende Geld gewesen war, denn genügend Studierende sorgten ja selbst für ihren Lebensunterhalt. Vielmehr ging es um mein Interesse an dem, was ich das wahre Leben nannte. Das Leben, das sich tagtäglich auf den Straßen abspielte. In den Niederungen und an den Rändern der Gesellschaft. Vielleicht war ich gerade deshalb Privatermittler geworden, um im Dreck anderer Leute herumzuschnüffeln oder aber anderen zu helfen, den Unrat im eigenen Haus zu beseitigen.
Ich überquerte die Straße und wurde auf einem Pop-up-Fahrradweg beinahe von einem Lieferando-Fahrrad über den Haufen gefahren. Der Lieferant hatte extra noch heftiger in die Pedale getreten, als er sah, dass ich seinen Weg kreuzen würde. Das war ich von Berlin gewöhnt. Hier gab es alles: militante Autofahrer, militante Radfahrer und sogar militante Fußgänger. Preußens Prägung ließ grüßen.
»Hey, pass doch auf, Vollpfosten!«, rief der junge Mann mir lautstark zu, als er aber beinahe schon um die nächste Ecke gebogen war. »Hast keene Oogen im Kopp, du Depp?«, schickte er noch einen weiteren freundlichen Gruß hinterher, während mein Mittelfinger ihm eifrig hinterherwinkte.
Eine weitere Erwiderung sparte ich mir – das Verhalten gehörte einfach zum Großstadtkiez dazu. Als ich die Klingelschilder inspizierte, fand ich schnell E. Owen. Wie vorhergesagt zweiter Stock. Ich musterte kurz die Eingangstüre und schwankte noch zwischen Dietrich-Set und der Paketdienst-Nummer. Doch die Entscheidung wurde mir abgenommen, denn eine Dame um die siebzig öffnete die Türe. Sie war in einen viel zu warmen Pelzmantel gekleidet und wollte ihre Louis-Vuitton-Tasche und ihren kleinen Hund spazieren führen, der mich argwöhnisch ansah, sodass ich um die Gesundheit meiner Fußknöchel fürchtete. Sie musterte mich mit zusammengekniffenen Augen.
»Danke schön«, sagte ich so höflich wie möglich und schenkte ihr ein Lächeln, das wie die aufgehende Sonne wirken sollte.
»Zum wem wolln Se denn, junger Mann?«, fragte das Berliner Urgestein, als ich bereits die weiß glitzernde Treppe erreicht hatte.
»Eve Owen erwartet mich.«
»Die kleine Ami-Hure hatts aba dringend nötig«, hörte ich noch.
Die Aussage irritierte mich, hatte doch ihr Vater ein ganz anderes Bild von ihr vermittelt. Vielleicht war Berlin ja der Ort für sie, an dem sie sich von allem alten Ballast freischwimmen konnte. Im zweiten Stock angekommen, hielt ich kurz inne und lauschte. Aus keiner der beiden Wohnungen war ein Geräusch zu hören. Ich atmete auf und klebte kurzerhand meinen Kaugummi über den Türspion der gegenüberliegenden Wohnung. Danach inspizierte ich in aller Schnelle Türe und Schloss. Alles 08/15. Ich drückte prophylaktisch gegen die Tür, die aber erwartungsgemäß keinen Millimeter nachgab. Dann zückte ich meine Payback-Karte, die ich ohnehin nie nutzte, außer in Ausnahmefällen zum Harken von Lines, und probierte es damit.
Zu meiner großen Überraschung gab die Tür nach wenigen gut geübten Handbewegungen nach. Eve war entweder zu Hause oder hatte beim Verlassen der Wohnung nicht abgeschlossen. Wie immer, wenn ich ungebeten fremdes Territorium betrat, machte sich mein Herz durch besonders laute Schläge bemerkbar. Ich ging einen Schritt in den Flur hinein und zog die Wohnungstür leise hinter mir ins Schloss.
»Hallo?«, fragte ich zaghaft.
Es herrschte Stille. Zum Glück hatte ich meinen Revolver griffbereit. Es war eine gefährliche Welt, und Berlin war einer der Nabel der Welt. Noch Fragen?
Schnell checkte ich oberflächlich die zwei Zimmer, die Küche und das Bad. Niemand war zu sehen.
Als Erstes nahm ich Eves Schlafzimmer unter die Lupe. Auf dem Schreibtisch lagen dicke Bücher. Hegel, Schelling, Fichte und Kant – alle im Original. Schwere Kost, befand ich. Dann einige Lexika über Philosophen, Technikphilosophie, die meines Erachtens nicht wirklich dazu passte, und dickleibige Monografien über die philosophischen Grundlagen des Deutschen Idealismus. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand dieses Thema freiwillig bearbeitete, und wusste kaum noch den Titel ihrer Dissertation, den ihr Vater mir genannt hatte.
Ein US-amerikanischer gelber Notizblock lag aufgeklappt da, wobei mindestens fünfzig handbeschriebene Seiten nach hinten gebogen waren und circa dreißig Seiten noch auf Erkenntnisergüsse warteten. An Ernsthaftigkeit mangelte es Eve offenbar nicht, aber mich irritierte, dass ich keinen Laptop auf dem Schreibtisch oder anderswo finden konnte. Innerlich wettete ich einen Hunni, dass sie einen Mac hatte, wobei das christlich-republikanische Elternhaus dem eindeutig zu widersprechen schien und eher einen HP oder Dell nahelegte. Die Durchsuchung der unverschlossenen Schubladen brachte keine Ergebnisse von besonderem Interesse.
Das Zimmer war weder exklusiv noch billig eingerichtet. Die Möbel stammten nicht aus dem großen schwedischen Möbelhaus, waren aber auch keine Maßanfertigungen. Die Größe des Betts war eine gelungene Mischung zwischen Ein- und Zweipersonenbett. Auf dem Nachtischschränkchen standen ein elektronischer Wecker und ein weißes Glas, das zu einem Drittel mit Kondomen in bunten Farben gefüllt war. Während ich mich noch fragte, ob sie es dezenter fand, das Glas nur zu einem Drittel zu füllen, und mit wem sie gegebenenfalls die anderen zwei Drittel verbraucht hatte, fiel mein Blick auf die Wand. Dort hing ein künstlerisch anspruchsvolles Foto der Skyline von Seoul in einem hochwertigen Rahmen.
Am Kleiderschrank hing ein Post-It-Zettel mit dem aus der Mode gekommenen Aufdruck »Gib AIDS keine Chance« sowie einer Telefonnummer und dem handschriftlichen Vermerk »Call«, der zweimal unterstrichen war. Das passte nicht zum Kondomglas. Der Kleiderschrank offerierte Einblicke in das Konsumverhalten der blonden Eve. Die Kleidung war weder exklusiv noch überteuert, aber wies einen guten Geschmack auf. Eve schien einen zeitlosen Stil zu bevorzugen.
Ich nahm das Foto aus meiner Lederjacke, das mir Owen gegeben hatte. Auf ihm stand die blonde Eve in einem unschuldig-weißen Kleid. Ihre blonden, ein wenig gelockten Haare gingen ihr bis über die Schulter. Die blauen Augen lagen eine Spur zu nahe beisammen, und die Nase war eine winzige Spur zu groß. Vielleicht war der Mund das Schönste an ihrem Gesicht. Sie hatte rote und volle Lippen, die Vorfreude aufkommen ließen. Ansonsten war sie vermutlich zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, recht schlank und besaß einen normalen Vorbau, also weder Mäusefüße noch Monstertitten.
Ich konnte nicht gerade behaupten, dass ihr Anblick mir augenblicklich einen Steifen bescherte, aber nach ein paar Bieren hätte ich sie sicherlich nicht von der Bettkante gestoßen. Der besonders sittsame Eindruck auf dem Foto war sicherlich den Umständen geschuldet, denn dem hinter ihr stehenden Buffet nach zu urteilen war es auf einem Familienfest aufgenommen worden. Vielleicht strahlte sie im Alltag jede Menge sexuelle Energie aus, während sie auf dem Foto eher wie ein graues Mauerblümchen erschien.
Die Inspektion des Wohnzimmers brachte nicht viel zutage. Ein Riesenfernseher eines asiatischen Herstellers, eine Multifunktionsmusikanlage, ein paar Kunstdrucke an der Wand und einige Blu-Rays und CDs. Ziemlich konventioneller Film- und Musikgeschmack. Auf dem Glastisch standen weder eine Bong noch ein Silbertablett, um Lines zu ziehen. Alles langweilig und unergiebig, weshalb ich in die Küche ging.
Hier durchsuchte ich jeden Schrank, da Menschen häufig an solchen Orten Dinge verstecken, die nicht immer ganz legal sind. Außer einer Bratpfanne, für die sicherlich ein Waffenschein angezeigt gewesen wäre, gab es hier aber auch nichts Besonderes.
Der Blick in den Kühlschrank war ernüchternd. Zwei Flaschen Heineken-Bier, Butter, ein Brot und abgepackter Käse. In Sachen Kulinarik schien die Owen-Tochter die Messlatte recht niedrig zu hängen, außer sie ging jeden Tag in einem der besten Berliner Restaurants essen, wovon ich nicht ausging, zumal Owen mir ihre finanzielle Situation genau beschrieben hatte. Die war keineswegs unkomfortabel, reichte aber auch beileibe nicht dafür aus, es jeden Tag bis zum Anschlag krachen zu lassen. Der Alte schien ein gutes Augenmaß für die gesunde Mitte zu besitzen.
Als Letztes inspizierte ich das Bad, da dieses auch nicht selten als Versteck für gewisse Dinge herhalten musste. Aber außer angefangenen Schachteln apothekenpflichtiger, aber an sich harmloser Schlaftabletten und Schmerzmittel war hier nichts auffällig. Eve schien also nicht Drogen verfallen zu sein, oder aber sie hatte ihren Stash so gut versteckt, dass meine oberflächliche Inspektion diesen übersehen hatte.
Gerade als ich an der Pinnwand vor der Haustüre vorbeilief, erhaschte ich einen Blick auf einen Flyer, der eine gewisse, mir bis dato unbekannte Cosmos-Sekte anpries. Davon hatte ich bereits einmal in der Tageszeitung gelesen. Das Übliche: fragwürdige Praktiken, Verdacht auf Gehirnwäsche, aber es war auch die Rede von einem Guru, der seine Jünger über alles liebte. Der alles für sie tat und für sie und mit ihnen durchs Feuer ging. Ich steckte den Flyer ein und machte mich auf den Heimweg, um dem alten Owen wie versprochen Bericht zu erstatten. Leider hatte der Vater sich entschlossen, eine Weile in Berlin zu bleiben, sodass ich tatsächlich verpflichtet war, ihm jeden Tag aufs Neue Bericht zu erstatten, ohne technische Störungen über den Großen Teich oder Ähnliches vortäuschen zu können. Aber bei dem Honorar konnte er das auch verlangen.
5
Als ich auf den Fußabtreter vor meinem Büro trat, knirschte es komisch. Ich trat einen Schritt zurück. Hoffentlich handelte es sich um keine Mini-Tretmine. Doch ein Blick unter die Matte förderte einen kleinen Zipplock-Beutel zutage, in dem sich mindestens fünf Gramm dunkelbraunes Hasch befanden. Darauf klebte ein blauer Post-It-Zettel mit den Worten »Gruß von Ali«. Es war doch wunderbar, dass es Klienten gab, die einem für die geleisteten Dienste nahhaltig dankbar waren. Offensichtlich stand ich immer noch in der Gunst eines der größten arabischen Familienclans von Berlin. Das konnte nicht schaden. Meistens brachte jemand persönlich das Matt vorbei, und dann zogen wir gemeinsam einen durch und unterhielten uns über Gott, Allah und die Welt. Heute entfiel der Plausch, aber ich freute mich dennoch über das Geschenk.
Als ich mir am Schreibtisch eine Nachmittagstüte bastelte, überlegte ich, was ich dem Alten alles erzählen und was ich gegebenenfalls zurückhalten sollte. Irgendwie tat Eve mir leid. Was war wohl der wundere Punkt? Der Flyer für eine koreanische Sekte oder das eher leer als volle Kondomglas? Bereits beim Melden spürte ich, wie sehr der Alte unter Strom stand.
Hacke hier, ich wollte wie vereinbart kurz Bescheid geben.
Wissen Sie, wo Eve ist?
So schnell geht das nicht. Aber ich habe die Wohnung inspiziert. Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Entführung kann ich so gut wie ausschließen.
Das Geräusch, das Owen machte, konnte ich weder als Erleichterung noch als Sorgenaufschrei interpretieren.
Aber Sie müssen doch irgendwas gefunden haben, was uns weiterhilft.
Ich fürchte, nicht allzu viel. Es scheint, als hätte Ihre Tochter, nun, wie soll ich das diplomatisch sagen, recht regen Verkehr gehabt.
Das scharfe Schnaufen zeigte mir genau, was der Alte davon hielt.
Das ist kaum zu glauben. Schließlich ist Eve verlobt. Und sie war immer ein sehr anständiges Mädchen. Ihre Jungfräulichkeit wollte sie sich für die Ehe aufbewahren.
Aus Kindern werden Leute, und manchmal durchlaufen sie gravierende Veränderungen. Das bringt das Erwachsenenleben mit sich.
Ich habe Sie nicht engagiert, damit Sie mir das Leben erklären. Außerdem kenne ich Eve seit ihrer Geburt. Sie ist die treueste Seele, die Sie sich vorstellen können. Das ändert sich nicht so schnell.
Ich berichtete ihm in möglichst ruhigem und neutralem Ton von dem Kondomglas.
Das sieht Eve gar nicht ähnlich. Ich fürchte, sie ist da in Kreise geraten, die sie auf die schiefe Bahn gebracht haben. Oder sogar zu etwas gezwungen haben, was sie gar nicht wollte.
Das ist nicht auszuschließen.
Umso dringender müssen Sie sie finden.
Ich rang mit mir. Dann obsiegte die Loyalitätspflicht meinem Klienten gegenüber.
Hatte Eve eine besondere Beziehung zu Südkorea?
Wie bitte?
In ihrem Schlafzimmer hing ein Poster von Seoul und an ihrer Pinnwand ein Flyer einer gewissen Cosmos-Sekte.
Obwohl ich genau wusste, dass der alte Owen es sich in seiner Suite im Hilton Berlin gemütlich gemacht hatte, um von dort seine Geschicke in der Heimat zu lenken, hatte ich den Eindruck, dass die Leitung tot war.
Hallo?
Ja ... äh, nein. Eve hatte nie auch nur ansatzweise was mit Korea zu tun, außer dass wir einmal Kimchi und gegrillten Tintenfisch in einem koreanischen Restaurant probiert haben.
Das Maß an Humor hatte ich ihm nicht zugetraut, schon gar nicht in einer solch angespannten Situation.
Und eine Sekte kann ich vollkommen ausschließen. Ich habe zwar bereits von der Cosmos-Sekte gehört, aber nur, dass die sich dem Teufel verschrieben haben. Außerdem soll der Guru, ein Typ namens Gabriel, ein absoluter Kontrollfreak sein. Eine Art Charles Manson, der angeblich seine Jünger immer überwacht. Manchmal soll er ihnen heimlich Wanzen unterjubeln, sodass er immer weiß, wo seine Schäfchen sich aufhalten und was sie über ihn sagen. Hoffentlich ist Eve da in nichts hineingerutscht, wo sie ...
Seine Stimme hatte ihren festen Klang verloren, und ich war mir nicht sicher, ob ihm nicht vielleicht die eine oder andere Träne herunterkullerte. Ich nutzte die Pause sinnvoll und zündete den Joint an. Seine Aussagen über die Sekte, auch über den Erleuchteten der Gruppe schienen übertrieben. Ob an der Sache mit der Überwachung der Jünger etwas dran war? Auch wenn es vielleicht nur aus Liebe zu seinen Jüngern war.
Ein Flyer muss ja nichts heißen. Vielleicht hat sie ihn aufgelesen und aus irgendeinem Grund an die Pinnwand gehängt.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Was gedenken Sie als Nächstes zu unternehmen?
Gar keine so einfach zu beantwortende Frage, obwohl vollkommen vorhersehbar. Ich zog tüchtig, als ob mir das die plötzliche Erleuchtung bringen würde.