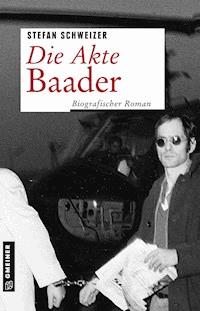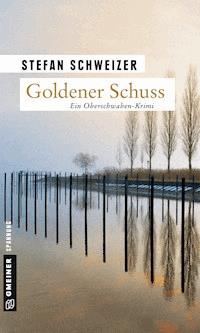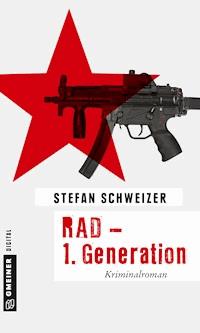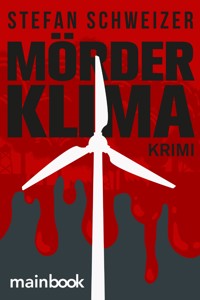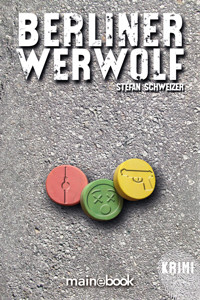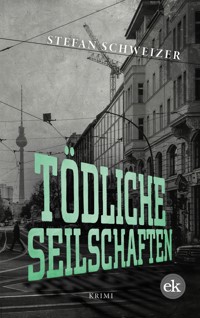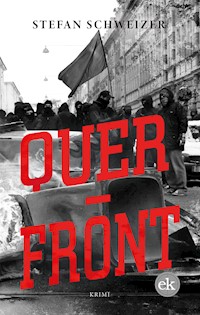
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis mit Privatermittler Hardy
- Sprache: Deutsch
Als bei einer Demonstration der "Querfront", ein Zusammenschluss links- und rechtsradikaler Gruppen, eine Demonstrantin erschossen wird, erhält Privatdetektiv Hardy den Auftrag, den Mörder zu finden. Auftraggeber ist der Onkel der Toten und zugleich Bundestagsabgeordneter einer nationalpopulistischen Partei. Als zur Bedrohung durch Querfront-Anhänger noch Akteure des Landeskriminalamts und Landesamts für Verfassungsschutz ins Spiel kommen, ist Hardys Leben keinen Pfifferling mehr wert. Kann er seinen Kopf rechtzeitig aus der Schlinge ziehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Stefan Schweizer
Querfront
Krimi
Schweizer, Stefan: Querfront. Hamburg, edition krimi 2023
1. Auflage 2023ISBN: 978-3-948972-94-3
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.ePub-eBook: 978-3-948972-95-0
Lektorat: Bernhard StäberSatzherstellung: Rebecca Riegel, 3w+p Typesetting Automation ExpertsKorrektorat: Sabrina EmrichUmschlaggestaltung: Annelie Lamers, HamburgUmschlagmotiv: Demonstration: © Bastian Ott / stock.adobe.com; Fahne: © Sebastian / stock.adobe.com; Struktur: pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die edition krimi ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,Hermannstal 119k, 22119 Hamburg: https://www.bedey-thoms.de
© edition krimi, Hamburg 2023Alle Rechte vorbehalten.https://www.edition-krimi.deGedruckt in Deutschland
1.
Mit dem Einbruch des Winters spielte die große Krise erneut mit uns. Oder die Medien und wir spielten mit ihr. Vielleicht war das lediglich eine Frage des Standpunkts. Auf jeden Fall war sie doch nicht so plötzlich vorbei gewesen, wie ich es bereits erhofft hatte. Dabei hatte es im Frühling und Sommer des vergangenen Jahrs gut ausgesehen, bis sich Ende des Herbstes zuerst die mahnenden Stimmen und schließlich die Ansteckungsziffern drastisch erhöhten, ohne dass dies in der Bevölkerung große Panik verursacht hätte.
Mein Leben hatte eine Veränderung erfahren, die nichts mit den bösen Viren zu tun hatte, aber dennoch nicht spurlos an mir vorüberging. Denn sie war der Grund, warum ich im Hoodie und offenem Wintermantel in meinem neuen Büro an der Ecke Turm- und Beusselstraße saß und mir immer wieder verzweifelt die klammen Hände rieb. Handwerker in Berlin zeitnah zu kriegen, war beinahe schwerer als eine Audienz beim pastoral wirkenden Bundespräsidenten, der als Pfarrer vielleicht eine noch bessere Figur abgegeben hätte. Die Handwerker, sofern sie denn auftauchten, zu bezahlen, erforderte zusätzlich einen minutiös geplanten Coup, der das nötige Cash hereinspülte, denn Handwerker waren inzwischen teurer als mittelmäßiger Champagner und durchschnittlicher russischer Kaviar.
Immer wieder zogen die Szenen, die sich vor wenigen Wochen abgespielt und zu meiner jetzigen Situation geführt hatten, an meinem inneren Auge vorbei. Formal betrachtet handelte es sich um einen glatten Rauswurf. Nur dass die Jungs mir weder etwas gebrochen oder angedroht hatten, wie sie das meistens taten, um Prozesse abzukürzen. Als die arabischen Habibis mich also aus heiterem Himmel besuchen kamen, dachten nur fernsehgeile Politiker und unerschütterliche Pessimisten daran, dass der Winter vor der Tür stand und die Freiheit der Menschen bald bloß eine blasse Erinnerung sein würde. Ich wedelte mit den Armen, machte Kniebeugen und kam mir ziemlich bescheuert vor, aber wegen der bitteren Kälte blieb mir nichts anderes übrig.
Schuld an meiner Misere waren meine Bekannten des Aras-Clans gewesen, also Hassan, Hakim, Ali und Erdal. Sie trugen schwarze Lederjacken, denen man ansehen sollte, dass sie einiges an Asche gekostet hatten und die sie wie die Obermacker des härtesten Berlin-Kiezes aussehen ließen. Sonnenallee & Co ließen schön grüßen. Dabei sahen alle vier nicht unbedingt wie fiese Clan-Mitglieder, sondern wie Typen aus dem Nahen Osten aus, die gerade von der Maniküre, dem Bart-, Nasen- und Ohrenhaartrimmen und dem Spa kamen. Aber der locker-legere Eindruck täuschte, denn allen klemmte schwere Artillerie unter den Armen, und sie machten sich nicht einmal die Mühe, diese auch nur ansatzweise zu verstecken. Ich wusste nicht, ob das noch vom vorigen Geschäftstermin herrührte oder mir galt. Doch in letzterem Fall waren sie an den Falschen geraten, denn dadurch war ich recht wenig zu beeindrucken. Erstens mochte ich die Jungs, zweitens hatte ich keine Angst vor ihnen und drittens wusste ich mich zu wehren. Aber mich irritierten ihre finsteren Blicke – es schien Neuigkeiten zu geben, und die waren wohl nicht sonderlich gut für mich.
»Wir haben schlechte Nachrichten«, legte Hakim gleich die Karten offen auf den Tisch, bestätigte also meine Befürchtungen und ich war dennoch dankbar, dass wir die orientalischen Blumenmetaphern und dieses »kommt-vom-Boss-ganz-oben« ausließen. Ihre Botschaft war so unmissverständlich klar wie eindeutig und lautete: »Du musst hier raus. Pack dein Zeug zusammen und mach das Büro frei.«
Zack, das saß wie ein gut gezielter Leberhaken. Wenn ich an meine Leber dachte, verzog ich automatisch das Gesicht zu einer schmerzverzerrten Grimasse. Die Leberzirrhose war nämlich nur noch eine Frage der Zeit. Die Jungs missverstanden das, und Hakim suchte bereits nach einem Taschentuch, sollte ich wider Erwarten in Tränen ausbrechen. Doch ich überlegte mir nur eine Verzögerungsstrategie. Auch wenn ich wusste, dass die Chancen gering waren, wollte ich nichts unversucht lassen.
»Äh, das wird aber ein bisschen länger dauern, Jungs«, versuchte ich Süßholz zu raspeln, um mir ein wenig Zeit zu verschaffen und nicht sofort einzuknicken. »Ihr wisst ja, der überhitzte Immobilienmarkt, meine finanzielle Situation und ...«
»Tut mir leid Bruder«, flötete Erdal, aber seine braunen Augen strahlten eine Kälte aus, die einem durch Mark und Bein ging und die keinen Zweifel daran ließ, dass er mir, ohne mit der Wimper zu zucken, das Lebenslicht ausblasen würde, wenn es sein Boss befahl. »Aras hat die Pläne geändert«, fügte er bestimmt hinzu und sein Blick ließ keinen Zweifel daran, dass er keine Sekunde zögern würde, Aras Wünsche ohne Wenn und Aber durchzusetzen. »Übermorgen beginnt nämlich der Umbau.«
Die folgende Pause war bedeutungsschwer und lastete auf meinen Schultern wie ein Zentnersack voll Reis.
»Kommt überraschend, Jungs«, sagte ich mehr zu mir als zu ihnen und überlegte verzweifelt, ob ich noch ein Bier im Kühlschrank hatte. »Und vor allem ziemlich schnell.«
An dem Bier hätte ich mich festhalten können, verwarf aber dann den Gedanken, da ich so wenig Schwäche wie möglich zeigen wollte. Dann wog ich kühl meine Optionen ab. Der Büroraum im angesagten Prenzlberg – fast zum Nulltarif – war also weg, keine Frage. Das brachte unweigerlich Veränderungen mit sich, und wenn es schlecht lief, bedrohte es auch meine finanziell-berufliche Existenz, denn nur durch die gegen Null tendierende »Freundschaftsmiete« konnte ich mich einigermaßen über Wasser halten. Das Arrangement hatte aber auch zur Folge, dass es keinen formalen Mietvertrag gab und ich damit keine Rechte besaß – abgesehen davon, dass ich mich nie erdreistet hätte, gegen Aras zu klagen. Wenn wir uns in einer Sache einig waren, dann darin: Das größte Schwein im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. In der Tiefe meines Herzens hatte ich mich auf Aras' Ehrenwort verlassen. Tja, Pustekuchen. Man kam allein auf die Welt, ging auch allein wieder, und in der Zwischenzeit war man einsam, auch wenn die meisten das gar nicht merkten, weil sie sich mit Konsum zudröhnten und ihre eigene Identität verloren. Also überlegte ich, ob ich vor den vier Mittzwanzigern den Orang-Utan rauslassen oder es auf die konziliante Art probieren sollte.
»Soll ich mein Büro jetzt unter der Möckernbrücke eröffnen?«, entschied ich mich für die zynisch-verzweifelte Variante. »Macht sich bestimmt gut, ein Pappschild mit ›Übernehme Ermittlungen jeder Art – auch Personenschutz möglich‹.«
Niemand lachte, aber ein dezentes Grinsen glaubte ich unter zwei der vier hipsterartigen Vollbärte doch zu erkennen.
Ich ließ nicht locker. »Vielleicht ist das geschäftsfördernd, weil die Menschen mich für einen harten Brocken halten, den ganzen Tag auf dem eiskalten Boden und so weiter. Oder ich kriege sogar ab und zu einen Fünfer zugesteckt, wer weiß, wenn ich einen Becher hinstelle ...«
Ich blickte herausfordernd in die Runde.
»Digga, Aras lässt seine Freunde nicht fallen«, schrieb mir Ali ins Stammbuch. »Das musst du doch wissen. Spar dir deine Seifenoper.«
Hassan war der Softeste und wollte sich vielleicht nicht gerade entschuldigen, aber zumindest erklären – manche seiner Verwandten hielten ihn trotz zahlreicher »Heilungsversuche« mit arabischen Jungfrauen für unheilbar schwul, aber gesichert war das nicht. Oder aber sie hatten vor dem Besuch Strohhalme gezogen und Hassan hatte die Arschficker-Variante gezogen, womit er dem ihm zugeschriebenen Image ja nur gerecht wurde.
»Hardy, schau mal, Aras macht hier was ganz Tolles draus«, behauptete er, ließ den Arm nach oben und unten gleiten und wollte damit wohl sagen, dass es das ganze Haus und nicht nur mein Büro betraf. »Endlich hat er alle Wohnungen erworben. Das ganze Haus gehört ihm. Überleg mal, was sich da für Möglichkeiten eröffnen. Alles schon fest geplant. Unten ein Barber-Shop und ein Späti, im ersten Stock orientalische Ganzkörpermassage, im zweiten Stock ein sozialer Treffpunkt für die Migranten-Community und oben ist für Büroräume reserviert.«
Ich übersetzte mir das ohne Nachfrage wie folgt: Unten zwei Geldwaschanlagen, die einem eher noch fünf Euro schenkten als der Bon-Pflicht nachzukommen, im ersten Stock ein Puff mit von der Oberlippe bis zu den kleinen Zehen gewachsten, internationalen Nutten, vermutlich überwiegend aus den arabisch-heimischen Ställen, darüber ein illegaler Spielsalon und ganz oben eine Giftmischer-Küche für Meth oder Crack. Klar, da passte ein abgewrackter deutscher Privatdetektiv nicht mit rein, auch wenn Aras und ich uns vorgegaukelt hatten, Freunde zu sein. Aber ich konnte ihn verstehen, denn wer hatte bei diesem Geschäftsportfolio schon gerne einen angeranzten Privatdetektiv unter demselben Dach?
»Okay«, sagte ich schließlich, »ich hol ein paar Pappkartons aus dem Keller und schlage meine Zelte irgendwo anders auf.«
Die Jungs lachten höflich, und plötzlich wuchs wie aus dem Nichts ein riesiger Joint rüber, der mich erst einmal ein wenig beruhigen sollte. Ich tat mein Bestes, doch das Haschisch half trotz Hammerqualität nicht wirklich über den ersten Schock hinweg.
»Bruder, du kriegst angemessenen Ersatz«, versprach Hakim und strahlte dabei wie ein Muslim, der von seiner Hauptfrau nach fünf Mädchen den ersten Sohn geschenkt kriegt. »Wir helfen dir beim Packen der wichtigsten Unterlagen und fahren das sofort in dein neues Büro. Nicht so eine abgefuckte Hipster-Scheiße wie hier. Dort ist der Kiez noch authentisch.«
Der letzte Satz klang wie derjenige einer Prostituierten, die ihrem nach einer Minute kommenden Freier versicherte, dass er der allertollste Hengst im ganzen Stall war. Ich gab mir nicht die Blöße nachzufragen, wo, sondern beschloss, alles auf mich zukommen zu lassen.
Als ich dann aber mein neues Domizil über der Stadtautobahn thronend zum ersten Mal bestaunen durfte, wurde mir beinahe etwas übel und ich bereute, die halbe Flasche Wodka nicht eingepackt zu haben. Nicht nur, dass Moabit angeblich die härteste Justizvollzugsanstalt in ganz Deutschland besaß, sondern der Kiez war auch sonst nicht ohne. Es gab Viertel in Berlin, in denen es keinen Unterschied machte, ob man sagte »Ich habe gerade in die Hose gekackt« oder »Ich wohne in Moabit« – das Ergebnis war in den Augen der Betrachter dasselbe: braun und ziemlich beschissen.
Nun denn, Home sweet Home. In der Gosse hatte ich mich doch immer schon am wohlsten gefühlt, und für mich galt wie für viele: einmal Gosse, immer Gosse. Wieso also nicht Moabit? Da blieben mir zumindest die Müsli fressenden und notorisch den Besen schwingenden Schwaben ebenso wie die Hipster mit ihren Macs und lactosefreien Latte Macchiatos erspart. Auch optisch entsprach die weibliche, überwiegend mit türkischem Migrationshintergrund versehene Bevölkerung eher meinem Beuteschema als die 08/15-Ossi-Schlampe mit den blondgefärbten Haaren, einer Ostblock-Dauerwelle und verwässerten blauen Augen.
Nur die kaputte Heizung störte mich mit der Zeit. Ich warf mir 600 Milligramm Tramadol und eine halbe Diazepam ein, schluckte alles auf einmal trocken runter und hoffte, dass die wärmende Wirkung schnell einsetzen würde, wobei ich wusste, dass die Retard-Tabletten durchaus einige Zeit benötigten, bis sie anschlugen. Aber Mörser und Stößel waren zu Hause, sodass ich sie nicht zerkleinern konnte, um die Wirkung zu beschleunigen.
Beim Hochtragen der letzten von fünf Kisten hatte mir Ali noch hoch und heilig versprochen, dass sich sehr bald Handwerker melden würden, um die winzigen Baustellen des »Büros« zu reparieren: Heizung, Fußboden, Schimmel, Wasserschaden und so weiter. Allerdings wusste ich aus Erfahrung, dass das arabische »sehr bald« einen sehr dehnbaren Begriff darstellte. Ich konnte den Jungs in dieser Sache nur zugutehalten, dass sie mich als Quasi-Entschädigung noch nicht um eine erste Miete gebeten hatten. Zudem deckten sie mich mit reichlich Material ein, das gegen Kälte und schlechte Gedanken half. Das alles half nicht gegen Blasenentzündungen und Augenkrebs wegen des heruntergekommenen Zustands der Bude, wirkte aber ein wenig gegen meinen Blues. Ich spielte mit dem Gedanken, Büro und Wohnung zusammenzulegen und mich mit Klienten digital in einem Café oder einer Kneipe zu verabreden. Aber irgendetwas hielt mich zurück, da mein Selbstbild und Berufsverständnis mit der Vorstellung eines eigenständigen Büros einhergingen. Das verlieh mir Identität, und Identitäten gab man nicht nach Belieben weg, wenn man für fünf Cent Ehre im Leib besaß.
Ich baute mir also einen Monster-Joint mit feinstem marokkanischem Pollen und beschloss, weiter auf die Handwerker zu warten, die eigentlich bereits vor drei Stunden hätten aufschlagen müssen. Allerdings waren Handwerker in der gesellschaftspolitischen Gesamtsituation eines der geringsten Probleme. Auch wenn die Konsequenzen wortwörtlich eiskalt waren. Ich beschloss, ihnen noch eine halbe Stunde zu geben und dann Hakim telefonisch meine gute Laune unmissverständlich zu kommunizieren. Sollte das nichts fruchten, würde ich demnächst Aras anrufen. Dann würde es sicher nicht lange dauern, bis die Handwerker auftauchten. Aber zunächst sollte jeder sein Gesicht wahren können, auch wenn ich wegen der verfluchten Kälte schon wieder das stille Örtchen aufsuchen musste.
2.
In letzter Zeit war es kaum mehr möglich, die privaten Ereignisse von den gesellschaftspolitischen Phänomenen zu trennen. Denn das Privatleben wurde stärker denn je davon beeinflusst, welche Auswirkungen das Virus auf die sozioökonomische Entwicklung entfaltete. Es entstand das Gefühl, sich in der Geiselhaft eines die Gesellschaft durchseuchenden Virus zu befinden. Dass jeder das Virus anders einordnete und er mit vielen Metaphern wie Virus des kapitalistischen Systems versehen wurde, vereinfachte die Dinge nicht unbedingt, sorgte aber für engagierte Diskussionen.
Die Jahreszeiten wurden zu einem Wechselbad der Gefühle und krasser hätten die Gegensätze kaum ausfallen können. In den wärmeren Monaten gab es kaum noch beängstigende Infektionszahlen, wenig durch das Virus bedingte Tote und viele der Masken waren von den Gesichtern gewichen. Die Menschen simulierten die ach so gewohnte und geliebte Normalität im Umgang mit dem täglichen Wahnsinn – Hauptsache sie konnten ihr Feierabendbier am Spreeufer genießen und später am Abend in den Clubs oder Kneipen auf die Pirsch gehen, auch wenn die meisten Abende allein mit einem Bier als Absacker auf dem Sofa endeten. Solange das Zwischenmenschliche mit all seinen Höhen und Tiefen perspektivisch vorhanden war, endete der Optimismus nicht, denn es bestand immer die Aussicht auf Besserung. Prinzip Hoffnung, auch wenn es fast nie funktionierte.
Doch inzwischen traute ich dem scheinbaren Frieden nicht mehr. Denn der Frieden war definitiv ein für alle Mal vorbei – wenn jemals überhaupt einer geherrscht hatte. Durch die tägliche Berichterstattung über Infektions-, Toten- und Inzidenzzahlen baute sich eine unüberwindbare Mauer des kollektiven Traumas auf. Lediglich die von den Herrschenden und Medien verwendeten Metaphern wandelten sich stetig. Sprache war Macht, und die ganz gezielt gewählte Semantik der Herrschenden war bestimmend für das Leben der großen Masse. Viele, die diese Zusammenhänge nicht erkannten, drohten daran zu zerbrechen, indem sie sich nicht mehr vor die Türe trauten, Zwangskrankheiten entwickelten oder anderweitig dermaßen am Rad drehten, dass sie Chemie wie Cornflakes in sich rein schaufelten und mindestens eine stationäre psychische Behandlung aufsuchen mussten. Eines war klar, die Pharma-Industrie gewann an allen Fronten.
So waren aus den Pandemiewellen und Virusvarianten inzwischen unüberwindbare Gebirge und richtige Kriegsschauplätze geworden. Die Gesellschaft war in meinen Augen so gespalten oder homogen wie immer – es wurde nur inzwischen dem Ganzen ein so tiefer Riss zugesprochen, dass er anscheinend nicht mehr gekittet werden konnte. Dabei beschlich mich das Gefühl, dass niemand ein wirkliches Interesse an einem vernünftig geführten, demokratischen Diskurswesen mehr besaß. Nur das Cui Bono und Quo Vadis waren mir und vielen anderen nicht völlig klar.
Bei genauerer Betrachtung stimmte es vielleicht in gewisser Weise, dass die gesellschaftlichen Gräben immer tiefer wurden. Es herrschte ein Krieg der Worte, der über alle Kanäle aller Medien ausgetragen wurde, wobei der eigentliche Clou darin bestand, dass eine gigantische Umverteilung von unten nach oben stattfand.
Es half nichts: Kein TV, kein Internet und keine Zeitung waren schließlich auch keine dauerhafte Lösung. Eine Fahrt durch die Hauptstadt reichte aus, alles trat klarer zu Tage als in jeder noch so reißerisch aufgemachten Berichterstattung. Überall und ständig gab es Demonstrationen, gewaltsame Zusammenstöße, Uniformierte an der Grenze ihrer Belastbarkeit, oft dienstunfähig, manchmal in Quarantäne und am meisten vom Burnout bedroht und ein Gesundheitssystem, das sich nun auch noch mit den Kollateralschäden von gewalttätigen Demonstrationen, Gegendemonstrationen und der dazwischen gepackten Staatsmacht beschäftigen musste. Inzwischen schenkten sich die Demonstranten und die Staatsmacht in Sachen Strategie, Taktik und Brutalität beinahe nichts mehr. Die Polizei passte ihre Taktik immer schnell derjenigen der protestierenden Bürger an, die ihrerseits von linken Genossen und rechten Kameraden exzellent geschult wurden, sodass sie der Polizei mehr Bauchschmerzen bereiteten, als ihr lieb sein konnte. Und diese alten Kämpfer fühlten sich in ihrer Kriegerehre mindestens so potent wie im zweiten Frühling und sahen je nach politischer Ausrichtung einen je nach Einstellung roten oder braunen Hoffnungsschimmer am Horizont aufleuchten, da die Parameter beinahe ideal für eine Revolution erschienen.
Was mich daran besonders faszinierte, war, dass die Farben Schwarz und Weiß immer mehr zu einem Dunkelgrau emergierten, das nirgendwo zugeordnet werden konnte. Das inzwischen in Verruf geratene, antiquierte Hufeisen-Schema von links und rechts gab es zwar immer noch, aber nur dem Namen nach. Denn die beiden ehemals verfeindeten Lager hatten sich gegen die Herrschenden nach dem Motto »der Feind meines Feindes ist mein Freund« zusammengeschlossen. Die Feinde der Freunde schienen irgendwo im politischen Nirgendwo zu stehen und die Samthandschuhe waren schon längst von allen beteiligten Akteuren ausgezogen worden.
Die Grenzen verschwammen, altbekannte Freund-und-Feind-Schemata griffen also nicht mehr und die Ordnungshüter wirkten wie der unbeliebte, aber nötige Punchingball einer herrschenden Clique, die weder ein noch aus wusste, aber alles so weiterlaufen lassen musste, damit sich die ganz Großen weiter die Taschen vollstopfen konnten. Business as usual, nur unter etwas veränderten Vorzeichen.
Für das Phänomen einer gemeinsamen Protestbewegung hatte sich nach und nach der Begriff »Querfront« eingebürgert. An einem beliebigen Nachmittag, der durch einen sanften Opioid-Benzodiazepin-Rausch abgemildert wurde, hatte ich herausgefunden, dass der Begriff Querfront aus der Weimarer Republik stammte, als die erste Demokratie auf deutschem Boden von den antagonistischen politischen Richtungen böse in die Zange genommen wurde. Die Welt war verrückt geworden – keine der altbekannten Richtungen und Orientierungsmuster passten mehr. Willkommen in der neuen, schönen Welt. Nur, dass weder Lebend- noch Tot-Impfstoffe das neue Soma waren, das die Bevölkerung dringender denn je benötigte. Dieses musste wohl erst gefunden beziehungsweise auf dem Schwarzmarkt organisiert werden.
3.
Ich saß im T-Shirt im neuen Büro mit der defekten Heizung und schwitzte. Ein Anruf bei Aras und eine halbe Stunde später hatte ich eine Lieferung erhalten, die höchstkriminell war, aber was wollte ich auch schon von einem Clanboss anderes erwarten? Drei Heizpilze standen jetzt in meinem Büro, und ich kam mir vor wie die letzte Umweltdrecksau. Aber warm war es immerhin. Und Aras hatte mir versichert, die Handwerker würden morgen Nachmittag kommen. Selbst für einen Clanchef war es in der Hauptstadt schwierig, ad hoc Handwerker zu organisieren. Ahmed, der gegenüber wohnte, hatte mir zum Einzug und auf gute Nachbarschaft mit vielen Verbeugungen und Geklopfe auf seine Brust sechs kleine Schultheißflaschen geschenkt. Seitdem wusste ich nicht, ob ich ihm trauen konnte, denn wer diese Biersorte verschenkte, wollte entweder Menschen zu Antialkoholikern bekehren oder ihnen die Pest an den Hals wünschen. Wahrscheinlich hatte er das Bier von einem deutschen Freund mit dem Hinweis erhalten, sich doch etwas mehr zu integrieren. Ich öffnete gerade eine der Flaschen, als das Handy zu klingeln begann.
»Hardy Hacke, Privatermittlungen«, meldete ich mich.
»Charly hier.«
Ich schluckte. Wieso um alles in der Welt rief mich mein Bullenfreund Charly vom LKA an?
»Zeit, dass du dein Versprechen einlöst«, durchbrach er die Stille.
Ich überschlug kurz im Kopf, wie viele Puffbesuche ich ihm für seine nicht immer nach Dienstvorschrift laufenden Freundschaftsdienste versprochen und nicht eingelöst hatte. Mindestens zwei.
»Wie wär's denn mit dem Artemis?«
Bam – dass er so mit der Türe ins Haus fiel, hatte ich nicht erwartet. Artemis, der Edel-Puff mit Wellness-Oasen direkt bei der Messe ICC. Zum Glück war mein Konto gut gefüllt. »Weiß nicht, ob ich mitswinge, aber versprochen ist versprochen. Und wie es gerade aussieht, passt es auch zeitlich.«
»Meine Alte hat doch ...«
Oh je, die alte Leier. Charly und seine holde Gattin schossen liebend gerne nebenraus und rieben dann dem jeweils anderen unter die Nase, wie fantastisch es gewesen sei. Obwohl ich das Handy auf den Schreibtisch gelegt hatte, um mich mit einem Schluck Bier für die Geschichten zu stärken, hörte ich doch noch die Worte »multi-multiple Orgasmen« und »Dauer-Squirten« nach heftiger »Anal-Penetration«. Vielleicht hatte sich seine Frau das alles erträumt, vielleicht hatte sie es erfunden, um ihn auf die Palme zu bringen, oder aber sie hatte Glück gehabt und ein Naturtalent gefunden. Charly tat mir auf jeden Fall leid.
»17 Uhr vor dem Eingang?«, kürzte ich deshalb die Klagelitanei ab.
»Nein. Ich habe noch einen Einsatz, der bis 19 Uhr dauert. Eine Querfront-Fahrraddemo. Aus den Chatverläufen wissen wir, dass die Demonstration vor dem Wohnsitz vom hiesigen Senator für Inneres enden soll. Da treibe ich mich in Zivil rum und würde mich freuen, wenn du mir Gesellschaft leistest und wir anschließend ins Artemis ...«
Ein Blick aus dem Fenster und ich schauderte. Knapp unter Null, eine Mischung aus Nieselregen und Schnee und finsterste Nacht. Mir stand weder der Sinn danach, arme Frauen sexuell auszubeuten, noch Charlys Begleiter bei einer Querfront-Demo zu spielen, aber mir fielen etliche Gründe ein, warum ich es dennoch tun sollte, denn er hatte mir beim Lösen so manchen Falls zur Seite gestanden.
»Klar!«, sagte ich und versuchte so viel Elan wie möglich in meine Stimme zu legen.
Er nannte mir eine feine Adresse im Westend. Ich trank das Bier aus, ging zum kleinen Waschbecken, wusch mir den Schweiß unter den Achseln ab und nahm ein weißes Hemd aus dem Schrank. Es war mein einziges weißes Hemd, das ich nur bei speziellen Anlässen anzog.
4.
Keine dreißig Sekunden später klingelte es. Ein schneller Blick auf die Uhr verriet mir, dass ich mindestens noch eine halbe Stunde Zeit hatte. Zur Not musste Charly ein paar Minuten allein auf den Senator aka Typen vom Verfassungsschutz aufpassen.
»Hallo?«, fragte ich aus reiner Gewohnheit, bevor ich den Summer drückte.
Das von einer geschlechtslos klingenden Stimme geäußerte »Hallo« verstand ich gerade noch so. Es folgte ein Wort, das von »Gscheitle« über »Scheible« bis zu »Schräuble« alles heißen konnte. In der Hoffnung auf eine deutlichere Kommunikation drückte ich den Türsummer und befürchtete, dass ein Teenager oder Spätzünder mich mit einem Logopäden verwechselte. Dann fiel mir aber wieder ein, dass es in ganz Moabit sehr wenig Logopäden gab, was nicht an der Sprachperfektion der in diesem Stadtteil aufwachsenden Kinder lag, sondern daran, dass sich die meisten hier lebenden Eltern mit Migrationshintergrund eine logopädische Behandlung aus verschiedenen Gründen weder leisten wollten noch konnten – auch wenn die Sprösslinge sie dringend benötigten.
»Grüß Gott!«, hörte ich eine zaghafte Stimme im Flur. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wann es das letzte Mal gewesen war, dass ich diesen Gruß gehört hatte – vielleicht in einer Kneipe von einem bayrischen Touristen oder einer schwäbischen Hausfrau, die Putzmittel ausleihen wollte. »Ist hier jemand?«
»Kommen Sie einfach rein, die Tür ist offen.«
Die Stimme hörte sich merkwürdig an. Sie klang tief und hoch zugleich, ganz so, als ob sie sich jede Sekunde überschlagen würde. Auch ohne psychologisches Grundstudium konnte man ahnen, dass die Person weit davon entfernt war, ihre innerliche Mitte gefunden zu haben.
»Hier?«, fragte die Stimme zögerlich und ich sah, wie ein winziger Frauenkopf mit halblangen grauen Haaren, die bestimmt seit einer Woche nicht mehr gewaschen worden waren, zur Tür reinlugte.
»Vollkommen richtig. Hier.«
Jetzt traute sich der Rest des Körpers in die gute Stube. Ich stand auf und mir wurde bewusst, dass die Frau zwar nicht unbedingt kleinwüchsig war, ich sie aber um mindestens zweieinhalb Köpfe überragte. Wir schüttelten uns die Hand. Ihr Händedruck wirkte genauso verhuscht wie der Rest ihrer Person. Sie trug eine günstige graue Allwetterjacke und Jeans, die nicht über zwanzig Euro gekostet haben konnten. Körperpflege und eine gepflegte Präsenz gehörten wohl nicht zum gewöhnlichen Erscheinungsbild der Dame. So vermittelte sie den Eindruck eines ungepflegten Zwergs, der sich wenig darum kümmerte, was andere über ihn dachten. Die Einstellung war mir an sich sympathisch, auch wenn das Ergebnis meine Augen ein wenig schmerzte, aber ich musste sie ja nicht heiraten.
»Hacke mein Name, nehmen Sie doch bitte Platz«, forderte ich sie auf und war stolz darauf, dass Dank Aras' Männern mein Büro komplett eingerichtet war. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, stellte ich eine beinahe rhetorische Frage, denn außer dem guten alten Hahnenquell und drei Schultheiss-Bieren hatte ich nichts anzubieten.
»Noi, danke, nix zom Dringge. Kaddrin Scheuble«, murmelte sie gedankenverloren. Ich wusste nicht, ob sie mich beschimpfte oder mir ein Kompliment machte.
Hoffentlich war die ältere Dame halb blind, sodass sie nichts von den zig Baustellen in dem Zimmer bemerkte. Doch für so etwas schien sie gar nicht den Nerv zu besitzen, denn sie setzte sich vorsichtig und in sich versunken hin. Außerdem: Wer so wenig auf sein eigenes Äußeres achtete, der hatte vermutlich auch keinen kritischen Blick für seine Umgebung. Als sie ergebnislos an ihrem blauen Jutebeutel herumfummelte, glaubte ich einen Augenblick lang, sie würde Klangschalen und Räucherstäbchen hervorzaubern, um mit einer Meditationssession zu beginnen. Doch nachdem sie entnervt den Jutebeutel wieder auf den Boden gestellt hatte, sagte sie einen Satz, den ich erneut nicht verstand. Ich grübelte darüber nach, welche Sprache sie sprach. Vielleicht sollte ich ihr einen Logopäden oder einen Berliner Sprachintegrationskurs empfehlen. Als ich dann »Roitlinge boi Stuttgart« verstand, wurde mir klar, dass eine waschechte Schwäbin vor mir saß.
»Ich möchte nicht unhöflich sein, aber können Sie das letzte noch einmal wiederholen?«, bat ich sie. »Wir Berliner sind so ignorant, dass wir nur unseren eigenen Dialekt verstehen, hehe.«
Sie schaute mich vollkommen schockiert an. Dabei hatte ich sie gar nicht gebeten, sich den Finger in den Arsch zu stecken und umzudrehen, sondern lediglich, sich für alle Nicht-Schwaben verständlich zu äußern. Sie räusperte sich, und ihre helle Gesichtshaut wurde von einem Hauch Rot überzogen.
»Ich möchte, dass Sie herausfinden, ob mein Herbert mir treu ist«, ließ sie die Katze aus dem Sack und gab sich Mühe, verständlich zu sprechen. »Ich kann die Situation nicht mehr ...«
Innerlich zuckte ich zusammen, denn Scheidungs- und Herzschmerzsachen machte ich grundsätzlich nicht. Das Prinzip durchbrach ich ausschließlich dann, wenn mein Kontostand mit dem Wattenmeer vergleichbar war und ich mir nicht nur um Substanz-Nachschub, sondern sogar um das tägliche Bier im Kühlschrank Sorgen machen musste.
»Wissen Sie, mein Herbert und ich sind sehr in der Querfront-Szene engagiert.«
Zack, jetzt hatte sie mich am Haken. Querfront-Szene klang tausend Mal interessanter als Herbert, der gerne mal was mitnahm, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Die Gefahr, die laut allen Mainstream-Medien von dieser Frau für die Allgemeinheit ausging, versuchte ich auszublenden, was nicht schwerfiel, denn sie wirkte wie ein Arbeitself aus der Weihnachts-Putzkolonne.
»Schön, dass Sie und Ihr Gatte ein gemeinsames, hm, äh Interessengebiet besitzen«, sagte ich. »Das ist eine bessere gemeinsame Grundlage als bei den meisten Beziehungen, die ich kenne«.
Ihre graugrünen Augen, welche die Harmlosigkeit ihres Körpers Lügen straften, bedachten mich mit einem mörderischen Blick. Überhaupt: Ihre Augen waren ein Rätsel. Wieselflink mit einem Hauch von ADHS, eine unglaubliche Energiequelle und etwas, das ich generell als Härte auslegte, die vor dem Gesamthintergrund ihrer Erscheinung nicht unterschätzt werden durfte. Ich wollte auf jeden Fall nicht mit Herbert tauschen, sollte sich herausstellen, dass er beim Plakate Malen seinen Pinsel mal versehentlich in den falschen Farbtopf getunkt hatte.
»Das ist ein Kampf auf Leben und Tod«, sagte sie, ihre Stimme überschlug sich, und ich überlegte, wo ich eine Plastiktüte hatte, denn wenn sie so weitersprach und sich noch mehr in die Politikthematik reinsteigerte, stand sie kurz vor dem Hyperventilieren. »Verstehen Sie denn nicht, was die da oben mit uns spielen? Die wollen uns alle mit ihrem Gift eliminieren. Eliminieren! Damit die alles haben können ...«
Die Wiederholung von eliminieren schrie sie beinahe, während sie bei »die« und »alles« deutlich leiser wurde. Ich hatte beinahe Angst, dass ein wütender Ali bald an der Tür klopfte und um Ruhe bat, womit er bestimmt bei einem deutschen Integrationskurs punkten konnte. Ich versuchte mich aus der Affäre zu ziehen, ohne Standpunkt beziehen zu müssen. »Ich kenne so ziemlich alle Meinungen in dieser Debatte. Das ist eine knifflige Sache, egal, aus welcher Perspektive man sie betrachtet.« Mit meinen Ausflüchten war ich froh, dass Politiker einem jeden Tag wunderbare Beispiele für inhaltslose Worthülsen lieferten.
»Eben«, interpretierte sie das als Zustimmung. »Jeder, der lesen kann und sich noch seines Gehirns bedient, weiß ganz genau, was gespielt wird. Dass das alles eine Inszenierung ist, damit nur die Superreichen überleben und uns in Knechtschaft halten. Das ist ein ganz abgekartetes Spiel auf unsere Kosten!«
Ihr schien der Widerspruch ihres vorletzten Satzes nicht aufzufallen. Aber bei der Erwähnung von so viel Spielen wurde mir beinahe warm ums Herz. Ich versuchte mich daran zu erinnern, wie oft meine Mutter mit mir während meiner Kindheit gespielt hatte. Vermutlich reichte eine Hand locker aus, die Gelegenheiten aufzuzählen. Doch das war nicht der richtige Zeitpunkt, um sentimental zu werden.
»Sie haben den Verdacht, dass Ihr Ehemann Querfront-Querschießen betreibt?«, versuchte ich die Situation aufzuheitern.
Das ging komplett schief. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich sofort von meinem Chefsessel gerutscht und nie wieder aufgewacht. Zugleich hätte ich mir am liebsten auf die Zunge gebissen, denn mein Verhalten war nicht professionell.
Ich nahm mir vor, ab jetzt alle Vorurteile, Witze und politischen Gräben auszublenden und in jeder Hinsicht politisch korrekt zu bleiben. Ein Auftrag war ein Auftrag, und wir waren noch nicht ansatzweise zum Kern der Sache vorgedrungen. Irgendwie hatte mich die Kombination von Querfront und Fremdgehen getriggert. Frau Scheuble seufzte, als ob sie alle Last dieser Welt auf ihren Schultern zu tragen hätte.
»Zuerst der große Reset, der uns alle unterwerfen oder aber auslöschen wird, und dann noch mein Herbert, der ...«
Sie war wieder kurz davor, in Tränen auszubrechen, aber ich konnte es nicht über mich bringen, um den Schreibtisch herumzugehen, um sie in den Arm zu nehmen. Nicht, dass die Seufzer in Stöhnen übergingen, denn wenn ihr Herbert so ein wilder Querfront-Feger war, dann konnte man das bei seiner Frau ja nicht komplett ausschließen ...
»Sie wissen ja gar nicht, was die Illuminaten, die Freimaurer, die geheime Weltregierung, ja man darf das gar nicht sagen, aber auch die Ju...«
Wie ein abgewichster Oberlehrer hob ich den rechten Zeigefinger in die Höhe, um sie zum Schweigen zu bringen und nicht losreihern zu müssen. Hätte sie das Wort ausgesprochen, wäre sie unverzüglich vor meiner Türe gelandet.
»Erzählen Sie mir von Herbert und sich«, gab ich mir Mühe, das Geschäftsanbahnungsgespräch weiter am Laufen zu halten.
Wieder dieser einzigartige Seufzer, der die Frage aufwarf, welche Tabletten denn der guten Frau wohl ein wenig helfen würden. Sie begann wie ein Wasserfall zu reden ...
Kurzgefasst: Die staatliche Verschwörung hatte damit begonnen, dass sie und ihr Göttergatte Herbert von der Rentenstelle um einen vierstelligen Betrag betrogen worden waren – monatlich versteht sich. Dann kam die große »Plandemie«, und weil sie ihr ganzes Leben so hart und ehrlich gearbeitet hatten, ohne etwas davon zu haben, hatten sie beschlossen, etwas zu tun, wovor sie in ihrer Jugend Angst gehabt hatten. Sie leisteten Widerstand gegen die Staatsgewalt und entdeckten, wie viel Spaß das machte. Welcher höhere Sinn ihrem Leben verliehen wurde. Jetzt waren sie die Wilden und Mutigen.
»Alles begann ganz harmlos«, bog sie in die Zielgerade ein. Ein verstohlener Blick auf meine Uhr zeigte mir ein perfektes Timing auf. Ich konnte es noch rechtzeitig zu meinem Date mit Charly schaffen, es sei denn, sie wollte mir die große Weltverschwörung in allen Einzelheiten erklären. »Zuerst fiel ich drei Wochen krankheitsbedingt aus. Sie wissen schon, so eine Frauensache ...«
Eigentlich hatte ich keine Ahnung, was die Frauensache sein sollte, wollte aber ihren Redefluss nicht durch unnötiges Nachhaken unterbrechen.
»Herbert ging seiner Pflicht nach und demonstrierte weiter«, fuhr sie fort. »Als ich wieder gesund war, fielen Herbert Gründe ein, wieso er zu dieser oder jener Demo allein hinmusste und mich nicht mitnehmen konnte. Einmal gab es keinen Platz mehr im Auto, das andere Mal meinte er, es sei schlicht zu gefährlich, da die Bullen auf Blut aus seien und so weiter und so fort. Er ist so erfindungsreich. In dieser Art ging es noch fünf Minuten weiter. Seltsame WhatsApp-Nachrichten von einer Ines, die sie nicht kannte, Liebesmails sogar auf dem offiziellen Account ihres Gatten und ein nicht mehr wiederzuerkennender Herbert, der sich um hundertachtzig Grad gewandelt hatte und sie beinahe mustergültig ignorierte. Das Wort Sex fiel kein einziges Mal, sodass ich schloss, dass dieses Kapitel wohl keine allzu große Rolle mehr in ihrer Ehe spielte. Ihr schien es mehr ums Prinzip und um die Ehre zu gehen.
»Herbert ist dieses Wochenende in Berlin, um Flagge zu bekennen. Ich bin ihm heimlich nachgereist. Er weiß nichts von meiner Anwesenheit hier. Finden Sie heraus, ob er mir untreu geworden ist. Aus seiner Korrespondenz weiß ich, dass diese Ines auch da ist. Und gnade ihm Gott, wenn ...«
Da lag der Auftrag offen vor mir. Weder besonders spannend noch lukrativ oder originell. Aber die Mischung aller Parameter machte ihn doch interessant. Und mein Konto würde auch keinen Aufstand veranstalten, wenn es noch mehr ins Plus kam.
»Tausend Euro Vorschuss. Als Freundschaftspreis fünfhundert Euro Tagessatz plus eine einmalige Gefahrenzulage von siebenhundertfünfzig Euro. Wenn ich Herbert dieses Wochenende nichts nachweisen kann, ist der Fall vom Tisch. Ich denke, dann können Sie davon ausgehen, dass alles ein Missverständnis war und Ihr Gatte eine treue Seele ist.«
Sie sah mich wie einen Geistesgestörten an. Das lag ausschließlich an den Preisen, die eine wackere Schwäbin natürlich vom Hocker hauen mussten. Dann blickte sie sich sehr genau im Büro um. Vielleicht wollte sie mir einen Deal vorschlagen, das Honorar durch Putzen abzuarbeiten.
»Des isch abbber würglich a Menge Geld«, fiel sie vor lauter Schreck in ihren Dialekt zurück. »I woiß gar it, ob i des so stemme kann ...«
Mir war es egal. Take it or leave it.
»Da ist schon ein politischer Soli-Bonus inklusive«, klärte ich sie auf. Sie nahm es für bare Münze.
Das Wort Bonus zauberte ein verbissenes Lächeln auf ihre schmalen Lippen. Es war einfach, Schwaben glücklich zu machen.
»Na gut, dann krieget hald unsre Kindär a weng weniger«, schwäbelte sie wieder weiter. »Aber i muss hald Gwissheit hänn. Moin Herrbert, ach ...«
In aller Eile druckte ich die Formulare aus, die wir beide unterschrieben. Mit knirschenden Zähnen zählte sie jeden Hunderter des Vorschusses mit einer Dignität auf den Schreibtisch, als ob es sich um ein Stück vom Leichentuch unseres Herrn Jesu persönlich handeln würde. Zum Abschied schüttelten wir uns die Hände, und ich fragte mich, wie lange es dauern würde, bis ich ihren wirren Blick aus meinem Gedächtnis streichen konnte.
Auf jeden Fall würde ich zu spät zu Charly kommen. Ich wusste genau, dass der alte Ossi sich das mit reichlich Artemis-Bier vergolden lassen würde, das exakt zehn Euro das Glas kostete – ohne Trinkgeld, versteht sich.
5.
Ich kam neunundzwanzig Minuten und drei Sekunden zu spät. Per WhatsApp dirigierte er mich zu seinem Standort.
»Verzeihung!«
»Dürfte ich bitte ...?«
»Bitte Vorsicht mit der Fahnenstange.«
Die Erwiderung der Demonstranten waren nicht alle freundlich, aber schließlich gelang es mir, eine Schneise durch den Fahrradkorridor zu schlagen.
»Hier ..., Charly ..., drüben!«
Die Stimme kam mir bekannt vor und als ich nach rechts schaute, piekte ich mir beinahe an einer Stange ein Auge aus, auf welcher der Spruch »Keine BfVs und LfVs – Volksverbrechern keine Chance!« stand.
»Alter, hier ...!«
Ich kämpfte mich nach rechts durch die Protestler in Richtung Gartenzaun. Vor dem reichlich verzierten Torbogen einer Villa stand mein LKA-Freund auf einem zirka zwei Meter erhöhten Podest und versuchte gleichzeitig, mich auf sich aufmerksam zu machen und dennoch das Demonstrationsgeschehen im Auge zu behalten. Dabei wirkte er wie ein übereifriger Circusclown.
Charly sah aus, als hätte seine Frau ihm gerade stundenlang erzählt, was ein gut bestückter Kenianer mit ihr tagelang angestellt hatte, und als sei er zum Schluss gekommen, dass es ab jetzt überhaupt keinen Sinn mehr machte, wenn er seine Minisalami aus deutscher Wertarbeit weiter in ihre Höhle schob, da weder sie noch er etwas davon mitkriegen würden.
»Schade, dass du da bist«, fuhr er mich an und strich mit dem rechten Zeigefinger über seinen 80er Jahre Pornobalken, der vielleicht in ehemaligen Zonenrandgebieten und Friedrichshagen noch als flott durchging. »Gleich geht's los. Immer erst kommen, wenn's abgeht, das ist billig. Ich stehe mir seit Stunden die Beine in den Bauch und hole mir Frostbeulen ab.«
Freundschaftlich tätschelte ich ihm die Schultern und murmelte eine Entschuldigung.
»Da drin wohnt der Innensenator und Chef des Berliner Landesamts für Verfassungsschutz, Herzig«, erzählte Charly und zeigte auf eine der prächtigen Gründerzeit-Villen, die sich in der engen Sackgasse wie an einer Perlenschnur aufreihten.
»Allein?«
»Das kann sich selbst der Sack nicht leisten«, knurrte Charly und dachte wahrscheinlich daran, welche Preisklassen hier für ihn in Betracht kamen – da wurde es sehr dünn.
»Sicherheitsgründe?«