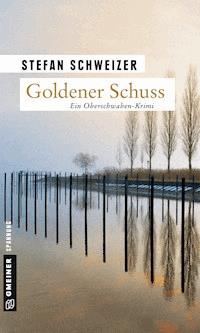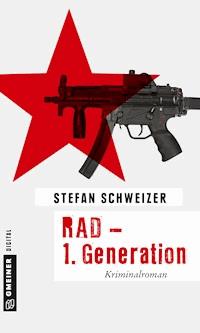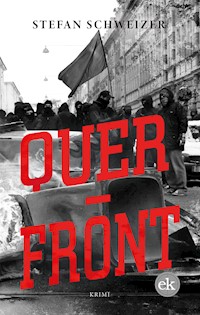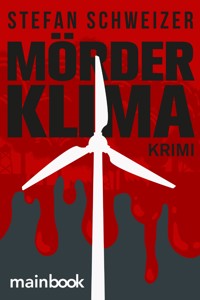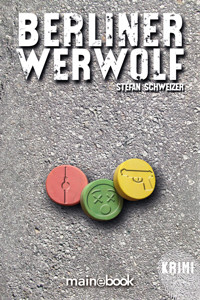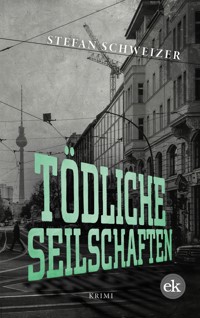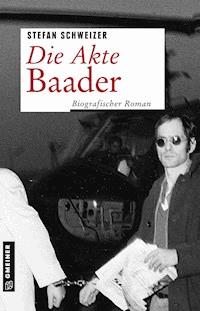
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Andreas Baader wächst ohne Vater bei Mutter, Tante und Großmutter auf. Früh zeichnen sich trotz verzweifelter Bemühungen der Mutter schulische Probleme und berufliches Scheitern ab. Baader schlittert in die Kriminalität, bewegt sich gern in der halbseidenen Münchener Schickeria, um dann in Berlin einen Politisierungsschub zu erfahren. Mit der Kommune 1 und der Kaufhausbrandstiftung 1968 vollzieht sich sein Weg vom Rebell zum Revolutionär. Mit der Gründung der linksrevolutionären Roten Armee Fraktion (RAF) wird er zum Staatsfeind Nr. 1!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Schweizer
Die Akte Baader
Biografischer Roman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
RAD – 1. Generation (E-Book Only, 2015), Goldener Schuss (2015)
Personen und Handlung sind teilweise fiktiv.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: Poizeihistorischer Verein Stuttgart e.V.
ISBN 978-3-8392-5596-4
Inhalt
Impressum
Inhalt
1 Einsame Nächte
2 Kindheit
3 Jugend und Schule
4 Junger Erwachsener
5 Abgleiten in die Kriminalität
6 Berlin und Kommune I
7 Terrorpaar: Baader und Ensslin
8 Die Kaufhausbrandstiftung
9 Verhaftung
10 Prozess und Gefängnis
11 Revision und weitere Politisierung
12 Abtauchen
13 Rückkehr nach Deutschland
14 Waffenbeschaffung – Ein V-Mann – Baaders Verhaftung
15 Baader-Befreiung
16 »Natürlich kann geschossen werden«
17 Der Dreierschlag Berlin
18 Die Mai-Offensive
19 Verhaftung in Frankfurt
20 Weitere Verhaftungen, Isolationshaft und Hochsicherheitstrakt
21 München 1972, Infosystem und Hungerstreik
22 Erste Lebenszeichen einer neuen RAF
23 Der Jahrhundertprozess
24 Meinhofs Selbstmord und ein Neuzugang im siebten Stock
25 Andreas’ Befehl: Abtauchen
26 Die Offensive 1977
Nachwort
Lesen Sie weiter …
1 Einsame Nächte
Die unzähligen, endlosen und einsamen Nächte waren für Andreas Baader das Schlimmste. Dann war er auf sich zurückgeworfen. Es gab weder Flucht noch Ablenkung. Mit sich selbst allein und mit genügend Zeit, darüber nachzudenken, was in seinem Leben alles gründlich schief gelaufen war und wann er welche Fehler begangen hatte. Dann pochte seine Halsschlagader wild, und eine Zornesader an der Stirn trat deutlich hervor. Jetzt war er so voller Hass auf sich selbst wie beinahe sein ganzes Leben lang auf alles, das anders war als er, auf alles, das seinen Wert aus dem Gefälligen, Bürgerlichen und Normalen bezog. Sein Herz schlug so laut, dass er dachte, das ganze Gefängnis, die ganze Stadt, ja ganz Deutschland müsse es hören.
Bumm! Bumm! Bumm!
Doch diese Anzeichen von Schwäche und Menschlichkeit wollte er sich nicht zugestehen und sie unter allen Umständen vor seinen Feinden verbergen. Sie durften auf keinen Fall herauskriegen, dass seine unermessliche Wut nicht nur politische Gründe hatte, sondern tief in seinem Wesen angelegt war und nichts mit Politik und den gesellschaftlichen Zuständen zu tun hatte. Denn das war seine Legende, die all sein Tun abdeckte: Er, der Revolutionär, der aus politischen und moralisch-ethischen Gründen die bürgerliche Gesellschaft hasste und bis aufs Blut bekämpfte. Für seine Freunde und Mitkämpfer musste man stark sein, Rückgrat beweisen, unbesiegbar und Vorbild bleiben. Niemals eingestehen, dass es neben politischen Gründen noch weitere gab, die zu den zahlreichen Toten, Verletzten und dem millionenschweren Sachschaden geführt hatten. Als er die Attentate vorbereitete und durchführte, hatte er sich stark, beinahe unbesiegbar gefühlt. Aber die Angst, die ihn nachts überkam, nagte unaufhörlich an seiner Seele. Vor lauter Verzweiflung presste er die Hände so stark zu Fäusten zusammen, dass sich die Fingernägel unerbittlich ins Fleisch gruben. Das hinterließ rote Spuren, welche seine Lebenslinien orthogonal kreuzten. Am liebsten hätte er seine Verzweiflung, seinen Hass, seine Wut und seine Angst laut herausgeschrien. Aber das hätte nichts gebracht. Denn seine Zelle war komplett schallisoliert. Er war vollständig von der Welt abgeschnitten, und das zerriss ihm vor Schmerz beinahe die Brust, da es seinem innersten Wesen zutiefst widersprach, ihm, der immer gerne in Gesellschaft anderer gewesen war, ihm, der den Umgang mit zahlreichen anderen liebte, ihm, der es für sein Ego brauchte, andere zu befehligen. In diesen Momenten fiel es ihm unsäglich schwer, die Tränen zu unterdrücken. Und dann dachte er an den nächsten Morgen, der ja nur noch wenige Stunden entfernt war. Das gab ihm wieder Kraft und Zuversicht. Denn tagsüber hatte er ja Umschluss mit seinen Mitkämpfern. Dann durften sie zusammen sein, und sie entwarfen komplizierte Verteidigungsstrategien, um die Rollen zu vertauschen. Sie klagten den Staat an und stilisierten sich selbst als Opfer einer Justiz, von der sie behaupteten, dass sie nicht besser sei als diejenige des nationalsozialistischen Vorgängerstaats. Diese abstrusen Behauptungen erfüllten Andreas mit unsäglichem Glück, da er den Staat bloßzustellen glaubte, und sie entschädigten ein wenig für die abgeschiedenen Horrornächte. Noch mehr Glück bescherte ihm die Möglichkeit, mit seinen gefangenen Genossen die grobe Strategie und die genaue taktische Vorgehensweise zu besprechen, wie die in Freiheit kämpfenden Einheiten ihre Befreiung aus dem Gefängnis bewerkstelligen konnten. Das bescherte ihm die obsessive Vorstellung, weiterhin das Heft des Handelns in der Hand zu halten und nicht 24 Stunden lang im modernsten Hochsicherheitstrakt der Welt abzusitzen. Während dann seine Brust vor Stolz anschwoll und sich in seinem Geist großmannssüchtige Szenen abspielten, blickte er seine Mitkämpfer mit dem alten Feuer in seinen braunen Augen an. Dann steckte er alle mit dem Gefühl an, dass alles wieder möglich und noch nichts verloren sei. Beinahe täglich erhielt er Verteidigerbesuche, denen er wichtige Botschaften für die freien Genossen übermittelte. Am meisten aber fieberte er den vielen Gerichtsterminen entgegen, da sie ihm eine perfekte Bühne für seine wohlchoreografierten Inszenierungen boten. Für diese Momente lebte er, und sie entsprachen völlig seinem innersten Wesenskern, der immer danach strebte, im Mittelpunkt zu stehen, Bedeutsamkeit zu besitzen, die ihm eigentlich gar nicht zustand.
Was ihm tagsüber in diesem Sinne an Positivem, an Aufmerksamkeit widerfuhr, das raubte ihm die Nacht ohne jegliche Gnade, denn dann herrschte diese völlige, unerträgliche Stille. Komplette Isolation! Kein Laut war zu vernehmen.
Nichts! Nichts! Nichts!
Nicht einmal Schreie von Gefangenen aus den unteren Stockwerken, denen Leid zugefügt wurde, waren zu hören. Keine Schritte der Wärter, die im Gang patrouillierten. Die nächtliche Komplett- und Schallisolation war für ihn ein eindeutiger Bestandteil des Plans der Bundesanwaltschaft (BAW), die Gefangenen der Roten Armee Fraktion (RAF) weichzukochen, sie psychisch zu vernichten. Zwar war Andreas’ Zelle deutlich größer als die der »normalen« Vollzugsgefangenen. Andreas und die anderen RAF-Mitglieder bezeichneten sich folglich als »politische Gefangene«, um damit klar zu machen, dass sie keine »gewöhnlichen Verbrecher«, keine »Durchschnittskriminellen« waren. Sie betrachteten sich als Revolutionäre in einem legitimen Kampf gegen das herrschende politische System. Knapp 20 Quadratmeter Zellengröße waren an sich ja nicht zu verachten. Mancher Student musste jahrelang mit der Hälfte an Quadratmetern zurechtkommen. Und er musste sich nicht mit lästigen Mitgefangenen herumplagen, die einem das Leben schwer machten. Insofern hatten er und seine Genossen schon recht, keine gewöhnlichen Gefangenen zu sein. Und wenn er ehrlich war, genossen sie eine Reihe von Privilegien, was er aber niemals zugeben würde. Die Privilegien, die er und die anderen genossen, halfen ihm ein wenig bei der Bewältigung seiner Seelenpein. An den Zellenwänden hingen Poster von den linken Freiheitskämpfern dieser Welt: Che Guevara und Mao Tse-tung blickten siegessicher und stolz dem Betrachter und einer »roten Zukunft« des Weltkommunismus entgegen. Andreas wusste genau, dass sein Konterfei direkt neben diese Poster gehörte, denn er hielt seine Person für mindestens genauso wichtig wie seine Idole. Nachdem die Justizvollzugsbediensteten den Strom abstellten, entzündete er Kerzen, was sonst im Gefängnis strengstens verboten war. Das gedämpfte flackernde Licht vermittelte der kargen Zelle etwas Heimeliges. Aber auch das ließ ihn nicht zur Ruhe kommen, genauso wenig wie der schweifende Blick über sein prall gefülltes Bücherregal und auf die üppige Plattensammlung mit Janis Joplin, den Rolling Stones und Grateful Dead. All das half nicht wirklich, denn immer wieder wurde ihm klar, dass seine Feinde, dass das System, dass der Staat ihn für immer wegsperren wollte.
Für immer und ewig! Für immer und ewig! Für immer und ewig!
Sie würden den Zellenschlüssel wegwerfen, und er könnte das Gefängnis erst in einer einfachen Holzkiste wieder verlassen. Diese Gedanken fand er unerträglich. Und in solchen Momenten der absoluten Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erwachte dann doch immer wieder der alte Kampfgeist in ihm. Noch war er nicht am Ende, und noch war der Kampf nicht verloren! Er war sich sicher, seine Genossen würden ihn hier rausholen. Verdammt, das waren sie ihm schuldig. Ihm, dem Gründervater der RAF! Er hatte doch nach wie vor alles in der Hand. Er zog die Fäden. Er bestimmte das Geschehen. Er dirigierte weiter die freien Kämpfer, und er bestimmte deren Aktionen. Über kurz oder lang würde es klappen, dass sie ihn aus dem Knast befreiten.
Andreas war auf diese Art und Weise jede Nacht hin- und hergerissen zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Der ständige Gefühlswirrwarr zerriss ihm beinahe die Brust, und er hatte Probleme, gleichmäßig zu atmen. In diesen Momenten vergrub er resigniert den Kopf zwischen seinen Oberschenkeln, und er wünschte sich, gar nicht da zu sein. Zumindest wollte er jemand anders sein als der, der er nun einmal war. Er wollte nicht der Staatsfeind Nummer eins sein und nicht der Anführer der gefährlichsten linksrevolutionären Bewegung Westeuropas. Aber für solche frommen Wünsche war es jetzt eindeutig zu spät. Vorbei war vorbei. Die Fehler, die ihm sein Leben verbaut hatten, lagen in der Vergangenheit und nichts auf dieser Welt konnte sie wieder gutmachen. Und nach dieser bitteren Erkenntnis blieb ihm nur noch die Erinnerung. Daran, wie das alles zu diesem für alle bitteren Ende gekommen war. Die Gedanken kehrten dann friedlich zu seiner Kindheit, zur Jugend und zu seinem jungen Erwachsenendasein zurück. Zu diesen Tagen voller kleiner Probleme und großer Zweifel. Was war das schon, verglichen mit dem jetzigen unerbittlichen Schicksal? Aber er hatte auch süßes Glück erlebt und große Erfolge gefeiert. Das war jetzt aber nur ein geringfügiger Trost.
2 Kindheit
Andreas wurde im fünften Jahr des Zweiten Weltkriegs in der bayrischen Landeshauptstadt München geboren. 1943 hatte sich das Blatt bereits gegen die Deutschen gewendet. Sein Vater, Dr. Berndt Philipp Baader, war Historiker und Archivar. Vom Vater wusste Andreas nur aus den Erzählungen seiner Mutter, Tanten und Großmutter. Direkte Erinnerungen an ihn besaß er keine. Seine Mutter, Anneliese Baader, hatte ihm vom Studium des Vaters an der renommierten Münchener Universität erzählt, dass er dort beinahe zwangsläufig mit einer der wichtigsten Widerstandsbewegungen des Dritten Reichs in Kontakt gekommen war, und dass die Verhaftungen und die Hinrichtungen des Widerstandskreises der Weißen Rose seinen Vater nicht kalt gelassen hatten. An dieser Stelle seufzte seine Mutter immer tief und vielsagend und fuhr mit der Schilderung der folgenden Begebenheit fort.
»Berndt kam aufgewühlt nach Hause und setzte sich an den Küchentisch, auf dem die dampfende Suppenschüssel stand. Er wollte aber nichts von dem leckeren Eintopf nehmen, da er zu aufgeregt war. Dabei hatte ich extra unter großen Mühen Fleisch besorgt, das in diesen Zeiten schwer und nur mit Beziehungen zu kriegen war. Berndt aber vergrub verzweifelt das Gesicht in seinen Händen. Dann stellte er mit gedämpfter und resignierter Stimme fest: ›Anneliese, wir müssen etwas unternehmen. Dieses Unrechtsregime darf nicht weiter bestehen!‹ Ich war zu Tode erschrocken, denn ich wusste, was diese Worte bedeuteten, wenn jemand sie mitkriegte. Das bedeutete Verhaftung, Konzentrationslager und Tod. Deshalb sagte ich zu deinem Vater ›Schschsch‹, ganz so, wie ich es immer zu dir gesagt habe, als du ein kleines Kind warst, und ich streichelte ihm liebevoll über den Kopf. Aber dein Vater war für meine gut gemeinten Ratschläge nicht zugänglich. Also versuchte ich, ihn auf andere Gedanken zu bringen. ›Nimm bitte von dem Eintopf. Du musst etwas essen‹, versuchte ich, ihn abzulenken. ›Ich habe Rindfleisch und Markknochen gekauft. Das ist eine kräftige, wunderbare Brühe. Probiere doch bitte!‹ Aber dein Vater blieb stur und schüttelte heftig den Kopf. ›Die Verhaftungen und die Hinrichtungen sind ungerecht. Das darf so nicht weitergehen! Sie werden uns alle in ein großes Unglück stürzen. Sie werden nicht ruhen, bis wir alle tot sind und unser schönes Vaterland komplett zerstört ist‹, sagte dein lieber Papa, während ihm Tränen in die Augen stiegen. Ich verstand zwar, was er meinte, wusste aber nicht, was er sich dabei dachte, wenn er solche Worte aussprach. Auf diese Weise gefährdete er die ganze Familie, denn die Nazis vollzogen Sippenhaft. Und die Gestapo, das darfst du mir glauben, mein lieber Andreas, fügte so lange Schmerzen zu, bis man bereit war, alles zu gestehen. Alles, auch etwas, was man gar nicht getan hatte. Das war deinem Vater aber egal. Er steigerte sich immer stärker in radikale Gedanken hinein. ›Ich werde in den Untergrund gehen und wie die Geschwister Scholl aktiv gegen Hitler und die Partei kämpfen. Ich werde nicht nur Flugblätter verteilen, sondern zur Waffe greifen.‹ Das einzige Mittel, das mir nun blieb, war, in hemmungsloses Weinen auszubrechen. ›Nein!‹, rief ich verzweifelt, und wischte mir mit der Schürze die Tränen aus dem Gesicht. ›Nein, Berndt, das darfst du niemals tun! Hörst du mich? Niemals. Bedeute ich dir denn nichts? Liebst du mich denn nicht?‹ Erst als ich deinen Vater sprichwörtlich auf Knien anflehte, nichts zu unternehmen, zeigte er sich ein klein wenig einsichtig. Aber der Stachel, gegen die Ungerechtigkeit vorzugehen und etwas zu unternehmen, blieb immer in ihm haften.«
Andreas fragte sich später häufig, wenn er an diese Erzählungen seiner Mutter zurückdachte, ob nicht bereits durch die Gedanken des Vaters sein späterer Lebensweg als Revolutionär und Staatsfeind vorgezeichnet war. Aber dann hielt er sich wieder vor Augen, dass der Unterschied zwischen ihm und seinem Vater nicht größer hätte sein können. Denn während er, Andreas, mutig und radikal zur Tat schritt, scheute sein Vater die letzte Konsequenz. Auf der anderen Seite unterschätzte Andreas seine Mutter und deren Einfluss nicht, den sie auf seinen Vater besaß. Denn wie ein Mantra erzählte sie von ihren stetigen Bemühungen, den Vater um der Familie willen vom offenen Widerstand gegen das Hitler-Regime abzuhalten.
»Dein Papa Berndt war grundgütig, hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, aber ihm fehlte die nötige Härte. Er hielt die Seelenqualen nicht aus, die ihm dieses verdammte Unrechtsregime, das uns alle ins Unglück gestürzt hat, bereitete. Auch als du geboren warst, trug er sich noch mit dem Gedanken, in den Untergrund zu gehen. Eines Nachmittags, bei dünnem Kaffee, den ich uns im wunderschönen blauen Hochzeitsservice serviert hatte, fing er wieder mit seinen gefährlichen Gedankenspielen an. ›Anneliese, ich möchte nicht, dass mein Sohn in einer ungerechten Welt wie dieser aufwächst. Ich habe Leute kennengelernt, die eine Widerstandszelle bilden. Ich werde mich ihnen anschließen. Dieses Mal wirst du mich nicht davon abhalten.‹ Während ich wieder einmal zu Tode erschrak und mir alles Blut aus dem Gesicht wich, trank er einen kleinen Schluck des edlen Gebräus. Kaffee erhielt man damals offiziell nicht einmal mehr auf Bezugsschein. Er stellte die Porzellantasse entschlossen auf den zierlichen Untersetzer zurück. Als ich nichts erwiderte, fuhr er fort: ›Ich möchte nämlich nicht, dass mein Sohn später sagen muss, sein Vater sei ein Feigling gewesen. Ich wünsche mir, dass er stolz auf mich ist. Dass ich dem Unrecht die Stirn geboten habe, auch wenn es mich das Leben kostet.‹ Als er diese Worte sprach, fing ich heftig zu weinen an. Der Gedanke, dass mein Mann sterben könnte und dass du ohne Vater aufwachsen würdest, versetzte mir einen Riesenschock. Aber ich durfte nicht aufgeben, Andreas, auch um deinetwillen nicht. Also wischte ich mir die Tränen mit dem Ärmel meiner weißen Bluse aus dem Gesicht und blickte ihm unerschrocken in die Augen. ›Das darfst du nicht tun‹, sagte ich so ruhig ich konnte. ›Dein Sohn wird nicht stolz auf dich sein, wenn du unter das Fallbeil musst und als Volksverräter auf dem Friedhof liegst. Dein Sohn braucht dich als lebendigen Vater. Denn nur auf einen lebenden Vater wird er stolz sein. Und ich brauche dich auch, Berndt. Ich liebe dich. Aber selbst wenn meine Liebe zu dir so groß wäre, dich tun zu lassen, was immer du möchtest, so könnte ich es doch nicht. Denn ich liebe auch deinen Sohn Andreas sehr, dein eigen Fleisch und Blut. Ich bin es meinem Kind schuldig, dass ich für es da bin. Denn was glaubst du, werden die Nazis mit uns machen, wenn du hingehst und Widerstand gegen Hitler und die Parteibonzen leistest? Du setzt die Existenz der ganzen Familie aufs Spiel. Du kannst uns nicht ernähren, wenn du im kalten Grab liegst. Und Andreas, meine Mutter, meine Schwester und mich werden sie ins Konzentrationslager stecken. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir sterben.‹ Auf meine Einwände hin wand sich dein Vater eine Weile. Er sah zwar ein, dass es Sinn machte, was ich sagte, aber in ihm tobte ein unerbittlicher Kampf, denn sein Gewissen hielt es nicht mehr aus, dass das Unrechts- und Terrorregime so viel Leid und Elend über das Land brachte. Aber dann siegte die Vernunft, und er fühlte sich seiner Familie stärker verpflichtet als seinem Gewissen. ›Ich werde es mir noch einmal überlegen‹, knurrte er dann resigniert und erhob sich, ohne den kostbaren Kaffee auszutrinken. ›Aber ich möchte nicht, dass Andreas in einer Welt wie der unseren heranwachsen muss. Ich würde es für euch tun. Und für Deutschland.‹ Nach diesen pathetischen Worten zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, um zu grübeln.«
Anneliese wusste, dass er den ganzen Tag nicht mehr zu gebrauchen sein würde. Aber das nahm sie billigend in Kauf, solange er keine Dummheiten beging.
»Doch leider waren alle meine frommen Wünsche vergeblich, obwohl dein Vater weiterhin dem verbrecherischen Hitler-Regime die Treue hielt und nie zum offenen Widerstand überging.« An dieser Stelle der Erzählung brach Anneliese jedes Mal in Tränen aus, und Andreas nahm sie dann sanft in den Arm und streichelte ihr über den Rücken, obwohl er damals schon eine seltsame, durch nichts wirklich zu erklärende innere Distanz zu seiner Mutter spürte. Was er tat, schien ihm aber angebracht zu sein, ob er nun wahres Mitgefühl für Anneliese hegte oder nicht. Auch über seine Gefühle gegenüber seinem Vater war er sich nicht völlig im Klaren.
»Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, Mutter«, sagte er dann. »Du hast alles versucht, um das Leben deines Mannes, meines Vaters, zu retten. Auf jeden Fall hast du uns allen das Schicksal erspart, ins Konzentrationslager zu müssen und dort elendiglich umzukommen.«
Trotz all der Bemühungen der Mutter teilte Andreas das traurige Schicksal, das Tausenden von deutschen Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erspart blieb. Sein Vater überlebte zwar den Krieg, geriet aber in sowjetische Kriegsgefangenschaft und blieb seit 1945 verschollen. Mit der Ungewissheit, was seinem Vater passiert war, konnte Andreas nur sehr schwer umgehen, und sie lastete zeitlebens auf ihm. Es war ihm nie vergönnt, mit seinem Vater vollkommen abzuschließen. Seine Mutter heiratete nicht mehr und verschrieb sich vollständig der Erziehung ihres über alles geliebten Sohnes. Andreas benötigte und genoss dieses außerordentliche Maß an Zuwendung und Liebe, was ihm Kraft, Selbstvertrauen und Zuversicht gab. Aber Anneliese war nicht die Einzige, die sich aufopferungsvoll um ihn kümmerte. Denn seine Tante und seine Großmutter wohnten in demselben Haus und umsorgten ihn liebevoll. Voller Freude und Wehmut erinnerte sich Andreas in den einsamen Nächten in seiner Zelle daran, wie sie ihn als Kind verwöhnt und verhätschelt hatten. Er war doch ihr »Andi«, für den sie alles taten, und der Kosename des Frauenhaushalts sollte ihn Zeit seines Lebens begleiten. Obwohl es ihm also beileibe nicht an weiblicher Fürsorge und Liebe fehlte, widersetzte er sich bereits als kleines Kind den Anweisungen seiner Mutter, Großmutter oder Tante. Ihm war es einfach zuwider, simplen Gehorsam zu leisten, ohne nach dem zugrunde liegenden Sinn der Anweisungen zu fragen. Stets blieb ihm in lebhafter Erinnerung, dass sein Verhalten die Mutter früh zur Verzweiflung brachte, und sie es irgendwann aufgab, rigoros erzieherische Maßnahmen durchzusetzen. Vielleicht war das ein Fehler gewesen, fragte er sich später immer wieder. In den einsamen Nächten der Isolationshaft erklärte Andreas sich sein widerborstiges Verhalten dadurch, dass er der einzige Mann im Haushalt gewesen war. Diese besondere Stellung verführte ihn dazu, sich schon sehr früh gegen zahlreiche Rituale aufzulehnen. Liebend gern stellte er den Sinn von Körperhygiene infrage, und zum Essen ließ er sich des Öfteren regelrecht zwingen. Speisen, die er nicht mochte, aß er nicht. Rote-Beete-Salat hasste er. Während er nachts einsam in der kalten Zelle auf seiner Matratze hockte und versonnen an einer selbstgedrehten Zigarette zog, kam ihm die folgende Erinnerung in den Sinn: Mutter, Tante, Großmutter und er saßen um den imposanten, bereits eingedeckten Eichenholztisch. In ihm stieg schon der Ekel auf, als er nur die Schüssel mit dem blutroten Rote-Beete-Salat erblickte.
»Ich habe Äpfel hineingeschnitten«, versuchte ihm die Mutter das einfache Mittagessen schmackhaft zu machen.
Angewidert verzog er das Gesicht. »Das esse ich nicht. Ich hasse Rote Beete, und das weißt du genau! Wieso quälst du mich damit?«
Doch seine Mutter gab nicht so schnell auf. »Andi, Rote Beete ist gesund. Und du möchtest doch groß und stark werden. So wie dein Vater ein sehr stattlicher Mann war … oder ist.«
Andi bemerkte wohl, dass seine Mutter beim Gedanken an den verschollenen Ehemann einen dicken Kloß im Hals spürte. Aber er ließ sich auch nicht durch die Anspielung auf seinen Vater und das Unwohlsein seiner Mutter umstimmen. »Ich werde auch ohne dieses ekelhafte Zeug groß und stark. Und dann werde ich Rote Beete verbieten. Bah!«
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, streckte er der Mutter angewidert die Zunge heraus und schnitt hässliche Grimassen.
Das brachte ihm einen liebevollen Klaps auf die Wange ein. »Du musst mehr Respekt haben«, ermahnte ihn seine Mutter. »Sei froh, dass wir überhaupt genug zu essen haben. Andere Kinder müssen schließlich hungern, während wir Lebensmittel im Überfluss haben, auch wenn wir alles andere als reich oder auch nur wohlhabend sind.«
Andreas aber nutzte die Gelegenheit, brüllte wie am Spieß, schmiss den Esszimmerstuhl um und rannte aus dem Zimmer. »Du hast mich geschlagen!«, brüllte er immer wieder. »Ich werde nie Rote Beete essen! Niemals!«
Als er wieder in das Esszimmer zurückkam, seufzte Anneliese immer noch, denn sie liebte ihren Sohn über die Maßen, und er war ihr ein und alles. »Du bist so dickköpfig und stark«, schalt sie ihn. »Ganz anders als dein Vater, der weich, gutmütig und immer wieder leicht zu überreden war.«
Andreas wollte aber nicht so werden wie sein Vater, und er besaß auch andere innere Dispositionen. Deswegen ging er bereits sehr früh keine Kompromisse ein und war schon als Kind über die Maßen radikal. Das zeigte sich zum großen Leidwesen des Frauenhaushalts allerorten. Zum Beispiel wenn er mit seiner Mutter über den Sinn und Unsinn von Geburtstagen oder vom Weihnachtsfest stritt. Er scheute keine Anstrengung, Anneliese beide Feste auszureden. Aber in diesen Dingen blieb er ohne Erfolg, denn seine Mutter hegte einen gefestigten inneren Glauben. Sein Scheitern machte ihn nur umso wütender. Denn er war es gewohnt, sich durchzusetzen. Es ging ihm auch nicht so sehr um die Sache an sich. Vielmehr wollte er seine Macht ausspielen und andere Menschen beherrschen. Er wollte bestimmen, was gut und wahr war. Ganz unabhängig vom eigentlichen Inhalt. Dieses herrschsüchtige Wesen nahm bereits in der frühen Kindheit bedenkliche Konturen an. Aber in Sachen Weihnachten und Geburtstage traf er auf eine Wand, die er nicht überwinden konnte. Und dies erschütterte ihn zutiefst. Er schwor sich, dass ihm solch ein Scheitern nicht mehr allzu oft in seinem Leben widerfahren sollte.
3 Jugend und Schule
Andreas war während seiner gesamten Kindheit unstet und sprunghaft. Diese Wesenszüge bildeten zwei zentrale Charaktereigenschaften, die ihn Zeit seines Lebens begleiteten. Dadurch trieb er seine Lehrer und seine Mutter häufig beinahe in den Wahnsinn. Außerdem war sein Verhalten nur selten vorhersehbar. Andreas liebte es, die an ihn gestellten Erwartungshaltungen in vollem Bewusstsein zu durchbrechen, um sich dann an den Reaktionen der Beteiligten zu weiden. Sanktionen trug er mit Fassung, denn es ging ihm um den Spaß, die anderen zu ärgern. Einer seiner wenigen wirklich feinen Charakterzüge war, dass er häufig nach Gerechtigkeit strebte. Aus Mitleid teilte er mit Armen und Bedürftigen manchmal sprichwörtlich sein letztes Hemd. Als er einmal an einem warmen Sommertag mit seinem Freund Marcus Fußball hinter dem Haus bei den Wäscheständern spielte, bemerkte er, dass dieser todtraurig dreinblickte und sich nicht auf das Spielen konzentrierte.
»Was ist denn mit dir los?«, wollte Andreas wissen.
»Ich habe mein Geld verloren. Mutter hat es mir extra für Brause und andere Süßigkeiten gegeben«, antwortete der blonde Bub, und seine ohnehin schon wässrigen blauen Augen füllten sich mit Tränen.
Das Elend konnte Andreas nicht mit ansehen, und er wollte seinem Freund über die Trauer hinweghelfen und sich die unumwundene Bewunderung eines Freundes sichern. Schnell entschlossen ging er in die Stube hinauf und stibitzte sich den Geldbeutel seiner Mutter vom Küchenbuffet. Diesem entnahm er ohne jegliches schlechte Gewissen ein Fünfzigpfennigstück und rannte das Treppenhaus zu seinem Spielkameraden hinunter, der ihn nichts ahnend, aber erwartungsvoll anblickte.
»Komm, lass uns Bonbons beim Krämer kaufen«, frohlockte er, und zeigte Marcus das silberfarbene Geldstück.
»Aber das ist ja viel mehr Geld als …«, stammelte Marcus, und Andreas ergötzte sich weidlich an der verlegenen Überraschung des Freundes und an dem bewundernden Blick, den ihm dieser jetzt schenkte.
Als seine Mutter ihn am Abend unweigerlich zur Rede stellte, da sie den Diebstahl bemerkt hatte, wurde Andreas kleinlaut, aber er behielt sein Geheimnis für sich, sosehr ihn die Mutter auch drängte, sich zu offenbaren. Er beschloss insgeheim, den von seiner Mutter erlittenen Verlust wieder gutzumachen. Folglich lauerte er am nächsten Tag einem älteren, aber schwächeren Mitschüler auf, von dem bekannt war, dass er wohlhabende Eltern hatte und über ausreichend Taschengeld verfügte. Er passte ihn am Waldrand in einem unbeobachteten Moment ab, packte den schwitzenden Buben kräftig am Kragen und presste ihn mit aller Gewalt gegen den massiven Stamm einer Eiche. Hier zeigte sich Andreas’ andere Seite, die eiskalt, berechnend und zur rohen Gewalt gegen Unschuldige neigend sein konnte.
»Spinnst du denn?«, presste Eckart mit Mühe hervor, denn Andreas hatte ihm die rechte Hand an den Hals gelegt und würgte ihn ein wenig.
Widerstand gegen die Umsetzung seiner Wünsche und Vorstellungen waren ihm der größte Graus, weshalb er noch kräftiger zudrückte. »Gib mir eine Mark, sonst tut’s noch mehr weh«, forderte Andreas drohend.
»Nein«, gab sich Eckart wehrhafter als erwartet.
Daraufhin verpasste Andreas ihm links und rechts wirklich deftige Backpfeifen. Seine starken Hände hinterließen furchterregende Abdrücke auf den rosigen Wangen des dicklichen Jungen. Eckart fing herzzerreißend zu schluchzen an, doch das stachelte Andreas in seinem Tun nur noch mehr an.
»Jetzt mach schon, du Pfeife, sonst setzt es weiter Hiebe!«, zischte Andreas. »Ich möchte nicht, dass du dir vor Angst noch in die Hose pisst«, fügte er gehässig hinzu, »denn was wird dann deine Mama von dir denken?«
Derart unter Druck gesetzt, rückte der von Angst geplagte Eckart zwei Fünfzigpfennigstücke heraus. Als Andreas fröhlich mit seiner Beute nach Hause sprang, überlegte er, ob er seiner Mutter das ganze Geld überlassen sollte. Aber dann fiel ihm ein, dass das unweigerlich zu unangenehmen Fragen über die Herkunft des Geldes führen würde, und er beschloss, die übrigen 50 Pfennige für sich zu behalten und der Mutter nur den ihr gebührenden Anteil zurückzuzahlen. Die Episode mit Eckart war zum Leidwesen seiner Mitmenschen kein Einzelfall. Auch sonst neigte Andreas bereits in jungem Alter dazu, häufiger handgreiflich zu werden, ohne dass es dafür angemessene Anlässe gegeben hätte. Sein sich immer wieder bahnbrechender Jähzorn verhinderte es, dass er Meinungsverschiedenheiten nur mit Worten austrug. Ihm ging es dabei nicht immer nur um die Durchsetzung eigener Interessen. Er ergriff auch Partei für Freunde um der Freundschaft willen, oder weil er deren Ansichten und Ansinnen teilte. Stets war es ihm aber wichtig, sich durch seine Handgreiflichkeiten die Aufmerksamkeit und zum Teil Bewunderung von anderen zu sichern. Dann stürzte er sich unbesehen in Keilereien, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Aus den Streitereien ging er nicht immer als Sieger hervor. Aber er hatte keine Angst vor körperlichen Schmerzen und war deshalb ein gefürchteter Gegner. Ein weiterer Widerspruch seines Charakters war, dass er, obwohl er ja ganz offensichtlich physische Stärke besaß, den Sportunterricht kategorisch ablehnte. Wenn seine Klasse zu Wanderungen in die Berge aufbrach, täuschte er körperliche Gebrechen vor, um im Tal zu bleiben. Auch seine geistige Entwicklung gab nicht nur Anlass zur Freude. Seine schulischen Leistungen waren von Anfang an wenig berauschend. Und so bahnte sich die erste von vielen schulischen Katastrophen sehr früh an, denn bereits in der zweiten Klasse verfehlte er das Klassenziel. Psychosozialer Druck seiner Verwandten, Lehrer oder anderer Kinder vermochte ihm wenig anzuhaben, und er war stets stolz auf seine vermeintliche Unabhängigkeit. So verwunderte es nicht wirklich, dass sich das Drama des schulischen Scheiterns in der fünften Klasse wiederholte. In diesem Schuljahr hatte er sich schlichtweg geweigert, die Hausaufgaben zu machen, und er akzeptierte die Lehrer nicht als Autoritätspersonen. Aber seine Mutter Anneliese war ebenso starrköpfig wie er, und sie hielt am Traum vom Abitur für ihren Sprössling unumwunden fest. Eines Abends am Bett ihres Sohnes deckte sie ihn fürsorglich und sanft zu, streichelte ihm über das hübsche Gesicht und wuschelte zärtlich die dichten schwarzen Haare. Andreas ahnte, dass sie ihm jetzt gleich eine Neuigkeit verkünden würde, die nicht nur Angenehmes beinhaltete.
»Du wirst bald auf das Internat in Königshofen gehen«, sagte die Mutter mit seltsam kalter und bestimmter Stimme. »Du kannst unter der Woche nicht mehr bei uns bleiben und wirst dort im Evangelischen Schülerheim wohnen. Du hast ja nie auf mich hören wollen. Ich bin sicher, dass es dir dort gelingen wird, ein besserer Schüler zu werden. Denke immer an das Vorbild deines Vaters, der ein ausgezeichnetes Studium mit einer hervorragenden Doktorarbeit abgeschlossen hat.«
Andreas war sehr bemüht, seine Enttäuschung nicht zu zeigen, und antwortete vielsagend, so gut er konnte mit fester Stimme: »Ach Mutter, das werden wir wohl noch sehen.« Als seine Mutter aus dem Zimmer gegangen war und er sich unbeobachtet glaubte, schluckte er einen dicken Kloß herunter, fühlte eine schwere Last auf seiner Brust und ließ schließlich seinen Zornestränen freien Lauf. Dann vergrub er sein Gesicht in dem weißen weichen Kopfkissen und schwor, sich den mütterlichen und schulischen Erziehungsversuchen weiterhin zu widersetzen.
Gesagt, getan.
Denn im Internat täuschte er häufig Krankheiten vor, um dem Unterricht fernbleiben zu können. Dabei entwickelte er ein erstaunliches Repertoire. Er aß Tabak, um unpässlich zu sein, oder er wusch sich nach dem Toilettengang nicht die Hände, um einen Magen-Darm-Virus zu provozieren. Am Unterricht beteiligte er sich widerwillig und weiterhin nur sporadisch. Häufig fiel er hingegen durch penetrantes Stören auf. Er erfand Geschichten, um sich wichtig zu machen, und genoss seine Rolle als Rebell gegen das Schulsystem.
Als die Konfirmation anstand, bahnte sich ein weiterer massiver Streit zwischen ihm und seiner Mutter an. Schon früh hatte er im Religionsunterricht Zweifel am christlichen Glauben geäußert, sehr zum Missfallen des Pfarrers und seiner Mutter. Doch Anneliese tat dies als momentane Verwirrung ab. Sie war weiter überzeugt, dass ihr Spross im Inneren seines Herzens ein guter Christ war. Umso überraschter war sie, als Andreas sie eines Nachmittags in der ordentlich hergerichteten Stube zur Rede stellte. Sie sah von ihrem Strickzeug auf und betrachtete neugierig ihren Sohn, der sich angriffslustig vor ihr aufgebaut hatte.
»Mutter, ich werde nicht zur Konfirmation gehen«, sagte er und schob trotzig die volle Unterlippe nach vorne.
Anneliese legte sorgfältig Stricknadeln und Wolle auf das schwarz lackierte Beistelltischchen, ging auf ihn zu und nahm ihn sanft am Arm, den er ihr aber sofort entzog. Blitzschnell flüchtete er hinter den nussbraunen Sessel, der neben dem Bücherregal ihres verschollenen Gatten stand. Dort verschränkte er die Arme und machte ein grimmiges Gesicht.
Anneliese versuchte es mit gutem Zureden und Sanftheit. »Andi, du darfst nicht vom rechten Weg abweichen, denn unser Herrgott wird dir das nicht verzeihen. Willst du dein Seelenheil aufs Spiel setzen?«
Andreas lachte – voller Verachtung. »Ich glaube nicht an Gott, und falls es ihn doch gibt: Angst habe ich vor ihm nicht«, erwiderte er trotzig und voller Verachtung. »Genauso wenig wie vor dem Teufel«, schob er dann noch schnell hinterher.
Anneliese erschrak ob der Heftigkeit ihres Sohnes. Sie reagierte aber schnell und wechselte die Strategie. »Denk doch an die vielen Geschenke, die du erhalten wirst, Andi. Du hast dir ein neues Fahrrad gewünscht. Oma, Tante und ich werden dir das zum Konfirmationsfest schenken. Ein ganz tolles mit allem möglichem Schnickschnack.«
Ob des plumpen Bestechungsversuchs verzog Andreas angewidert das Gesicht. Er rannte aus dem Wohnzimmer in die Küche und hielt seinen Mund unter den silberfarbenen Wasserhahn, um ausgiebig zu trinken. Seine Mutter frohlockte innerlich, denn sie dachte, dass der Fluchtversuch ein Zeichen der Schwäche und ein Gesinnungswandel nur eine Frage von Minuten waren.
Andreas aber wischte sich die Tropfen aus dem Gesicht, drehte der Spüle den Rücken zu und fixierte seine Mutter mit klarem, ruhigem Blick. »Ihr könnt mir alle Geschenke dieser Welt versprechen, aber ich gehe ganz bestimmt nicht zur Konfirmation. Auf keinen Fall! Bei dieser verlogenen, heuchlerischen Angelegenheit mache ich nicht mit! Ich käme mir dabei ziemlich dreckig vor.«
Die Mutter, die Oma und die Tante beredeten den Jungen in einem fort mit Engelszungen, doch er blieb stur, hart und bockig. In der Schule war auch keine Besserung in Sicht. Anneliese war aber nach wie vor entschlossen, dass Andreas das Abitur machen müsste. Folglich schickte sie ihn auf eine neue Schule, das Maximiliansgymnasium. Dort widerfuhr Andreas zum ersten Mal das Glück, dass sein Klassenlehrer trotz aller Ecken und Kanten für ihn eine Grundsympathie entwickelte. Er forderte und förderte ihn und bescheinigte ihm eine überdurchschnittliche Intelligenz, die Fähigkeit zum logischen Denken und eine kritische Urteilsfähigkeit. Andreas tat dieses Lob unglaublich gut, auch wenn er sich lieber die Zunge abgebissen hätte, als dies offen zuzugeben. Zum ersten Mal in seiner schulischen Laufbahn erhielt er gute Rückmeldungen, und er hatte einen väterlichen Beschützer gefunden. Im disziplinarischen Bereich gab es aber weiterhin Probleme, denn Andreas sammelte Einträge, als ob es sich dabei um einen Wettbewerb handelte. Das Sündenregister umfasste eine umfängliche Litanei: fortwährendes Reden mit dem Nachbarn, Schlamperei, Störung des Unterrichts, Vergesslichkeit und ungebührendes Verhalten beziehungsweise üble Nachrede gegenüber einem verstorbenen Lehrerkollegen. Den letzten Punkt fand Andreas ungerecht, hatte er doch »nur« seine Meinung kundgetan:
»Endlich hat Herr Keck seine Ruhe vor uns. Das hat er sich doch immer gewünscht. Und endlich haben wir unsere Ruhe vor ihm. Ruhe er in Frieden!«
Die Klasse brach in schallendes Gelächter aus, aber der Religionslehrer Mangold fand das gar nicht lustig, wurde puterrot im Gesicht und bebte vor Zorn.
»Das ist eine Ungeheuerlichkeit, so von einem geschätzten Kollegen zu sprechen, was erlaubst du dir eigentlich, du kleiner Scharlatan?«, wies er Andreas in scharfem Ton zurecht. »Auf diese Art wirst du nie Seelenheil erfahren!«
Das Gebaren des erzürnten Lehrers erheiterte die Klasse noch mehr, was dessen Zorn wiederum steigerte, denn jetzt zitterte er am ganzen Körper, und sein Gesicht hatte sich ungesund violett verfärbt.
»Wenn Sie sich jetzt nicht beruhigen, werden Sie der Nächste auf dem Friedhof sein«, konnte sich Andreas eine weitere Boshaftigkeit nicht verkneifen.
Das war einfach zu viel! Der erzürnte Pfarrer packte Andreas recht unsanft am Schlafittchen und schleifte ihn unter Aufbietung aller seiner Kräfte in das eindrucksvolle Direktorenzimmer. Natürlich hätte Andreas sich wehren können, denn er war dem korpulenten Mann körperlich überlegen. Aber er weidete sich an der psychischen Schmach, die er dem Lehrer und Pfaffen zugefügt hatte. Der Schulleiter beruhigte erst seinen Kollegen, indem er ihm einen Schnaps einschenkte und ihm eine Zigarre anbot. Dann wandte er sich Andreas zu und maßregelte ihn so gewaltig, dass es selbst bei Andreas einen bleibenden Eindruck hinterließ. Nach diesem Vorfall erweckte Andreas bei den Lehrern erst recht den Eindruck eines verwöhnten Kindes, das den Problemen lieber aus dem Weg ging beziehungsweise sie verdrängte, als sich ihnen zu stellen. Folglich suchten sie die Gründe für seine schlechten schulischen Leistungen und für seine sozialen Unzulänglichkeiten im familiären Umfeld. Und die fanden sie auch. Denn es war bekannt, dass Andreas eine straffe väterliche Hand fehlte. Seine Mutter war aber nicht nur alleinerziehend, sondern auch noch berufstätig, was damals als großer gesellschaftlicher Makel galt. Durch sein fortwährendes unangemessenes Verhalten, sein gemeinschaftsstörendes, asoziales Verhalten musste Andreas das Maximiliansgymnasium bald wieder verlassen. Als er der Mutter die traurige Nachricht überbrachte, hörte sie schlagartig auf, Leberknödel zu formen, die es zum Abendessen geben sollte, und fing hemmungslos zu weinen an. In der kleinen Küche herrschte für kurze Zeit eine Eiseskälte, sodass es sogar Andreas beinahe zu viel wurde, der sonst so ziemlich jeglichem Druck gewachsen und gegen jedes Mitleid immun war. Dann wischte sie sich mit der rosafarbenen, mit Spitzen versehenen Schürze das Gesicht trocken.
»In diesem einen Punkt werde ich dir nicht nachgeben, Andi«, verkündete sie mit eisernem Willen und strengem Blick, in den sie ihre ganze Autorität legte. »Ich werde es nicht zulassen, dass du dir dein Leben versaust.«
Andreas, den der Anblick der erschütterten Mutter ergriff, schluckte den Kloß im Hals hinunter und er erwiderte trotzig: »Aber Mutter, auch ohne Abitur kann etwas Rechtes aus mir werden. Und ohne Schule wäre ich glücklicher. Lass mich doch einfach eine Arbeit suchen.«
Mit schnellem Schritt ging Anneliese auf Andreas zu und verpasste ihm eine schallende Backpfeife. Das war eines der wenigen Male, dass sie ihren Sohn körperlich züchtigte. Andreas wollte instinktiv zum Gegenschlag ausholen, besann sich aber rasch eines Besseren, denn das brachte selbst er nicht zustande, die Hand gegen die eigene Mutter zu erheben.
»Nein! Und wenn es mich ruiniert und ins Grab bringt. Aber du machst das Abitur! Und dabei bleibt es! Jegliche weitere Diskussion ist sinnlos.«
Trotzig verließ Andreas die Küche, erstaunt über die Ohrfeige und das Maß an Entschlossenheit, das seine Mutter an den Tag legte. Er spürte, dass es hier kein Entkommen gab, und dass er sich seinem Schicksal wohl fügen musste. Die Einsicht erschütterte ihn zutiefst, denn er hasste es, fremdbestimmt zu werden und nicht seinen Willen zu bekommen. Andreas wechselte also notgedrungen auf ein Privatgymnasium, auf dem er immerhin drei Jahre durchhielt. Aber auch hier blieben die schulischen Leistungen schlecht, und die erheblichen Verhaltensauffälligkeiten bestanden weiter. Immerhin handelte er sich nicht wie schon des Öfteren einen schnellen Schulverweis ein. Es bestand also Hoffnung, dass aus ihm doch noch etwas werden könnte. Andreas lieferte seiner Mutter einen erbitterten Kampf.
4 Junger Erwachsener
Die Schulzeit von Andreas stellte sowohl für ihn als auch für seine Mutter und seiner Lehrer ein Wechselbad der Gefühle dar. Andreas brachte es nicht fertig, stetig gute schulische Leistungen zu liefern und sich angemessen in das Klassen- und Schulgefüge einzugliedern. Aber er zeigte kleine Anzeichen der Besserung. Als er 16 Jahre alt war, bestellte sein Klassenlehrer, der Deutsch und Philosophie unterrichtete, seine Mutter zum Gespräch ein. Anneliese war recht aufgeregt, denn sie befürchtete wieder einmal das Schlimmste und rechnete mit einem neuen Eklat, der in einen Schulverweis münden würde. Sie zwängte sich in ihren schönsten Sonntagsstaat, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ihre Kleidung bestand aus einer blütenweißen Bluse mit adretten Rüschen, einem schwarzen Rock, der gerade noch züchtig ihre Knie bedeckte, und schwarzen Lederschuhen mit dezenten, aber doch recht hohen Absätzen.
Der Klassenlehrer, Herr Weiß, war ein Mittfünfziger mit imposantem rotem Vollbart und einer nicht weniger eindrucksvollen Leibesfülle, der eine graue Anzugsweste über einem weißen Hemd und zu einer grauen Stoffhose trug. »Nehmen Sie doch bitte Platz, Frau Baader«, bat er und musterte sie, ohne sein Interesse gänzlich verbergen zu können. »Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich wollte mich einmal mit Ihnen über Ihren Andreas unterhalten.«
Alles Blut wich schlagartig aus Annelieses Gesicht, und ihr Herz pochte sehr heftig, wobei der Mann nicht unfreundlich oder gar bedrohlich klang. »Was hat er denn dieses Mal wieder angestellt?«, stieß sie hastig hervor und führte ihre rechte Hand unwillkürlich vor den Mund, als ob sie sich selbst jedes weitere Wort verbieten wollte.
Der Pädagoge lächelte süffisant und strich sich zufrieden mit beiden Händen über seinen sehr ausgeprägten Wohlstandsbauch, während seine lebhaften graugrünen Augen Anneliese eingehend musterten. »Aber nicht doch, Frau Baader«, antwortete er mit starkem fränkischem Akzent, indem er das »R« besonders stark rollte. »Ich finde, Andreas macht sich so langsam als, na ja, sagen wir mal, recht guter Schüler. Er hat große Fortschritte in beinahe allen Bereichen gezeigt. Das wollte ich Ihnen mitteilen, da ich den Eindruck habe, dass er bisher in der Schule wenig Erfolg gehabt hat. Und das möchte ich als Pädagoge von altem Schrot und Korn noch hinzufügen: Er ist ein durchaus sympathischer Kerl, klar mit ein paar Ecken und Kanten, der aber durchaus das Potenzial für eine durchschnittliche bis gute Hochschulreife besitzt.«
Anneliese umklammerte vor lauter Glück fest die Armlehnen und strahlte Herrn Weiß regelrecht an. Es war ihr, als ob sie träumte, und am liebsten hätte sie sich gezwickt, um sicherzugehen, dass das alles wahr war und sie nicht einem Traumgebilde aufsaß, das ihr etwas vorgaukelte. Sie hatte alles Mögliche erwartet, nur nicht so etwas.
»Das … das … das …«, stammelte sie, brachte aber keinen geraden Satz heraus, da sie von Glücksgefühlen übermannt wurde, die sie zu erdrücken drohten.
Der jahrelange Kampf um das schulische Gelingen ihres Sohnes – und jetzt solch eine positive Nachricht! Aus ihrem Buben würde doch noch was Anständiges werden. Der Lehrer Weiß genoss offensichtlich die Situation. Dann besann er sich seiner pädagogischen Pflichten und führte aus, wie sich Andreas noch stärker verbessern, und wie sie ihn dabei gezielt unterstützen könnte.
»Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um Andreas jedwede Unterstützung zukommen zu lassen«, versicherte sie ihm hastig, als sie sich wieder ein wenig gefasst hatte. »Er soll wie sein Vater Abitur machen, studieren und auf einem rechten, tugendhaften Pfad wandeln.«
Bei der Verabschiedung hatte sie den Eindruck, dass der Lehrer ein wenig mit sich kämpfte, um sie nicht zu umarmen. Stattdessen gab es aber einen einfachen Handschlag, wobei er ihre rechte Hand mit seinen beiden dicklichen Händen, die zudem ein wenig schwitzten und feucht waren, etwas zu lange umklammert hielt, während er ihren Augenkontakt suchte. Auch sie fand ihn nicht gänzlich unsympathisch, er war gebildet und wohlerzogen, obgleich optisch nicht wirklich ihr Geschmack. Aber solch ein Vater und Mann würde Andreas und ihr sicherlich gut tun. Aber sie hatte sich nun einmal geschworen, ihrem Mann treu zu bleiben, solange dessen Schicksal nicht restlos geklärt war. Die positiven Mitteilungen des Klassenlehrers versetzten Anneliese eine Zeit lang geradezu in Verzückung. Sollten ihre Bemühungen und Entbehrungen noch Früchte tragen? Würde es ihr vergönnt sein zu erleben, dass der einzige Sohn, ihr Andi, das Abitur erfolgreich bestand? Der Klassenlehrer hatte ihr nämlich noch mehr berichtet, was von seiner Wertschätzung gegenüber Andreas zeugte.
»Die Streiche von Andreas sind genauso schlimm oder harmlos wie die der meisten anderen Schüler auch. Aber sie zeichnen sich durch eine Prise Humor aus, der manchmal recht feinsinnig, mitunter aber auch recht derb ist. Humor an sich spricht aber für seinen ausgezeichneten Charakter.«