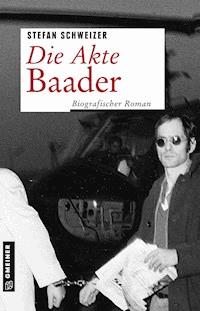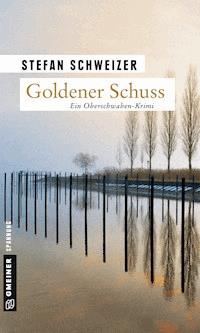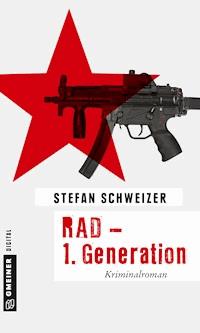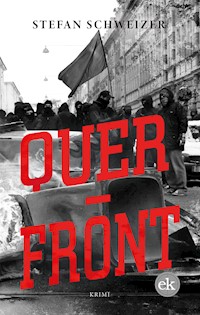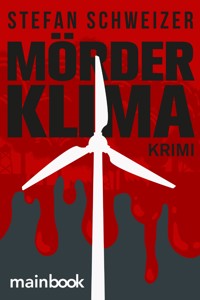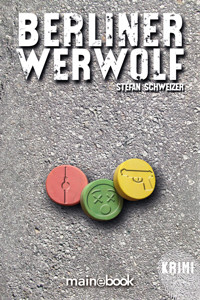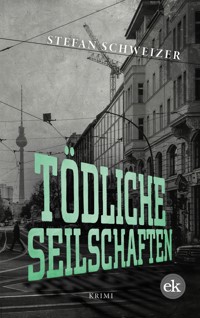4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach einer schweren psychischen Erkrankung hat Freddy Walz sich von seiner Familie getrennt und den Dienst als Kriminalpolizist in Berlin aufgegeben. In Amsterdam findet er eine neue Heimat und eine neue Liebe, die Niederländerin Lieke. Doch als vor ihren Augen ein Geldtransporter überfallen und Lieke verletzt wird, geraten sie und Freddy in Verdacht, in kriminelle Strukturen verstrickt zu sein. Freddy beginnt zu ermitteln. Er entdeckt, dass hinter den schönen Kulissen Amsterdams nicht alles ist, wie es scheint. Bald muss er um sein Leben fürchten. Kann er sich selbst und Lieke von jedem Verdacht befreien?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefan Schweizer
Mord an der Keizersgracht
Kriminalroman
Prolog
Er wendete das teure Kristallglas mit dem Whiskey für 2.000 € die Flasche in der Hand hin und her, schnupperte an dem Glas und nahm einen Schluck. Nichts, kein Brennen, jedoch breitete sich eine wohlige Wärme in seinem Körper aus. Dieser Stoff war fantastisch, und wenn er wollte, konnte er bis an sein Lebensende täglich eine Badewanne davon trinken. Aber Geld allein war nicht alles. Und Geld war keine Garantie für Glück!
Ein wenig durch das edle Getränk besänftigt und dennoch mit einem Stachel des ewigen Zweifels behaftet, blickte er aus dem hohen Fenster auf die Gracht, die sich als dunkle Masse in Richtung Ijsseelmeer schlängelte. Auf der Straße war es ruhig, obwohl die Nacht noch nicht ganz hereingebrochen war. Amsterdam war und blieb eine Kleinstadt. Vielleicht kein Dorf, wie einige behaupteten, aber eine kleine Stadt. Und er fühlte sich inzwischen als König dieser Stadt. Wie Napoleon hatte er sich selbst gekrönt. Nur eine Josephine war ihm bisher verwehrt geblieben, was nicht zuletzt an seinen hohen Ansprüchen lag, die er an die Dame seiner Wahl stellte.
Seine Herrschaft war allumfassend. Sie berührte die bürgerliche Sphäre ebenso wie die Bereiche des Kriminellen, was nicht unüblich war. Viele Bürger dieser Stadt hatten mit solch einem Spagat kein Problem. Im Gegenteil, ein Großteil des sagenhaften Reichtums dieser Gemeinde war genau auf dieser Doppelgesichtigkeit ökonomischen Erfolgs gegründet worden. In den inneren Zirkeln dieser Stadt lachten sie über die naiven Vorstellungen der Besucher, hier werde der Wohlstand ausschließlich auf ehrliche Weise generiert und einfach von Generation zu Generation weitervererbt. Dabei hatten sich alle großen Familien, die er kannte, und das waren beinahe alle, früher oder später die Hände schmutzig gemacht. Entscheidend war doch allein die Tatsache, sich nicht erwischen zu lassen.
Die neue Aktion war von seinem Kontaktmann an ihn herangetragen worden. Sie klang vielversprechend. Ein satter Gewinn in Höhe einer sechsstelligen Summe, ohne dass er dafür auch nur einen Finger zweimal krümmen musste. Doch zuerst hatte er mit der Zustimmung gezögert.
Doch dann hatte er eine geniale Idee gehabt. Vielleicht war es möglich, aus der Aktion etwas Größeres zu machen. Sie konnte eine Möglichkeit darstellen, alte Rechnungen zu begleichen. Davon hatte er mindestens einen ganzen Tresor voll. Andere hätten sich mit dem Hier und Jetzt zufriedengegeben, das zugegebenermaßen fantastisch war. Doch niemand wollte sehen, wie viel Blut, Tränen, Schweiß und Enttäuschungen mit dem heutigen Status quo verbunden waren. Aber er konnte nichts für sein Gedächtnis, das keine Kränkung, keinen Kränkenden vergaß und stets auf Vergeltung aus war.
Außerdem bereitete es ihm Freude, Menschen wie Schachfiguren hin und her zu schieben. Wenn er also alte Rechnungen mit der neuen Aktion begleichen wollte, erforderte das mehr Überlegung und Weitsicht als konventionelle Beutezüge. Aber genau darin lag für ihn jetzt der Reiz.
Ein weiterer Schluck des Edelgetränks befeuerte seine Fantasie. Ja, so würde es ihm gelingen, Personen, die seinem Weg nach oben Steine in den Weg gelegt hatten, die Rechnung dafür zu präsentieren. Das würde sein kühl berechnendes Gehirn befriedigen. Außerdem bot es ihm die Chance, emotionale Verletzungen aufzuarbeiten. Verletzungen, die nie verheilt waren. Verletzungen, die anderen vielleicht minimal und nicht der Rede wert erschienen, die aber nach wie vor sein Ego belasteten.
Doch er zauderte. Wieso konnte er nicht über seinen Schatten springen und Fünfe gerade sein lassen? Darauf fand er keine Antwort. Es war, wie es war. Für seine Persönlichkeitsstruktur konnte er nichts. Gegen die Macht der Gene konnte er nichts ausrichten. Als er alle Verästelungen und Wendungen des neuen Projekts bedacht hatte, war er zufrieden. Er rieb sich die Hände. Ausgezeichnet. Das wäre vielleicht sogar sein bisheriges Meisterstück. Die Eingeweihten würden wissen, wem die Aktion zuzuschreiben war. Und die anderen Trottel, die nur seine Fassade und sein Äußeres entdeckten, interessierten ihn sowieso nicht.
Er griff nach dem Wegwerfhandy, das neben dem Whiskeyglas lag und tippte eine Nummer ein. Nach dreimaligem Läuten hörte er, wie abgehoben wurde. Kein »Hallo«, kein »Wie geht’s« und vor allem keine Namen. Nur sein »Die Grachtentour kann beginnen«. Danach legte er sofort auf, ohne eine Antwort abgewartet zu haben. Nach dem Anruf blickte er den Billigartikel voller Abscheu an. Scheußlich, sich mit so etwas herumschlagen zu müssen. Aber es war nicht zu ändern, denn ein solches Handy konnte nicht zurückverfolgt werden. Nachdem er das Ding sorgfältig abgewischt hatte, würde er es sofort in einem Mülleimer entsorgen. Vielleicht war das ein wenig übertrieben, aber besser als eine zweistellige Anzahl von Jahren in einem holländischen Gefängnis zu verbringen. Den Gegenstand würde er in eine Papiertüte packen und diese in der Nähe des Sexmuseums im Rotlichtviertel entsorgen. Von da aus würde keine Spur zu ihm führen. Da war er sicher.
»Jetzt bist du endlich dran, mein Schätzchen«, murmelte er laut vor sich hin, erhob sich und freute sich auf den Spaziergang in seiner Geburtsstadt. Die Zeit der großen Abrechnung war endgültig gekommen.
Zur gleichen Zeit, einige Kilometer entfernt in einem anderen Stadtteil von Amsterdam
In der kleinen Autowerkstatt roch es nach Schmieröl, altem Metall, kaltem Zigarettenrauch und Schweiß. Es herrschte eine angespannte Atmosphäre und sieben Männer gingen eifrig verschiedenen Tätigkeiten nach. Zwei Männer machten sich an den Nummernschildern der Daimler Limousine zu schaffen. Sie schraubten die alten Tafeln ab und brachten die gefälschten Autokennzeichen an.
»Was ist mit der Lackierung?«, fragte der Mann mit nord-afrikanischem Erscheinungsbild, der sich am Heck der Limousine zu schaffen machte, den Mann, der auf der Werkbank ein neues Kalaschnikow-Modell akribisch auseinanderbaute und die Einzelteile sorgfältig einölte.
»Die Lackierung kann so bleiben. Wir müssen uns keine unnötige Arbeit machen«, antwortete der Gefragte und inhalierte den Rauch seiner Zigarette tief in die Lungen, bevor er den Kippenstummel auf den Boden schnippte. »Was ist mit den Sturmhauben?«, wandte er sich an einen weiteren Mann, der auf einem Drehschemel saß und die Funktionstüchtigkeit einer Panzerfaust Punkt für Punkt überprüfte. »Sind die alle vorhanden?«
Der bereits etwas ältere Mann mit einem typisch orientalischen Schnurrbart seufzte, unterbrach seine Arbeit und blickte in die Runde.
»Sind wie vereinbart einsatzbereit«, meinte er. »Aber der Boss hat befohlen, dass wir dieses Mal ein wenig von den alten Gewohnheiten abweichen sollen, um die Bullen auf eine falsche Fährte zu locken.«
Mit Zufriedenheit nahm er wahr, dass alle Männer zwar Fragezeichen in ihren Gesichtern hatten, ihm aber treu ergeben zunickten. Keine Frage, in diesem engeren Zirkel hatte er das Sagen. Vorsichtig legte er die Panzerfaust aus sowjetischer Produktion auf den Betonfußboden, erhob sich von seiner Sitzgelegenheit und ging zu einem Pappkarton, der chinesische Schriftzeichen trug. Er bückte sich und holte ein in Plastik verschweißtes Viereck heraus, in dem sich ein rot-blauer Stoff mit weißen Mustern befand.
»Sollen wir uns als Cowboys verkleiden?«, ulkte der Mann, der am Heck der Luxuslimousine stand. »Ich dachte, das sind immer die Guten.«
Es folgte Gelächter, das klarmachte, dass diese Männer der hartgesottenen Art angehörten. Ein Gelächter, das einem das Blut in den Adern gefrieren lassen konnte und dem zu entnehmen war, wie viel Böses diese Männer bereits auf dem Kerbholz hatten.
»Nein«, entgegnete der Schnauzbärtige. »Die Idee ist, dass wir die Amsterdamer Polizei möglichst lange darüber im Unklaren lassen, mit wem sie es zu tun haben.«
»Davon bin ich ohnehin ausgegangen«, meinte der Mann mit der Kalaschnikow ohne jeglichen Hauch von Ironie und seine braunen Augen blickten finster drein, weil er an einige Begegnungen mit ebenjener Polizei dachte, die er lieber vermieden hätte.
Plötzlich herrschte absolute Stille in der Werkstatt, und es wurde klar, dass keiner der hier Anwesenden auch nur das geringste Risiko eingehen wollte, in die Fänge der Staatsmacht zu geraten, um sich für ein paar Jährchen bei Vollpension bei Vater Staat einzumieten.
»Schon klar«, entgegnete der Anführer ruhig und sandte einen beinahe feindseligen Blick in Richtung des Experten für Feuerwaffen, der daraufhin den Kopf senkte. »Kein unnötiges Risiko eingehen, dafür aber für maximale Verwirrung sorgen. Männer, ich werde euch später noch haarklein in die Details unseres Plans einweihen, anders geht es ja gar nicht. Nur so viel: Unser Unfallfahrer soll dieses Tuch als Maskierung vor das Gesicht ziehen. Die Polizei wird lange rätseln, ob sie es mit Trotteln oder Profis zu tun hatte. Sie sollen sich bereits an der Durchführung des Überfalls die Zähne ausbeißen, einerseits professionell, dann wieder amateurhaft. Dann können sie sich schlecht einen Reim auf die Täter machen.«
Es folgte aufgeregtes Gemurmel.
»Dabei hatte ich gedacht, wir stünden kurz davor, Prinzessin Amalia zu entführen und jetzt soll ich dieses hässliche Ding vor das Gesicht binden«, sagte der jüngste der Gruppe, der bisher nicht gesprochen hatte, und die ganze Zeit damit beschäftigt war, grüne Bierkisten aufeinander zu stapeln.
»Alles zu seiner Zeit«, meinte der Chef missmutig. »Aber nun wieder an die Arbeit, meine Herren. Unsere Bankkonten füllen sich schließlich nicht von alleine. Dafür müssen wir schon etwas tun.«
1.
Königlicher Palast
Einiges hatte sich in der Zwischenzeit zum Guten entwickelt. So war es Freddy inzwischen möglich, einfach einmal erleichtert aufzuatmen, statt dauernd die Stirn in Falten zu legen und um jeden Atemzug zu kämpfen. Die Zeiten der großen Panik und schwerwiegenden Krankheit waren zwar vorbei, aber die Nachwehen dauerten an. Doch heute war es ihm möglich, wieder ein einigermaßen normales Leben zu führen, wofür er dankbar war. In den Zeiten der tiefsten Depression hatte er das nicht mehr für möglich gehalten. Diese Veränderungen bedeuteten zwar nicht nur Licht und Sonnenschein, aber immerhin war die tiefschwarze Nacht kein Dauerzustand mehr. Die Zeiten der großen Auseinandersetzungen und der Dunkelheit waren also keineswegs komplett aus seinem Leben verschwunden, lagen aber mit einem komfortablen Sicherheitsabstand hinter ihm. Dennoch war er sich bewusst, dass alles jederzeit wiederkommen konnte. Diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, war nur realistisch.
Seit ein paar Wochen, vielleicht schon seit einem halben Jahr, hatte er das Gefühl, seine Bestimmung endlich gefunden zu haben und angekommen zu sein. Er hatte nicht mehr das Gefühl, das Kreuz dieser Welt allein tragen zu müssen. Manchmal ertappte er sich dabei, erstaunt festzustellen, wie einfach und schön das Leben doch sein konnte. Eine veränderte Einstellung, deren Leichtigkeit ihn manchmal beinahe zu erdrücken drohte.
Diese Stadt bildete seit Jugendtagen einen wichtigen Bestandteil für die Stabilisierung seines Lebens und war sein absoluter Sehnsuchtsort. Wenn es zwischen Menschen Seelenverwandtschaften gab, dann konnte es seines Erachtens so etwas auch zwischen einer Stadt und bestimmten Menschen geben. Seit er 16 Jahre alt gewesen war, hatte Freddy viel Zeit in Amsterdam verbracht. Und heute lebte er hier und hatte sich seinen Jugendtraum erfüllt. Er teilte die Meinung vieler nach Amsterdam Zugezogener, dass es sich nach Heimat anfühlte, sobald sie den Innenstadtbezirk von Amsterdam betraten. In Abwandlung eines Sprichworts war er der Meinung, Heimat war da, wo er mit dem Herzen wohnte. Das war bei ihm in Amsterdam der Fall, darüber konnte es keine zwei Meinungen geben. Die neue Heimat gab ihm Halt und Stärke. Auch wenn nicht alle Narben verheilt waren, so standen einerseits die Chancen gut, dass dies demnächst der Fall sein würde. Andererseits hatte ein Psychiater ihm gesagt, er müsse sich unbedingt auch um Stabilität und Ruhe bemühen, sonst könne er jederzeit wieder Opfer der großen Depression werden, die ihn dann vielleicht völlig verschlingen würde.
Am heutigen Tag gab es aber nicht nur innerlichen Sonnenschein, die Sonne schien auch wuchtig am Firmament, was für Amsterdam nicht selbstverständlich war, da der Wettergott es nicht immer gut mit der größten Stadt der Niederlande meinte. Der Palast lag am Ende des Damraks und stellte die letzte Station der Sightseeing-Tour dar. Dieses Mal handelte es sich um eine fröhliche Gruppe von Touristen aus dem Rheinland, die an einer Flusskreuzfahrt mit einem eintägigen Stopp in Amsterdam teilnahm. Freddy hielt diese Gruppe für einen Prototyp des neuen Tourismus’, der Amsterdam seit einiger Zeit auszeichnete. Dies deckte sich mit der Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte. Weg vom Schmuddelimage mit Drogen und käuflichem Sex, zurück zur prächtigen Metropole, die einst das Herz des kulturellen und ökonomischen Europas bildete.
Die unterschiedlichen Entwicklungsschritte Amsterdams hatte er hautnah mitgekriegt. In den 80er- und 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt eine Hochphase in Sachen Drogentourismus, die viele Anwohner nicht gutgeheißen hatten und was dazu geführt hatte, dass die niederländische Metropole von den Reisezielen vieler Touristen gestrichen worden war. Heerscharen von jungen Deutschen, Franzosen, Engländern, Spaniern und Italienern waren mit Rucksäcken, Bärten und verratzter Kleidung ein fester Bestandteil des städtischen Erscheinungsbilds gewesen. Diese Touristen waren meistens zwischen 18 und 30 Jahre alt, Schüler, Studierende und Lebenskünstler. Ab und zu auch Menschen, die bereits in der Mitte des Lebens angekommen waren und sich einmal wieder jung fühlen wollten. Bereits ab zehn Uhr am Morgen waren die jungen Touristen damals in der Stadt auf den Beinen gewesen, da sie in den Hostels früh aus den Zimmern geworfen wurden, damit diese geputzt werden konnten. Und was lag für diese Touristen näher als direkt den ersten Joint des Tages im Coffeeshop zu »genießen«? Eben, nichts. Dieses urban kulturelle Image war vor 20, 30 und 40 Jahren eine Selbstverständlichkeit gewesen. Der Anblick der Drogentouristen hatte ebenso zum Amsterdam Besuch gehört wie das palettenweise Kaufen von Bierdosen bei Albert Heijn. Der Punkt war, auch diese Art von Touristen hatte viel Profit generiert. Aber egal, wie viel diese Touristen kifften oder Geld im Rotlichtmilieu verprassten, das alles ließ sich nicht ins Unendliche steigern. Deshalb hatte der Stadtrat Amsterdams eine grundsätzliche Änderung angestrebt. Zahlungskräftiges, gehobenes Publikum mit Familie war nun die Zielgruppe. Ein Abendessen in einem Steakhouse brachte dann mehr Cash ein, als eine Woche lang Bierdosen beim Discounter zu kaufen.
Wie unterschiedlich das Amsterdam von heute im Gegensatz zu dem von früher war. Nicht, dass es heute keine Cannabis-Liebhaber oder Coffeeshops mehr gab, auch wenn die Zahl der Letzteren abgenommen hatte. Das Sterben der Coffeeshops war durch Verordnungen der Stadtverwaltung forciert worden, denn plötzlich durften diese den Betrieb nicht mehr in der Nähe einer Schule aufrechterhalten. Hinzu kam, dass das Erscheinungsbild der Stadt an der Amstel ein anderes geworden war. Ordentlicher, übersichtlicher und moderner. Viele Amsterdamer waren froh, das ehemalige Schmuddelimage, das einen einmaligen Mix aus Westernstadt, Cannabis und käuflicher Liebe im Rotlichtbezirk darstellte, losgeworden zu sein. Niederländer aus anderen Städten unterstellten den Metropolenbewohnern Habsucht und Amsterdamer galten in den restlichen Niederlanden als gefühlskalt. Das änderte nichts am Ergebnis. Amsterdam war wieder wer. Eine europäische Metropole voller Historizität und Stolz. Amsterdam kam inzwischen wieder der ihr gebührende Rang in der Welt zu.
Bei seiner Touristengruppe handelte sich um Menschen, die zwischen 50 und 60 Jahren alt waren. Die älteren von ihnen waren sicherlich schon in Frührente gegangen und andere schauten erfreut dem baldigen Ruhestand entgegen. Er hatte zwei Paare ausgemacht, die Enkelkinder dabeihatten. Das fand er süß, aber er wusste, vor zwanzig Jahren hätte ihn ein solcher Anblick in dieser Stadt nachdenklich gestimmt.
Die Sonne schien in all ihrer Pracht auf den Palast und spiegelte sich wie pures Gold in seinen majestätischen Fenstern wider. Für Amsterdamer Verhältnisse war das Wetter traumhaft. Angenehme 23 Grad und keine Wolke am Himmel. Aus Erfahrung wusste er, dass der Sommer hier auch ganz anders aussehen konnte. Wie viele triste Regen- und Wolkentage hatte er in Amsterdam im Juni, Juli oder August bereits erlebt? Unzählige und dennoch hatte die Stadt ihm stets ein wohliges Heimatgefühl vermittelt, ganz unabhängig vom Wetter. In dieser Hinsicht unterschied sich Amsterdam für ihn eklatant von Berlin, denn dort hatte ihn dasselbe miese Wetter im Sommer von der Stadt entfremdet.
Freddy erkannte, dass einige der Touristen noch Zeit benötigten, um zu seinem Regenschirm in der deutschen Nationalfarbe zu gelangen. Er mochte es nicht, den Schirm als Erkennungszeichen mitzutragen, aber der Chef der Touristenagentur, Gerrit, bestand darauf, da er es sich nicht leisten konnte, Kunden bei einer Tour zu verlieren. Sein Chef war eine schillernde Figur. Ein Macher, temperamentvoll, lustig und ein ausgezeichneter Alleinunterhalter. Ein oder zwei Mal hatte Gerrit nach ein oder zwei Bieren zu viel allerdings einige Andeutungen über seine Vergangenheit gemacht. Als Polizist und erfahrener Mann war es Freddy möglich gewesen, feine Zwischentöne aus dem Gesagten herauszuhören. In Gerrits Leben war anscheinend nicht immer alles glattgegangen und als junger Mann hatte er wohl auch manches Mal jenseits des Gesetzes agiert. Wahrscheinlich mit nordafrikanischen Banden, aber Gerrit hatte es immer wieder verstanden, im richtigen Augenblick mit seinen wehmütigen Erzählungen über die Vergangenheit aufzuhören.
Als Gerrit ihm das erste Mal von dem Schirm erzählt hatte, war seine Reaktion ein ungläubiges Lachen gewesen. Was an sich ein Wunder war, aber immerhin konnte er inzwischen wieder lachen und die Vorstellung, dass Touristen bei einer Stadtführung verloren gingen, amüsierte ihn. Er hatte diese Stadt von Grund auf selbst erkundet und war stolz darauf, im Innenstadtbezirk jeden Baum und jede Asphaltritze zu kennen.
»Es ist doch ganz normal, wenn Touristen verloren gehen«, hatte ihm Gerrit aufgrund seiner Reaktion erklärt. »Stell dir vor, du gehst mit einer Reisegruppe zum Bahnhof Centraal, aber einer aus der Gruppe möchte sich bei Febo eine leckere Krokette aus dem Automaten gönnen. Schon hundertmal passiert. Kein Scheiß, Mann.«
»Hm, das kann ich gut verstehen, hehe. Ich liebe die Sate-Kroketten von Febo auch. Aber deswegen gehe ich doch nicht gleich verloren. Ich denke, du unterschätzt die Fähigkeiten deiner Klientel, Gerrit. Nur weil sie gut zahlen, heißt das nicht, dass sie ihren Verstand im Hotel lassen.«
»Doch!«, hatte ihm sein temperamentvoller Chef widersprochen. »Wenn es sich um ältere Leute handelt, sind die unter Umständen nicht mehr schnell genug, um mit dem Tour-Tempo mitzuhalten. Sie haben zum Beispiel kein Kleingeld und müssen erst an der Theke wechseln. Oder das entsprechende Fach des Essensautomaten klemmt, was häufig passiert, wie du wohl am besten weißt.«
Freddy nickte, denn die Kroketten von Febo waren eine seiner großen Schwächen.
»Dann muss die betroffene Person warten, bis ein Imbiss-Mitarbeiter das Ding repariert. Wie kann ich es dir nur erklären? Hm, mal weg vom Essen, vielleicht wird es dann klarer: Viele Männer gehen mit Absicht im Rotlichtviertel verloren, kein Scherz. Andere möchten nur kurz in eine Kneipe, um sich schnell einen Muntermacher reinzupfeifen. Du kannst sagen, was du willst, aber ich bestehe auf dem Schirm. Mein Unternehmen, meine Regeln. Wenn du hier arbeiten möchtest, ist der Schirm Bedingung. Dieses riesige Ding erkennt man auch als alter Mensch aus fünfhundert Metern Entfernung. Glaub mir, das rettet so manchen Kunden und beschert dir am Ende der Tour mehr Trinkgeld. Sag bloß, dagegen hast du was einzuwenden.«
Klar, gegen Gerrits Order war nichts zu machen, also hatte er schnell den Widerstand gegen das Monstrum eingestellt. Was zur Folge hatte, dass er nun bei jeder Stadtführung dieses unsägliche Ungetüm mit sich führen musste. Doch das änderte nicht das Geringste an seiner positiven Einstellung seinem neuen Job gegenüber. Er liebte den Kontakt mit fremden Menschen, ihnen vergnügliche Stunden zu bereiten und einiges an Wissen über seine Lieblingsstadt preiszugeben.
Doch Fremdenführer war nicht Freddys einziges berufliches Standbein. Dafür reichte das Geld nicht. Und wenn Freddy ehrlich zu sich selbst war, wusste er nicht, welcher seiner beiden Jobs ihm mehr zusagte, ihn stärker erfüllte und den Wunsch nach Selbstverwirklichung besser zu realisieren half. Die Juristerei war nun einmal ein gänzlich anderes Feld. Als Tourist Guide war er privilegiert, den Urlaubern die Stadt zeigen zu dürfen, die er über alles liebte und als Rechtsanwalt übte er den Beruf aus, den er vor fast zwei Jahrzehnten an der Juristischen Fakultät der Humboldt Universität erlernt hatte, um Menschen dabei zu helfen, ihr Recht zu bekommen. Doch nach der bravourösen Beendigung seines Studiums mit Auszeichnungwar alles anders gekommen als ursprünglich gedacht. Sein Leben hatte eine andere Wendung genommen und im Rückblick wusste er nicht mehr, wie es dazu gekommen war. Statt in eine angesehene Sozietät einzutreten, die ihn mit Kusshand genommen hätte, hatte er sich für den Höheren Dienst beim Landeskriminalamt Berlin beworben und war dort mit offenen Armen empfangen worden. Vater Staat freute sich über gut qualifizierte Diener, die sich freiwillig und nicht aus Mangel an Alternativen für ihn entschieden. Was folgte, waren spannende, manchmal fast existenzielle Abenteuer als Polizeibeamter, die ihm aber mit der Zeit aufs Gemüt geschlagen waren. Insofern war es heute beinahe egal, was für einen Job er machte, Hauptsache, er musste sich nicht mehr berufsbedingt mit Schwerverbrechern und abscheulichen Verbrechen herumschlagen. Die immense berufliche Belastung als Polizist hatte ihn schließlich in diese unglaublich scheußliche Krankheit geführt, für die es seit einiger Zeit nur noch einen englischen Namen zu geben schien: Burnout. Ausgebrannt sein. Nicht mehr können. Nur noch die Hülle seines Selbst sein. Er kannte alle inhaltlichen Schattierungen des Begriffs nur zu gut.
Wenn er das unsägliche Wort für diese Krankheit hörte, zuckte er zusammen. Am schlimmsten fand er, dass viele Menschen ihn nicht richtig ernst nahmen und ihm unverblümt zu verstehen gaben, dass sie die Krankheit für eine Modeerscheinung und ihn für einen Simulanten hielten. Als ob er freiwillig auf den Zug der Zeit aufgesprungen war, um ein angeblich schönes Leben führen zu können. Was für ein Hohn, denn das Leben mit dieser Krankheit war die reinste Hölle gewesen. Aber auch mit diesen hässlichen Unterstellungen hatte er konstruktiv umzugehen gelernt, allerdings hatte es eine Weile gedauert.
Zu seiner Zufriedenheit realisierte er, dass die Gruppe inzwischen eng genug beisammenstand. Also konnte er loslegen und alle würden ihn ohne Probleme verstehen können, vorausgesetzt, die Hörgeräte einiger Teilnehmer funktionierten.
»Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren«, begann er ein wenig antiquiert, was aber gut ankam, und versuchte dabei, den allgemein sehr ausgeprägten Charme der Rheinländer noch zu überbieten, denn das versprach ihm vermutlich ein saftiges Trinkgeld, »wer von Ihnen kann mir sagen, vor welchem wichtigen Gebäude Amsterdams wir uns befinden? Also hier, genau an dem Platz, an dem wir uns befinden«, fügte er sicherheitshalber für Tagträumer oder diejenigen, die wegen der fremden Betten schlecht geschlafen hatten, hinzu.
»Dat is doch dat Rathaus«, antwortete prompt eine blondgefärbte, vollschlanke Dame, die bereits über 60 Jahre alt war, aber jünger aussah
Jedenfalls wirkte ihre Erscheinung dynamisch, was ihr den Hauch von jugendlicher Frische zukommen ließ. Freddy lächelte aufmunternd und hob den rechten Daumen in die Höhe. Dabei nahm er sich vor, bei der nächsten richtigen Antwort zu klatschen, da das die Touristen mehr freute als das schlichte Daumensymbol.
»Aber handelt es sich denn nicht um den Königspalast?«, schaltete sich ein Mann um die Mitte 50 ein, von dem Freddy ausging, dass er Lehrer war.
Der Mann bemühte sich von Beginn an auffällig darum, sich durch gepflegtes Hochdeutsch vom Rest der Gruppe abzusetzen. Die meisten der Zuhörer schienen sich nicht sicher zu sein, wer von den beiden Antwortenden recht hatte. Abwechselnd sahen sie wie bei einem Tennismatch zwischen den Antwortgebern hin und her. Freddy entschied sich für eine salomonische Lösung und klatschte in die Hände, um beiden Gruppenteilnehmern den ihnen gebührenden Beifall zu zollen.
»Meine Dame und mein Herr, erstaunlicherweise haben Sie beide recht und ich werde Ihnen sofort verraten, warum.«
Es folgte heiteres Gelächter, das er nicht unterbrach. Die Stimmung in der Truppe war ausgezeichnet. Das machte die Arbeit mit ihr angenehm.
»Jetzt machen Sie mal bitte ein wenig zügig, junger Mann!«, meldete sich ein Mann mit grauen, beinahe weißen Haaren zu Wort. »Wir wollen uns schließlich noch im Coffeeshop eindecken, bevor wir uns wieder auf das Kreuzfahrtschiff begeben. Mein Enkel hat mir eine riesige Einkaufsliste mitgegeben, und ich hätte auch gern etwas für zu Hause mitgenommen.«
Wie schon des Öfteren während der Tour erntete der Senior erheitertes Gelächter, aber auch irritierte Blicke. Doch die Frau des Vorlauten versetzte ihm einen kräftigen Stoß in die Rippen, was ihn offensichtlich irritierte. Den Rippenstoß hatte er allein schon für die anmaßende Anrede »junger Mann« verdient. Das gehörte sich nicht.
»Da müssen Sie sich einen Augenblick gedulden«, entgegnete Freddy und bremste sich gerade noch, ein gehässiges »Opa« dranzuhängen. »Sie werden noch schnell genug zu Ihrem Gras kommen.«
Jetzt war der Lautsprecher ein Opfer seiner eigenen Avancen geworden. Freddy war sich sicher, dieser Mann hatte nie in seinem Leben einen Joint geraucht, würde es auch nicht mehr tun, liebte es aber umso mehr, vor dem Publikum den Klassenclown zu geben. Dafür nahm der Mann dann auch Kollateralschäden mit seiner Frau ebenso in Kauf, wie sich dem Gelächter der anderen auszusetzen. Also entschloss sich Freddy kurzerhand eins draufzupacken, denn Rücksichtnahme sah er bei solchen Typen, die es darauf anlegten, nicht ein.
»Sie werden verstehen, in Sachen Coffeeshops kann ich Ihnen keine Tipps geben«, verkündete er mit fester Stimme und blickte den Entertainer an, »sonst gerate ich in Verdacht, prozentual an dem Geschäft beteiligt zu sein«, versuchte Freddy den Tanzbären ein wenig von der Leine zu lassen, um das potenzielle Trinkgeld zu steigern, auf das er, wenn er ehrlich war, angewiesen war. »Schließlich sind wir hier nicht auf einem Basar in Marrakesch.«
Das Trinkgeld war wichtig, wenn auch nicht entscheidend. Das Leben in Amsterdam war trotz seiner Bescheidenheit nicht günstig.
»Da is et doch auch schön«, grölte jemand aus der hinteren Reihe.
»Falls Sie aber nach dem Besuch im Coffeeshop Hilfe benötigen, um den richtigen Anlegeplatz Ihres Schiffes zu finden, werde ich Ihnen gerne helfen«, hängte Freddy einen weiteren Kalauer hinten dran.
Die meisten Mitglieder der Touristenschar bogen sich vor Lachen, während andere ostentativ auf die Uhr blickten und wegen des Lautsprechers genervt schienen. Wer wusste schon, was der Mann den ganzen Tag über von sich gab, und als Mitglied einer Reisegruppe war es schwer, sich vor dem Gehabe solcher Typen zu schützen.
»Meine Damen und Herren«, setzte Freddy zum Finale an, »der Palais op de Dam heißt zugleich Koninklijk Paleis. Also einerseits der Palast auf dem Dam, was wiederum sehr gut dazu passt, dass wir uns hier am Ende des Damraks befinden, der zum Bahnhof Centraal führt, der Ihnen sicherlich allen ein Begriff ist.«
Da er mit dem Rücken zum Palast stand, zeigte seine Hand nach links. Amsterdam war seit jeher eine Stadt mit verschachtelten Straßen, Wegen und Brücken, aber die Chance, sich nicht zurechtzufinden, war gering. Nur, wenn ihn jemand korrigierte, gab Freddy seine Vereinfachungen zu und lobte den Kritisierenden ob seines guten Wissensstands in Sachen Amsterdam.
»Die Bauzeit dieses imposanten Gebäudes betrug sage und schreibe siebzehn Jahre. Natürlich ist diese Zeitspanne vor dem Hintergrund der Bauzeit anderer historischer Bauwerke nicht sonderlich groß. Während der Entstehungszeit befand sich Amsterdam in einer Phase der Hochkonjunktur, die heute gerne als »goldenes Zeitalter« bezeichnet und deren Renaissance von vielen alteingesessenen Familien in Amsterdam heute wieder herbeigesehnt wird. Amsterdam bildete damals das Zentrum eines gigantischen Überseeimperiums, dessen Pfeiler aus dem Handel mit exotischen Waren bestanden. Die Ostindien Kompanie wird Ihnen vermutlich ein Begriff sein.«
Zustimmendes Gemurmel und nickende Köpfe bestätigten seine Behauptung.
»Der Architekt Jacob van Campen errichtete das Gebäude im niederländisch-klassizistischen Stil als Rathaus, was auf Niederländisch das Stadhuis heißt. Insofern stimmt es, wir befinden uns hier vor dem ehemaligen Rathaus. Aber ab 1808 diente dieses Prachtstück niederländischer Baukunst ausschließlich als Königlicher Palast. Die Königsfamilie nutzte von 1939 bis heute den Palast zudem als Gästehaus für wichtige Staatsgäste und zu Repräsentationszwecken.«
Wie immer an dieser Stelle machte er eine wohl akzentuierte Pause, um dem Publikum die Gelegenheit zu geben, sich mit Fragen oder Kommentaren einzuschalten. Er fand diese Art einer interaktiven Stadtführung viel spannender und unterhaltsamer als solche, bei der ausschließlich der Fremdenführer die Wortgewalt innehatte. Vielleicht war es auch eine Frage, was für ein Charakter man war, aber ihm war der Austausch mit seinen Mitmenschen ebenso wichtig, wie in seiner Lieblingsstadt leben und arbeiten zu dürfen. Während seiner Erkrankung hatte er darauf verzichten müssen, viel Interaktion mit Menschen zu haben. Die innere Einsamkeit hatte ihn beinahe aufgefressen, aber zu viel menschliche Interaktion war damals beinahe noch schlimmer gewesen.
»Wo hat denn die niederländische Königsfamilie heute ihren Sitz?«, fragte prompt die junggebliebene Blonde und ihr Gesicht zeigte, wie sie selbst nach der Antwort zu ihrer Frage suchte, die sie wahrscheinlich in einem der Klatschblätter bei ihrem Coiffeur gelesen, aber inzwischen vergessen hatte.
»Die niederländische Königsfamilie hat ihren Sitz im Palast Huis ten Bosch in Den Haag«, antwortete er schnell, bevor ein ganz Gewitzter ihm zuvorkommen konnte, was er an dieser Stelle unpassend gefunden hätte.
Ein allgemeines »Ah« folgte.
»Noch als Letztes: 1956 wurde auf dem Platz, auf dem wir uns gerade befinden, das Nationalmonument hinter Ihrem Rücken erbaut.«
Alle Köpfe drehten sich wie auf einen Befehl hin zu der Statue um. Als sich seine Schäfchen wieder ihm zuwandten, war es Zeit, das Finale einzuläuten.
»Das Palastgebäude und das Monument wurden beide zum Rijks Monument erklärt. Mit diesem letzten Hinweis beende ich zeitbedingt meine Stadtführung und hoffe, Ihnen Amsterdams schönste Seiten ein wenig nähergebracht zu haben. Ich sage das nicht jeder Gruppe. Aber mit Ihnen hat es wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank! Falls Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht auf mich zuzukommen. Ich werde Ihnen noch einige Zeit für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.«
Der Applaus war angemessen kräftig und Freddy ließ sich deshalb sogar dazu hinreißen, wie ein Rockstar oder Schauspieler eine Verbeugung anzudeuten. Ein circa achtzigjähriger Mann mit Deckelglatze und Tonsur, der sich bisher völlig mit Bemerkungen zurückgehalten hatte, drängte sich eilig als Erster zu ihm vor. Er hielt einen 5-Euro-Schein in der Hand, schien aber noch nicht gewillt zu sein, das Trinkgeld Freddy sofort auszuhändigen. Das kannte er zur Genüge: Menschen, die das Gefühl hatten, der Guide müsse sich seine Zusatzeinnahme dadurch verdienen, ihnen persönlich zur Verfügung zu stehen. Der Mann hatte einen knallroten Kopf, was wahrscheinlich eher mit seiner Aufregung als mit dem strahlenden Sonnenschein zusammenhing. Er räusperte sich und trat verlegen von einem Fuß auf den anderen.
»Wie stehen Sie denn zu den Behauptungen, die leider immer noch, auch in der neueren deutschen Geschichtsschreibung, aufgestellt werden, die Deutschen hätten die Niederländer bis 1945 ausgebeutet und unterdrückt?«
Innerlich zuckte Freddy zusammen, denn das deutsch-niederländische Verhältnis litt heute immer noch unter dem zum Glück längst vergangenen Joch der deutschen Besatzung während des 2. Weltkriegs. Der Gesichtsausdruck des Mannes verhieß nichts Gutes. Die Anspannung und die Bereitschaft, Menschen mit einer anderen Meinung gnadenlos überzeugen zu wollen, waren eindeutig erkennbar. Wer ihn auf diese Art und Weise fragte, besaß meistens versteckte Sympathien für die Nazis. Auch in seiner eigenen Herkunftsfamilie gab es ein dunkles Kapitel, das er jedoch am liebsten für immer vergessen hätte. Also musste er sich um eine diplomatische Antwort bemühen. Doch der Alte kam ihm zuvor.
»Wissen Sie, ich bin nämlich weitläufig mit dem ehemaligen Reichskommissar der Niederlande, Arthur Seyß-Inquart verwandt«, legte der an der Geschichte des 2. Weltkriegs und dem 3. Reich interessierte Rentner nach. »Familiärer Zusammenhang sollte meiner Meinung nach nicht nur auf dem Papier bestehen …«
Also hatte ihn sein Bauchgefühl nicht nur nicht getrogen, der Mann legte zwar unterschwellig, aber unübersehbar, seine Sympathien für die Besatzer offen – eine schwierige Kiste, für die er sich allerdings aufgrund seiner Erfahrungen eine Strategie zurechtgelegt hatte.
»Oh, darüber müssten wir uns einmal ausführlicher, idealerweise bei einem Kaffee oder einem Glas Bier unterhalten«, gab er seine Standardantwort, wobei er bemerkte, wie auf einmal die Mundwinkel des rüstigen Rentners nach unten zeigten. »Allerdings bin ich der Meinung, dass die nationalsozialistische Besatzung großes Unrecht begangen hat.«
Die Mundwinkel hingen noch weiter nach unten, und eine längere Diskussion stand zu befürchten.
»Ich habe auch eine Frage«, grätschte unvermittelt die blonde Dame hinein und missmutig drückte der mit Seyß-Inquart weitläufig Verwandte ihm den 5-Euro-Schein in die Hand, murmelte etwas Unverständliches und trollte sich unzufrieden von dannen.
Bis er die letzte Frage der Gruppe beantwortet hatte, vergingen weitere fünfzehn lange Minuten. In der Summe war die Tour gut gelaufen und Freddy hatte knapp 100 Euro Trinkgeld eingestrichen, was ihm nicht nur materiell über die Runden half, sondern auch sein Ego streichelte, das unter seiner Erkrankung schwer gelitten hatte. Er blickte auf die Rado, die ihm seine Ex-Frau Monique zum 40. Geburtstag geschenkt hatte. Das war noch gar nicht so lange her, aber es kam ihm vor, als lägen ganze Epochen dazwischen. Er konnte sich nicht einmal mehr ansatzweise an das Glück erinnern, das damals vielleicht Bestandteil seines Lebens gewesen war, denn durch die hinterhältige Erkrankung hatte sich alles geändert. Wirklich alles. Aber je weniger er daran dachte, umso besser ging es ihm. Also musste er das Monster, das jederzeit wieder zuschlagen konnte, für immer in seinem Inneren verbannen.
Freddy rieb sich zufrieden die Hände. Der Nachmittag war jung und die Sonne würde erst in einigen Stunden untergehen. Also wäre es vielleicht am besten, sich in einem gediegenen Café am Nieuwmarkt ein Plätzchen zu sichern, um die Sonne zu genießen und Stadt und Leute zu beobachten. Am nächsten Tag musste er früh raus, denn sein niederländischer Freund Rudy, der eine der renommiertesten Amsterdamer Anwaltskanzleien führte, hatte ihm mitgeteilt, er solle einen neuen Fall mit einer deutschen Touristin als Angeklagter übernehmen. Nicht mehr und nicht weniger Informationen hatte er herausgerückt, aber er würde selbst herausfinden, wie der Fall gelagert und was die beste Verteidigungsstrategie war.
Auf dem Weg zum Café würde er auf der Damstraat in einer ganz speziellen Käserei einkehren, deren Marke mit dem Namen der Stadt glänzte und noch ein Old davorsetzte, was sich vor allem auf den Reifegrad des Käses bezog und zugleich das Gefühl hervorrief, etwas Besonderes zu genießen. Und das stimmte in jeder Hinsicht. Alter, nordholländischer Gouda war eine seiner großen Schwächen und obwohl er trotz seines Alters gut in Form war, überfiel ihn ein schlechtes Gewissen, wenn er zu viel von dem ausgesprochen leckeren Käse aß. Aber es war wichtig, die eigene Seele ab und an zu streicheln. In Gedanken überlegte er, ob er sich bereits auf dem Nachhauseweg ein wenig von dem Prachtkäse gönnen sollte. Warum auch nicht? Es gab nichts und niemanden, was oder wer dagegensprach.
2.
Singelgracht
Einen Tag später saß Freddy beinahe um dieselbe Uhrzeit, zu der er die Touristen der Flusskreuzfahrt verabschiedet hatte, in einem alten niederländischen Kaffeehaus, das durch eine schmale Straße von der Gracht getrennt wurde. Direkt an der Gracht waren kleine Tische aufgestellt worden, um den Umsatz zu steigern. Diese Plätze waren besonders bei Touristen begehrt. Er hingegen bevorzugte den Platz im Außenbereich, der näher an der Theke lag, weil er aus Erfahrung wusste, dass die an der Gracht aufgegebenen Bestellungen eine Weile dauerten.
Weil er für seine Verabredung zu früh da war, hatte er sich schon einen Cappuccino kommen lassen. Inzwischen war er daran gewöhnt, dass die Niederländer jede Kaffeespezialität mit einem leckeren Gebäckstück versüßten. Nun gut, seiner Linie würden die niederländischen Leckereien nicht schaden, denn seit seiner Erkrankung und Scheidung hatte er 15 Kilogramm abgenommen. Während der Dienstzeit als Polizist hatte er sich vor allem aus Kompensationsgründen mit Pommes, Chips, Süßigkeiten und anderem ungesundem Kram vollgestopft. Während seiner Erkrankung hatte er hingegen manchmal vergessen, überhaupt zu essen.