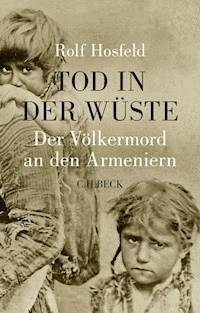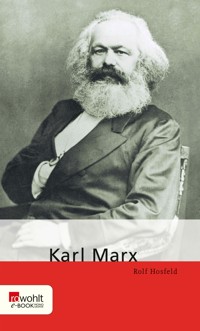
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rowohlt E-Book Monographie Karl Marx zählt zu den bedeutendsten Deutschen des 19. Jahrhunderts und hat unser modernes Denken entscheidend beeinflusst. Aber sein Bild ist von Vorurteilen verstellt. Nach den Umwälzungen von 1989 unternimmt dieses Porträt eine neue Betrachtung in historisierender Perspektive, die Marx' spekulative Irrtümer ebenso thematisiert wie seine heute noch herausfordernden Entdeckungen und zugleich sein abenteuerliches Leben erzählt. Eine kurze Biographie, die alles Wissenswerte über den großen Denker und Politiker bündelt. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rolf Hosfeld
Karl Marx
Über dieses Buch
Rowohlt E-Book Monographie
Karl Marx zählt zu den bedeutendsten Deutschen des 19. Jahrhunderts und hat unser modernes Denken entscheidend beeinflusst. Aber sein Bild ist von Vorurteilen verstellt. Nach den Umwälzungen von 1989 unternimmt dieses Porträt eine neue Betrachtung in historisierender Perspektive, die Marx’ spekulative Irrtümer ebenso thematisiert wie seine heute noch herausfordernden Entdeckungen und zugleich sein abenteuerliches Leben erzählt.
Eine kurze Biographie, die alles Wissenswerte über den großen Denker und Politiker bündelt.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Rolf Hosfeld, geboren am 22. Juni 1948 in Berleburg (NRW), studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie in Frankfurt a. M. und Berlin (West). M.A., Promotion über Heinrich Heine mit summa cum laude. Er war u. a. Verlagslektor, Redakteur der Monatszeitschrift «Merian» und Kulturchef der Wochenzeitung «Die Woche» sowie Film- und Fernsehproduzent, seit 2011 Direktor der Forschungs- und Begegnungsstätte Lepsiushaus Potsdam. Zahlreiche Veröffentlichungen, TV- und Rundfunkbeiträge, mehrere Bücher zu historischen und zeitgeschichtlichen Themen, zuletzt das vierbändige Multimediawerk «Die Deutschen 1815 bis heute» (mit Herrmann Pölking), München 2006/07, «Was war die DDR? Die Geschichte eines anderen Deutschlands», Köln 2008, «Die Geister, die er rief. Eine neue Karl-Marx-Biographie», München 2009, «Tucholsky. Ein deutsches Leben», München 2012, «Johannes Lepsius - Eine deutsche Ausnahme. Der Völkermord an den Armeniern, Humanitarismus und Menschenrechte», Göttingen 2013, « Das Deutsche Reich und der Völkermord an den Armeniern», Göttingen 2017 (mit Christin Pschichholz). Rolf Hosfeld starb am 23. Juli 2021 in Potsdam.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2014
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther
Coverabbildung akg-images, Berlin
ISBN 978-3-644-53281-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Kindheit und Jugend
Am 2. Brumaire des Jahres XII, am 24. Oktober 1804, starb im französisch besetzten Trier der Rabbiner Samuel Marx Levi. Am selben Tag wurde er auf dem jüdischen Friedhof in der Weidengasse begraben. Samuel Marx Levi, 1746 im böhmischen Postoloprity geboren und mit Eva (Chaje) Moses Lewuw aus Anspach verheiratet, war der Großvater von Karl Marx, ein gelehrter und universaler Herr[1], wie es in der hebräischen Inschrift auf seinem Grabstein heißt, der heute noch dort steht, wo er damals errichtet wurde.
Französisches Recht herrschte zu dieser Zeit in Trier, von oben verordnet, und mit ihm die bürgerliche Gleichstellung der Juden. Napoleon Bonaparte, am 18. Mai des Jahres in Paris zum Kaiser der Franzosen ausgerufen, hatte kurz vor Samuels Tod – am 6. Oktober – die seit dem Frieden von Campo Formio 1797 als Verwaltungszentrum des französischen Départements de la Sarre fungierende Stadt besucht, vom «Herrn Maire», dem Bürgermeister, mit einem Ehrenwein aus den Moselbergen in goldenem Becher, einem «coupe des vins-d’honneur», ehrfurchtsvoll begrüßt. «Ja, Herr Maire, Sie haben einen recht guten Wein», meinte Napoleon[2], doch zehn Jahre später, seit dem 8. Januar 1814, befand sich Trier nach über zwei Dekaden des ersten großen europäischen Bürgerkriegs plötzlich unter preußischer Herrschaft. Am 2. November dieses Jahres ließen sich Marx’ Eltern Heschel und Henriette auf dem Trierer Standesamt trauen. Am 30. November fand die jüdische Hochzeit statt.
Als Karl Marx am 5. Mai 1818 geboren wurde, war Heschel bereits zum protestantischen Christentum übergetreten und hatte sich damit jenes unvermeidliche Entrebillet in die offizielle Gesellschaft verschafft, wie Heinrich Heine es einmal nannte, der sich wenig später ebenfalls taufen ließ. Heschel Marx war Rechtsanwalt und Notar und hatte alle Gründe, in Zeiten des Rollbacks der Freiheitsrechte nach dem Wiener Kongress als Glaubensjude andernfalls um seine berufliche Existenz zu fürchten.
Am 9. März 1815 beispielsweise musste der beamtete Frankfurter Polizeiaktuar Löb Baruch, der sich später als Schriftsteller mit dem Namen Ludwig Börne einen Namen machte, erleben, dass er wieder auf die Straße gesetzt wurde, nur weil er Jude war. Die Dekrete zur Gleichberechtigung der Juden waren dem Bemühen der Heiligen Allianz, die Verhältnisse vor der Französischen Revolution wiederherzustellen, zum Opfer gefallen. «Mein eigener Bruder war unter den Frankfurter Freiwilligen nach Frankreich gezogen», erzählt Börne, «während meine Mutter in Angst und Kümmernis war, ihr geliebter Philipp – so heißt er, ich bitte Seine Majestät den König von Preußen ganz untertänig um Entschuldigung – möchte für die deutsche Freiheit totgeschossen werden, entsetzte man mich meines Amtes, weil ich ein Jude war.»[3] Er hätte, um im Amt zu bleiben, zum Christentum konvertieren müssen.
Immer mehr entfernten sich die meisten deutschen Staaten von jener funktionalen und liberalen Auffassung der Religion, welche das preußische Emanzipationsedikt von 1812 noch geprägt hatte.[4] Auch der Rabbinersohn Heschel Marx bekam das zu spüren.
Doch ohnehin war er schon lange dem Einfluss des freien Geistes der Aufklärung erlegen. Er betrachtete sich, wie viele intellektuelle Zeitgenossen, eher als Deist und das Göttliche als ein unpersönliches moralisches Prinzip. Dem, was Newton, Locke und Leibniz geglaubt haben, dieser freien «Anbetung des Höchsten» dürfe sich jeder getrost unterwerfen, meinte er.[5] Deshalb galt ihm, wenn schon die Taufe unabwendbar sein sollte, der Übertritt zum Protestantismus im tiefkatholischen Trier auch als ein bescheidenes Zeichen freien Geistes, das ihm zudem die neue preußische Elite zumindest nicht entfremdete.
Die Wandlung des Heschel zum christlichen Heinrich Marx fand möglicherweise 1816, wahrscheinlich aber später statt. Genau weiß man das nicht mehr. Am 26. August 1824 wurden auch seine sieben Kinder, unter ihnen der sechsjährige Karl, dem Taufritual unterzogen.[6] Sie erhielten nie eine jüdische Erziehung, obwohl ihr Onkel Samuel Marx, der 1827 starb, als Oberrabbiner an die Stelle des Großvaters getreten war.
Die Mutter, auch sie von altem Rabbinerstamm, mit berühmten gelehrten Vorfahren in Krakau und an der talmudischen Hochschule in Padua, wartete, aus Rücksichtnahme auf ihre Familie, bevor auch sie sich im November 1825 taufen ließ. Sie war im niederländischen Nijmegen aufgewachsen und würde nie richtig Deutsch schreiben lernen. Diese Familie sollte Kapitalismusgeschichte schreiben. Henriette Marx’ Schwester Sophie heiratete den Tabak- und Kaffeehändler Lion Benjamin Philips aus Zalt-Bommel, dessen Sohn Benjamin Frederik David 1891 in Eindhoven mit der Glühlampenfabrik Philips N.V. den Grundstein für den späteren Weltkonzern gleichen Namens legte.
Onkel Lion übrigens würde nach dem Tod von Marx’ Vater zum Verwalter des Familienvermögens werden.[7] Dazu gehörte unter anderem das Haus an der Porta Nigra und landwirtschaftlicher Grundbesitz, vor allem Weinberge in Kürenz und Mertesdorf.[8] Marx bezeichnete sich noch 1866 in einem Brief an den Vater seines künftigen Schwiegersohns, den großbürgerlichen Weinhändler François Lafargue, als Ex-Weinbergsbesitzer[9], als dieser ihm eine Lieferung guter Tropfen aus Bordeaux zukommen ließ.
Napoleon war nicht der einzige Imperator, den Trier gesehen hatte. Die Stadt war eine imperiale Gründung, einst die größte römische Ansiedlung nördlich der Alpen, in der Konstantin der Große entscheidende Jahre seines Lebens verbrachte. Die Porta Nigra, heute noch das Wahrzeichen der Stadt, stammt aus konstantinischer Zeit, ebenso wie die alte Basilika und die Ruinen der großzügig angelegten römischen Thermen. Meditationen über den Aufstieg und Verfall der Staaten konnten in dieser Umgebung mehr als modische romantische Träume sein.
Nichts war von Dauer. Weltreiche und gesellschaftliche Ordnungen konnten entstehen und vergehen. In solcher Umgebung, die das sinnfällig zeigte, wuchs Marx auf, in der Simeonstraße, die geradewegs auf das alte römische Tor zuführt. Er hatte Rom gewissermaßen vor Augen, als er in seiner lateinischen Abiturientenarbeit über die Größe des Augustus schrieb, er habe durch seine Institutionen und Gesetze den zerrütteten Staat in einen besseren Zustand versetzt.[10]
Auch die Zeit seiner Jugend war eine Zeit der einschneidenden politischen Veränderungen. Fünf Jahre vor seinem Abitur hatte man mit der Pariser Julirevolution von 1830 den Versuch der Wiederherstellung bourbonischer Legitimität – ein Geschöpf der Heiligen Allianz – unversehens in sich zusammenbrechen sehen. Mit diesem Ereignis war für die Zeitgenossen deutlich geworden, dass das Prinzip der Revolution, nicht das der Restauration – wie bereits von Napoleon auf St. Helena prognostiziert[11] –, den weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts bestimmen würde.
Die erste Folge war die Unabhängigkeit des benachbarten Belgien. England erlebte 1832 eine Wahlrechtsreform, Spanien erhielt 1834 eine konstitutionelle Charta. In Deutschland sammelten sich 1832 Liberale und Demokraten auf dem pfälzischen Schloss Hambach zu einem Fest der Völkerverbrüderung. Im gleichen Jahr gründete Giuseppe Mazzini die Freiheitsbewegung La Giovine Italia und öffnete sie dem europäischen Gedanken. Marx gehörte gewissermaßen zur europäischen Revolutions-Generation seines Jahrhunderts.
Am 13. Januar 1834 veranstaltete die liberale Trierer Casino-Gesellschaft ein Bankett anlässlich der Rückkehr der Deputierten des Landtags in die Stadt. Das war ungewöhnlich, zeigte doch diese öffentliche Demonstration ein deutlich gewachsenes Selbstbewusstsein der Bürgerschaft gegenüber den monarchischen Autoritäten.
Marx’ Vater gehörte zu diesem Kreis einheimischer liberaler Honoratioren. Er war auch einer der Organisatoren jenes damals als ungewöhnlich empfundenen Banketts, hielt dort eine Rede und wurde daraufhin zur polizeilichen Vernehmung zitiert. In Wirklichkeit hatte er auf der Veranstaltung aber nur seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, der König werde den «gerechten und vernünftigen Wünschen seines Volkes immer hold und offen bleiben»[12]. Er war ein preußisch-patriotischer Liberaler. Und er blieb eine wichtige Bezugsperson für seinen Sohn. Karl Marx trug zeit seines Lebens immer ein Bild des Vaters bei sich, der 1838, schon lange leberleidend, plötzlich an einer Tuberkulose verstarb.
Liberal war auch der Geist des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, in das Marx im Jahr der Pariser Julirevolution aufgenommen wurde. Direktor Hugo Wyttenbach, der Geschichtslehrer und ein Freund des Vaters, gehörte zu den Mitgliedern der Casino-Gesellschaft und stand seit dem Hambacher Fest – an dem er teilgenommen hatte – unter Polizeibeobachtung. Die preußischen Behörden stellten ihm bald als Korrektiv und Ko-Rektor den stockkonservativen Altphilologen Vitus Loers zur Seite, der sich immer mehr in den Vordergrund drängte. Man hätte, meinte Heinrich Marx zu seinem Sohn über Wyttenbach, «weinen mögen über die Kränkung dieses Mannes, dessen einziger Fehler allzu große Gutherzigkeit ist»[13]. Preußen war für Heinrich Marx, wie für viele Zeitgenossen, ein Land der gelegentlichen Hoffnungen und vielen Enttäuschungen.
Karl Marx’ bester Schulfreund hieß Edgar von Westphalen, väterlicherseits junger Briefadel, aber durch seine Großmutter Jeanie Wishart of Pittarow auch dem alten schottischen Adelsgeschlecht der Earls of Argyll zugehörig. Edgar brachte es nie recht zu etwas, aber der Kontakt zu Marx sollte zeitlebens nicht abbrechen. Im Wesentlichen ist dieser Umstand seiner Schwester Jenny von Westphalen zu verdanken, jenem schönsten Mädchen von Trier[14], in das sich der Abiturient verliebte und das später seine Frau wurde.
Jenny war eine Intimfreundin von Marx’ Schwester Sophie, vier Jahre älter als er selbst, und ihre Beziehung hatte lange etwas von einer Sandkastenfreundschaft an sich, bevor sie romantische Züge annahm. Ihren Vater nannte Marx in den Widmungszeilen seiner Dissertation einen jugendstarken Greis, der jeden Fortschritt der Zeit mit dem Enthusiasmus und der Besonnenheit der Wahrheit begrüßt.[15] Ludwig von Westphalen war für ihn damals so etwas wie ein väterlicher Freund, zumal Marx in ihm durch seinen Wissensdurst offenbar Hoffnungen weckte, zu denen der luftige Edgar nur wenig Anlass gab. Auch Westphalen, wie Heinrich Marx Mitglied der Casino-Gesellschaft, war von liberalem Geist und verzaubert von dem damals in Deutschland grassierenden saint-simonistischen Fieber[16], wodurch Marx zum ersten Mal in Berührung mit jenen präsozialistischen Ideen kam, die sein späteres Weltbild entscheidend mitformten.
Die Waffe der Kritik
1835 wurde Marx Student. Die industrielle Revolution, die sein großes Lebensthema werden sollte, hatte im Rheinland erste Spuren hinterlassen. Von Koblenz zu seinem ersten Semester in Bonn konnte er bereits mit dem Dampfboot reisen, denn seit 1827 gab es eine regelmäßige Linie zwischen Mainz und Köln. Die Dampfschifffahrt, von vielen Zeitgenossen wie ein beängstigender Geschwindigkeitsrausch empfunden, veränderte schlagartig alle Vorstellungen von Raum und Zeit, noch bevor die ersten Eisenbahnen die Landschaft in Bewegung setzten. Zukunft wurde die neue Parole in einer über Jahrhunderte auf Tradition beruhenden Welt.
«Die Dampfschiffe fahren zu schnell.» – «Sie fahren zu langsam und sind für das Auge ermüdend. Der Gedanke einer feurigen, über das Wasser kriechenden Schildkröte steht vor unserer Einbildungskraft, und wir sind einmal daran gewöhnt, das Kriechen für langsam zu halten.»
Karl Gutzkow: Wally, die Zweiflerin, 1835
Berlin, seinen zweiten Studienort, musste Marx im Oktober 1836 dagegen noch mit der Postkutsche ansteuern. Es dauerte von der Mosel bis an die Spree eine gute Woche. Berlin, damals noch eine weitgehend vorindustrielle Stadt mit über 300000 Einwohnern, war ein Wunsch seines Vaters, denn die dortige Hochschule hatte den Ruf einer Arbeitsuniversität, ganz anders dem Fortkommen des Zöglings förderlich als die von liederlichem Corpswesen beherrschte Bonner Alma Mater, in der Marx gern mit Trierer Landsleuten gekneipt und sich bei einem Duell eine Wunde über dem linken Auge zugezogen hatte.
Ihn selbst dürfte allerdings eher der Ruf der akademischen Freiheit angezogen haben. Die Hochschule Unter den Linden galt als der einzige mehr oder weniger zensurfreie öffentliche Raum in Preußen, und die Atmosphäre Berlins zeichnete sich durch eine fast fieberhafte intellektuelle Neugier aus. Hier würde Marx in den nächsten Jahren die entscheidenden Impulse seines Lebens empfangen.
Wahrscheinlich hätte der Vater ihn am liebsten im Staatsdienst gesehen oder in der Wissenschaft, ganz befreit von den Anstrengungen, denen er selbst noch als Jude der ersten Generation mit ordentlicher akademischer Laufbahn ausgesetzt war. «Ich wünsche in Dir das zu sehn, was vielleicht aus mir geworden wäre, wenn ich unter ebenso günstigen Auspizien die Welt erblickt hätte», lässt er den Studienanfänger in Bonn wissen. «Meine schönsten Hoffnungen kannst Du erfüllen und zerstören.»[17]
Und kaum in Berlin, erreichen Marx gutgemeinte Ratschläge zur strategischen Lebensplanung. Die Klugheit, so eine Botschaft aus Trier, gebiete es, «versteht sich, auf eine ehrenvolle und würdige Weise», nach nützlichen Stützen im künftigen Leben Ausschau zu halten. Will heißen, die für das Fortkommen notwendigen sozialen Kontakte aufzubauen und zu pflegen, zum Beispiel «bei wenigstens einem der einflussreichsten Professoren etwas näheren Zugang zu suchen». Mit seinen natürlichen Anlagen und seinem enormen Fleiß werde der Sprössling sein Ziel bestimmt erreichen, und auf ein Semester mehr komme es dabei nicht an. Philosophie und Jura – «vorzüglich, um den Grund zu legen». Selbst etwas gediegene Poesie schade dem Ruf nie, wenn sie auch in einer angepeilten bürgerlichen Existenz immer nur den zweiten Rang einnehmen sollte.[18]
Man könnte ja, schlägt Heinrich Marx dem Sohn im Frühjahr 1837 vor, vielleicht zum 18. Juni, dem Jahrestag der Schlacht bei Waterloo, eine Ode verfassen, «patriotisch, gefühlvoll und mit deutschem Sinn bearbeitet», und sich so «im Falle des Gelingens einen nicht ganz unbedeutenden Namen» machen. Wenn es darum gehe, sie zu vervielfältigen und unter die Leute zu bringen, wolle er die Kosten gern tragen.[19] Auch wenn der Sohn, wie der Vater an anderer Stelle tadelnd anmerkt, nicht unbedingt zu bescheidener Haushaltsführung neigte: «Als wären wir Goldmännchen, verfügt der Herr Sohn in einem Jahre für beinahe 700 Taler gegen alle Abrede, gegen alle Gebräuche, während die Reichsten keine 500 ausgeben.»[20]
Marx sollte sein ganzes Leben lang dazu tendieren, auf großem Fuß zu leben, wenn er es nur eben konnte. «Die Existenz des Marx besteht in Pendelschwingungen zwischen Champagner und Pfandhaus», urteilte beispielsweise ein Konfident der dänischen Regierung Ende September 1859.[21]
Doch ansonsten herrscht in den väterlichen Briefen nach Berlin ganz der gefühl- und verständnisvolle Ton der Biedermeierzeit vor. Der Scheck vom Februar 1837 fällt höher aus als angefordert, und auch in Herzensangelegenheiten erweist sich der Vater als eine große Stütze. «Du weißt, lieber Karl», lässt er ihn wissen, «ich habe aus Liebe zu Dir mich in etwas eingelassen, was nicht meinem Charakter ganz anpasst und was mich wohl zuweilen drückt. Aber mir ist kein Opfer zu groß, wenn es das Wohl meiner Kinder erfordert. Ich habe auch das unbegrenzte Zutrauen Deiner Jenny erworben. Aber das gute, liebenswürdige Mädchen peinigt sich unaufhörlich – fürchtet Dir zu schaden – Dich zur Überanstrengung zu verleiten etc. etc. etc. Drückend ist es für sie, dass ihre Eltern nichts wissen oder, wie ich glaube, nichts wissen wollen. Sie kann sich selbst nicht erklären, wie sie, die ganz Verstandmensch zu sein glaubt, sich so hinreißen ließ.»[22] Er solle ihr doch einmal über ihn als «Unterhändler» schreiben, das könne ihrem «kindlichen, reinen Gemüte»[23] Trost bringen.
Viel ist nicht überliefert, aber ein paar bemühte poetische Versuche doch. Ach, diese Blätter dürfen fliegen, so ein Sonett an die ferne Verlobte. Sie dürfen Dir sich bebend nahn, / Und meine Geister unterliegen, / Vor Trennungsschmerz und Wahn. Des Pathos nicht genug, geht es weiter: Und wenn ich aus der Ferne kehre, / Verlangend zu dem teuren Sitz, / Umfasst ein Gatte Dich, die hehre.[24] Ein Genie der Leichtigkeit war Marx nie. Doch, so der Vater, der zu dieser Zeit den Kontakt mit der heimlich Verlobten aufrechterhält, nicht einmal «ein Fürst» wäre imstande gewesen, «sie Dir abwendig zu machen».[25] Im März 1837 wurden auch Westphalens in die heimliche Verlobung eingeweiht.
Die Karriereratschläge des Vaters fanden allerdings keine sonderliche Beherzigung, und auch das Studium vollzog sich eher außerhalb als innerhalb der geordneten Curricula. Marx belegt zwar Kriminalrecht bei Friedrich Carl von Savigny, Preußisches Landrecht bei Eduard Gans und Hegel’sche Logik bei Georg Andreas Gabler, aber, bald nach seiner Ankunft in Berlin, zwei Semester lang gar nichts. Stattdessen vertieft er sich ins Selbststudium, sehr zur Sorge des Vaters, der ihm unwillig vorwirft, «wie Du Deine Gaben verschwendest und Nächte durchwachst, um Ungetüme zu gebären». Wie aus diesem negierenden Genie jemals ein gediegener Denker werden solle, das gebe ihm unlösbare Rätsel auf.[26]
Marx hatte diesen Brief noch nicht erhalten, als er dem Elternhaus eine umfangreiche Rechtfertigung seines eingeschlagenen Weges zusandte. Teurer Vater, lässt sich der Neunzehnjährige nach dem zweiten Berliner Semester mit gestelzter Frühreife vernehmen. Es gibt Lebensmomente, die wie Grenzmarken vor eine abgelaufene Zeit sich stellen, aber zugleich auf eine neue Richtung mit Bestimmtheit hinweisen. In solch einem Übergangspunkte fühlen wir uns gedrungen, mit dem Adlerauge des Gedankens das Vergangene und Gegenwärtige zu betrachten, um so zum Bewusstsein unserer wirklichen Stellung zu gelangen.[27] Es handelt sich um das Resümee eines sommerlichen Kuraufenthalts am Rummelsburger See bei Berlin. Anfang 1837 war er dem Arzt wegen Brustschwäche und periodischen Blutspuckens aufgefallen und wenig später wegen Reizbarkeit der Lungen zum Invaliden erklärt worden. Nun sollte die frische Landluft im Fischerdorf Stralau vor den Toren der preußischen Hauptstadt den bleichsüchtigen Schmächtling erst einmal wiederherstellen.
Er hatte soeben sein zweites Berliner Semester abgeschlossen. Anfangs war ihm die groteske Felsenmelodie der Hegel’schen Philosophie, zumal in dem trockenen Vortrag von Gabler, etwas fremd geblieben, doch nun kam sie seinem Bedürfnis nach Ruhe überaus entgegen. Marx vertiefte sich beim Mondschein am Ufer des Rummelsburger Sees in Hegel, vom Anfang bis zum Ende, lief wie toll im Garten an der Spree schmutzigem Wasser umher, fiel am Ende dem Feind in den Arm und wurde Hegelianer. Von dem Idealismus, so das Fazit, den ich, beiläufig gesagt, mit Kantischem und Fichteschem verglichen und genährt, geriet ich dazu, im Wirklichen selbst die Idee zu suchen. Hatten die Götter früher über der Erde gewohnt, so waren sie jetzt das Zentrum derselben geworden.
«Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins gebrochen und steht im Begriffe, es in die Vergangenheit hinab zu versenken, und in der Arbeit seiner Umgestaltung.»
G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, 1807
Die Welt war in sich vernünftig, auch wenn sie in sich widersprüchlich war. Ein zweites Fazit der Stralauer Sommerwochen lautete: Im konkreten Ausdruck lebendiger Gedankenwelt, wie es das Recht, der Staat, die Natur, die ganze Philosophie ist, hier muss das Objekt selbst in seiner Entwicklung belauscht, willkürliche Einteilungen dürfen nicht hineingetragen, die Vernunft des Dinges selbst muss als in sich Widerstreitendes fortrollen und in sich seine Einheit finden.[28] Wissenschaft, das hatte Marx von Hegel gelernt, bedeutete, sich dem Leben des Gegenstands zu übergeben und aus ihm selbst durch gedankliche Abstraktion die Begriffe und Kategorien zu destillieren, die ihn klassifizieren und einordnen.
Zunächst einmal fand er in Hegel jedoch den Schlüssel zu dem, was in seinem künftigen Wortgebrauch Kritik heißt. Die Gegenwart kritisch betrachten bedeutete für ihn und seine Generation von jungen Hegelianern, sie nicht als Gegebenes hinzunehmen, sondern aus ihren inneren Widersprüchen jene Prinzipien und Tendenzen herauszuarbeiten, die über sie hinaus in die Zukunft wiesen. Ein Biergarten am Stralauer Spreeufer wurde dabei zum Laboratorium solcher Gedankenexperimente. Hier traf sich im Sommer 1837 der Berliner Doktorklub, ein exzentrischer Zirkel kritischer Hegelschüler, zu dem der junge Student Marx sich jetzt auch zählte; und in diesem Ambiente offenbarte sich manche widerstrebende Ansicht[29].
Im Stralauer Wirtshaus, bei regelmäßigen Literatentreffen in einem Café in der Französischen Straße und bei Marx in der Schützenstraße, nicht etwa in akademischen Seminarräumen oder Vortragssälen, entstanden die Anfänge jener Hegel’schen Linken, ohne die Marx’ weitere Entwicklung kaum vorstellbar ist. Er selbst war in diesem Kreis der bei weitem Jüngste, aber nicht selten ein wesentlicher Impulsgeber. Hegel etwas vereinseitigend, behauptete man bald, dass weniger die Wirklichkeit in sich vernünftig als dass vielmehr die Vernunft die eigentliche Wirklichkeit sei.[30] Und die Vernunft war wesentlich negierend, eben «kritisch».
Unmittelbar politisch konnte diese abstrakte Fragestellung werden, wenn man sie auf den preußischen Staat bezog. War er für Hegel bereits ein in sich vernünftiges Gebilde, oder hatte sich in ihm die Vernunft erst noch zur Wirklichkeit auszubilden? Forderte nicht die Hegel’sche Gestalt der Idee, der Freiheit, fragte Marx wenig später, auch und notwendig die Freiheit der unbeschränkten öffentlichen Meinungsäußerung?[31]