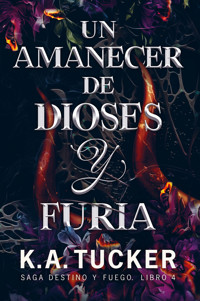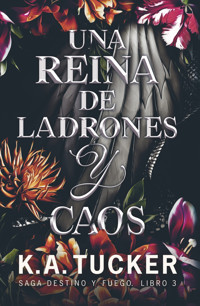9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dunkel, gefährlich und romantisch Seit Grace denken kann, lebt sie in einem Trailerpark, wo es niemanden interessiert, dass ihr Vater ein korrupter Cop war und ihre Mutter stetig auf den Drogentod zusteuert. Bis eines Tages Noah aus ihrer Vergangenheit vor ihrer Tür steht und eine Tasche voller Geld dabeihat, das angeblich für sie sein soll. Beide fühlen sich zueinander hingezogen, auch wenn es aufgrund ihrer Vorgeschichte kaum schlechtere Vorzeichen für sie geben könnte. Um Grace zu helfen, den Namen ihres Vaters reinzuwaschen, müsste Noah den Ruf seiner toten Mutter aufs Spiel setzen. Aber irgendjemand ist mit allen Mitteln darauf aus, dass die Wahrheit von damals auf keinen Fall ans Licht kommt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
BLUT IST DICKER ALS WASSER, ABER IST LIEBE STÄRKER ALS SCHULD?
Seit Grace denken kann, lebt sie in einem Trailerpark, wo es niemanden interessiert, dass ihr Vater ein korrupter Cop war und ihre Mutter stetig auf den Drogentod zusteuert. Bis eines Tages Noah aus ihrer Vergangenheit vor ihrer Tür steht. Beide fühlen sich zueinander hingezogen, auch wenn es kaum schlechtere Vorzeichen für sie geben könnte: Um Grace zu helfen, den Namen ihres Vaters reinzuwaschen, müsste Noah den Ruf seiner toten Mutter aufs Spiel setzen. Und irgendjemand ist mit allen Mitteln darauf aus, dass die Wahrheit von damals auf keinen Fall ans Licht kommt …
Dunkel, gefährlich und romantisch – ein betörender Spannungscocktail
Von K. A. Tucker sind bei dtv außerdem lieferbar:
Wir. Hier. Jetzt.
Wir. Hier. Vielleicht? (als E-Book)
Für all die Abraham Wilkeses dort draußen,die jeden Tag ihr Leben riskieren
PROLOG
Corporal Jackie MarshallJuni 1997
»Da sind bestimmt fünfhundert Gramm in jedem drin.« Abe stupst mit der Spitze seines Stifts einen der wiederverschließbaren Plastikbeutel mit Marihuana an. Der Küchentisch ist übersät mit diesen Beuteln und Geldbündeln. Jede Wette, dass in diesem Drecksloch von Apartment noch viel mehr versteckt ist.
Ich schaue zu dem Typen, den wir gerade hochgenommen haben. Er liegt unter dem wachsamen Blick eines anderen Officers bäuchlings auf dem Boden, die Hände auf dem Rücken gefesselt, und wartet auf seinen Abtransport zur Wache. Ein dürrer neunzehnjähriger Hitzkopf. »Ich weiß ja nicht, wie’s dir geht, aber ich hätte es mir zweimal überlegt, ob ich meine Freundin krankenhausreif prügle, wenn ich die Bude mit diesem ganzen Zeug vollhätte.« Seine Nachbarn haben den Notruf verständigt, als sie hörten, wie Glas zu Bruch ging und er Todesdrohungen ausstieß. Eine Flut rassistischer Beschimpfungen gab uns Grund genug, die Tür einzutreten, worauf er Abe auch noch ins Gesicht gespuckt hat. So kam es, dass wir nicht nur das blutüberströmte blonde Mädchen gefunden haben, sondern auch das hier.
Die Sanitäter verarzten gerade die Schnittwunden in ihrem Gesicht, während wir auf die Kollegen von der Drogenfahndung warten.
Abe reibt sich mit seiner ebenholzschwarzen Hand über die Wange. »Was meinst du, was der ganze Plunder wert ist?«
»Hängt von der Qualität ab. Zehntausend? Vielleicht zwanzig?«
Er pfeift leise. »Ich bin in der falschen Branche gelandet.«
»Da bist du nicht der Einzige. Wir mussten letzten Monat den Scheck für unsere Hypothekenrate platzen lassen.« Blair hat mir gleich gesagt, dass wir uns das Haus nicht leisten können. Ich hätte auf ihn hören sollen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht vorgehabt, schwanger zu werden. Nicht dass ich es bereue, Noah bekommen zu haben. Ich dachte nur, ich hätte mich auf der Karriereleiter schon etwas weiter nach oben gearbeitet, bevor ich bis zu den Ellbogen in Windeln und Babybrei versinke.
»Keine Sorge, wird nicht mehr lange dauern, bis du das große Geld machst, Sergeant Marshall …«, sagt Abe mit gutmütigem Spott und zeigt seine Grübchen, als er dabei breit grinst. So nennt er mich jetzt ständig, seit ich vor ein paar Monaten die Prüfung bestanden habe und auf die Beförderungsliste gesetzt wurde. »Hauptsache, du vergisst uns kleine Streifenpolizisten nicht, wenn du anfängst, dir einen Stern nach dem anderen an den Kragen zu heften.«
»Sei nicht albern.« Ich verdrehe die Augen.
»Wieso? Du bist eine verflucht ehrgeizige Frau, Jackie, und diese ganzen Clowns hier steckst du locker in die Tasche, Anwesende eingeschlossen.« Er seufzt. »Aber für mich wird es ohne dich nicht mehr dasselbe sein.«
»Ich werde es vermissen, deine Partnerin zu sein, Abe.« Nach sieben Jahren gibt es im Austin Police Department – und in meinem Leben – niemanden, dem ich mehr vertraue als Abe Wilkes.
Er schnaubt. »Keine Sorge, du wirst mich noch oft genug zu Gesicht kriegen. Im Ernst, Jackie. Noah wird wahrscheinlich öfter bei uns zu Hause sein als bei euch.«
»Kommt Dina denn klar? Ich meine, jetzt wo sie selbst ein Baby hat? Ich möchte auf keinen Fall, dass Noah eine zusätzliche Belastung für sie ist.«
Abe winkt ab. »Im Gegenteil. Wenn du nicht aufpasst, will Dina den Kleinen am Ende gar nicht mehr hergeben. Sie hat darauf bestanden.«
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Dina gewesen ist, die angeboten hat, sich um Noah zu kümmern, während Blair und ich arbeiten, oder ob es Abes Vorschlag war. Ich habe noch nie einen erwachsenen Mann erlebt, der einen solchen Narren an einem kleinen Jungen gefressen hat wie Abe an meinem Noah. Nicht einmal Blair schenkt ihm so viel Beachtung, dabei ist Noah sein Sohn. »Deine Frau ist nicht nur wunderschön, sondern dazu noch ein Engel. Hättest du sie nicht schon vor ein paar Jahren schwängern und heiraten können? Dann hätte ich eine Menge Geld für Tagesmütter gespart.«
Abe hat Mühe, sein dröhnendes Lachen im Zaum zu halten – es wäre in unserer momentanen Umgebung fehl am Platz. »Ich würde mal sagen, wir waren so schon ganz schön schnell, oder?«
Drei Monate nach dem ersten Date schwanger zu werden und noch in derselben Woche, in der sie es herausfinden, standesamtlich zu heiraten? Das würde ich allerdings auch sagen. »Kommt deine Mom mittlerweile klar?« Abes Mutter, eine traditionelle Christin, war alles andere als begeistert, als sie erfuhr, dass ihr achtundzwanzigjähriger Sohn ein achtzehnjähriges Mädchen geschwängert hatte. Ein achtzehnjähriges weißes Mädchen. Ich habe Carmel Wilkes kennengelernt und glaube nicht, dass sie ein grundsätzliches Problem mit Dina hat. Sie macht sich mehr Sorgen darüber, dass andere Leute ein Problem damit haben könnten, dass Dina und Abe ein Paar sind, und über die Schwierigkeiten, die daraus entstehen könnten. Auch wenn Austin für texanische Verhältnisse eine extrem offene Stadt ist, gibt es immer noch jede Menge Vorurteile und Hass, wenn es um die Hautfarbe eines Menschen geht.
Abe zuckt mit den Schultern. »Sagen wir, sie fängt langsam an, sich damit abzufinden.«
»Ich wette, deine bezaubernde kleine Gracie macht die ganze Sache einfacher.«
Wie immer, wenn jemand den Namen seiner Tochter erwähnt, breitet sich auf Abes Gesicht ein strahlendes Lächeln aus. Er will gerade etwas erwidern – wahrscheinlich wieder eine Geschichte darüber zum Besten geben, wie süß sie ist –, als unsere Funkgeräte knackend zum Leben erwachen.
»Die Kavallerie ist hier.« Ich klopfe mir auf den Bauch. »Sehr gut, ich sterbe nämlich vor Hunger. Lass uns diesen Abschaum hier abliefern und dann einen Happen essen gehen.«
»Hey …« Abe senkt die Stimme zu einem Flüstern. »Was meinst du, wie genau nehmen es die Typen vom Drogendezernat mit den Vorschriften?«
»Genau genug, würde ich vermuten. Warum?«
Der Blick seiner schokoladenbraunen Augen wandert über die Geldbündel. »So eins davon könnte bestimmt ganz leicht verloren gehen, oder?«
Eine solche Frage stellt man nicht, erst recht nicht, wenn man eine Polizeiuniform trägt und vor einem Küchentisch voller Drogen steht. »Sehr leicht sogar, würde ich vermuten.«
1
NoahApril 2017Austin, Texas
»Hallo?«
Mir antwortet eine Reihe verzerrt klingender Codewörter, die der Polizeifunk den dunklen Flur hinunterträgt.
Meine Stimmung sinkt in den Keller.
Sie ist noch auf.
Ich schlüpfe aus meinen staubigen Sneakers und mache mich seufzend auf den Weg in den hinteren Teil des Hauses. »Hey, Mom«, sage ich, als ich an ihrer vornübergebeugt am Küchentisch sitzenden Gestalt vorbeigehe, und versuche so entspannt wie möglich zu klingen. Auf dem Rand eines Esstellers glimmt eine Zigarette, in direkter Griffweite steht eine halb geleerte Flasche billiger Whiskey, daneben liegt ihr wie achtlos hingeworfenes Gürtelholster, in dem ihre Dienstwaffe steckt.
Ich weiß nicht, warum ich gehofft habe, dass heute irgendetwas anders ist. Diese Szene begrüßt mich seit Wochen jeden Abend, wenn ich nach Hause komme.
»Wo hast du gesteckt?« Wenn sie getrunken hat, wird ihr texanischer Zungenschlag immer eine Spur ausgeprägter.
Ich mache den Kühlschrank auf. »Heute ist Mittwoch.«
Statt den Kopf zu heben, dreht sie ihn nur etwas zur Seite und entdeckt den Basketball unter meinem Arm. »Ach ja, stimmt. Ich kann einfach nicht mit dir mithalten.«
Ich könnte dagegenhalten, dass es da nicht viel mitzuhalten gibt. Ich bin ein Gewohnheitstier. Wenn ich nicht bei der Arbeit bin, bin ich mit meinen Freunden unterwegs, im Fitnessstudio, ziehe meine Bahnen im Becken oder werfe Bälle. Seit ich vor sieben Jahren nach Austin zurückgezogen bin, um an der University of Texas zu studieren, gehe ich jeden Mittwochabend zu denselben Streetball-Plätzen.
Stattdessen öffne ich wortlos den Orangensaft und trinke ihn direkt aus dem Karton. Etwas in mir wünscht sich, sie würde mir eine kleine Standpauke halten, weil ich kein Glas benutze. So, wie sie es früher gemacht hat, als sie noch nicht sofort die Hausbar ansteuerte, kaum dass sie nach der Arbeit zur Tür reinkam. Als sie mich noch ermahnte, gefälligst nicht mit meinem Ball durchs Haus zu dribbeln und meine verschwitzten Klamotten sofort in die Waschmaschine zu stecken, damit es in meinem Zimmer nicht wie in einer Umkleidekabine riecht.
Mittlerweile macht sie sich meistens noch nicht einmal die Mühe, ihre Uniform abzulegen und sich umzuziehen, wenn sie nach Hause kommt.
Als wollte ich mir beweisen, dass ich recht habe, lasse ich den Ball einmal … zweimal … auf den Fliesen aufspringen und klemme ihn nach dem dritten Mal zwischen Unterarm und Hüfte, während das Echo des dumpfen Aufprallgeräuschs noch in der Luft hängt.
Warte.
Hoffe.
Nichts. Nicht mal ein kurzer ungehaltener Blick. Sie sitzt einfach nur weiter da, die Lider auf Halbmast, die kurzen blonden Haare zerrauft, und starrt geistesabwesend auf die Eichenholzmaserung der Tischplatte. Sie schert sich nicht mehr um einfache Umgangsformen. Seit Wochen tut sie nichts anderes, als nach Feierabend am Küchentisch vor ihrem Funkgerät zu sitzen und den von statischem Rauschen begleiteten Meldungen über Raubüberfälle, häusliche Gewalt und einem Dutzend anderer nächtlicher Vorfälle zu lauschen, die im Austin Police Department eingehen.
Ihrem Police Department, sie ist nämlich die Polizeichefin. Ein weiblicher Chief in einer der größten Städte der Vereinigten Staaten. Eine Riesenleistung. Sie hat den Posten seit zwei Jahren.
Und schien der Aufgabe bis vor Kurzem bestens gewachsen zu sein.
Ich huste gegen den Nikotingestank an, der in der Luft liegt, und schiebe das Fenster über der Spüle nach oben. Kühle Frühlingsluft weht herein. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich vermisse den Geruch von Zitronenreiniger und Bleichmittel.
»Vergiss nicht, es wieder zuzumachen, bevor du schlafen gehst. Nicht dass jemand hier einsteigt und uns ausraubt«, murmelt sie.
»Uns raubt schon niemand aus.« Wir leben in Clarksville, einer altehrwürdigen Nachbarschaft, das zu den Vierteln der Stadt gehört, die von sich aus schon den Ruf haben, besonders sicher und sauber zu sein. Aber ich kann ihr keinen Vorwurf machen, dass sie sich um unsere Sicherheit sorgt, schließlich ist sie schon seit dreißig Jahren im Polizeidienst. Sie kennt die Schattenseiten der Gesellschaft. Womöglich weiß sie Dinge über unsere Nachbarn, die mich dazu bringen würden, den Blick abzuwenden, wenn ich ihnen auf der Straße begegne. Trotzdem sind selbst die übelsten Ecken in Austin ein Kinderspielplatz im Vergleich zu den typischen Großstadtghettos.
Ich runzle die Stirn, als mein Blick ins Spülbecken fällt. Der Edelstahl ist voller schwarzer Sprenkel. »Hast du irgendwas verbrannt?«
»Bloß … Müll.«
Ich fische einen Papierfetzen heraus, der an einer Seite perforiert ist. Er sieht aus, als wäre er aus einem Notizblock herausgerissen worden. Darauf steht in einer Handschrift, die nicht die meiner Mutter ist, das Datum 16. April 2003.
»Der größte Fehler meines Lebens.« Sie zieht an ihrer Zigarette, ihre Stimme ist leise und undeutlich. »Ich hätte wissen müssen, dass Betsy nicht die Einzige war …«
»Wer ist Betsy?«
»Niemand mehr«, nuschelt sie und schiebt noch etwas Unverständliches hinterher.
Ich fülle Wasser aus dem Hahn in ein großes Glas und stelle es vor sie hin, um sie abzulenken, während ich die Whiskeyflasche aus ihrer Reichweite schiebe. Aber sofort streckt sie mit einer langsamen, fahrigen Bewegung die Hand danach aus. »Gib sie mir wieder, Noah. Auf der Stelle, hast du gehört?«
Ich stelle mich demonstrativ auf die andere Seite des Tischs und drehe, so fest ich kann, den Deckel zu, auch wenn ich weiß, dass sie die Flasche ziemlich sicher trotzdem aufkriegen würde. Für eine Frau ihrer Statur – eins zweiundsechzig groß, fünfundsechzig Kilo – besteht sie ganz aus Muskeln. Das heißt, sie bestand mal ganz aus Muskeln. Seit ihrer allabendlichen Alkoholdiät hat ihr Körper angefangen abzubauen. »Ich glaube, für heute ist es genug.«
»Was weißt du schon davon, wie viel genug ist? Es gibt gar nicht genug Whiskey auf dieser Welt für das, was ich getan habe.« Sie nestelt an den vier silbernen Sternen an ihrem Uniformkragen herum, als wollte sie sie abreißen.
Das ist also mal wieder einer dieser Abende. Aber wem versuche ich eigentlich was vorzumachen? Diese Abende, an denen sie anfängt, unzusammenhängendes Zeug von sich zu geben, und davon redet, sie hätte es nicht verdient, Polizeichefin zu sein, werden in letzter Zeit immer häufiger. Ich vermisse die Tage, an denen sie sich über nichts anderes als idiotische Gesetze und fehlende Mittel für das Department beschwert hat.
»Na los«, seufze ich. »Ich helfe dir nach oben.«
»Nein«, knurrt sie und runzelt starrsinnig die Stirn.
Mittlerweile ist es halb zwölf. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch auf ist, normalerweise hat sie sich nämlich schon gegen neun halb bewusstlos getrunken. Aber wenn sie jetzt noch ein paar Gläser Wasser trinkt und dann schlafen geht, hält sich ihr Kater morgen früh vielleicht in Grenzen, und sie schafft es, trotzdem zur Arbeit zu gehen.
Ich falte meine knappen Ein-Meter-Neunzig in den Stuhl ihr gegenüber. »Mom?«
»Mir geht’s gut …« Sie zieht gereizt die Brauen zusammen, während sie versucht, die nächste Zigarette aus ihrem Päckchen zu fischen.
Ich wünschte, ich könnte wütend auf sie sein. Stattdessen bin ich traurig und frustriert. Mir wird allmählich immer klarer, dass ich mir Hilfe suchen muss, aber ich habe keine Ahnung, bei wem. Als sie das letzte Mal so viel getrunken hat, war ich elf. Damals waren sie und Dad noch verheiratet, also hat er sich darum gekümmert. Aber seitdem hat Dad mit einer anderen Frau eine neue Familie gegründet und führt jetzt ein durch und durch bodenständiges Leben in Seattle. Er ist nicht dafür geschaffen gewesen, mit einer Polizistin verheiratet zu sein, erst recht nicht mit einer, die so ehrgeizig ist wie meine Mutter.
Sie würde mir bei lebendigem Leib die Haut abziehen, wenn ich es wagen würde, mit jemandem aus ihrem Department über ihr Alkoholproblem zu reden. Es sind zu viele Typen darunter, die nur darauf lauern, einen Grund zu finden, ihren weiblichen Chief loszuwerden. Und das wäre ein verdammt guter Grund.
Ich könnte mit Onkel Silas sprechen. Er ist der Bezirksstaatsanwalt; es wäre ihm bestimmt nicht recht, wenn seine Wähler herausfinden würden, dass seine Schwester, die Polizeichefin, Alkoholikerin ist. Ich hätte schon längst mit ihm darüber reden sollen, aber ich hatte gehofft, dass es nur eine Phase ist, aus der sie aus eigener Kraft wieder herausfindet.
Vielleicht braucht sie bloß ein bisschen liebevollen Druck von unserer Seite, um wieder trocken zu werden. Vor ein paar Jahren hat sie es schon mal geschafft. Hat von heute auf morgen zu trinken aufgehört. Mom ist hart im Nehmen. Sie kann es noch mal schaffen.
Falls sie es will.
Ich drehe die Lautstärke am Polizeifunk leiser. »Mom?«
Sie reißt ruckartig die Augen auf. Es dauert einen Moment, bis sie mich wahrnimmt. »Wie war’s beim Basketball?«
»Wir haben ziemlich was einstecken müssen.«
»Mit wem hast du gespielt?«
»Jenson, Craig. Die übliche Mannschaft.«
»Jenson und Craig …« Sie lässt den Blick über meine Arme wandern, die vom regelmäßigen Gewichtheben und Schwimmen definiert und sehnig sind. Ein kleines wehmütiges Lächeln stiehlt sich in ihr Gesicht, das sie für einen Moment nüchterner wirken lässt. »Aus dir ist ein starker und unabhängiger junger Mann geworden, Noah. Und ein ausgesprochen kluger dazu. Du weißt, dass ich dich über alles liebe, oder?«
Ich schiebe das Wasserglas noch ein Stück näher zu ihr hin. »Nimm wenigstens einen Schluck, Mom. Bitte.«
Sie trinkt es sogar bis zur Hälfte aus, greift anschließend aber sofort nach ihrem Whiskeyglas und leert es in einem Zug.
»Wann musst du morgen im Department sein?« Die Chancen, zu ihr durchzudringen und eine ernsthafte Unterhaltung mit ihr zu führen, stehen vermutlich besser, wenn sie wieder nüchtern ist und versucht, ihren Kater mit einem starken Kaffee zu kurieren.
»Aus dir ist ein guter, aufrichtiger Mensch geworden«, sagt sie, als hätte sie meine Frage gar nicht mitbekommen. »Du wirst deinen Weg gehen.«
Ich stehe auf, fülle drei weitere Gläser mit Wasser und reihe sie vor ihr auf dem Tisch auf. »Hier, trink. Bitte.«
Sie greift widerstrebend nach dem ersten Glas.
»Okay, dann springe ich mal schnell unter die Dusche.« Ich bücke mich nach der Whiskeyflasche, die ich in der Zwischenzeit unter den Stuhl gestellt habe. Ohne ihren Stoff wird sie garantiert nach oben torkeln und in ihrer Uniform bäuchlings auf dem Bett liegend ins Koma gefallen sein, bis ich fertig bin.
»Er ist auch ein guter, aufrichtiger Mensch gewesen«, nuschelt sie.
»Du bist noch jung, Mom. Ich bin mir sicher, du findest noch mal jemanden.« Das ist auch so etwas, von dem sie fast jedes Mal anfängt, wenn sie betrunken ist – sie redet von Dad, sagt, dass es ihre Schuld ist, dass sie sich haben scheiden lassen. Und gleich wird sie sagen, dass sie eine schreckliche Mutter ist, weil sie mich vor all den Jahren nicht bei sich behalten und zugelassen hat, dass er mich nach Seattle mitnahm. Sie glaubte damals, dass ein Junge seinen Vater braucht.
»Nicht dein Dad … Abe.«
Ich erstarre.
Sie hat diesen Namen seit Jahren nicht mehr ausgesprochen.
Vorsichtig frage ich: »Der Abe? Abraham?«
»Mhmm.« Sie nickt. Wieder spielt dieses wehmütige Lächeln um ihre Lippen. »Du erinnerst dich doch noch an ihn, oder?«
»Natürlich.« Abraham Wilkes war ein großer Mann mit tiefschwarzer Haut und einem strahlenden Lächeln, der mir beigebracht hat, wie man einen Ball dribbelt. Er war lange Jahre der Partner meiner Mutter und sogar noch länger einer ihrer besten Freunde.
Bis er von einem Drogendealer erschossen wurde und nach seinem Tod den Stempel »Korrupter Cop« aufgedrückt bekam. Ich war elf, als er starb. Ich verstand damals nicht, was das bedeutete, ich verstand nur, dass Abraham Wilkes etwas Schlimmes getan hatte. Der Fall machte landesweit Schlagzeilen und führte dazu, dass sich die sowieso schon spürbare Kluft zwischen Schwarz und Weiß vergrößerte. Es führte dazu, dass Mom mit dem Trinken anfing, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es letztlich zum Auseinanderbrechen unserer Familie führte.
»Er war ein guter Mensch.« Ihre Augen werden feucht und ihr Blick driftet in die Ferne. »Er war ein guter und aufrichtiger Mensch.«
Ich gehe von der Tür an den Tisch zurück. »Ich dachte, er wäre bestechlich gewesen und hätte mit konfiszierten Drogen gedealt.«
Sie zieht an ihrer Zigarette und lacht leise auf. Es ist ein traurig hohler Laut. »Das ist das, was alle Welt denkt, weil es das ist, was sie sie glaubengemacht haben. Aber du …« Sie sticht mit ihrem Zeigefinger in die Luft. Ihre sonst penibel gepflegten Fingernägel sind bis aufs Fleisch abgekaut. »Du musst die Wahrheit kennen. Ich will, dass du weißt, dass er der Gute war und wir die Bösen sind.«
»Wen meinst du mit wir?« Am liebsten würde ich den Stuhl herausziehen und mich wieder zu ihr setzen, um herauszufinden, was sie mir zu sagen versucht. Aber womöglich würde ihr dann bewusst werden, dass sie über Dinge spricht, von denen sie denkt, sie sollte sie besser für sich behalten.
Also bleibe ich stehen und schaue schweigend zu, wie sie umständlich die nächste Zigarette aus dem Päckchen klopft und ansteckt. »Er hat Dinas Leben zerstört. Hat sie und ihr wunderschönes kleines Mädchen aus der Stadt gejagt. Sie war noch so klein, als Abe starb. Gracie. Er hat immer gestrahlt, wenn er ihren Namen sagte.« Mom lächelt gedankenversunken vor sich hin. »Von ihrer Mutter hat sie die grünen Augen geerbt und von Abraham die vollen Lippen und krausen Locken. Und ihre Haut, sie schimmert wie Karamell, und …«
»Mom!«, unterbreche ich sie, um ihre Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt zurückzulenken. Ich kann mich noch dunkel an Abes Tochter erinnern – ein süßes Mädchen mit großen Augen und einem dichten Schopf Korkenzieherlocken –, aber mich interessiert im Moment etwas anderes. »Wovon redest du? Wer hat was getan?«
»Es war nicht abzusehen, dass es so kommt. Obwohl … wahrscheinlich doch. Aber ich habe mir von ihm einreden lassen, dass es das Richtige ist.«
»Von wem? Abe?«
Sie schüttelt langsam den Kopf. »Ich habe es nicht verdient, Polizeichefin zu sein, aber der Köder war verflucht noch mal einfach zu gut, um ihn nicht zu schlucken. Ich war der brave Maulesel, der ihnen die Möhre aus der Hand gefressen hat. Abe … hat den Stock zu spüren bekommen. Er war nicht käuflich. Er war bloß zur falschen Zeit am falschen Ort. Meinetwegen.«
»Mom, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst.«
Sie mahlt mit dem Kiefer und heftet den Blick auf einen Punkt hinter mir. »Ich habe nichts getan, um es zu verhindern … da hätte ich den Abzug genauso gut auch selbst drücken können.« Grimmig macht sie ihre Zigarette in dem überquellenden Aschenbecher aus. »Ich habe meine Seele verkauft … und wer das tut, für den gibt’s kein Zurück mehr.«
»Was …«
»Natürlich hätte ich wissen müssen, dass er wie ein gerissener Fuchs auf der Lauer liegt und keine Skrupel haben würde, es gegen mich zu verwenden.«
»Wer …«
»Ich will einfach nur, dass du nicht vergisst, dass ich geglaubt habe, nicht anders handeln zu können. Er hatte mir hoch und heilig geschworen, dass er ihr Alter nicht gekannt hätte. Dass so etwas nie wieder vorkommen würde.« Sie schnaubt. »Ich will, dass du weißt, dass Abe ein guter Mensch war.« Ihr rinnt eine Träne die Wange hinunter, und als sie weiterspricht, sieht sie mich an und hält meinen Blick fest. »Ich habe versucht, es in Ordnung zu bringen. Aber ich habe es nicht geschafft, ihr nach all den Jahren in die Augen zu schauen. Ich habe es nicht geschafft, mich dem zu stellen, was ich ihr angetan habe. Ich bin ein Feigling. Keine Polizeichefin. Ein verfluchter Feigling.«
Mir läuft ein Schauder über den Rücken. »Von wem redest du, Mom?«
Wieder schüttelt sie den Kopf. »Sie muss ihren Dad hassen. Sie weiß es nicht besser. Aber ich will, dass sie die Wahrheit erfährt. Sag Gracie, dass er ein guter Mensch war. Versprich es mir, ja?«
Ich schaue sie bloß sprachlos an, während mein Gehirn sich vergeblich abmüht, aus ihren verworrenen Andeutungen schlau zu werden. »Mom … was versuchst du mir zu sagen?« Es hört sich verdammt nach einem Geständnis an. Aber um was für eine Schuld geht es?
Sie setzt zu einer Antwort an, starrt mich dann aber nur mit halb geöffnetem Mund an. In ihren Augen, die genauso kornblumenblau sind wie meine, liegt ein gehetzter Ausdruck.
Schließlich schnippt sie ihr Feuerzeug an und lässt einen Moment die Flamme tanzen, bevor sie den Daumen wegnimmt und sie erlischt. »Zeit, ins Bett zu gehen. Denn wie heißt es so schön? Schlafende Hunde soll man nicht wecken.« Sie lacht freudlos auf. »Er hat dieses Sprichwort gern benutzt und immer hinterhergeschoben, dass sie dann nicht beißen. Jedes Mal, wenn ich auf ihn eingeredet habe, jedes Mal, wenn ich zu ihm gesagt habe, dass sie es mit den Vorschriften nicht so genau nehmen.«
Als ob ich jetzt noch an Schlaf denken könnte. »Mom …«
»Erinnerst du dich noch an Hal Fulcher?«
»Dein Anwalt?«
»Geh zu ihm. Aber warte nicht zu lange damit. Ihnen läuft die Zeit davon.«
Was? Warum?
»So, und jetzt geh endlich nach oben und spring unter die Dusche.« Sie trinkt das erste Glas Wasser aus und kippt das zweite direkt hinterher. Für heute ist nichts Vernünftiges mehr aus ihr rauszukriegen. Ich werde wohl oder übel bis morgen warten müssen, um dieses Gespräch fortzusetzen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das anstellen soll.
Als ich mich über sie beuge, um ihr einen Kuss auf die Stirn zu geben, legt sie mir liebevoll eine Hand an meine stoppelige Wange. »Ich liebe dich über alles. Vergiss das nie.«
»Ich liebe dich auch. Und wehe, du liegst nicht im Bett, wenn ich aus der Dusche komme, dann befördere ich dich eigenhändig nach oben.« Sie weiß, dass das keine leere Drohung ist. Ich habe sie mir schon mal über die Schulter geworfen.
Sie stößt ein müdes Lachen aus und stellt den Polizeifunk wieder lauter, dabei fallen ihr fast die Augen zu. Ich gebe ihr höchstens noch fünf Minuten, bis sie hier am Tisch in einen komatösen Schlaf gefallen ist.
Die Stimme des Diensthabenden der Notrufleitstelle kann ihr schweres Seufzen nicht ganz übertönen. »Du wirst deinen Weg gehen.«
Ich schäle mich aus meinen Klamotten und werfe sie in eine Ecke. Darum kümmere ich mich später. Genau wie um meinen Dreitagebart. Oder auch nicht. Wir wollen morgen Abend in der Rainey Street in der Altstadt was trinken gehen, und Jensons Freundin bringt ihre Freundin Dana mit, mit der ich letzte Woche im Bett gelandet bin. Da hatte ich auch vergessen, mich zu rasieren, aber ihr schien es gefallen zu haben.
Einen Moment stehe ich einfach nur da, lasse den heißen Wasserstrahl über meine Haut strömen und hoffe, er löst das Unbehagen auf, das sich zwischen meinen Schulterblättern eingenistet hat. Mom ist anders gewesen heute Abend. Als würde sie nicht nur körperlich abbauen, sondern langsam auch mental. Wirklich merkwürdig, dass sie von Abe angefangen hat. Sein Tod hat sie unglaublich mitgenommen. Damals hat sie daserste Mal zur Flasche gegriffen.
Und was sollte dieses ganze Gerede über Möhren und Stöcke und dass sie ihre Seele verkauft hat?
Ich atme den herben Geruch meines Shampoos ein, während ich mir damit den Kopf massiere. Betrunkenen hört man am besten gar nicht zu, es kommt nur unsinniges, theatralisches Zeug heraus. Mir fällt absolut nichts ein, dessen meine Mutter sich hätte schuldig machen können. Sie ist eine hochdekorierte Polizeichefin. Sie ist bei allen angesehen. Sie ist klug und witzig. Wenn sie nicht gerade zu viel getrunken hat.
Sie ist meine Mom.
Ein Schuss hallt durchs Haus.
2
Noah
Mein Onkel Silas humpelt.
Ich war fünf, als mir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass er sich nicht so bewegt wie alle anderen, und ich ihn auf seinen seltsamen Gang angesprochen habe. Er hat mich auf seinen Schoß gesetzt und gefragt, ob ich wüsste, was ein Ninja ist. Ich habe gelacht und meine Ninja-Turtle-Figur Raphael hochgehalten. Darauf erzählte er mir, dass er einmal mit einem echten Ninja gekämpft hätte. Er sagte, er hätte gewonnen, aber der Ninja hätte ihm im letzten Moment eine Klinge ins Bein geschlagen. Dann rollte er sein Hosenbein hoch und zeigte mir eine knapp dreizehn Zentimeter lange Narbe.
Immer wenn wir ihn besucht haben, bat ich ihn, mir die Geschichte noch mal zu erzählen, und er schmückte sie jedes Mal mit neuen und absurderen Einzelheiten aus. Dabei klang er so überzeugend, dass ich ihm jedes Wort glaubte und mit einem naiven Lächeln an seinen Lippen hing.
Ich wurde älter. Bald war ich zu groß, um noch auf seinem Schoß zu sitzen und ihm sein Lügenmärchen abzukaufen. Ich hörte trotzdem nicht auf, ihn danach zu fragen – im klugscheißerischen Tonfall und mit dem skeptischen Blick eines Jungen, der allmählich in die Pubertät kam. Aber er hielt unbeirrt an seiner Geschichte von der Klinge des Ninjas fest und beendete sie immer mit einem Zwinkern.
Als ich neun war, erzählte meine Mom mir schließlich, was wirklich passiert war – dass Silas als Zwölfjähriger von einem Baum gefallen war, als er sie vor genau diesem Schicksal bewahrte, und von diesem Sturz einen komplizierten Bruch davongetragen hatte, der seine Knochen nicht wieder richtig zusammenwachsen ließ. Meine Großmutter hatte den Vorschlag der Ärzte abgelehnt, den Knochen noch mal zu brechen, und es in Kauf genommen, dass ihr Sohn ein leichtes Humpeln zurückbehielt.
Obwohl mir zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen war, dass die Ninja-Geschichte erfunden war, fühlte ich mich seltsam betrogen. Irgendwo tief in mir drin hatte ich wohl immer noch die kindliche Hoffnung gehegt, dass das Unmögliche wahr sein könnte.
Als ich jetzt auf der Vorderveranda sitze und sehe, wie sich die Silhouette eines humpelnden Mannes nähert, dessen Gesicht im Blaulichtgewitter, das in unserer Straße geisterhafte Schatten durch die Nacht wirft, nicht zu erkennen ist, wünsche ich mir nichts mehr von ihm, als dass er mir wieder eine Geschichte erzählt.
Eine, in der meine Mutter noch lebt.
Silas ist siebenundfünfzig und weit davon entfernt, ein alter Mann zu sein, doch genauso wirkt er, als er die Treppe hochsteigt. Seine Bewegungen sind langsam und hölzern, seine Schultern gebeugt, seine Hand sucht Halt am schmiedeeisernen Geländer. Wahrscheinlich kommt ihm das alles genauso unwirklich vor wie mir.
Als er die letzte Stufe genommen hat und zu mir auf die Veranda tritt, klingt er außer Atem. »Ich hatte mein Handy auf lautlos gestellt. Und Judy muss das Festnetztelefon beim Staubwischen heute aus Versehen auf stumm geschaltet haben.«
»Schon okay.« Ich habe jeweils dreimal versucht, ihn zu erreichen, bevor die Leitstelle einen Streifenwagen zu ihm geschickt hat.
Er bleibt zögernd vor der Eingangstür stehen.
»Geh rein, wenn du willst, kann nur sein, dass sie dich wieder rausschicken«, sage ich mit tonloser Stimme. Er ist der Bezirksstaatsanwalt von Travis County, aber er ist auch der Bruder der Verstorbenen. Wie lautet in so einer Situation das Protokoll?
»Von wollen kann keine Rede sein.« Er spielt abwesend mit einem Schüsselbund in der Tasche seiner Strickjacke. Darunter trägt er lediglich ein weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt, das zerknittert aussieht. Wie ein Kleidungsstück, das man kopflos aus dem Wäschekorb fischt, nachdem einen die Polizei um ein Uhr morgens aus dem Schlaf geklingelt hat, um einem mitzuteilen, dass die kleine Schwester sich eine Kugel in den Kopf gejagt hat.
Ich kann mich nicht erinnern, wann Silas das letzte Mal so derangiert ausgesehen hat, aber ich bin der Letzte, der darüber irgendeine Bemerkung fallen lassen würde. Bis vor einer Stunde hatte ich selbst nichts als ein hastig um die Hüften gewickeltes, blutdurchtränktes Handtuch am Leib. In meinen Haaren klebt immer noch Shampoo.
Er holt tief Luft und verschwindet mit einem gemurmelten »Bin gleich wieder da« im Haus. Ich bleibe auf der Veranda zurück und starre weiter auf das Durcheinander in unserer Einfahrt. Die Leitstelle muss jeden verfügbaren Officer hierhergeschickt haben, in unserer Sackgasse reiht sich ein Streifenwagen an den nächsten. Unsere Nachbarn stehen in Bademänteln und Pyjamas auf ihren Veranden und verfolgen das Ganze schweigend. Wenigstens leben wir in einem abgegrenzten Bereich unseres Wohnviertels, in dem lediglich die Bewohner von sechs Häusern Zeugen von alldem hier werden. Und die schaulustige kleine Menge an der Straßenecke wird von der Polizeiabsperrung auf Distanz gehalten.
Zwei Minuten später kommt Silas wieder zu mir auf die Veranda. Vielleicht sind es auch zwanzig Minuten. Seine Züge sind eingefallen und grau. Er setzt sich neben mich auf die Hollywoodschaukel und starrt einen Moment schweigend auf meine Hände, an denen getrocknetes Blut klebt. Noch während ich die Finger an ihren Hals und an ihr Handgelenk gelegt und vergeblich nach einem Puls gesucht habe, wusste ich, dass ich sie eigentlich nicht anfassen durfte.
»Was, verflucht noch mal, ist passiert, Noah?«
Ich kann nur den Kopf schütteln. Man hat mich angewiesen, mich nicht von der Stelle zu rühren, niemanden anzurufen und mit niemandem zu sprechen. Aber da Silas bis jetzt von niemandem aufgefordert wurde, den Tatort zu verlassen, nehme ich an, dass sich diese Order nicht auf ihn bezieht.
»Noah …«, sagt er drängend.
»Das Küchenfenster war offen. Es hätte jemand reinklettern können.«
»Vielleicht.« Es ist offensichtlich, dass er das nur mir zuliebe sagt.
So schnell, wie ich die Stufen hinuntergestürzt bin, ist es praktisch unmöglich, dass jemand Zeit gehabt hätte, durch das Fenster zurück nach draußen zu klettern und das Fliegengitter wieder an seinen Platz zu ziehen, ohne dass ich irgendetwas mitbekommen hätte. Außerdem, warum nicht einfach die Tür nehmen? Aber die Türen sind abgeschlossen und die Alarmanlage ist eingeschaltet gewesen.
»Fang am besten ganz von vorn an.«
»Du wirst deinen Weg gehen.«
Das sind ihre letzten Worte an mich gewesen. Gott … Das sind ihre letzten Worte gewesen und ich habe sie einfach dort sitzen lassen.
Silas legt mir eine Hand aufs Knie und reißt mich aus meinen schuldbeladenen Gedanken.
Ich erzähle ihm, was ich auch schon der Notrufleitstelle und der Polizei erzählt habe – dass ich höchstens zwanzig Minuten oben war und unter der Dusche gestanden habe, als ich einen Schuss hörte. Dass ich sofort nach unten gerannt bin und sie am Küchentisch mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache gefunden habe, die Pistole in der Hand.
»Und davor?«
Davor … »Sie hatte ziemlich viel Whiskey getrunken.«
»Nur heute Abend?«
Ich zögere und schüttle dann den Kopf.
Er atmet tief durch. »Wie lange?«
»Ein paar Wochen.« Ich senke die Stimme. »Silas, sie hat heute Abend eine Menge verrücktes Zeug von sich gegeben.«
»Ach ja?« Er lehnt sich zurück und rutscht etwas näher an mich heran. »Was für verrücktes Zeug?«
»Zum Beispiel, dass sie es nicht verdient hat, Chief zu sein. Dass sie sich hat kaufen lassen.«
Er denkt einen Moment darüber nach. »Es gibt genügend unbelehrbare Vollidioten, die immer wieder versucht haben, ihr einzureden, dass eine Frau nichts auf dem Posten des Polizeichefs zu suchen hat. Vielleicht hat sie angefangen, den Mist zu glauben.«
»Ich glaube nicht, dass es das war«, entgegne ich und füge flüsternd hinzu: »Sie hat über Abe gesprochen. Es klang so, als ob ihm damals etwas angehängt wurde und sie darin verwickelt war.«
»Das hat sie gesagt? Genau mit diesen Worten?«
»Nein, aber …«
»Sie hatte nichts mit diesem Desaster zu tun.« Er schüttelt entschieden den Kopf. »Absolut nichts.«
»Sie scheint das anders zu sehen. Schien das anders zu sehen«, korrigiere ich mich leise.
»Glaub mir, Noah, ich kenne keinen Fall, der so gründlich untersucht worden ist wie dieser. Es hat nicht der geringste Zweifel daran bestanden, dass dieser Mann schuldig war.« Sein Blick sucht meinen. »Hat sie dir gesagt, warum sie das anders sieht?«
»Sie ist nicht ins Detail gegangen. Aber so, wie sie es gesagt hat, hat es sich angehört, als hätte sie ihre Finger mit im Spiel gehabt.«
»Großer Gott, Jackie«, seufzt er leise. Sein Blick wandert über die kleine Menschenmenge und die hin und her eilenden Polizeibeamten. Ein paar von ihnen kenne ich, aber die meisten habe ich noch nie gesehen. »Hast du über irgendetwas davon schon mit jemandem vom APD geredet?«
»Noch nicht.«
»Vielleicht kann ich den Einsatzleiter davon überzeugen, mit deiner Vernehmung bis morgen zu warten.«
»Sie haben gesagt, sie würden heute Nacht zumindest noch eine vorläufige Aussage von mir brauchen.«
Silas gibt einen zustimmenden Laut von sich. »Wen wundert es. Sie war die Polizeichefin.« Er trommelt mit den Fingern auf sein Knie. »Aber dann sollen sie sich gefälligst beeilen.«
»Ich bin mir sicher, sie kümmern sich darum, sobald sie können.« Mom ist immer noch dort drin und ihr lebloser Körper wahrscheinlich noch nicht ganz kalt.
»Hat sie sonst noch etwas gesagt?«
»Ich weiß nicht …« Ich versuche angestrengt, mich an weitere Einzelheiten aus unserem Gespräch zu erinnern, aber in diesem seltsamen Vakuum, in dem ich bin, ist es schwer, überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen. »Sie sagte so was wie, dass sie anfangs geglaubt hat, sie hätte das Richtige getan, und dass irgendein gerissener Fuchs etwas gegen sie benutzt hätte. Glaubst du, sie ist erpresst worden?«
»Sie hat mir gegenüber nie irgendetwas in dieser Richtung erwähnt, was sie bestimmt getan hätte, wenn es so gewesen wäre, meinst du nicht?«
Ich zucke mit den Schultern. Wer weiß schon, was meine Mutter getan oder nicht getan hätte, angesichts dessen, was sie gerade getan hat.
Silas hält einen Moment inne, bevor er weiterspricht. »Okay, hör zu«, sagt er schließlich und beugt sich zu mir vor. Ich kann förmlich dabei zuschauen, wie in seinem Kopf ein Plan Gestalt annimmt. So ist mein Onkel schon immer gewesen – man geht mit einem Problem zu ihm und er formuliert innerhalb weniger Minuten eine Lösung dafür. »Sie brauchen nicht bis ins Kleinste zu wissen, worüber ihr gesprochen habt«, raunt er so leise, dass ich ihn kaum verstehe. »Das geht nur euch beide etwas an. Deine Mom war eine großartige Polizistin und äußerst kompetente Chefin, und es ist nicht nötig, irgendjemandem einen Grund zu geben, etwas anderes zu behaupten. Es wird für die Stadt auch so schon hart genug werden.«
»Aber was soll ich der Polizei sagen? Ich kann nicht lügen, Silas.«
»Hat sie dich gefragt, wie dein Tag war?«
»Ja.«
»Dann erzähl ihnen davon. Du bist nach Hause gekommen und ihr habt euch noch kurz unterhalten, bevor du nach oben bist. Sie hatte ein bisschen zu viel getrunken, aber du hast dir deswegen keine Gedanken gemacht. So war es doch, oder?«
»Ja.« Wäre mir auch nur ansatzweise in den Sinn gekommen, sie könnte sich etwas antun, wäre ich ihr niemals von der Seite gewichen.
»Also erzählst du ihnen genau das. Ganz gleich, was deine Mutter über Abe gesagt hat … sie war betrunken. Sie redet wirres Zeug, wenn sie zu viel getrunken hat. Ich bin mir sicher, dass es nicht so gemeint war, wie es sich für dich angehört hat. Es wäre nicht richtig, davon anzufangen, schließlich kann sie sich nicht mehr verteidigen.«
Das sagt er mir nicht nur als mein Onkel. Ich bekomme gerade das Einverständnis des Bezirksstaatsanwalts, die verworrenen Anspielungen meiner Mutter für mich zu behalten. Und ob richtig oder nicht, ist es genau das, was ich jetzt hören will. Ich nicke, und trotz der überwältigenden Leere, die sich in mir ausgebreitet hat, spüre ich so etwas wie Erleichterung.
Silas und ich versinken in Schweigen, während wir zusehen, wie immer wieder Leute rein- und rausgehen und dabei kaum einen Blick in unsere Richtung werfen.
»… kann ich nicht sagen. Wann würde es denn passen?« Boyd kommt aus dem Haus, das Funkgerät in der Hand. Ich kenne ihn seit dem Kindergarten, und auch wenn wir nie beste Freunde gewesen sind, wissen wir nach einundzwanzig Jahren, dass wir uns auf den anderen verlassen und ihn jederzeit um Hilfe bitten können. So wie damals, als er sich beim APD bewerben wollte und mich anrief und fragte, ob meine Mom ihm eine Empfehlung schreiben würde.
Er ist heute Nacht als einer der Ersten hier gewesen.
Die Holzdielen der Veranda knarzen unter dem Gewicht eines zweiten Mannes, der ihm dichtauf folgt. Er trägt keine Uniform, kann aber nur ein Cop sein, sonst wäre er nicht durchgelassen worden. »Wie wäre es nächsten Mittwoch nach unserem Spiel? Shit, die Saison fängt schon nächste Woche an? Da muss ich erst schauen, ob ich …«
»Sind Sie hier, um den Tod Ihrer Polizeichefin zu untersuchen oder um Ihre Freizeitaktivitäten zu organisieren, Officer? Richten Sie Towle aus, dass Bezirksstaatsanwalt Silas Reid gern endlich seinen Neffen von hier wegbringen würde«, unterbricht Silas ihn ungehalten.
Boyd dreht sich mit einem betroffenen Blick zu mir um. Kein Polizist, der auch nur einen Funken Verstand hat, will es sich mit dem Bezirksstaatsanwalt verscherzen, und Boyd ist kein Idiot. »Natürlich, Sir. Wir warten noch auf …« Meine Aufmerksamkeit driftet von Boyd zu dem Mann, der ihm gefolgt ist und mich schweigend mustert. Seine Miene ist nichtssagend und hat gleichzeitig etwas Bedrohliches. Was vielleicht bloß an seinen tief liegenden dunklen Augen und seiner extrem hohen, fliehenden Stirn liegt, aber die Kombination aus beidem sorgt dafür, dass er wie ein hinterhältiger Dreckskerl aussieht.
»Noah?«
Silas’ Stimme reißt mich aus meinen dumpfen Grübeleien. Boyd steht mit gezücktem Notizblock und Stift vor mir, einen mitfühlenden Ausdruck im Gesicht.
»Er nimmt deine vorläufige Aussage auf, um den Rest kümmern wir uns morgen.« Silas lächelt mich beruhigend an. »Kriegst du das hin?«
Ob ich es hinkriege, nur die halbe Wahrheit zu sagen? »Ja, Sir.«
Natürlich hat Mom nicht das Geringste mit Abes Tod zu tun.
Und niemand braucht zu wissen, dass sie etwas anderes gesagt hat.
3
GraceTucson, Arizona
Ich fische eine Babymöhre aus der Tüte und werfe sie Cyclops hin. »Sag nicht, ich würde nicht teilen.«
Cyclops klaubt sie blitzschnell vom Boden auf und verschlingt sie in einem Stück, ohne sich an den Sandkörnern, die daran kleben, zu stören. Alles andere hätte mich auch gewundert. Er frisst alles, was ihm zwischen die Zähne kommt. Ich habe ihn schon mehr als einmal mit einem aus seinem Maul baumelnden Rattenschwanz vorbeitraben sehen.
»Und jetzt zieh Leine.« Es ist sinnlos; der Köter riecht die Chicken Taquitos, die ich in meiner Tasche habe. So bald wird er nicht lockerlassen. Hartnäckigkeit sichert sein Überleben. Er ist ein herrenloser Streuner, der sein Glück bei jedem versucht, der ihm im Trailerpark über den Weg läuft, in der Hoffnung, auf jemanden zu treffen, der genug Mitleid mit ihm hat, um ihm ein paar Reste hinzuwerfen. Für gewöhnlich bin ich dieser Jemand.
Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als er das erste Mal auftauchte. Er kam lahmend auf mich zugetrottet und blinzelte mich mit seinem einen Auge an; das linke musste er schon vor langer Zeit verloren haben. Er hatte einen Schnitt in der Hinterpfote, der sich entzündet hatte, und eine frische Bisswunde an einem Ohr. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis ich ihn dazu gebracht hatte, ruhig liegen zu bleiben, damit ich die Verletzung an seiner Pfote reinigen und verbinden konnte. Das war vor drei Jahren und seitdem kommt er immer wieder hierher zurück.
So wie viele der Leute, die irgendwann hier im Sleepy Hollow Trailerpark landen.
Ich gehe die staubige kleine Hauptstraße entlang und ignoriere ihn. Es ist zwei Uhr nachmittags und wie immer um diese Uhrzeit wirkt die Wohnwagensiedlung wie eine Geisterstadt. Die meisten schlafen noch, weil sie erst frühmorgens nach ihrer Nachtschicht ins Bett gekommen sind, oder schuften sich irgendwo für einen Hungerlohn den Rücken krumm, damit sie nach einem langen, harten Arbeitstag hierher zurückkehren können.
Ich komme bei den Cortez’ vorbei. Sie wohnen zu sechst in dem Trailer. Ein Fenster ist mit einer Sperrholzplatte zugenagelt, weil Mr Cortez letzten Monat während eines Wutanfalls die Faust durch die Scheibe gerammt hat und bis jetzt noch kein Geld hatte, um sie zu ersetzen. Dem Management des Trailerparks ist es egal. Für eine Monatsmiete von fünfhundert Dollar kriegt man hier nicht mehr als ein Dach überm Kopf, das sich während der Regenzeit als undicht herausstellt. Mindestens dreimal die Woche geht das Wasser aus und die meiste Zeit stinkt es nach Kloake.
Anscheinend ist niemand zu Hause, und ich schicke ein kleines Dankgebet in den Himmel, weil an Schlaf nicht zu denken ist, wenn die Cortez’ zu Hause sind. Ich bin um fünf aufgestanden, um pünktlich meine Frühschicht im QuikTrip anzutreten, und sehne mich nach einem kleinen Nickerchen, bevor ich meinen Hintern zu meinem Job als Kellnerin ins Aunt Chilada’s schaffen muss.
Neben dem der Familie Cortez steht der Trailer der Sims’, in dem Kendrick Sims, seine Schwester, ihr Freund und ihr siebenjähriger Sohn wohnen. Im Gegensatz zu seiner Schwester und ihrem Freund, die einer ehrlichen Arbeit nachgehen, war Kendrick schon öfter im Knast, als ich zählen kann. Zurzeit verbringt er seine Tage damit, in ihrem Vorgarten abzuhängen, jede Menge Hände zu schütteln und immer wieder kurz um die Ecke zu verschwinden. Jeder weiß, dass er Drogen vertickt.
Gerade lungert er am Maschendrahtzaun herum und wirft mir einen anzüglichen Blick zu. Mehr wird er sich nicht trauen. Vor acht Jahren hat er es mal versucht. Er hat mir eines Abends in einer der Nebengassen aufgelauert und mir irgendeinen Quatsch erzählt von wegen, ich sollte mit ihm ausgehen, weil er schwarz ist und mein Dad meinem Aussehen nach zu urteilen garantiert auch schwarz ist, und dass er mir alles beibringen würde, was ich über mein biologisches Erbe wissen müsste. Er war neunzehn.
Ich war zwölf.
Ich bin schon damals nicht auf den Mund gefallen gewesen. Obwohl ich mir vor Angst fast in die Hosen machte, habe ich ihn aufs Übelste beschimpft, dann bin ich nach Hause gerannt und habe das Springmesser meiner Mutter unter ihrer Matratze hervorgekramt. Ich trage es bis heute immer bei mir.
Neben den Sims’ wohnt die Familie Alves. Vilma Alves winkt mir von ihrem mit rotem Samt bezogenen Lehnstuhl zu, der draußen vor ihrer Tür steht. Er ist ihr Thron; niemand wagt es, ihn anzurühren. Ein vom Straßenrand aufgelesener Schatz, den ihr Sohn vor ein paar Jahren angeschleppt hat. Seitdem steht er genau an diesem Fleck, egal ob es regnet oder die Sonne scheint. In Tucson meistens Letzteres.
»¡Buenas tardes!«, ruft sie mir mit ihrer durchdringenden Stimme zu.
»Hola.« Ich schenke ihr wie immer ein Lächeln, weil sie neunzig ist und weil sie uns schon oft selbst gemachte Enchiladas und Guacamole vor die Tür gestellt hat, wenn sie wusste, dass ich mal wieder besonders schwere Zeiten durchmachte.
Als sie Cyclops entdeckt, wirft sie ihm einen finsteren Blick zu, wedelt ungeduldig mit der Hand und zischt: »¡Rabia!«
Ich spähe zu der hässlichen Promenadenmischung hinunter – halb Terrier, halb Chihuahua, durch und durch eine Nervensäge – und grinse. »Noch hat er keinen Schaum vorm Maul.«
Sie zuckt widerwillig mit den Schultern. Ich weiß nicht, was schlimmer ist – mein Spanisch oder ihr Englisch. Aber wir hangeln uns immer irgendwie an der Sprachbarriere vorbei.
»Hasta luego.« Ich hebe kurz die Hand und will weitergehen.
»Un hombre visitó a tu mamá.«
Mein Spanisch ist vielleicht grauenhaft, aber was das heißt, weiß ich. Genauer gesagt, und das ist noch viel wichtiger, weiß ich, was es heißt, wenn ein Mann meine Mutter besucht, während ich bei der Arbeit bin.
Mein Magen zieht sich zusammen. »Wann? Uhrzeit?« Ich tippe auf mein nacktes Handgelenk.
»A las diez.«
Um zehn. Vor vier Stunden.
Ich schaue zu der rechteckigen Kiste ein paar Meter weiter, ein Trailer Baujahr 1960 mit zwei Schlafzimmern, in dem meine Mutter aufgewachsen ist und den sie vor ein paar Jahren geerbt hat, als meine Großmutter starb. Eigentlich sollte es mich nicht überraschen. Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, den leeren Versprechungen meiner Mutter zu glauben und sie jedes Mal vor Angst und Wut anzuschreien, wenn sie wieder rückfällig geworden ist. Das ist die Version von mir gewesen, die noch Hoffnung hatte.
Die, die jung und naiv war.
Ich nicke Vilma zu und bedanke mich mit einem leisen »Gracias« für ihre Warnung. Als ich weitergehe, schwanke ich zwischen dem Bedürfnis, die letzten zwanzig Schritte zu unserer Eingangstür zu rennen, und dem, sie so lange wie möglich hinauszuzögern. Weil ich weiß, dass ich eines Tages nach Hause kommen und ihre Leiche finden werde. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob der Grund für diesen Knoten in meinem Bauch der ist, dass ich mich vor diesem Tag fürchte, oder ob ich mich schon damit abgefunden habe, dass es irgendwann so kommen wird.
Wahrscheinlich beides.
Cyclops ohrenbetäubendes Kläffen lenkt mich für einen Moment ab. Er weiß genau, dass dies seine letzte Chance ist, und blinzelt mich mit seinem einen Auge bettelnd an.
»Reichhaltiges Essen ist nichts für dich.« Ich werfe ihm noch eine Babymöhre zu. Er schlingt sie gierig hinunter und jagt dann der getigerten Katze von Mrs Hubbard hinterher, die gerade unter dem Trailer der Alves’ verschwunden ist.
»Gern geschehen«, brumme ich und nehme mir selbst auch eine Möhre, obwohl mir der Appetit vergangen ist. Auf unsere ramponierte Eingangstür starrend, liste ich in Gedanken alle ihre beschädigten Stellen auf – eine Einbuchtung der Schuhgröße vierundvierzigeinhalb dort, wo Mr Cortez versucht hat, sie einzutreten, weil er sich im Vollrausch in der Tür geirrt hatte und dachte, seine Frau hätte hinter seinem Rücken das Schloss ausgewechselt; eine tiefe Kerbe im Rahmen da, wo Einbrecher versucht haben, die Tür aufzustemmen; schwarze Sprühfarbe, wo ein paar bekiffte Sprayer aus der Nachbarschaft sich verewigt haben.
Mit angehaltenem Atem laufe ich die Betonstufen nach oben und stecke den Schlüssel ins Schloss.
Ich öffne die Tür.
Mir schlägt eine dichte Zigarettenrauchwolke entgegen, und ich weiche angewidert zurück, zwinge mich aber, mich auf meine Erleichterung zu konzentrieren.
Wenn sie raucht, ist sie nicht tot. Wobei die Luft verqualmt genug ist, um sich zu Tode zu husten. »Warum hast du die Klimaanlage nicht angemacht?«, schimpfe ich, während ich in den stickigen, dunklen Trailer trete. Dank einer Hitzewelle sind es draußen fünfunddreißig Grad im Schatten, obwohl erst Frühling ist.
»Die ist kaputt«, kommt es matt zurück.
»Das kann nicht sein. Ich habe sie doch gerade erst gekauft!« Ich gehe zum Fenster rüber, drehe an den Knöpfen, prüfe den Stecker, schlage einmal kräftig mit der Hand dagegen. Aber sie hat recht; die Klimaanlage tut es nicht mehr. Dabei hat dieser Bote aus dem Aunt Chilada’s, dem ich sie abgekauft habe, geschworen, dass sie praktisch wie neu ist. »Gott.« Ich verpasse der Eingangstür einen Tritt, damit sie ganz aufgeht.
Mom blinzelt gegen das hereinfallende Sonnenlicht an. Sie liegt noch immer auf der Couch, genau dort, wo ich sie heute Morgen zurückgelassen habe. Nur dass sie da leise geschnarcht hat und jetzt rot geränderte und glasige Augen hat und verstohlen die Hand unter den Polsterkissen hervorzieht, wo sie ihre Nadel und ihren Löffel verschwinden lassen hat. Als ob sie sie vor mir verstecken könnte.
Früher habe ich mich regelmäßig auf die Suche nach ihren Geheimvorräten gemacht, damals, als es noch Wodka und Gras waren und verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Als ich noch geglaubt habe, ich könnte sie davon abhalten. Wirklich erstaunlich, wie viele Orte es in dieser Blechbüchse gibt, an denen man Drogen verstecken kann. Aber ich habe sie immer gefunden und dann den Ausguss oder das Klo runtergespült, denn wenn sie kein Geld hatte, um sich Nachschub zu besorgen, würde sie auch nichts nehmen können, richtig?
Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass sie schon lange nicht mehr ohne leben kann. Sie findet einfach einen anderen Weg, für ihren Stoff zu bezahlen.
Also habe ich angefangen, Geld in die Küchenschublade zu legen. Nicht viel, aber so, dass es reicht. Wir verlieren kein Wort darüber. Ich deponiere es dort, und wenn ich nach Hause komme, ist es weg und sie high. Aber diese Woche hatte ich kein Geld übrig, weil ich diese bekackte Klimaanlage kaufen musste, die nicht funktioniert.
Bei dem Gedanken, was sie für den heutigen Schuss getan haben muss, krampft sich mein Magen zusammen.
»Wehe, dieser räudige Köter taucht hier auf …«, brummt Mom, ohne sich zu rühren.
»Keine Sorge, Cyclops mag es hier drin nicht.« Genauso wenig wie ich. Aber ich sitze hier fest. In diesem Trailer, in dieser Siedlung.
In diesem Leben.
Ich bin nur deshalb noch nicht ohne einen Blick zurück durch diese Tür verschwunden, weil meine Mutter innerhalb von einer Woche auf der Straße oder im Leichenschauhaus landen würde, wenn ich sie im Stich lasse.
Ich versuche, meine Wut runterzuschlucken, als ich meine Tasche auf dem Esstisch abstelle und die Taquitos auspacke. »Hier, mit Hühnchen. Iss.« Ernie, der Manager bei QuikTrip, erlaubt dem Personal, das mitzunehmen, was zu lange unter der Wärmelampe gelegen hat, um es noch verkaufen zu können.
»Hab schon.« Sie wedelt mit der Hand, als ich ihr einen Teller hinhalte, die Augen auf den alten Röhrenfernseher in der Ecke geheftet, auf dem gerade eine ihrer Soaps läuft. Ich wette, sie könnte mir noch nicht mal sagen, wie die Serie heißt. Und was das Essen angeht, hat sie gelogen. Wenn sie nämlich mal nicht vergisst, dass sie zwischendurch auch etwas essen muss, ernährt sie sich ausschließlich von überbackenen Käsesandwiches, und wenn ich dann nach Hause komme, ist die Arbeitstheke immer voller Krümel und auseinandergerissenen Brotscheiben, und an den Glühdrähten des kleinen Tischbackofens klebt eine leicht brennbare Schicht geschmolzener Käse. Heute sieht die Theke noch genauso sauber aus, wie ich sie heute Morgen verlassen habe.
Mom ist schon immer schmal gewesen, aber mittlerweile ist sie nur noch Haut und Knochen, die harten Drogen haben sie fest im Griff, saugen ihr Fett und ihre Muskeln ab, ihre Haut ist teigig, ihre Haare sind stumpf und strähnig, ihre Wangen eingefallen. Nur noch ein Schatten der wunderschönen Frau, die sie einmal gewesen ist.
Aber ich werde mich nicht wegen ihrer Essgewohnheiten mit ihr streiten, weil man mit einer Heroinabhängigen, und genau das ist aus meiner Mutter geworden, nicht vernünftig reden kann.
»Ich lege mich ein bisschen hin. Versuch in der Zwischenzeit, die Bude nicht abzufackeln«, sage ich zwischen zwei Bissen und mache mich auf den Weg in mein Zimmer. Dort gibt es wenigstens einen Ventilator, und mittlerweile bin ich so schlau, ein Handtuch unter die Tür zu klemmen, um den Qualm draußen zu halten.
»Jackie Marshall ist tot.«
Ich halte mitten im Schritt inne. »Was?« Es wundert mich, dass sie nicht gleich mit dieser Neuigkeit herausgerückt ist.
Mom hebt Mittel- und Zeigefinger an die Schläfe, um den Lauf einer Pistole nachzuahmen. »Hat sich eine Kugel in den Kopf gejagt. Heißt es zumindest.«
Jackie Marshall. Die frühere Partnerin meines Vaters bei der Polizei und seine beste Freundin. Die Frau, die uns im Stich gelassen hat, als wir sie gebraucht haben. Die Frau, von der meine Mutter überzeugt ist, dass sie etwas mit der Sache zu tun hatte, die ihm vor vierzehn Jahren angehängt wurde.
Ich werde sie also auch gekannt haben, damals, als wir noch in Austin lebten, in einem hübschen Bungalow mit einem hübschen Gartenzaun drum herum. In einem vergangenen Leben. Dieses Leben endete, als ich sechs war, und ich habe nicht viele Erinnerungen daran. Schattenhafte Gesichter, hier und da ein verschwommenes Lächeln. Das Echo eines lachenden Kindes, das von einem Mann in die Luft geworfen wird, bevor dieser Mann eines Tages nicht mehr nach Hause kam.
Dieses alte Leben hat den Weg für mein neues vorgezeichnet, und die Erinnerungen daran sind vor allem von Schmerz und Tränen geprägt. Und einem großen Hass auf das Austin Police Department und eine Frau namens Jackie Marshall.
»Wo hast du das gehört?« Wir sind hier in Tucson, mehr als einen ganzen Bundesstaat von Texas entfernt, und als wir fortgegangen sind, haben wir alle Kontakte abgebrochen und sogar unseren Namen in Richards geändert, den Mädchennamen meiner Mutter.
»Ist überall in den Nachrichten.« Sie hält mir mit einer fahrigen Bewegung ihr Handy hin.
Meine Mutter hat schon vor langer Zeit den Bezug zur Realität verloren, doch an Texas hält sie mit geradezu verbissener Bitterkeit fest. Würde sie jemand fragen, wer der Gouverneur von Arizona ist, würde sie ratlos mit den Schultern zucken, aber in ihren klaren Momenten scrollt sie wie eine Verschwörungstheoretikerin durch texanische Nachrichtenseiten, als wäre es ein Zwang, sich über alles, was dort passiert, auf dem Laufenden zu halten. Seit sie vor zwei Jahren im Netz über einen Artikel gestolpert ist, in dem über die Ernennung Jackie Marshalls zur Polizeichefin des Austin Police Departments berichtet wurde, ist diese Besessenheit noch größer geworden.
Genau wie ihre Abhängigkeit.
So mies, wie es ihr geht, wundert es mich, dass sie sich offensichtlich nach wie vor regelmäßig informiert.
»Austins Polizeichefin begeht Selbstmord.« Ich überfliege ein paar der Artikel von diesem Morgen, die nicht gerade mit grausigen Einzelheiten, bei denen ich innerlich zusammenzucke, geizen. Mom zieht die Boulevardblätter den seriösen Zeitungen vor. Sie sagt, darin gibt es weniger politischen Bullshit und mehr gefährlichere Wahrheiten. Und die Privatsphäre anderer ist ihnen anscheinend auch ziemlich egal. »Ihr Sohn hat sie gefunden.« Noah Marshall. Ihn habe ich wohl auch gekannt, sagt Mom. Ich kann mich tatsächlich auch vage an einen zehn- oder elfjährigen Jungen erinnern, aber nicht dass ich ihn erkennen würde, wenn ich ihm irgendwo begegnen würde.
»Was für eine Mutter tut das ihrem Kind an?«, sagt sie.
»Eine, die krank ist.« Ich könnte jetzt noch eine Bemerkung hinterherschieben von wegen Wer im Glashaus sitzt … Schließlich musste ich meine Mutter schon zweimal wegen einer Überdosis ins Krankenhaus bringen. Aber dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. »Da steht, sie wäre nicht mit dem Druck in ihrem Job klargekommen.«
»Ich kann dir sagen, womit sie nicht klargekommen ist …« Mom kippt den Kopf eher zur Seite, als dass sie ihn mir zudreht, und heftet ihre blutunterlaufenen Augen auf mich, in denen ein getriebener Ausdruck liegt. »Mit der Schuld. Die, die einen zerfrisst, wenn man jemanden verraten hat.«
Jemanden wie meinen Vater.
»Ich hab’s dir immer gesagt. All die Jahre, in denen sie an der Lüge festgehalten hat. So getan hat, als ob … Und jetzt ist er da … der Beweis.« Moms Blick ist wieder auf den Fernseher geheftet. »Hat dich am Ende doch alles eingeholt, was … Chief Marshall.«
»Was für ein Beweis?« Das beweist nämlich gar nichts. Genau das ist das Problem – Mom hat mir nie ein einziges Indiz liefern können, das beweist, dass Jackie oder sonst irgendjemand von der Polizei meinem Vater etwas angehängt hat. Sie ist einfach davon überzeugt, weil sie ihn so sehr geliebt hat und nicht in der Lage ist, etwas anderes auch nur in Betracht zu ziehen.
Als das alles damals passiert ist, hat sie mir erzählt, er hätte einen Unfall gehabt und würde nicht mehr nach Hause kommen. Das habe ich geglaubt, bis ich zehn war und eines Tages in der Bibliothek am Computer saß, um an einem Schulprojekt zu arbeiten. Ich war neugierig und habe seinen Namen in die Suchmaschine eingegeben. Da habe ich die Artikel gefunden.
Die Überschriften.
Die Wahrheit.
Ich bin weinend nach Hause gerannt und habe sie zur Rede gestellt. Sie sagte, ich solle den Mist nicht lesen, dass das alles Lügen seien, dass mein Daddy unschuldig sei.
Wieder habe ich ihr geglaubt – was hätte ich auch anderes tun sollen? Natürlich wollte ich glauben, dass mein Vater kein korrupter Polizist war, der Drogen verkauft und sich mit Kriminellen eingelassen hat.
Dann wurde ich älter und lebenserfahrener. Ich stellte Fragen, auf die meine Mutter keine Antworten hatte. Ich schaute zu, wie sie in ihrer Scheinwelt lebte und psychisch immer weiter abbaute. Und ich akzeptierte, dass das, was ich glauben wollte, keine Rolle spielte, weil alle anderen ihr Leben weitergelebt haben, während Mom in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Zusammen mit mir, in diesem Drecksloch, bis ich einen Ausweg gefunden habe.
Ich habe mich schon vor langer Zeit mit der Realität abgefunden: dass alle Beweise auf einen korrupten Polizisten hingedeutet haben, der das bekommen hat, was er verdiente. Dass mein Vater nicht der gute Mensch gewesen ist, von dem sie schwört, dass er es war. Dass er sich einen Dreck um mich oder seine kleine dreiköpfige Familie geschert hat und dass er es verdient hat, dass ich ihn für das, was er uns angetan hat, hasse, für das, was aus meiner Mutter geworden ist, weil er den Hals nicht vollkriegen konnte.
Und jetzt musste Jackie Marshall sich auch noch umbringen. Das wird die Wahnvorstellungen meiner Mutter nur noch mehr befeuern. Als ob die Polizeichefin von Austin nach vierzehn Jahren noch so von ihren Schuldgefühlen gequält worden wäre, dass sie es plötzlich nicht mehr ausgehalten hätte.
Es wäre dumm von mir zu glauben, ihr Tod hätte irgendetwas mit uns zu tun.
Aus Neugier lese ich den Artikel trotzdem zu Ende. Darin wird ausführlich auf ihre steile Karriere von der Streifenpolizistin zur Polizeichefin eingegangen. Demnach ist Jackie Marshall eine »hochmotivierte« Polizeibeamtin gewesen. Geradlinig, zielstrebig, karrierebewusst; fest entschlossen, es zu etwas zu bringen.
Wie ist es möglich, dass eine solche Frau es derart mühelos die Karriereleiter hinaufschafft und dann zusammenbricht, wenn sie oben angekommen ist?
Zum Ende des Artikels stoße ich auf eine Erwähnung ihres ehemaligen korrupten Partners Abraham Wilkes. Bis heute wird es mir immer noch eng in der Brust – vor Wut, vor Demütigung, vor Schmerz –, wenn ich diesen Namen lese. Scheint, als hätte sich noch nicht einmal die Frau, die es bis zur Polizeichefin gebracht hatte, völlig von dem Skandal distanzieren können.
»Da steht nichts von einem Abschiedsbrief«, sage ich.
»Denkst du vielleicht, die würden einen Abschiedsbrief an die Öffentlichkeit geben?« Mom schnaubt. »Komm schon, Grace. Ich hab dir beigebracht, deinen Kopf zu benutzen.« Sie nestelt eine Zigarette aus dem Päckchen und steckt sie sich an. »Gott allein weiß, was für Wahrheiten darin ans Tageslicht gekommen wären. Die werden sie hübsch für sich behalten, genauso wie sie es mit der Wahrheit über deinen Vater gemacht haben. Die finden doch immer irgendein Schlupfloch. Von wegen Informationsfreiheitsgesetz. So läuft das in der Welt. Sie haben dafür gesorgt, dass ich den Mund halte, und das tue ich bis heute. Aber ich weiß, bei was sie mitgeholfen hat.«
»Wer hat dafür gesorgt, dass du den Mund hältst?«, frage ich, obwohl ich weiß, dass ich keine Antwort bekommen werde. Das habe ich noch nie.
»Irgendwann kriegt jeder, was er verdient hat.« Sie dreht den Anhänger an ihrer Halskette hin und her und reibt mit dem Daumen über das Herz – genauer gesagt ist es nur ein halbes Herz.