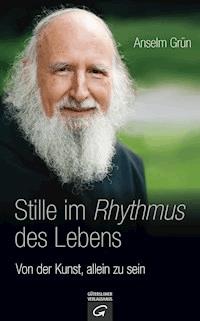16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Einsamkeit und Isolation, exzessiver Individualismus und Interessenegoismus nehmen zu. Wie kann persönliche Zerrissenheit heilen? Was tun angesichts der Gleichgültigkeit gegenüber dem Gemeinwohl? Anselm Grüns Antwort ist konkret und klar: Es geht darum, Verbundenheit zu schaffen oder zu vertiefen. Um gefährdete Beziehungen erkennen und heilen braucht es eine neue Form des Wirgefühls und eine tiefere Qualität des Miteinander – auch in Familie und Arbeitsbeziehungen, in Gesellschaft und Kirche. Und es braucht gemeinsame Werte: Gerechtigkeit, Kooperation, Solidarität, Toleranz, Mitgefühl und Respekt. Wichtig sind Gemeinschaften, die Glauben und Hoffnung leben und erfahrbar machen. Es braucht die Verbundenheit. Ein Buch, das Antworten gibt und Hoffnung macht: Ressource für ein vertieftes Miteinander. Spirituelles Lebenswissen für jeden Einzelnen. Aber auch die große Vision für eine menschlichere Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ein einfach-leben-Buch
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagmotiv und Illustrationen im Innenteil:
© GettyImages - lasagnaforone
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-39635-9
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83062-4
Stimmen zum Buch
Drei große Trends sind seit Jahrzehnten festzustellen: Singularisierung, Urbanisierung und Medialisierung: Single-Haushalte nehmen ebenso zu wie die Verwendung des Wortes „Ich“ in der Literatur, Familienhaushalte und das Wort „Wir“ nehmen dagegen ab. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten, wo man wenig glückende Sozialkontakte und viel Anonymität erlebt. Und wir verbringen immer mehr Zeit mit Bildschirmen anstatt mit anderen Menschen. Aber kein Mensch ist eine Insel und niemand kann nur für sich allein leben: Daher halte ich dieses Buch Anselm Grüns für wichtig, das den Wert der Verbundenheit für ein gelingendes Leben umfassend beleuchtet.
(Prof. Dr. Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler, Professor für Psychiatrie, ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm, Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen, Autor)
Der Schritt vom Ich-Denken zum Wir-Denken ist das zentrale Thema unserer Zeit, und zugleich eine Kernfrage der Spiritualität. Anselm Grün bringt dies auf den Punkt: In wirklichen Frieden mit uns selbst und untereinander kommen wir nur und eine gute Zukunft werden wir nur haben, wenn wir Verbundenheit als unsere innerste Wirklichkeit ernst nehmen. Wir können ja nicht sagen: Mein Verhältnis zu allen anderen ist wunderbar, nur zu mir selbst habe ich keine guten Beziehungen. Oder: Mit Gott habe ich eine wunderbare Beziehung, nur mit den Menschen komme ich nicht aus. Das Wir-Denken umfasst die ganze belebte und unbelebte Natur. Alles hängt zusammen! Das dankbar anzuerkennen – und praktische Konsequenzen daraus zu ziehen – ist der Schlüssel für den spirituellen Weg des Einzelnen. Und das gibt Kraft, uns für Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen, für das friedliche Zusammenleben der Religionen und Kulturen einzutreten und so zu leben, dass unser Planet auch für künftige Generationen ein gemeinsam bewohnbares Zuhause bleibt.
(Dr. David Steindl-Rast OSB, spiritueller Lehrer, weltweit engagiert in der Friedensbewegung und im interreligiösen Dialog)
Soziale Verbundenheit ist, wie sich auch aus Sicht der Neurowissenschaften zeigt, in das menschliche „Selbst“ hineingewebt, sie ist Teil dessen, was wir sind. Der uns von innen her mitgegebene Sinn für Verbundenheit ist das, was uns von Künstlichen Intelligenzen unterscheidet. Computer kennen keine soziale Wirklichkeit. Anselm Grün macht deutlich, warum und wie wir das, was uns zum Menschen macht, schützen und bewahren können.
(Prof. Dr. med. Joachim Bauer, Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut, Autor zahlreicher Bestseller)
Wir sind jeden Augenblick unseres Lebens verbunden, auch wenn wir es nicht immer realisieren. Das Buch von Anselm Grün eröffnet viele wertvolle Aspekte für die Wahrnehmung dieser tiefen Dimension der Verbundenheit, die auch Einsamkeitsfähigkeit als heilsame Erfahrung von innerem Reichtum und Geborgensein ermöglicht.
(Prof. Dr. med. Luise Reddemann, Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin, Honorarprofessorin für Psychotraumatologie an der Univ. Klagenfurt, Autorin)
Die Erfahrung des Synodalen Wegs hat gezeigt: Polarisierung, Konflikte und die Gefahr der Zerrissenheit gibt es nicht nur in der Gesellschaft. Auch in der Kirche gelten für den Weg des Miteinanders Werte wie Gerechtigkeit, Dialog, Solidarität und Verantwortung. Versöhnte Verschiedenheit, Verbundenheit miteinander, aber auch mit uns selbst und mit Gott muss immer neu eingeübt und gelebt werden. Anselm Grün ist ein Autor, der zusammenführen kann. Sein Buch leistet spirituelle Hilfe zur Verbundenheit.
(Sr. Philippa Rath OSB, Mitglied des Synodalen Wegs, Autorin und Herausgeberin)
Inhalt
Kein Mensch ist eine Insel – Einleitung
1. Das klösterliche Miteinander als Testfall
2. Isolation, Vereinsamung und „erfüllte Einsamkeit“
3. Unser Hunger nach Zugehörigkeit
4. Die Sehnsucht nach Resonanz
5. Verbunden mit mir selbst
6. „Selbstsein“ und „Wirsein“
7. Was unser Wir-Gefühl bestimmt
8. Beziehung zu mir selbst durch die Beziehung zum anderen
9. Verbundenheit mit der Natur
10. Resonanzräume: Verbundenheit konkret
Vater – Tochter
Mutter – Tochter
Vater – Sohn
Mutter – Sohn
Geschwister
Mann und Frau
Freundschaften
Alt und Jung
Berufliche Beziehungen
11. Heimat in mir finden – anderen Heimat sein
12. Kirchenvision: ein Lebensraum, der Menschen miteinander verbindet
13. Im Angesicht des Todes: Verbundenheit mit den Verstorbenen
14. Verbunden mit dem Grund allen Seins: Gottes Nähe
15. Mystik: Verbunden mit allem, was ist
16. Was Verbundenheit behindert
Gleichgültigkeit
Symbiose
Destruktive emotionale Energien
Egozentrik
Anpassung und Aufgehen in der Masse
Optimierungsdruck und Konkurrenzdenken
Die Ökonomisierung vieler Lebensbereiche
Die Krankheit der Selbstreferenzialität
17. Was Verbundenheit ausmacht und ermöglicht
Mitgefühl
Solidarität
Übernahme von Verantwortung
Gerechtigkeit
Hoffnung
Konfliktfähigkeit und Versöhnungsbereitschaft
Frieden
Toleranz
Kommunikation
Dankbarkeit
Achtsamkeit
Stille
18. „Todsünden“ für das Miteinander – und unsere Antwort
Dankbarkeit statt Neid
Das rechte Maß statt Völlerei
Nicht-Anhaften statt Habgier
Die Lust auf Askese statt Wollust
Demut statt Hochmut
Gelassenheit statt Trägheit
Sich-Abgrenzen statt Zorn
19. Die biblischen Tugendkataloge als Wege zu einer guten Verbundenheit
20. Über alles die Liebe: Selbstliebe und Nächstenliebe, Feindesliebe und Gottesliebe
Alles ist mit allem verbunden – Schluss
Literatur
Über den Autor
Über das Buch
Kein Mensch lebt nur für sich allein: Wir sind von unserem Wesen her immer schon auf andere Menschen hingeordnet. Wir stehen immer in Verbundenheit mit anderen. Selbst wer als Einsiedler lebt, ist nicht unabhängig von seiner Mitwelt. Er verdankt sich selber anderen, trägt Verantwortung für andere – und die Weise, wie er lebt, hat auch Auswirkungen auf seine Mitmenschen. Nicht zu Unrecht heißt es: Kein Mensch ist eine Insel.
Im Bild der Insel kann die Beziehung von Einzelnem und Gemeinschaft, von Abgrenzung und Besonderheit deutlich gemacht werden. Dieses Bild der Insel hat in unserer Vorstellung meist eine doppelte Bedeutung. Da gibt es die positive Idee von etwas Großartigem: splendid isolation, die ideale Abgeschiedenheit, man spricht von der „Insel der Seligen“. Aber als Bild kann die Insel auch für Isolation und Trennung stehen. Einerseits kann dieses Bild eine Gegenwelt zu unserer Alltagserfahrung beschreiben und andererseits auch etwas Unwirkliches meinen. Thomas Morus schildert zum Beispiel im 16. Jahrhundert seine Vorstellung von einer idealen Welt namens „Utopia“, indem er sie auf einer imaginären Insel ansiedelt: Da ist das Bild einer gerechten und gemeinnützig organisierten, toleranten Gesellschaft von gleichgesinnten und gleichberechtigten Bürgern. Aber das ist ein Ort, der nicht wirklich existiert, ein u-topos: nicht von dieser Welt.
Vor über dreihundert Jahren, 1719, hat Daniel Defoe Robinson Crusoe geschrieben, die Geschichte von einem Mann, der als Schiffbrüchiger auf einer Insel gestrandet ist und erlebt, wie schwer es ist, ganz auf sich selber gestellt sein Überleben zu meistern: die Geschichte einer „Inselexistenz“. Am Staatstheater Wiesbaden wurde der Stoff vor einigen Jahren neu inszeniert und ins Heute übersetzt. Der „Held“ erlebt da seine Inselexistenz, indem er das Casting für eine Reality-Show gewinnt, aber schon bald beginnt ein einsamer Überlebenskampf. Denn nach anfänglicher Publikumsresonanz sinken die Einschaltquoten, er droht vergessen zu werden. Seine Einträge bei Instagram werden zwar angeklickt, aber niemand interessiert sich wirklich dafür. In der Wiesbadener Inszenierung ruft der moderne Robinson aus: „Holt mich hier raus. Ich bin ein Star.“ Die Angst vor dem Vergessenwerden ist das eigentliche Leiden dieser modernen Robinsons. Sie sehen sich als Star, als verkanntes Genie, umspült vom Meer ihrer Einzigartigkeit. Angetrieben von der Sucht nach der Aufmerksamkeit ihrer Umwelt bleiben sie dennoch allein. Denn keiner erkennt sie wirklich. Was als Mediensatire gemeint ist trifft offensichtlich ein Daseinsgefühl vieler Menschen heute und beschreibt, wie sich viele in ihrem Verhältnis zum Ganzen empfinden.
Soziologen wie Andreas Reckwitz sprechen von einer „Gesellschaft der Singularitäten“, in der Menschen sich „besonders“ oder „einzigartig“, „anders als alle anderen“ vorkommen. Man könnte auch hier von „Inselexistenzen“ sprechen. Doch das ist oft keine freiwillig gesuchte, sondern eine von der Kraft der sozialen Medien geprägte und oft aufgezwungene Existenz. Insel – italienisch: isola – bedeutet bildhaft: Isoliertsein, Abgeschottetsein.
Weder Utopie noch Gesellschaftskritik ist ein anderes berühmtes Buch. Es liest sich wie ein Gegenprogramm zur Inselexistenz heutiger Menschen. Der Trappist Thomas Merton hat es 1955 veröffentlicht, und sein Titel lautet: No man is an island – deutsch: Keiner ist eine Insel. Merton schreibt in der Einleitung: „… im Letzten ist jeder Einzelmensch dafür verantwortlich, daß er sein eigenes Leben lebt und ‚sich selbst findet‘“ (Merton 7). Aber zugleich gilt: „Jeder andere Mensch ist ein Stück von mir, denn ich bin Teil und Glied der Menschheit“ (ebd. 17). Wir leben in dieser Spannung: dass wir für uns selbst verantwortlich sind, dass auch der spirituelle Weg immer ein ganz persönlicher Weg ist – und dass wir zugleich Teil des Menschengeschlechts sind, im Innersten miteinander verbunden. Daher schließt Merton seine Einleitung zu den Meditationen über die Liebe mit dem Satz: „Nichts hat Sinn, wenn wir nicht mit John Donne bekennen: ‚Keiner ist eine Insel, in sich selbst vollständig. Jeder ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Ganzen‘“ (ebd.).
Thomas Merton bezieht sich mit diesem Bild auf John Donne, einen englischen Dichter, der vor 400 Jahren lebte, aber er antwortet mit seinem Buch, das den Untertitel „Betrachtungen über die Liebe“ trägt, auf die Sehnsucht vieler Menschen heute. Diese Sehnsucht nach liebender Verbundenheit drückt auch die wohl populärste Fußballhymne der Gegenwart aus: You’ll never walk alone – „Du gehst niemals allein deinen Weg“. Das ist ein Lied über das Leben, über Vertrauen und Hoffnung trotz aller Gefährdung und trotz aller Risiken. Wer lebt, ist bezogen auf andere, die mit ihm fühlen. Und das ist es, was stärkt und trägt. Dass keiner wirklich allein ist, hat seinen Grund eben darin, dass wir im Innersten miteinander verbunden sind. Leben heißt also nicht nur: „Wir sind nun einmal zufällig alle im gleichen Boot.“ Es heißt: Innerlich verbunden zu sein gehört zu unserem Wesen als Menschen.
Was dieses Lied sagt, das hat Papst Johannes Paul II. bei seinem ersten Besuch in Deutschland auf seine Weise ausgedrückt, und Benedikt XVI. hat es später wiederholt: „Wer glaubt, ist nie allein.“ Nicht nur die Vitalität, das Leben verbindet uns. Auf eine noch tiefere Weise ist es der Glaube, der uns nie allein lässt. Wir sind geborgen, wenn wir offen bleiben auf eine umfassende Wirklichkeit hin, die uns trägt. Verbunden sind wir auch durch die Gemeinschaft derer, die das glauben. Thomas Merton drückt diesen Glauben mit den von einem biblischen Bild inspirierten Worten christlicher Theologie so aus: „Jeder Christ ist ein Teil meines eigenen Leibes, denn wir sind Glieder Christi. Was ich tue, wird auch für sie, mit ihnen und durch sie getan. Was jene tun, wird in mir, durch mich und für mich getan“ (Merton 17).
Ein anderer amerikanischer Autor, der Franziskaner Richard Rohr, greift den Gedanken von Thomas Merton auf, wenn er sagt, wir bräuchten nicht perfekt zu sein: „not perfect, but connected“. Verbunden also – mit uns selbst, mit den Menschen und mit Gott. Darin liegt für Rohr auch das Wesentliche des spirituellen Weges: dass wir in Verbindung treten mit uns selbst, mit Gott und mit den Menschen. In diesem Verbundensein können wir alles in uns zulassen, auch unsere Schattenseiten. Wer das Ziel seines spirituellen Weges darin sieht, verbunden zu sein, der weiß sich mit allem, was in ihm ist, verbunden, und auch mit Gott und mit den Mitmenschen.
In vielen soziologischen Büchern ist heute von „Connectedness“ die Rede, von Verbundenheit. Früher hat man darüber kaum nachgedacht, weil es selbstverständlich war, dass man zeitlebens im Rahmen eines bestimmten sozialen Beziehungsgefüges lebte. Heute ist das anders. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass gerade in einer Gesellschaft wie der US-amerikanischen dieser Begriff heute sehr verbreitet ist. Offensichtlich ist auch deswegen, weil diese Gesellschaft sich immer mehr spaltet, das Bedürfnis nach Gruppierungen, die sich miteinander verbinden und sich gemeinsam für soziale und ökologische Projekte engagieren, besonders groß. Und nicht nur für die USA gilt: Ohne die Verbundenheit von bürgerschaftlichen Initiativen würde unsere Gesellschaft immer mehr auseinanderdriften und Schaden leiden. Nur gemeinsam können wir die Probleme – Klimawandel und Pandemie, Gerechtigkeit und Frieden – angehen, um Lösungen zu finden, die allen Menschen dienen.
Es war in den Wochen vor Weihnachten, als ich anfing, dieses Buch zu schreiben. Zu dieser Zeit machte uns die Corona-Pandemie noch zu schaffen. Da gab es die Erinnerung an Phasen, die von erzwungener sozialer Distanz bestimmt waren. Für einige bedeutete das Quarantäne. Das hatte in der Gesellschaft eine anhaltend heftige und kontroverse Debatte über das richtige Verhalten zur Folge. Und dann brachte auch noch der plötzlich Realität gewordene Krieg mitten in Europa erschreckende Bilder von politischer Entzweiung und tödlicher Gewalt. Abgesehen davon war die Spaltung in der Gesellschaft immer wahrzunehmen: das Auseinanderklaffen von armen und reichen Schichten und auch Konflikte zwischen „konservativen“ und „progressiven“ Positionen im politischen Streit. Mir ist damals, in dieser Vorweihnachtszeit, klar geworden, dass gerade jetzt nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Herzen der Menschen etwas in den Vordergrund rückt, was das Leben eigentlich immer angeht. In den Zeitungen stieß ich aber gerade jetzt in vielen Kommentaren immer wieder auf das Thema Verbundenheit. Gerade jetzt sehnen sich die Menschen nach gelingenden Beziehungen, auch und gerade wenn die sozialen Verhältnisse im eigenen familiären Umfeld brüchig geworden sind.
Es ist aber nicht nur das Familienidyll, dem viele nachtrauern und nach dem sie sich dann umso stärker sehnen. Es geht meist auch um etwas Umfassenderes. Man möchte verbunden sein mit den Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen, aber auch mit denen, die sonst hinter der Anonymität einer Dienstleistungsgesellschaft unsichtbar sind. Gerade in der Vorweihnachtszeit las man etwa, dass Menschen Schaffnern dankbar sind, die über die Feiertage Dienst haben, oder auch Krankenschwestern, die über Weihnachten die Kranken pflegen. Das ist kein Zufall: Viele Menschen beachten zwar das Geheimnis von Weihnachten in seiner religiösen Bedeutung kaum mehr. Aber diese jetzt deutlich aufbrechende Sehnsucht nach Verbundenheit zeigt für mich doch, dass sie etwas Wesentliches von diesem Fest verstanden haben. Christen drücken es so aus: Gott ist in Jesus für alle Mensch geworden. Er hat in seiner Menschwerdung alle Menschen berührt und sie in der Tiefe miteinander verbunden. Und er hat auch die nicht ausgeschlossen, die „an den Rändern“ und in Not leben. Das gilt nicht nur für die Weihnachtszeit.
Unabhängig von der besonderen emotionalen Färbung, die Weihnachten hat: Dazuzugehören, verbunden zu sein ist eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse, auch im Alltag unseres Lebens. Um das zu veranschaulichen, zitiert der Religionspädagoge Anton A. Bucher eine Vision der amerikanischen Poetin Alix Kates Shulman, die ein Erlebnis in der New Yorker U-Bahn schildert: „Und ich sah in den vielen Fahrgästen die wunderbare Verbundenheit aller Lebewesen. Ich fühlte es nicht – ich sah. Was als oberflächlicher Gedanke begann, wuchs zu einer Vision heran, … in der alle Menschen auf diesem Planeten gemeinsam der Sonne entgegenzogen, zu einer einzigen Familie vereinigt, unauflösbar verbunden durch das einzigartige Wunder des Lebens“ (Bucher 7).
Für Bucher ist Verbundenheit also letztlich eine spirituelle Erfahrung. Auch heute, in einer Zeit, in der wir vom Glaubensschwund sprechen, „verspüren nach wie vor viele Menschen eine tiefe Verbundenheit mit etwas Größerem, Transzendentem, aus dem sie Trost beziehen, wie ihn die Welt nicht geben kann“ (Bucher 9).
Bei einem Kurs über das Geheimnis von Weihnachten, den ich damals angeboten habe, beklagte sich eine Teilnehmerin, dass sie zum ersten Mal Weihnachten alleine feiern müsse, ohne ihre Kinder und Enkelkinder. Sie fühlte sich allein gelassen und spürte in sich eine große Traurigkeit. Doch im Gruppengespräch wurde ihr klar: Auch wenn sie allein feiert, kann sie sich verbunden fühlen mit ihrer Familie – und darüber hinaus mit allen Menschen, die alleine Weihnachten feiern. Wenn ich mich vor eine brennende Kerze setze und in das milde Licht der Kerze schaue, kann ich mir vorstellen: das Licht der Kerze leuchtet jetzt auch für meine Kinder und Enkelkinder. Ich bete darum, dass die Kinder und Enkelkinder dieses Licht in sich eindringen lassen, sodass es sie mit Liebe und Güte erfüllt. Ich fühle mich in die Kinder ein: Wonach sehnen sie sich? Worunter leiden sie? Was bräuchten sie? Und in dieser Erfahrung fühle ich mich mit ihnen verbunden.
In diesem Buch möchte ich diese spürbare Sehnsucht aufgreifen und zugleich Wege aufzeigen, wie in unserer nicht nur an Weihnachten emotional aufgewühlten Zeit Verbundenheit möglich wird – im Leben von Einzelnen, aber auch in der Gesellschaft. Dabei geht es um viele Aspekte: die Verbundenheit mit mir selbst, der ich mir oft selber als zerrissen erscheine, die Verbundenheit mit den Menschen in meiner Nähe und den Zusammenhalt in der Gesellschaft, um die Verbundenheit mit der Natur und die Verbundenheit mit Gott. Nach solch umfassender und tiefer Verbundenheit sehnen sich die Menschen. Und doch erleben sie oft etwas anderes: Sie fühlen sich allein, isoliert, abgeschnitten von der Verbindung mit den anderen. Und viele sind zwar verbunden, erleben aber die Verbundenheit als belastend. Da ist die Verbindung zu eng, sie engt ein, sie macht krank. Die Grundfrage dieses Buches ist also: Wie können wir unsere Sehnsucht nach Verbundenheit so leben, dass sie für uns heilsam ist, und wie können wir Beziehungen so leben, dass unser Miteinander glückt und uns glücklich macht?
1.
Das klösterliche Miteinander als Testfall
In Distanz zur Gesellschaft, aber nicht mit dem Rücken zur Welt
Das monastische Leben ist ein konkreter Erfahrungshintergrund meines Schreibens. Und da ist es durchaus legitim, zu fragen: Ist das, was ich dort erfahre, mit dem, was in der Welt und der Gesellschaft passiert, überhaupt in Verbindung zu bringen oder gar darauf zu übertragen? Ich will also im Folgenden zunächst das mir vertraute benediktinische Modell des Miteinanders quasi als Testfall anschauen. Im Kloster leben wir zwar in Distanz zur Gesellschaft, aber nicht isoliert von ihr oder gar mit dem Rücken zur Welt: „Der Mönch ist einer, der allein lebt, aber sich mit allen Menschen verbunden fühlt“, sagt schon Evagrius Ponticus, der Mönchsschriftsteller aus dem vierten Jahrhundert. Er meint mit Verbundenheit: dass er sich in jedem Menschen selber sieht und im anderen sich selber erkennt. Das drückt sich auch im Gebet aus: In den Psalmen, die wir Mönche jeden Tag beten, wird die Not der Welt in Solidarität vor Gott getragen. Und natürlich lese ich auch die Zeitung, höre Nachrichten und nehme Anteil an dem, was in der Welt passiert. Wie sollte ich denn predigen, wenn ich nicht wüsste, was die Menschen bewegt?
Gäste, die zu uns ins Kloster kommen, um einige Tage mit uns das Leben zu teilen, fragen mich tatsächlich immer wieder: „Wie gelingt es euch, dass achtzig so verschiedene Männer friedlich zusammenleben und dass ihr gemeinsam eure Aufgaben in der Schule, im Gästehaus, im Recollectiohaus, in der Missionsarbeit, in der Landwirtschaft und in den Werkstätten bewältigen könnt?“ Seit bald sechzig Jahren lebe ich als Mönch in dieser Gemeinschaft. Daher möchte ich einige Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich in dieser langen Zeit in einer konkreten Gemeinschaft gemacht habe, darstellen.
Benedikt stellt kein hohes Ideal von Gemeinschaft auf. Denn wenn wir von der Gemeinschaft in zu großen Worten schwärmen, verdrängen wir meistens ihre Schattenseiten. Benedikt begnügt sich damit, einfach zu beschreiben, wie ein Miteinander gelingen kann. Und seine nüchternen Beschreibungen könnten auch für uns heute eine Anregung sein, über unsere Beziehungen und unser Verbundensein nachzudenken.
Gegenseitige Achtung und Ehrfurcht vor dem anderen
Wie das Miteinander gelingen kann, fasst Benedikt im 72. Kapitel seiner Regel zusammen. Da erinnert er die Mönche an den guten Eifer, den sie haben sollen: „Diesen Eifer sollen also die Mönche mit glühender Liebe in die Tat umsetzen, das bedeutet: Sie sollen einander in gegenseitiger Achtung zuvorkommen; ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher Geduld ertragen; im gegenseitigen Gehorsam sollen sie miteinander wetteifern; keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das des anderen; die Bruderliebe sollen sie einander selbstlos erweisen; in Liebe sollen sie Gott fürchten; ihrem Abt seien sie in aufrichtiger und demütiger Liebe zugetan. Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen. Er führe uns gemeinsam zum ewigen Leben“ (RB 72,3–12). Dieses Kapitel ist gleichsam das Vermächtnis Benedikts. Auch hier wird weniger eine Theologie der Gemeinschaft entfaltet als die Bedingungen für ein gedeihliches Miteinander aufgezeigt. Im letzten Satz wird allerdings deutlich, dass es eben nicht um das Wohlfühlen in der Gemeinschaft geht, sondern um Christus, der die eigentliche Mitte und das Ziel des gemeinsamen Suchens ist.
Die erste Bedingung, dass eine Gemeinschaft den Geist Christi atmet wie in der Urkirche, ist demnach die Achtung, die Ehrfurcht vor dem anderen. Wenn man ein Leben lang zusammenlebt, bekommt man auch die Schwächen seiner Mitbrüder mit. Da ist es wichtig, den anderen nicht wegen seiner Schwächen zu verachten, sondern immer um seine Würde zu wissen und daran zu glauben. Die Ehrfurcht lässt dem anderen sein Geheimnis. Sie verzichtet darauf, alles beim anderen herauszufinden oder ihn gar auszuspionieren. Unsere heutige Sucht, alle Fehler anderer Menschen in der Öffentlichkeit breitzutreten, widerspricht dieser Ehrfurcht. Und diese Sucht zerstört das Gefühl von Verbundenheit. Indem wir über andere so hart urteilen, isolieren wir uns selbst. Denn wir spüren dabei auch, dass wir selber unseren eigenen Maßstäben nicht gerecht werden können. In dieser Sucht, andere zu be- und zu verurteilen, wird ständig eine Grenze überschritten, wird die notwendige Distanz zu anderen Menschen nicht gewahrt. Eine Gemeinschaft kann nur auf Dauer menschlich miteinander leben, wenn sie ein gesundes Verhältnis von Nähe und Distanz hat. Manche modernen Gemeinschaften gehen nach kurzer Zeit wieder auseinander, weil sie zu viel Nähe wollen und weil man alles vom anderen wissen will. Nur eine gesunde Spannung von Einsamkeit und Gemeinschaft, von Nähe und Distanz, von Mitteilen und dem Geheimnis, das jedem bleibt, kann auf Dauer eine lebensfähige Gemeinschaft bilden.
Bereitschaft, den anderen zu ertragen
Die zweite Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben ist die Bereitschaft, den anderen zu ertragen. Schon Paulus fasst das Gesetz Christi in dem Satz zusammen: „Einer trage des anderen Last“ (Gal 6,2). Auch hier braucht es eine gesunde Spannung. Ich darf nicht jeden Konflikt in der Gemeinschaft als Kreuz verstehen, das ich tragen muss. Denn dann würde ich die Gemeinschaft ideologisieren und mich vor der Realität verschließen. Das nähme mir aber die Möglichkeit, die Konflikte offen anzusprechen und zu lösen. Und es führt zu einer masochistischen Haltung, die der Psychotherapeut Bert Hellinger in dem Satz zusammenfasst: „Lieber leiden statt lösen.“ Doch auch wenn Konflikte angesprochen und Problemlösungen versucht werden, bleibt immer noch genug, das man einfach tragen und annehmen muss. Vor allem gilt es zu ertragen, dass eine Gemeinschaft nicht ideal ist, dass auch in einem Kloster nicht nur immer wahrhaft gottsuchende Brüder und Schwestern sind, sondern auch Menschen, denen es mehr um die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse geht, die die Gemeinschaft vielleicht auch gesucht haben, damit es ihnen gut geht. Benedikt hat diesen Satz auf dem Hintergrund der Erfahrung geschrieben, die er selbst mit seiner Gemeinschaft gemacht hat, aber auch im Anschluss an Gedanken, die der Mönchsvater Johannes Cassian in seiner 16. Unterredung entfaltet. Cassian schreibt: „Wer den andern aushält und erträgt, zeigt sich stark; wer dagegen schwach, fast krankhaft veranlagt ist, den muss man vorsichtig und sanft behandeln; manchmal muss man dem andern um seiner Ruhe, seines Friedens und Heils willen auch in notwendigen Dingen nachgeben … Niemals nämlich erträgt der Schwache einen Starken“ (vgl. Holzherr 411f). Ja, Cassian weiß, dass manche Mitmenschen für die anderen eine große Belastung und zugleich Herausforderung sein können: „Im übrigen ist auch festzuhalten, dass die Schwachen von Natur aus immer rasch bereit sind, andere zu beleidigen oder einen Konflikt auszulösen, selber aber nicht einmal den Schatten eines Unrechts tolerieren können“ (ebd.). Wenn eine Gemeinschaft allerdings nur aus Schwachen besteht, kann das leicht zur Spaltung und Auflösung führen. Zumindest wird das Leben bald unerträglich. Es braucht immer genügend Starke, die die Schwachen mittragen und ihnen einen Raum der Heilung anbieten.
Gemeinschaft ist kein Einheitsbrei. Der Einzelne hat Verantwortung
Benedikt fordert nicht nur den Gehorsam dem Abt gegenüber, sondern auch den gegenseitigen Gehorsam. Damit meint er wohl, dass die Brüder aufeinander hören sollen. Jeder bringt seine Begabung mit. Jeder hat seine persönliche Sichtweise. Eine Gemeinschaft ist kein Einheitsbrei, in dem der Einzelne ganz und ununterscheidbar aufgeht. Sie bleibt nur dann bunt und lebendig, wenn jeder auf den anderen hört und seiner Stimme Raum lässt. Viele Stimmen müssen zusammenklingen, damit die Gemeinschaft zu einem Einklang findet. Gehorsam den Brüdern gegenüber heißt auch, dass der Einzelne bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft und für einzelne Mitbrüder zu übernehmen. Er lässt sich fordern und kreist nicht nur um die eigenen Bedürfnisse.
Worin brüderliche Liebe ihren Grund hat
Eigenartigerweise spricht Benedikt von der Liebe zu Gott als „amor“ (RB 72,9). Amor ist eigentlich die erotische Liebe, die begehrende Liebe, die sich danach sehnt, mit dem Geliebten eins zu werden. Hier klingt an, dass die Liebe zu Gott sich aus der Kraft des Eros speist. Es ist keine intellektuelle Liebe, keine Liebe, die nur aus dem Willen kommt, sondern aus der Sehnsucht des Herzens, das eins werden möchte mit dem Geliebten. Benedikt geht es offensichtlich darum, dass die menschliche Liebe zwischen den Brüdern von der Gottesliebe gespeist wird und die Liebe zu Gott von der erotischen Liebe zu einem geliebten Menschen. Beide Pole müssen zusammenkommen, damit die Liebe echt bleibt. Ohne Eros bleibt die Gottesliebe langweilig und nicht spürbar. Ohne die göttliche Liebe wird die Liebe zu den Menschen entweder zu einer moralischen Überforderung oder zu einem ständigen Kreisen um die eigenen Gefühle.
Die Liebe zu Gott sieht Benedikt zusammen mit der Furcht. Bei Johannes heißt es, dass in der Liebe keine Furcht ist (vgl. 1 Joh 4,18). Doch die Mönche sollen Gott in Liebe fürchten. Hier ist von der Spannung die Rede zwischen Gott als fascinosum und Gott als tremendum, zwischen dem Gott, der uns begeistert und anzieht, und dem, der uns erschreckt, der uns bis in die Knochen trifft. Nur wenn diese Spannung ausgehalten wird, wird unsere Gottesbeziehung lebendig bleiben und gesund. Ohne die Ehrfurcht sind wir in Gefahr, Gott zu verniedlichen und zu vereinnahmen. Aber ohne die Liebe wird die Furcht zur Angst, die das Gottesbild verfälscht.
Die Gemeinschaft braucht ein Ziel, das sie übersteigt
Die wichtigste Bedingung für das Gelingen von Gemeinschaft liegt in der Forderung Benedikts: „Christus sollen sie überhaupt nichts vorziehen. Er führe uns gemeinsam zum ewigen Leben“ (RB 72,11f). Diesen Satz hat Benedikt aus der Spiritualität der Märtyrer übernommen. Er findet sich in ähnlicher Weise bei Cyprian von Karthago (+ 258). Benedikt ist offensichtlich davon überzeugt, dass das Miteinander nur gelingen wird, wenn die Mönche vom Geist der Märtyrer erfüllt sind: von ihrer Bereitschaft zur Hingabe, von ihrem Mut, sich ganz und gar auf Christus einzulassen und für ihn Zeugnis abzulegen. Wenn die Gemeinschaft nur um sich selbst kreist, um das Wohlbefinden der einzelnen Mitglieder, dann wird sie sich bald auflösen. Die Gemeinschaft braucht ein Ziel, das sie übersteigt. Dieses Ziel muss mehr sein als eine gemeinsame Arbeit. Es muss letztlich ein jenseitiges Ziel sein: Gott oder Jesus Christus. Nur wenn die Mönche Christus über alles stellen und ihr Leben für ihn einsetzen, wird ihre Gemeinschaft Bestand haben.
In diesem Satz klingt für mich aber noch etwas anderes mit. Meine Erfahrung mit Gemeinschaft hat mir gezeigt, dass die Gemeinschaft nie meine Bedürfnisse nach Heimat, nach Angenommenwerden, nach Verbundenheit und Geborgenheit erfüllen wird. Die Gemeinschaft wird mich in dieser Sehnsucht immer wieder auch enttäuschen. Doch gerade die Enttäuschung an der Gemeinschaft verweist mich auf Christus. Nur wenn ich nichts höher stelle als Christus, kann ich die Gemeinschaft realistisch erleben. Da erlebe ich sie manchmal als einen Ort, an dem Christus erfahrbar wird, etwa in gemeinsamen Gottesdiensten oder in Gesprächen, die gelingen, in denen wir einander teilgeben an unserer Suche nach Gott. Aber dann erlebe ich sie wieder in ihrer Banalität und Durchschnittlichkeit, in ihrem kleinkarierten Denken und in ihrem Kreisen um sich und unwichtige Probleme. Aber wenn es mir um Christus geht, dann zerbreche ich nicht daran, sondern dann nehme ich auch diese Enttäuschung als Ansporn, mich tiefer in Christus zu gründen und wirklich auf ihn zuzugehen.
Die Frage ist nun, was diese Weisungen Benedikts an seine Mönche für die Sehnsucht nach Verbundenheit beitragen können, die heute viele Menschen bewegt. Eine klösterliche Gemeinschaft ist natürlich etwas ganz und gar anderes als das Zusammenleben in der Familie, in beruflichen oder anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Dennoch macht sie Erfahrungen, die auch für die Gesellschaft hilfreich sein könnten.
Da ist einmal die Frage nach dem, was uns verbindet. Bei den Mönchen ist es die gemeinsame Suche nach Gott, das gemeinsame Schauen auf Christus. Für die Gesellschaft würde das bedeuten: Sie braucht Ziele, die über die Gefühle des Sich-Wohlfühlens hinausgehen. So ein Ziel könnte das friedliche Miteinander sein, die Toleranz, die Achtung der Menschenwürde, das Streben nach Gerechtigkeit und die Hoffnung auf ein inneres Verbundensein, das auch durch Konflikte und Differenzen nicht zerstört werden kann.
Nähe und Distanz. Und ein weites Herz
Ein anderer Aspekt ist das Verhältnis von Nähe und Distanz. Mönche sind eigentlich Menschen, die sich zurückgezogen haben, die einsam leben. Aber Benedikt möchte, dass die Mönche eine Gemeinschaft bilden. Das Miteinander von Einsamkeit und Gemeinschaft gibt der Gemeinschaft auf Dauer Halt. Wenn die Menschen immer zu eng zusammen sind, gehen sie sich gegenseitig auf die Nerven. Es braucht auch die Fähigkeit, allein zu sein, die uns dann auch gemeinschaftsfähig macht. Und es braucht die Bereitschaft, die anderen so anzunehmen, wie sie sind. Daher ist für Benedikt das weite Herz die Voraussetzung, dass Menschen mit ganz unterschiedlichem Charakter miteinander in Eintracht leben können.
Wenn ich in der Abtei Kurse gebe, so mache ich oft die Erfahrung, dass die Kursteilnehmer sich untereinander verbunden fühlen. Gleich, ob das auf berufliche Themen bezogene Führungsseminare oder Seminare zu spirituellen Themen sind: Da entsteht auf einmal ein wunderbares Miteinander. Weil sie gemeinsam auf dem Weg sind, kommen sie sich näher. Und viele erfahren die Abtei als ihre geistliche Heimat. Sie fühlen sich mit ihr verbunden. Offensichtlich färbt die Verbundenheit der Mönche untereinander auch auf die Menschen ab, die das Kloster besuchen. Wenn wir Mönche miteinander verbunden sind, sind wir auch offen für die Menschen, die zu uns kommen. Das spüren die Besucher und öffnen sich dann auch füreinander. So braucht es in unserer Gesellschaft offensichtlich Gemeinschaften, die Verbundenheit leben, damit sich um sie herum auch Menschen miteinander verbinden.
Auch über zeitliche Distanz hinweg ist Nähe erlebbar: Am Sonntag gehe ich manchmal nach dem Mittagessen in unserer Bachallee spazieren. Der Bach, den die Allee umgibt, haben die Mönche schon im 12. Jahrhundert geschaffen, indem sie ihn von der Schwarzach abgeleitet haben, um die Klostermühle zu betreiben. Als die Mönche 1935 begannen, die Kirche zu bauen, haben sie den Erdaushub an diesem Bach abgelagert, sodass eine schöne Allee entstanden ist. Sie geht über einen Kilometer am Bach entlang. Wenn ich diesen Weg gehe, fühle ich mich verbunden mit den Mitbrüdern, die diese Allee gestaltet und seit über achtzig Jahren gepflegt haben. Ich denke an die Mitbrüder, mit denen ich auf diesem Weg gegangen bin, um ein geistliches Gespräch zu führen. Wenn ich bei der Rückkehr auf die Abtei schaue, fühle ich mich verbunden mit all den Mitbrüdern, die beim Aufbau der Abtei mitgeholfen haben. Und ich fühle mich auch mit mir selbst verbunden. Denn ich darf dankbar auf das zurückschauen, was ich in den 36 Jahren, in denen ich Cellerar war, für die Abtei schaffen durfte. So mag es manchen gehen, wenn sie an ihrem Heimatort spazieren gehen und sich an all die Menschen erinnern, die dort ihr Leben geprägt haben. Da spüren sie eine tiefe Verbundenheit, die sie heute noch trägt.
Das Gefühl der Verbundenheit hält eine Gemeinschaft über Jahrhunderte zusammen. Wir fühlen uns aber auch verbunden mit den Brüdern, die im Alltag räumlich getrennt in der Krankenstation sind. Auch sie kommen an den Festen in ihren Rollstühlen zu den gemeinsamen Feiern. Und sie werden täglich von Mitbrüdern besucht. Niemand wird ausgeschlossen. Auch eine Gesellschaft wird sich nur untereinander verbunden fühlen, wenn die Einzelnen in ihrer Schwäche, ihrer Krankheit und in ihrem Tod nicht vergessen werden und der Blick über die unmittelbare Gegenwart hinausgeht. Auch die Gesellschaft braucht dieses weite Herz, von dem Benedikt spricht, damit das Miteinander gelingt.
2.
Isolation, Vereinsamung und „erfüllte Einsamkeit“
Vielleicht können die beschriebenen Erfahrungen auch bei der Beantwortung der Frage helfen, wie wir heute in einer Gesellschaft zusammenleben können, die so stark von der Erfahrung von Isolation geprägt ist, und eine Perspektive darauf geben, wie wir in unserer oft genug polarisierten Gesellschaft ein gutes Miteinander, ein fruchtbares Verbundensein ganz unterschiedlicher Menschen schaffen können. Soziologen stellen jedenfalls fest, dass trotz aller Möglichkeiten, durch die sozialen Medien miteinander verbunden zu sein, der Zusammenhalt nicht wächst, ja dass die Erfahrung der Unverbundenheit, das Gefühl von Vereinsamung zunimmt.
Dass allein in Deutschland 14 Millionen Menschen sagen, dass sie sich einsam fühlen, hat sicher viele Gründe. Einer davon ist wohl die Individualisierung der Gesellschaft. Darunter versteht man auch verbreitete Haltungen wie die des Sich-selber-Durchsetzens. Manche sprechen auch vom Ego-Kult. Der Rückgang von Bindungsbedürfnissen ist offensichtlich. Die Single-Haushalte nehmen in den Großstädten rapide zu. Man hat zwar viele Kontakte per Facebook oder Instagram. Aber im Grunde fühlt man sich doch allein.
Wenn Einsamkeit als schmerzvoll erfahren wird: Worunter leiden wir?
Im Kern ist das Leiden an der Einsamkeit das Gefühl, keine Beziehung zu anderen zu haben, nicht wahrgenommen, anerkannt oder geschätzt zu sein, nicht gerecht behandelt zu werden. Man fühlt sich unfreiwillig abgeschnitten von einer Verbundenheit, die auch für das eigene Selbstwertgefühl wesentlich ist. Lebensgeschichtlich kann das ganz verschiedene Ursachen haben – man muss dabei nicht nur an die plötzliche Zwangssituation der Pandemie oder an die Flüchtlinge denken, die ohne Sprachkenntnisse in einer ihnen fremden Umgebung „stranden“. Es können andere unerwartete, individuelle Situationen sein: Da wird jemand plötzlich arbeitslos und fällt durch das soziale Netz. Da wird jemand auf einmal gemobbt. Oder jemand wird krank, fühlt sich ausgeschlossen aus dem Club der Gesunden, will sich ihnen nicht zumuten und hat keine Hilfe. Oder da verliert jemand seinen liebsten Menschen durch den Tod, sieht sich selber am Abgrund und niemand weiß, wie es ihm geht. Da sind einem anderen etwa die Eltern gestorben, und die Geschwister haben sich entzweit. Auch da kann über einen Menschen plötzlich die Erfahrung hereinbrechen: Ich stehe allein. Es ist heute ja kein Einzelschicksal mehr, dass die familiäre Verbundenheit auseinandergebrochen ist. Bei vielen herrscht in solchen Situationen das Gefühl: Die anderen oder auch die Gesellschaft kümmern sich nicht darum, wie es einem geht. Immer öfter erlebe ich auch Menschen, die in ihre eigene Angst eingeschlossen sind angesichts drohender Katastrophen oder im Blick auf die eigene individuelle Zukunft: Die Angst, alleingelassen zu werden im Sterben, zieht manchen schon jetzt den Boden unter den Füßen weg.
Zehrend und bitter: Alterseinsamkeit
Offensichtlich gibt es die Not der Alterseinsamkeit, auch wenn sie bisweilen im Verborgenen stattfindet. Wenn etwa 38 Prozent der über 70-Jährigen in Deutschland allein leben, hat das Folgen. Die Zahl der sozialen Kontakte schrumpft durch das Ausscheiden aus dem Beruf. Freunde und Bekannte sterben. Der Austausch mit anderen Menschen wird geringer. Mit dem Älterwerden sind viele zudem von einer existenziellen Zukunftsangst beherrscht: etwa dass man, wenn man noch älter und hilfsbedürftig wird, niemanden hat, der für einen sorgt. Man fürchtet, dann die staatlichen oder kirchlichen Fürsorgeinstitutionen in Anspruch nehmen zu müssen – und schämt sich dafür. „Ich weiß gar nicht mehr, wie Besuch geht“, sagte eine ältere Frau im Gespräch. Viele „verschanzen“ sich im Alter, trauen sich nicht mehr, „unter Leute“ zu gehen, weil sie sich auch schämen, isoliert zu sein. Sie sind vielleicht mit Sorgen um die eigene Gesundheit oder die des Partners belastet. Oder sie erfahren, dass sie nicht mehr über genügend Mittel verfügen, um an wichtigen und in unserer Geldgesellschaft nicht immer billigen Ereignissen wie Konzert oder Theater teilzunehmen. Oft glauben sie auch, dass sie ihr Leben nicht mehr im Griff hätten, oder meinen, dass sie kein von positiven Dingen erfülltes Leben vorweisen und davon erzählen können. Sie haben den Eindruck, dass ihr Leben sinnlos sei. Sie werden nicht mehr gebraucht, nützen keinem, fallen nach eigenem Empfinden höchstens anderen zur Last. So verkriechen sie sich in sich selbst, verstecken sich immer mehr in ihrer Wohnung, vernachlässigen sich und meiden den Kontakt mit Menschen, nach denen sie sich eigentlich im Inneren so sehr sehnen. Solche Einsamkeit kann zehrend, kalt, bitter und voller Enttäuschung sein. Da ist tiefes Leid.
Warum sich junge Menschen einsam fühlen
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: