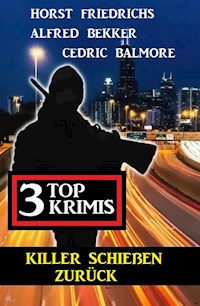Sein Atem kam laut und keuchend wie bei einem Kranken. Aber
ihn quälte kein Asthma, das war zu hören. Er hatte Angst.
»Brown«, sagte er schließlich. »James Brown.«
ich drückte auf den Knopf, der das Bandgerät in Tätigkeit
setzte. Es konnte nicht schaden, das Telefongespräch
mitzuschneiden. Sobald ein Anrufer sich als Brown, Miller oder
Smith meldete, konnte man mit neun gegen eins wetten, daß er sich
zu tarnen versuchte.
»Ich höre«, sagte ich.
»Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie, Trevellian. Da ist
ein Begräbnis. Morgen. Aber die Tote wird nicht in ihrem Sarg
liegen. Sie wird…«
Er unterbrach sich.
»Was wird sie?« drängte ich.
Er schwieg. Das Atemgeräusch war wie abgeschnitten, aber die
Verbindung blieb aufrechterhalten.
»Hallo?« rief ich.
Dannn fielen die Schüsse, gleich zwei hintereinander.
»Leslie…« drang es kaum hörbar an mein Ohr. Es war die Stimme
eines Sterbenden. Zumindest klang sie so.
Im nächsten Moment klickte es in der Leitung, dann ertönte das
Freizeichen. Ich legte auf.
»Was ist los?« fragte mich mein Freund und Kollege Milo
Tucker.
Ich spulte das Band zurück und ließ es mit eingestelltem
Lautsprecher ablaufen. Milo hörte sich an, was geschehen war.
»Mord«, sagte er.
Ich griff nach dem Telefon und wählte eine Nummer.
»Trevellian, FBI. Gibt es eine Stelle, die zentral alle städtischen
Begräbnisse erfaßt? — Ja? — Gut. Ich muß wissen, wie viele Mädchen
und Frauen morgen begraben werden — und außerdem möchte ich
herausfinden, welche der Toten mit Zu- oder Vornamen Leslie
heißt.«
Ich legte auf. »Du mußt die Kollegen von der Kriminalpolizei
benachrichtigen«, sagte Milo. »Dieser Fall betrifft uns
nicht.«
»Doch«, sagte ich. »Der Unbekannte hat ausdrücklich mich
verlangt. Ich fühle mich für das Geschehen
mitverantwortlich.«
Milo stülpte die Unterlippe nach vorn. »Warum sollte jemand
eine Tote stehlen?« fragte er.
»Ich weiß es nicht. Im übrigen hat er nur gesagt, daß sie
nicht in ihrem Sarg liegen wird.«
»Soll das heißen, daß sie gar nicht tot ist — und daß es
jemand darauf anlegt, den Tod zu simulieren? Das würde auf einen
Versicherungsbetrug hinweisen.«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte ich. »Das Ganze kann ein Scherz
sein«, meinte Milo. »Das würde nicht zum erstenmal passieren. Ein
paar Halbwüchsige spielen Mord. Wahrscheinlich liegen sie jetzt auf
dem Boden und krümmen sich vor Lachen.«
»Schon möglich.«
»Hm«, meinte Milo, irritiert von meinem ernsten
Gesichtsausdruck. »Manche mögen’s spannend. Du gehörst dazu.«
»Ich und der Mörder«, sagte ich.
»Laß das Band noch einmal ablaufen«, bat er.
Ich tat ihm den Gefallen. Milo runzelte die Augenbrauen und
schüttelte den Kopf.
»Das laute Atmen ist gespielt«, meinte er. »Es wirkt
aufgesetzt, forciert. Ich halte das Ganze für einen geschmacklosen
Halbstarkenscherz.«
Das Telefon klingelte. Ich griff nach dem Hörer und meldete
mich.
»Der Tod hat Hochkonjunktur«, teilte mir ein Kollege mit.
»Morgen werden dreihundertvierundzwanzig Begräbnisse durchgeführt.
Nur zwei der Verblichenen heißen Leslie. Mit Vornamen.«
»Die Einzelheiten bitte«, sagte ich und griff nach meinem
Kugelschreiber.
»Leslie Stewart, siebenundsechzig, Witwe eines Müllwerkers.
Wird in Brooklyn begraben auf dem Zentralfriedhof.«
»Und die zweite?«
»Heißt Brown«, sagte er. »Leslie Brown.«
***
Ich stellte meine Lauscher hoch. Vielleicht hatte der Anrufer
sich doch nicht getarnt, vielleicht war er ein naher Verwandter der
Toten gewesen.
»Sie wurde das Opfer eines Verkehrsunfalls«, sagte der
Anrufer. »Mit zweiunddreißig. St. John’s Cemetary.«
»Danke«, sagte ich und legte auf.
Milo hatte über einen Zweithörer mitbekommen, was der
Teilnehmer gesagt hatte.
»Was nun?« wollte er wissen.
»Wir gehen zum Begräbnis. Du kümmerst dich um die
Müllwerkerswitwe, und ich sehe mir an, was mit den Browns los ist.
Es muß doch festzustellen sein, ob einer aus ihrem Clan plötzlich
verschwunden ist.«
***
Am nächsten Morgen pilgerte ich im dunklen Anzug am Ende einer
etwa zwanzig Personen umfassenden Trauergemeinde hinter einem von
sechs Männern getragenen Sarg her.
Die Hinterbliebenen waren einfache Leute mit geröteten, von
tiefem Leid gekennzeichneten Gesichtem. Niemand weinte, aber es war
zu spüren, wie tief sie das Geschehen bewegte.
Der Methodistenprediger, der mit großen Gesten und noch
größeren Worten das Leben der Verstorbenen würdigte, vermochte die
Gefühle der Anwesenden kaum anzurühren. Immerhin gab er mir
Gelegenheit, einen kurzen Überblick über das Lehen der Leslie Brown
zu gewinnen. Selbst wenn man unterstellte, daß der Prediger mit
Rücksicht auf die Hinterbliebenen gewisse positive Übertreibungen
einbaute, gab es in diesem Lebenslauf kaum einen schwachen Punkt zu
entdecken.
Leslie Brown hatte fleißig ihre Kir che besucht; sie war als
freiwillige Helferin in der Bürgeraktion »Helft kranken Kindern«
tätig gewesen und war in dem Kaufhaus, wo sie als Stenotypistin
gearbeitet hatte, sehr beliebt gewesen. Sie hinterläßt außer ihren
Eltern noch einen Bruder, der mit gesenktem Kopf und zuckendem Mund
dem ausgehobenen Grab am nächsten stand.
Der Unfall, dessen Opfer das Mädchen geworden war, hatte noch
zwei weitere Opfer gekostet und war durch die brechende Achse eines
Sattelschleppers verursacht worden.
Ich musterte verstohlen die Gesichter der Anwesenden. Es war
nicht schwer, die Familie von den Trauergästen zu trennen. Ein paar
junge Mädchen — offenbar Leslies Kolleginnen — sahen genauso
bedrückt aus wie die Familie selbst.
Es war praktisch nicht vorstellbar, daß diese einfachen Leute
in irgendeinen Zusammenhang mit einem Verbrechen ge bracht werden
konnten, aber natürlich wäre es falsch gewesen, sich nur nach dem
Augenschein zu orientieren.
Nach dem Begräbnis nahm ich einen der Sargträger beiseite. Er
war ziemlich erstaunt, als ich ihm meinen Ausweis präsentierte.
»Wir haben einen etwas seltsamen Anruf bekommen«, erklärte ich ihm.
»Er muß nichts zu bedeuten haben, aber wir sind verpflichtet, ihm
nachzugehen. Deshalb muß ich einige Fragen an Sie richten. Wann
haben Sie den Sarg verschlossen?«
»Schätzungsweise vor einer halben Stunde«, antwortete er.
»Nachdem die Angehörigen den Raum verlassen hatten, in dem die Tote
aufgebahrt wurde.«
»Haben Sie den Sarg unmittelbar danach ins Freie getragen?«
wollte ich wissen.
»Ja, Sir.«
»Ich hatte den Eindruck, daß Sie und Ihre Kollegen an dem Sarg
sehr schwer zu tragen hatten«, sagte ich. »Schwerer als
sonst?«
»Hm, ich hatte auch das Gefühl«, meinte er kopfnickend, »aber
das hat nichts zu sagen. Es kommt ganz darauf an, wer den Sarg
liefert. Es gibt Firmen, die zimmern die Kästen noch nach alter
Väter Sitte — aus soliden Holzbohlen —, während andere mit
Kunststoff und Spanplatten arbeiten. Die Toten selbst wiegen selten
viel.«
»Haben Sie die Tote genau angesehen?«
»Da war nicht viel zu sehen«, meinte er. »Sie hat bei dem
Unfall starke Kopfverletzungen erlitten — fast der ganze Kopf war
bandagiert.«
»Danke«, sagte ich.
Ich kam gerade noch zurecht, um am Friedhofsausgang
mitzuerleben, wie sich die Trauergemeinde voneinander
verabschiedete. Die Browns — die Eltern, der Sohn und ein älterer
Mann — kletterten in einen Wagen, der von Brown junior gesteuert
wurde.
Ich ließ sie wegfahren und sprach dann ein blondes, leidlich
hübsches Mädchen an. »Sie waren mit Leslie befreundet?« fragte ich
sie.
»Ja — sie war meine Arbeitskollegin.«
Das Mädchen hatte blaue, recht intelligent wirkende Augen, so
daß ich es riskieren konnte, den Anruf zu erwähnen. Nachdem ich es
getan hatte, schloß ich: »Sie werden verstehen, daß wir uns
Gedanken über die Geschichte machen. Es steht keineswegs fest, daß
Leslie Brown in irgendeinen Zusammenhang mit dem Anruf zu bringen
ist, aber die Tatsache, daß sie den gleichen Namen wie der Anrufer
hat, ist natürlich nicht zu ignorieren.«
Das Mädchen — es hieß Mary Maple — blickte mir geradewegs in
die Augen. »Ich kann mir nicht denken, daß Leslie Brown der Grund
des Anrufs gewesen ist«, sagte sie. »Nein, nicht Leslie. Sie hatte
keine Feinde. In ihrem Leben gab es keine Geheimnisse. Es ist
schlechthin absurd, sich Leslie in Verbindung mit einem Verbrechen
vorzustellen.«
»Hatte sie einen Freund?«
»Ja — er war ebenfalls auf dem Begräbnis. Der Junge mit den
weißblonden Haaren. Ihm war anzusehen, wie sehr ihn Leslies Tod
mitgenommen hat.«
»Das stimmt«, sagte ich. »Sie haben Leslie im Aufbahrungsraum
noch einmal gesehen?«
»Viel war da nicht zu sehen«, meinte das Mädchen und starrte
ins Leere. »Nur die Nase — Leslies süße, kleine Stupsnase!«
»Sie sind also sicher, daß die Tote im Sarg mit Ihrer Freundin
identisch war?«
»Ganz sicher«, meinte sie. »Eine Nase mag nicht viel sein,
wenn es darum geht, einen Menschen zu identifizieren — aber in
diesem Fall reichte das aus.«
»Wovon leben Leslies Eltern?«
»Der Vater arbeitet als Angestellter in einem
Architekturbüro«, antwortete Mary Maple. »Die Mutter ist Hausfrau.
Ich war schon einigemal ihr Gast. Es sind sehr fromme, liebe
Menschen.«
»Und der Bruder?«
»Der wohnt nicht in New York. Er ist nur wegen des
Begräbnisses hergekommen.«
»Was tut er beruflich?«
»Er ist Landvermesser oder so was Ähnliches. Genau weiß ich es
nicht. Leslie hing sehr an ihm und hat mir gegenüber oft bedauert,
daß er wegen seiner Berufsausbildung nicht mehr bei der Familie
sein konnte.«
»Kennen Sie die Einzelheiten des Unfalls?«
»Sicher«, meinte das Mädchen. »Leslie saß im Wagen unseres
Abteilungsleiters. Er wohnte ganz in Leslies Nähe und nahm sie
abends oft mit nach Hause — zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls
im Kaufhaus arbeitete. Bei dem Unfall sind alle drei ums Leben
gekommen.«
»Danke«, sagte ich, verabschiedete mich und fuhr zurück ins
District Office. Milo war bereits da.
»Fehlanzeige bei den Stewarts«, sagte er. »Das sind ganz
schlichte Leute. Alles in allem waren es nur Neun, die an dem
Begräbnis teilnahmen. Ich habe mir die Frau angesehen. Aufgebahrt,
meine ich. Sie ist ordnungsgemäß unter die Erde gekommen.«
»Das scheint auch auf Leslie Brown zuzutreffen«, sagte ich und
massierte mir das Kinn. Dann berichtete ich Milo, was ich gesehen
und gehört hatte.
»Na bitte«, schnaufte er. »Ich wußte doch gleich, daß sich
jemand einen Witz mit uns erlaubt hat.«
Ich lehnte mich zurück und blickte ihn an. »Die Nase und die
Bandagen — darüber komme ich nicht hinweg.«
»Was willst du damit sagen?«
Ich beugte mich nach vorn. »Setzen wir einmal den Fall, jemand
brauchte einen Sarg und ein normales Begräbnis, um etwas
verschwinden zu lassen…«
»Einen Menschen, meinst du?« unterbrach mich Milo.
»Vielleicht einen Menschen«, bestätigte ich schulterzuckend,
»vielleicht etwas anderes. Dieser Jemand, den wir mit X bezeichnen
wollen, hält also Ausschau nach einer passenden Gelegenheit. Wofür
entscheidet er sich? Natürlich für einen Toten, dessen Gesicht sich
leicht rekonstruieren läßt. Aus Wachs, meine ich. In diesem Falle
hier brauchte nur die Nase nachgebildet zu werden.«
»Du glaubst, daß sich darunter ein anderer Mensch befinden
könnte?« fragte Milo.
»Das wäre doch nicht auszuschließen.«
»Ich weiß nicht, was du mit diesen Hypothesen zu beweisen
versuchst. Beide Begräbnisse waren offenkundig in Ordnung, es waren
Demonstrationen echter Trauer, die Hinterbliebenen waren einfache,
bürgerliche Leute. Willst du wegen eines vagen, recht konstruiert
wirkenden Verdachtes die Ruhe der Toten stören?«
»Nein. Was ich weiß und denke, reicht nicht aus, um eine
Öffnung der Gräber zu rechtfertigen. Aber…«
Ich stand auf. »Ich fahre noch einmal zum Friedhof. Vielleicht
ist das Grab noch offen.«
»Du bist verrückt, wenn du dir wegen dieses idiotischen Anrufs
irgendwelchen Ärger einhandeltest.«
»Es muß auch Verrückte geben«, sagte ich und marschierte aus
dem Office.
Als ich mich etwa eine Stunde später über den Friedhof
bewegte, lag ein Hauch von Herbst in der Luft. Die ersten braunen
Blätter tanzten raschelnd über die Kieswege, und die Trauerweiden
zeigten ein melancholisch stimmendes Gelb. Melancholisch wirkte
auch die junge verschleierte Frau, die sich etwa zwanzig Schritte
vor mir bewegte und hin und wieder stehenblieb, um die
Gräberinschriften zu studieren.
Ich drosselte mein Tempo, weil ich plötzlich fand, daß die
junge Frau meine Aufmerksamkeit verdiente. Ich vermochte nicht auf
Anhieb zu sagen, wie sich die Reaktion erklärte. Eine verschleierte
Witwe war auf einem Friedhof gewiß nichts Ungewöhnliches. Aber
schon wenige Sekunden später wußte ich, was mich störte oder doch
zumindest irritierte.
Die Art, wie sie sich auf ihren langen rassigen Beinen
bewegte, hatte etwas herausfordernd Weibliches, ein erotisches
Fluidum, das einen krassen Gegensatz zu ihrer Trauerkleidung
bildete. Und da war noch etwas. Verschleierte Witwen dieses Alters
hatten einen gewissen Seltenheitswert, sie gehörten bis zu einem
gewissen Grad der Vergangenheit an. Die Jugend — und dazu gehörte
diese Frau noch — fühlte sich nicht länger verpflichtet, ihre
Trauer auf so antiquierte Weise zu zeigen.
Kurz und gut: Irgend etwas an der Verschleierten fesselte
meine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich wäre sie mir am anderen Ende
des Friedhofes nicht aufgefallen, aber hier, in Blickweite von
Leslie Browns Grab, behielt ich sie im Auge.
Sie setzte sich auf eine Bank, die etwas erhöht unter einer
Trauerweide stand. Von ihrem Platz aus konnte sie das etwa dreißig
Yard entfernte Grab von Leslie Brown prächtig übersehen. Zwei
Männer mit Schaufeln tauchten auf und fingen an, das Grab
zuzuschütten. Ich war stehengeblieben, dicht neben einem über
mannshohen Grabmal, das mir Deckung bot. Die verschleierte Frau
wandte mir ihren Rücken zu.
Sekunden später griff sie in ihre lederne Umhängetasche und
machte eine Aufnahme von den schaufelnden Männern. Ich sah, daß
ihre Spiegelreflexkamera mit einem Teleobjektiv ausgerüstet war.
Sie packte die Kamera in die Tasche zurück, wartete etwa zehn
Minuten, dann schoß sie ein weiteres Bild.
Die junge Frau blickte nur ein einziges Mal über ihre
Schulter, um festzustellen, ob jemand in ihrer Nähe war. Ich konnte
gerade noch rechtzeitig in Deckung gehen.
Sie wartete, bis die Männer ihre Arbeit beendet und die Blumen
auf das geschlossene Grab gehäuft hatten, dann stand sie auf, schoß
ein letztes Bild und wandte sich zum Gehen.
Ich trat hinter das Grabmal und wartete, bis sich ihre
Schritte auf dem knirschenden Kies entfernt hatten. Dann folgte ich
ihr zum Ausgang. Sie kletterte in ein Taxi und fuhr davon. Ich
hatte keine Mühe, mit meinem Jaguar Anschluß zu halten.
Das Taxi stoppte mitten in Manhattan vor einem Kaufhaus in der
47. Straße. Als die junge Frau den Fahrer entlohnte, hatte sie
ihren Schleier hochgeschlagen, und ich sah deutlich ihr klares,
sehr aufregend modelliertes Profil. Ich schätzte das Mädchen auf
vierundzwanzig. Es wirkte ernst, aber von der Trauer, die mich bei
Leslie Browns Hinterbliebenen beeindruckt hatte, konnte ich auf den
Gesichtszügen der jungen Dame nichts bemerken.
Sie betrat das Kaufhaus, während ich im Schrittempo
weiterkroch und nach einem Parkplatz Ausschau hielt. Schließlich
trat ich auf die Bremse und ließ meinen Flitzer in einer
Halteverbotszone stehen. Ich sprintete über die Fahrbahn, ohne auf
das wütende Hupen einiger motorisierter Verkehrsteilnehmer zu
achten und atmete auf, als ich die junge Witwe gerade noch mit der
Rolltreppe in die obere Etage entschwinden sah.
Kurz darauf sah ich sie an einem Tresen der Fotoabteilung
stehen. Sie ließ sich den Film aus der Kamera nehmen und wartete,
bis man ihr einen Quittungsstreifen ausgehändigt hatte, dann
verschwand sie in den Damentoiletten.
Ich baute mich neben einer Deckensäule auf, die es mir
ermöglichte, die Toilettentür im Auge zu behalten, und wartete.
Nach zehn Minuten wurde ich ungeduldig. Mir dämmerte, daß irgend
etwas schiefgelaufen sein mußte. Die Toilette wurde fleißig
frequentiert — aber unter denen, die sie verließen, befand sich
keine junge Frau in Witwenkleidung.
Nach weiteren fünf Minuten Wartezeit stand außer Zweifel, daß
mich die junge Dame getäuscht hatte. Ich erinnerte mich, ein
Mädchen mit rotblondem Haar und großer dunkler Sonnenbrille gesehen
zu haben. Sie hatte sich beim Verlassen der Toilette die Nase
geputzt und auf diese Weise geschickt ihr Gesicht verdeckt. Das
Mädchen war mit einem größeren Paket bewaffnet gewesen. Ich war
überzeugt davon, daß es den Scheier und die anderen Utensilien
enthalten hatte.
Ich begab mich zu dem Fotostand und winkte den Verkäufer
heran, der die Witwe bedient hatte. Ich wies mich aus und fragte:
»Auf welchen Namen wurden die Fotoarbeiten der verschleierten
jungen Dame gebucht, die Sie vor einer Viertelstunde
bedienten?«
»Brown«, antwortete er wie aus der Pistole geschossen. »Leslie
Brown.«
***
»Sie haben ein gutes Gedächtnis«, bemerkte ich lobend.
Er grinste. »Normalerweise nicht«, sagte er. »Wer kann sich
schon die vielen Namen merken? Aber bei Klassepuppen ist das
natürlich etwas anderes. Da hört man genau hin.«
»Ist Leslie Brown eine Kundin des Hauses? Liefert sie oft bei
Ihnen Fotoarbeiten ab?«
»Ich sah sie heute zum erstenmal.«
»Ich muß mit der Frau sprechen, die die Damentoiletten
betreut«, sagte ich. »Können Sie das veranlassen, bitte?«
»Ich schicke eines meiner Mädchen hinein«, nickte er. »Sie
schickt Ihnen die Alte her.«
Die Toilettenwärterin hieß Martha Henderson. Sie war klein,
dick und freundlich. Die dicken Brillengläser gaben ihr ein
eulenhaftes Aussehen. Ich sagte ihr, wer ich war und was ich wissen
wollte. Sie wußte sofort Bescheid.
»Ja, die junge Dame in Witwenkleidung. Sie war schon vor ein
paar Stunden hier. Sie gab mir fünf Dollar — dafür sollte ich ihr
das Paket aufbewahren. Ich wußte, daß sie sich auf dem Klo umziehen
wollte und fand daran nichts Besonderes. Wer will heutzutage schon
als trauernde Witwe durch die Gegend laufen?«
»Sahen Sie sie zum erstenmal?«
»Ja.«
»Was war in ihrer Brieftasche, als sie sie öffnete?«
»Eine ganze Menge Geld — fast ausschließlich große Scheine«,
erwiderte Martha Henderson.
»Befanden sich irgendwelche Initialen darauf?«
»Darauf habe ich nicht geachtet, Sir. Hat die Puppe was
angestellt? Sind Sie hinter ihr her?«
»Nein, nein«, sagte ich, »aber wir versuchen festzustellen, ob
sie zu einigen unserer Kunden Beziehungen unterhält. Versuchen Sie
sich zu erinnern, ob Ihnen an der jungen Dame etwas Besonderes
auffiel. Die Sprache. Ein Schmuckstück. Eine Bemerkung. Irgend
etwas, das uns weiterbringen könnte.«
»Hm«, meinte Martha Henderson und rückte blinzelnd an ihrer
dicken Brille herum. »Lassen Sie mich überlegen. Als sie eintraf,
war sie blond. Als sie ging, hatte sie eine rote Perücke auf. Das
ist nichts Besonderes, was? Was war’s denn noch? Ich fand sie sehr
hübsch. Auffallend hübsch sogar. Keineswegs billig. Ich würde
sagen, daß sie aus einem guten Stall stammt.«
Ich verschränkte schweigend die Arme vor meiner Brust, weil
ich sicher sein konnte, daß diese stumme Geste die gute Alte zu
weiteren Denkübungen anspornen würde.
»Mir fällt nichts mehr ein«, meinte sie gequält.
»Schon gut«, tröstete ich sie. »Sie haben mir sehr geholfen.
Sagen Sie mir nur noch etwas über die Art, wie das Mädchen
sprach.«
»Sehr fein, fast wie eine Engländerin«, meinte die Frau. »In
Brooklyn ist die bestimmt nicht groß geworden!«
»Danke«, sagte ich und ging.
Als ich auf der Straße stand, blieb ich einen Moment stehen
und überlegte. Es mußte einen Grund geben, weshalb das Mädchen sich
ausgerechnet für diese Gegend, diese Straße und dieses Kaufhaus
entschieden hatte. Entweder wohnte sie in der Nähe — oder sie hatte
hier ihren Wagen geparkt.
Mir fiel ein, daß nur hundert Schritte von dem Kaufhaus
entfernt ein, Parkhaus stand — ein Riesenkomplex mit mehr als zehn
Etagen. Ich setzte mich in meinen Jaguar und stoppte kurz darauf —
erneut verkehrswidrig — in Sichtweite der Parkhausausfahrt. Ich
hatte Glück. Keine zwei Minuten später verließ ein englischer
Roadster das Gebäude. Am Steuer saß das rotblonde Mädchen. Sie
hatte sich ein Kopftuch umgebunden, um dem Fahrtwind trotzen zu
können. Ich wartete, bis sich vier, fünf Wagen zwischen ihren und
meinen Jaguar gesetzt hatten, dann brummte ich los.
Es war leicht, den flachen dunkelgrünen Triumph im Blickfeld
zu behalten. Er hatte eine New Yorker Nummer. Ich griff nach dem
Handmikrofon meines Autosprechfunkgerätes und gab die Nummer des
Wagens an die zuständige Abteilung durch. Drei Minuten später wußte
ich, wie die Besitzerin des Fahrzeuges hieß. Es war eine Sandy
Pratt. Sie wohnte Westend Drive 181.
Genau dorthin ging die Fahrt. Das Gebäude, in dessen
Tiefgarage der Triumph verschwand, hatte eine mit Marmorplatten
beschichtete Fassade. Vor dem baldachinbewehrten Eingang
produzierte sich ein hünenhafter Portier in goldbedreßter
Phantasieuniform.
Ich zwängte meinen Flitzer in eine Parklücke, kletterte ins
Freie und bewunderte kurz darauf, mit welcher Geschicklichkeit es
der Portier fertigbrachte, meine Fünfdollarspende in seinem
Ärmelaufschlag verschwinden zu lassen. Er tat es, ohne vorher nach
meinen Wünschen zu fragen — woraus geschlossen werden konnte, daß
er ein Mann von bemerkenswert liberaler Haltung war.
»Die Pratts«, sagte ich, »sind Leute, die mich interessieren.
Was können Sie mir über die Familie sagen?«
Er schaute mich an, schwieg einige Sekunden, dann zog er meine
Fünfdollarnote aus dem .Ärmelaufschlag und gab sie mir kommentarlos
zurück.
»Was ist, wenn ich den Betrag ein wenig auf bessere?«
erkundigte ich mich.
Er starrte ins Leere, als hätte er mich nicht gehört.
»Wie heißt der Hausmeister?« fragte ich.
»Burleigh. Tom Burleigh«, grunzte der Portier.
»Danke«, sagte ich und marschierte an dem Portier vorbei in
die von einer Klimaanlage gekühlte Halle. In ihrer Mitte
plätscherte ein Springbrunnen. In seinem beleuchteten Becken
tummelten sich exotischbunte Fische.
Burleighs Wohnung lag hinter dem Fahrstuhlschacht. Ich
klingelte. Der Mann, der mir die Tür öffnete, war groß und hager.
Er hatte tiefliegende Augen und sehr markante Backenknochen.
»Mr. Burleigh?« fragte ich.
Hinter mir tauchte der Portier auf. »Ein Schnüffler, Tom«,
sagte er. »Er will was über die Pratts wissen.«
»Danke, Harry«, meinte der Hausmeister und versuchte, mir die
Tür vor der Nase zuzuschlagen. Mein prompt dazwischengestellter Fuß
vereitelte dieses Bemühen.
»Er wird keß, Harry«, stellte der Hausmeister fest.
»Wie finden wir das, Tom?«
»Sehr ärgerlich«, meinte Burleigh. »Höchst ärgerlich. Für
Leute, die Ärger machen, hegen wir keine Sympathien.«
»Nicht die geringsten, Tom«, pflichtete der Portier ihm bei
und legte seine schwere Pranke auf meine Schulter. »Stinken Sie ab,
Schnüffler«, sagte er drohend, »oder Sie laufen Gefahr, unseren
hübschen Zierfischen als Futter vorgeworfen zu werden.«
»Das ist das bemerkenswerte an diesen vornehmen Häusern«,
sagte ich. »In ihnen herrscht ein betont exklusiver Ton.«
»Ein Witzbold«, stellte Burleigh fest.
»Einer von denen, über die man weinen muß«, sagte der
Portier.
»Ich will aber nicht weinen«, meinte der Hausmeister und
starrte auf seinen Fuß. »Schon gar nicht über so einen. Sorg dafür,
daß er verschwindet.«
»Sie haben gehört, was Tom sagte«, meinte der Portier. »Er war
mal in seinen guten Tagen ein richtiger Boxer. Darf ich Ihnen einen
Rat geben? Reizen Sie ihn nicht. Immer, wenn er an diese Zeiten
erinnert wird und eine kleine Probe seines Könnens gibt, müssen wir
den Krankenwagen anrollen lassen.«
»Darf ich auch mal was sagen?« fragte ich.
»Ja«, meinte der Portier. »Good bye. Und sonst nichts.«
Ich holte schweigend meine ID-Card aus der Tasche und hielt
sie ihm unter die Nase. Seine tückisch funkelnden Augen wurden
auffallend klein.
»Was ist denn das?« schnarrte er.
»Ein Ausweis«, belehrte ich ihn mit sanfter Stimme. »Meine
Legitimation als Schnüffler.«
»Warum haben Sie nicht gleich gesagt, daß Sie ’n G-man sind?«
fragte er und begann vor Zorn oder Aufregung leicht zu
nuscheln.
Ich steckte den Ausweis ein. »Weil ich ein Menschenfreund bin
und Ihr Trinkgeldbedürfnis zu respektieren wünschte — aber es geht
natürlich auch so, ohne Kies.«
Beide Männer zeigten sich sichtlich betreten. Schließlich
räusperte sich der Hausmeister und bat mich in sein Wohnzimmer. Der
Portier kehrte auf seinen Platz zurück.
»Wissen Sie«, murmelte der Hausmeister, als wir uns in dem
mittelgroßen, durchschnittlich möblierten Raum gegenübersaßen, »wir
wollten nicht grob sein. Bestimmt nicht. Aber die Pratts sind nun
mal die Hausbesitzer — und da fühlt man sich verpflichtet, sie zu
decken.«
»Gegen wen oder was?« wollte ich wissen.
Er zuckte mit den Schultern. »Nur so. Er ist unser Boß.«
Ich versuchte mir vorzustellen, was das Haus wert war. Zehn
Mille? Oder zwanzig? Sicher war, daß es in dieser Lage und
Größenordnung ein beträchtliches Vermögen repräsentierte.
»Wie groß ist die Familie?« fragte ich.
»Sie umfaßt drei Personen. Mr. und Mrs. Pratt und die
Tochter.«
»Wovon leben die Pratts?«
»Na, hören Sie mal!« sagte er. »Mit so einem Haus in der
Tasche braucht man keinen Finger zu rühren. Wissen Sie, was der
Kasten an Mieten einbringt?«
»Nein«, sagte ich.
»Soviel ich weiß, bleiben dem Chef nach Abzug von Steuern und
Unkosten monatlich mehr als zehntausend Dollar zum Verpulvern.
Davon kann man sich einen schönen Tag machen.«
»Er muß doch einen Beruf haben.«
»Er ist Kaufmann. Er hat sogar ein eigenes Büro — ganz in der
Nähe. Eine Vermögensberatung.«
»Mit wem ist die Tochter befreundet?« erkundigte ich
mich.
»Ich glaube nicht, daß sie ’n festen Scheich hat«, meinte er.
»Ich sehe sie mal mit diesem und mal mit jenem Burschen abzischen.
Feste Absichten hat sie nicht, davon bin ich überzeugt.«
»Wie alt ist Pratt?«
»So um die Fünfzig, würde ich sagen.«
»Und seine Frau?«
»Fünfundvierzig«, meinte er und hatte ein seltsames Funkeln in
den Augen. »Sie sieht noch blendend aus.«
»Hat sie einen Freund?«
Burleighs Gesicht verschloß sich. »Davon ist mir nichts
bekannt«, antwortete er.
»Sie haben Angst, darüber zu sprechen«, stellte ich fest.
»Warum?«
»Ich werde mich hüten, meine Nase in die Intimsphäre meines
Chefs zu stecken.«
»Ist Pratt zu Hause?«
»Keine Ahnung. Ich würde eher sagen, daß Sie ihn nicht
antreffen. Er ist viel unterwegs.«
»Allein oder mit seiner Frau?«
»Meistens allein.«
»Danke«, sagte ich und stand auf.
»Die Pratts wohnen im Penthouse — auf dem Dach«, meinte
Burleigh und brachte mich zur Tür.
Ich verabschiedete mich von ihm und ging zum Fahrstuhlschacht.
Er enthielt zwei Lifts. An einem hing ein Schild mit dem Aufdruck
»Out of Order«. Nicht in Betrieb.
Ich nahm den anderen Lift. Er schwebte fast lautlos nach oben.
Dann stoppte er. Ich versuchte die Tür zu öffnen, als die Mechanik
nicht funktionierte, aber das schaffte ich nicht. Plötzlich ging
das Licht aus.
Anscheinend war auch dieser Fahrstuhl nicht in Ordnung. Ich
knipste mein Feuerzeug an und suchte das auf Hochglanz polierte
Schaltbrett nach dem Notrufknopf ab. Ich berührte ihn, aber nichts
geschah. Plötzlich hörte ich ein leises, rasch stärker werdendes
Zischen.
Ich hob das Kinn und bewegte schnuppernd die Nase. Der Geruch,
den ich wahrnahm, erinnerte an bittere Mandeln. Das traf mich wie
ein Schlag.
Gas mit Blausäuregehalt! Ich preßte mein Taschentuch vor das
Gesicht und registrierte, wie das Zischen stärker wurde. Es war ein
bösartiger, an den Nerven zerrender Ton.
Ich war von totaler Dunkelheit umgeben. Vermutlich gab es an
der Oberseite des Lifts eine Ausstiegsluke — aber wenn ich sie
erreichen wollte, mußte ich schon einen großen Sprung und einen
energischen Klimmzug riskieren, ich mußte also Dinge tun, die nicht
ohne Luft zu schaffen waren, aber gerade das wünschte ich zu
vermeiden. Ich konnte es mir nicht erlauben, tief
durchzuatmen.
Ich warf mich zu Boden. Hier unten war von dem enervierenden
Geruch noch nichts zu spüren. Ich tastete den glatten, etwas
schmierigen Linoleumboden ab und erfühlte unter dem mäßig dicken
Belag die Konturen einer Klappe.
Ich ruinierte mir fast die Fingernägel, als ich das Linoleum
wegzuzerren versuchte. Es ging nicht. Es war an den Seiten von
einer solide verschraubten Metalleiste überdeckt.
Plötzlich merkte ich, daß es aus war.
Ich begann zu schweben. Zumindestens schien es mir so. Es war
ein Zustand, bei dem sich der Kopf vom Rest des Körpers zu trennen
schien und einen schwindelerregenden Trip in unbekannte Höhen
unternahm. Ich hatte einen ekelerregenden Geschmack auf der Zunge.
Im nächsten Moment kippte ich nach vorn. Ich wollte schreien, ich
wollte aufspringen, ich wollte hundert Dinge gleichzeitig tun —
aber statt dessen registrierte ich nur mit schwindenden Sinnen, daß
ich keine Kraft mehr hatte. Ich ging auf Tauchstation.
***
Mein Bewußtsein kehrte nur langsam zurück. Ich hatte Mühe,
mich zu konzentrieren. Ich wußte nur, daß sich irgend etwas in mir
dagegen wehrte, die bleischweren Lider zu heben.
Schlafen. Ruhen. Alles andere war unwichtig.
Aber es ging nicht. Ich spürte, daß ich in einem Wagen saß, in
einem fahrenden Auto. Dann war, schlagartig, noch eine Erkenntnis
da. Ich hielt mit den Händen ein Steuer umfaßt.
Ich riß die Augen auf, ich versuchte es jedenfalls, obwohl ich
das Gefühl hatte, trotz meines heftigen Erschreckens wie in einem
häßlichen Traum zu reagieren — im Zeitlupentempo.
Im nächsten Moment starrte ich durch die Windschutzscheibe
eines rollenden Wagens auf das schnurgerade Band einer im grellen
Sonnenlicht liegenden Betonstraße.
Der Wagen beschleunigte sein Tempo. Ich blickte nach unten.
Mein Fuß stand neben dem Gaspedal. Ich war völlig durcheinander.
Ich wandte den Kopf, dann blickte ich über meine Schulter.
Ich saß allein in dem Wagen.
In wessen Wagen? Das Instrumentenbrett machte mir klar, daß es
sich um einen 68er Fairlane handelte. Die Polster waren schmutzig;
der ganze Wagen machte einen ungepflegten, verrotteten
Eindruck.
Ich starrte wieder nach vorn. Ein kurzer Blick auf die
Tachonadel belehrte mich, daß der Wagen seine Geschwindigkeit auf
dreißig Meilen erhöht hatte.
Was war das für eine Straße? Weshalb war sie wie leergefegt,
und wo endete sie?
Ich hatte das Gefühl, daß die Straße auf einem Hochplateau
lag. Links und rechts von ihr zerrte der Wind an hohen Gräsern und
niedrigen Büschen. Meerlandschaft, dachte ich.
Als ich den linken Fuß bewegte, schien es mir so, als sei er
mit Blei gefüllt. Ich trat auf die Bremse. Der Hebel gab nach, er
ließ sich bis zum Bodenbrett durchtreten, aber der Wagen reagierte
nicht darauf. Er rollte weiter.
Ich schluckte. Im Schloß steckte kein Zündschlüssel! Ich
versuchte die Lenkung zu bewegen. Sie ließ sich nicht
beeinflussen.
Ich begann zu schwitzen. Was hatte das alles zu bedeuten?
Träumte ich — oder war dieser Alpdruck bestürzende Wirklichkeit?
Ich saß in einem Geisterauto, das über eine Geisterstrecke glitt,
ohne zu wissen, wer uns steuerte.
Durch einen Schlitz des Fensters drang frische Luft ins
Wageninnere. Sie roch salzig.
Das Meer!
Plötzlich wußte ich, woher der Eindruck entstand, daß der
Wagen über ein Hochplateau glitt. Er rollte geradewegs auf die
Klippen zu. Irgendwo vor mir mußte die Straße einen scharfen Knick
machen, denn es war nicht zu erwarten, daß sie an einem Steilufer
endete.
Der salzige Duft erinnerte mich vage an einen anderen Geruch.
Bittere Mandeln. Mit einem Schlag kehrte meine Erinnerung zurück.
Der Besuch im Hause der Pratts. Die Fahrt im Lift. Das häßliche
Zischen. Und dann die Ohnmaoht.
Erst jetzt wurde mir klar, was mich erwartete.
Ich zerrte an dem Öffnungsmechanismus des Wagenschlags. Es war
wie mit der Bremse. Meinen Bemühungen blieb der angestrebte Erfolg
versagt; die Tür blieb geschlossen. Ich rutschte auf die
Beifahrerseite und probierte dort mein Glück. Umsonst.
Ich hatte längst begriffen, daß ich den Kurs des
ferngesteuerten Wagens nicht beeinflussen konnte. Mir war auch
klar, daß ich mein rollendes Gefängnis schnellstens verlassen
mußte, wenn ich nicht Gefahr laufen wollte, mit ihm am Fuße der
Klippen zu zerschellen. Daneben gab es noch andere, nicht zu Ende
gedachte Überlegungen. Die Frage zum Beispiel, welchen Sinn dieses
endlose, glatte Betonband hatte, diese Straße, die ins Nichts zu
führen schien, obwohl ich wußte oder zu wissen glaubte, daß sie
mitten in der Hölle endete. Es war doch nicht anzunehmen, daß man
sich meinetwegen — oder anderer Gegner wegen — die Mühe gemacht
hatte, unter gewaltigem Unkostenaufwand eine solche Straße zu
bauen!
Ich schwang mich über die Vordersitze in den Fond und rüttelte
an den hinteren Türen. Sie gaben nicht nach.
Die Fenster? Ich winkelte einen Ellenbogen an und ließ ihn mit
voller Wucht gegen das dicke Sicherheitsglas krachen. Ein scharfer
Schmerz durchzuckte meinen Arm. Das Glas blieb von meiner Attacke
praktisch unberührt.
Ich blickte erneut durch die Windschutzscheibe.
Ich sah das Ende der Straße ganz deutlich. Wir rasten
geradewegs darauf zu.
Ich sah noch mehr. Das Straßenende war von Schranken und
Warnsignalen markiert gewesen. Irgend jemand hatte sie beiseite
geräumt. Sie lagen links und rechts auf dem Boden.
Außerdem sah ich, daß jenseits der v Betondecke nur noch
dreißig oder vierzig Yard glatter, felsiger Boden lag — dann kam
das Nichts, der Sturz, der Tod.
Das glitzernde Meer blendete meine Augen. Es schien fast so,
als wollte es mich betäuben und anlocken. Ich warf mich mit aller
Gewalt gegen die Tür. Wieder und wieder — aber ich war außerstande,
sie zu öffnen.
Im nächsten Moment war es soweit. Die trampelnden Räder
rollten über Fels- und Sandboden. Der Abgrund kam näher, das weite,
von Lichtreflexen übersäte Meer schien seine Arme auszubreiten, um
mich aufzunehmen.
Der Wagen schoß in voller Fahrt über den Abgrund hinaus. Ich
flog nach vorn und sah den tief unter mir liegenden, von tosenden
Wellen umspülten und umgischteten Klippenboden, eine Landschaft aus
bizarr aufragenden Felsbrocken und kochendem, schäumendem
Meerwasser.
Alle Anstrengungen waren vergebens gewesen. Jetzt konnte ich
nur noch hoffen, daß das Ende rasch und glimpflich verlaufen würde.
Das heulende Pfeifen, das der Sturz an Fenstern und Karosserie
verursachte, war das letzte Geräusch, das ich bewußt wahrnahm. Was
dann kam, war kein Geräusch mehr. Es war ein Inferno von sehr
unterschiedlichen Wahrnehmungen.
Es begann mit dem grellen Lichtblitz, der sämtliche Eindrücke
wie in einem Atommeiler zu verschmelzen schien, dann kam der
heftige Schmerz, dann das Rauschen, das Brausen, das Gurgeln.
Ich machte instinktiv Schwimmbewegungen und hielt die Augen
weit offen. Über mir war hinter einem Vorhang aus dunkelgrünem Glas
strahlendes Leuchten. Auf meinen Ohren lag ein heftiger Druck. Ich
ruderte verzweifelt mit Armen und Beinen, wobei ich merkte, daß
mein linker Arm nur mühsam reagierte — aber ich machte weiter, weil
ich begriff, daß es um mein Leben ging. Das Leuchten wurde stärker,
das Grün verblaßte.
Sekunden später stieß mein Kopf über die Wasseroberfläche. Ich
schnappte nach Luft. Das Ufer war nur knapp dreißig Yard von mir
entfernt. Ein Brecher deckte mich zu. Ich mußte mich erneut nach
oben kämpfen.
Der Sog, der an meinen Beinen zerrte, war von unerhörter
Kraft. Zuweilen trug mich eine Welle zurück. Aber ich lebte. Ich
war — bis auf irgend etwas, das mit meinem linken Arm nicht stimmte
— dem Sturz und seinen Folgen entronnen. Der Aufschlag, so schien
es, hatte die Türen gesprengt und mich wie einen Sektpfropfen aus
der Flasche in das Meer katapultiert.
Von dem Wagen war nichts zu sehen. Vermutlich war er irgendwo
zwischen den dem Ufer vorgelagerten Felsbrocken auf den Grund
gesackt.
Ich brauchte fast zehn Minuten, um den schmalen, nur zwei bis
drei Yard breiten Uferstreifen zu erreichen. Der felsige,
klatschnasse Boden bot keinen nennenswerten Schutz. Ich mußte mich
mit beiden Händen festhalten, um von den Brechern nicht ins Meer
zurückgeholt zu werden.
Ich war völlig groggy und fragte mich, ob meine Gegner das
Ufer und das kochende Meer mit ihren Blicken absuchten, um
festzustellen, ob ihr Anschlag geglückt war. Im Grunde konnten sie
darauf verzichten. Es war ein Wunder, daß ich den Sturz in die
Tiefe überlebt hatte.
Der Schmerz in meinem linken Arm nahm zu. Offenbar eine
Zerrung. Ich schloß die Augen und verkrallte meine Hände in den
Felsen, als mich erneut ein Brecher überspülte. Ich schnappte nach
Luft und blickte in die Höhe.
Die schroffe, etwa siebzehn bis zwanzig Yard auf steigende
Felswand bot nicht genügend Halt, um sie zu erklettern. Ich
arbeitete mich an dem Ufer-Streifen entlang vorwärts, um eine
Stelle zu finden, die für den Aufstieg geeigneter war. Hin und
wieder wurde der Streifen so schmal, daß ich schwimmen mußte, um
voranzukommen.
Es dauerte fast eine Stunde, bis ich eine solche Stelle
entdeckte, und es dauerte weitere zwanzig Minuten, bis ich es
schaffte, aus dem Wirkungsbereich der Brecher herauszukommen. Ich
legte mich auf einen Felsvorsprung in die Sonne und streckte alle
Viere von mir, um mich zu erholen.
Dann, einige Minuten später, setzte ich den Aufstieg fort. Als
ich meinen Kopf über den oberen Klippenrand schob, war weit und
breit kein Mensch zu sehen. Ich schwang mich hoch, richtete mich
auf und holte tief Luft.
Ich ging zurück zur Straße. Sie mußte in umgekehrter Richtung
irgendwo enden, es mußte eine Verbindung zum Highway oder zu einer
Zufahrtsstraße geben.
Ich grinste bitter, als ich sah, daß die Unbekannten die
Warnschilder am Ende der Betonstraße wieder aufgerichtet und eine
rot-weiß markierte Holzbarriere quer über das gefährliche
Straßenende gelegt hatten.
Ich fa.nd erst jetzt Zeit und Gelegenheit, meine Taschen
abzuklopfen. Sie waren leer. In meinen Schuhen quatschte das
Wasser. Ich zog sie mitsamt den Socken aus, hängte sie an den
verknoteten Schnürsenkeln über meinen Rücken und marschierte barfuß
über den heißen Beton.
Die Armbanduhr hatten sie mir gelassen. Es war dreizehn
Uhr.
Ich konnte mir leicht errechnen, wie lange ich bewußtlos
gewesen war und kam zu dem naheliegenden Schluß, daß man mit
einigen Spritzen nachgeholfen hatte, um diesen Zustand zu
verlängern.
Es war verrückt und scheinbar unlösbar, zwischen der biederen
Familie Brown, dem Begräbnis ihrer Tochter und meiner jetzigen
Situation einen Zusammenhang herstellen zu wollen, aber die
Geschehnisse zeigten, daß es eine solche Verbindung geben
mußte.
Die Browns.
Die Pratts.
Und ich.
Ich verließ die Betonpiste, weil meine Füße die Hitze nicht
aushielten, und trabte durch den nicht viel angenehmer wirkenden
Sand. Die Hitze, die zitternd über dem Land lag, machte es nahezu
unmöglich, weiter als wenige Meilen zu blicken.
Weit in der Ferne stieg eine graue Hügelkette in den wolkenlos
blauen Himmel — aber was dazwischenlag, verbarg sich hinter diesem
dichten, schmerzhaft monotonen Geflimmer.
Ich suchte beide Seiten der Betonstraße mit prüfenden Blicken
ab. Irgendwo in dieser Gegend hatte man mich, noch bewußtlos, in
den Fairlane gesetzt, irgendwo am Rande der Straße hatten die Leute
gestanden, die entschlossen gewesen waren, mich ins Jenseits zu
befördern.
Sie mußten Spuren hinterlassen haben. Die Reifenabdrücke ihrer
Wagen. Zigarettenkippen. Irgend etwas…
Aber ich fand nichts.
Vermutlich waren sie mit ihren Fahrzeugen auf der Betonpiste
geblieben. Der Wind hatte das wenige verweht, das möglicherweise
von ihnen zurückgeblieben war — und auf trockenem Beton zeigen sich
keine Reifenspuren.
Ich brauchte eine halbe Stunde, um das Ende der Straße zu
erreichen. Es lag mitten in einer flachen, tristen Landschaft —
ohne erkennbare Verbindung zu einer anderen Straße.
Es lag auf der Hand, daß die Erbauer der Geisterstrecke an
eine solche Verbindung gedacht haben mußten. Also setzte ich meinen
Weg in Verlängerung der Straße fort — und jetzt stieß ich auch auf
deutliche Reifenspuren. Aber der weiche Sandboden machte es schwer,
das Profil auszumachen. Immerhin ließ sich feststellen, daß hier
zwei Wagen, nein, sogar drei gefahren waren. Zwei auf der Hinfährt,
einer auf der Rückfahrt.
Nach einem Fußmarsch von weiteren zehn Minuten gelangte ich an
einen Highway. Ich setzte mich auf einen Meilenstein. Trotz der
Hitze — oder gerade deswegen — waren meine Klamotten immer noch
naß. Ich hatte unterwegs eine Menge Schweiß verloren. Ein Wagen
rollte heran. Ich erhob mich und winkte. Der Fahrer verlangsamte
sein Tempo. Darin, als er mich aus der Nähe sah, gab er plötzlich
Gas und fuhr weiter.
Ich konnte ihm sein Mißtrauen nicht verübeln. In meiner vom
Salzwasser völlig verbeulten und deformierten Kluft sah ich nicht
gerade vertrauenerweckend aus.
Erst der dritte Wagen stoppte — ein klappriger
Bedford-Pritschenwagen, in dessen Fahrerhaus ein älterer Mann mit
Strohhut saß. Er trug einen verblichenen blauen Overall und machte
den Eindruck eines Farmers. Er musterte mich aus sehr hellen,
blauen Augen und kaute dabei seinen Tabak.
»Wie kommen Sie denn in diese Gegend?« fragte er.
Ich wies mit dem Kopf zum Meer. »Ich habe ein kleines Bad
genommen.«
»Sie hätten eine Badehose mitnehmen sollen«, spottete er und
fuhr los.
»Offengestanden wollte ich gar nicht schwimmen gehen — aber
ich wurde dazu gezwungen.«
»Wollen Sie damit sagen, daß Sie jemand in den Tümpel gestoßen
hat?«
»Genau das. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich beim
nächsten Sheriff absetzen könnten. Selbstverständlich bekommen Sie
Ihre Unkosten ersetzt.«
»Okay«, sagte er. »Fahren wir zum alten Jimmy. Aber
versprechen Sie sich nicht zuviel von ihm. Er wird immer ein
bißchen sauer, wenn man ihn beim Schachspiel stört.«
»Vielleicht haben wir Glück, und er frönt gerade einer anderen
Leidenschaft«, sagte ich.
»Nicht Jimmy. Der spielt bloß Schach. Ein Wunder, daß sie ihn
immer wieder wählen. Wahrscheinlich imponiert es ihnen, daß niemand
in der Lage ist, ihn zu schlagen. Sie halten ihn für einen
Champion.’ Dabei hatte er noch niemals Gelegenheit, sich mit einem
wirklichen Könner zu messen. Die Leute von Cutler sind doch
allesamt Stümper. Er spielt immer wieder mit den gleichen
Versagern.«
»Cutler?« fragte ich.
»Yes, Sir. Cutler im schönen Staate Maine!«
»Wie weit sind wir von New York entfernt?«
»Ach, du meine Güte! New York liegt für mich auf einem anderen
Stern. Gut vierhundert Meilen von Cutler entfernt.«
»Befindet sich irgendwo in der Nähe ein Flugplatz?«
»Sicher«, sagte er. »Der Aero-Club am Nordende des
Ortes.«
»Welche Bewandtnis hat es mit der Betonstraße?« erkundigte ich
mich.
»Das ist keine Straße«, machte er mir klar. »Es ist eine
Piste. Eine Start- und Landebahn. Stammt noch aus dem Krieg. Damals
lag eine Marinefliegerabteilung in Cutler. Die Jungens wurden hier
ausgebildet.«
Vor uns tauchten einige Hinweisschilder auf, dann geriet
Cutler in unser Blickfeld — eine typische amerikanische Middle Town
mit einer schnurgeraden Main Street und einem silbern in der Sonne
glänzenden Wasserturm.
»Wie sieht es mit Ihren Unkosten aus?« fragte ich meinen
Begleiter.
»Vergessen Sie’s«, sagte er. »Ich muß sowieso am Sheriffs
Office vorbei.«
Eine Minute später lernte ich den Sheriff kennen. Er war ein
behäbig wirkender Koloß von etwa fünfzig Jahren. Er hatte ein
glattrasiertes Gesicht und trug eine randlose Brille, die den
Eindruck erweckte, als habe er sie von einem Kind geborgt. Auf
seinem Gesicht wirkte sie viel zu klein.
Übrigens traf ich ihn keineswegs beim Schachspiel an. Er saß
in seinem Office mit hochgelegten Beinen am Schreibtisch und las
eine Zeitung. Als ich mich ihm näherte, legte er die Zeitung ohne
Eile aus der Hand. Seine Füße mit den durchgelaufenen Schuhen ließ
er auf der Platte liegen — sie erinnerten mich an die Werbung einer
bekannten Zigarettenmarke. Meine eigenen Schuhe hatte ich
inzwischen wieder angezogen. Weder sie noch ich waren bislang
trocken geworden.
»Trevellian«, sagte ich.
»Burns«, meinte er und musterte mich aus schmal werdenden
Augen. »Jim Burns.«
»Ich bin Special Agent des FBI, New York«, erklärte ich ihm
und wies auf das Telefon. »Rufen Sie das District Office an, bitte.
Ich muß mich telefonisch ausweisen.«
»Sie hatten Ärger?«
»So kann man es nennen. Ich bin von ein paar Leuten in einen
ausrangierten Fairlane gesetzt und mitsamt dem Schlitten ins Meer
befördert worden.«
»Wo ist das geschehen?«
»Am Ende der Geisterpiste«, sagte ich.
»Setzen Sie sich«, meinte er. »Soll ich Ihnen trockene Sachen
besorgen?«
»Wenn Sie erlauben, ziehe ich mein Jackett und das Hemd aus«,
sagte ich.
Er erhob sich. »Ich bringe Ihnen etwas.«
Er ging hinaus und kehrte mit einem Handtuch und einem
buntkarierten Hemd zurück.
»Mehr habe ich nicht hier«, sagte er, »aber ich kann Ihnen
etwas Passendes besorgen. Mein Bruder hat ungefähr Ihre
Figur.«
»Danke«, sagte ich. »Würden Sie jetzt bitte eine Verbindung
mit New York herstellen?«
»Sicher«, nickte er. »Mach’ ich.«
Drei Minuten später hatte ich Milo an der Strippe. »Mann! Wir
sind bereits in heller Aufregung«, meinte er, als ich mich meldete.
»Wo steckst du?«
»In Cutler, Maine.«
»Wie kommst du denn dorthin, um Himmels willen?«
»Vermutlich per Flugzeug. Ich selbst habe davon nichts
mitgekriegt«, sagte ich. »Würdest du dem Sheriff bitte bestätigen,
wer ich bin? Die Burschen haben mich um meine Brieftasche
erleichtert.«
Ich streckte Burns den Hörer hin. Er wechselte einige Worte
mit Milo und gab mir den Hörer zurück.
»Ich muß jetzt hier einiges klären«, sagte ich. »Ich versuche
auf schnellstem Wege zurückzukommen.«
»Moment«, sagte er. »Was ist geschehen?«
»Bei einem Besuch am Westend Drive wurde mir eine Ladung
betäubendes Gas verpaßt. Als ich erwachte, rollte ich in einem
ferngesteuerten Wagen auf das Meer zu. Ich versuchte mich zu
befreien, aber das klappte nicht. Dann flog ich mitsamt dem Kasten
etwa zwanzig Yard tief über eine Klippe ins Meer. Es ist fast ein
Wunder, daß ich den Aufprall überlebte.«
»Ich hatte bereits zwei Anrufe von Leuten, die dich sprechen
wollten und ihren Namen nicht nannten. Ob die nur mal auf den Busch
zu klopfen versuchten, ob es dich noch gibt?«
»Für die bin ich erst mal tot — kapiert? Ich möchte mir nicht
die Freude nehmen lassen, ihnen persönlich gegenüberzutreten«,
sagte ich.
»Was kann ich inzwischen unternehmen?«
»Nichts«, sagte ich und legte auf.
»Das ist ja phantastisch«, murmelte Burns, der sich wieder
gesetzt hatte.
»Was ist mit dem Flugplatz am Nordrand des Ortes?« fragte ich
ihn.
»Das ist eine private Institution«, meinte er. »Ein reiner
Klubplatz mit Rasenpiste.«
»Wer tut dort tagsüber Dienst?«
»Terry Kane, der Mechaniker. Er ist so was wie Mädchen für
alles«, sagte der Sheriff.
»Versuchen Sie ihn telefonisch zu erreichen, bitte. Ich muß
wissen, welche Maschinen heute gelandet und gestartet sind.«
»Wenn ich ihn an die Strippe bekomme, sprechen Sie am besten
selbst mit Terry«, sagte der Sheriff und kurbelte eine Nummer
herunter. Er wartete einige Sekunden, dann rief er: »Hallo, Terry!
Ich habe Besuch hier. FBI, New York. Ein Mr. Trevellian. Ich
möchte, daß du ihm die Auskünfte gibst, die er braucht. Moment —
hier ist er.«
»Kane«, meldete sich eine brummige Männerstimme am anderen
Leitungsende.
»Trevellian. Ich wüßte gern, welche Maschinen heute bei Ihnen
gelandet und gestartet sind.«
»Nur die von Derek. Von Derek Gloystone, meine ich.«
»Wer ist das?«
»Ein Farmer. Er hat seine Felder mal wieder mit irgendeinem
Unkrautvernichtungsmittel besprüht.«
»Was war gestern los?«
»Nichts«, sagte Kane. »Kein Start, keine Landung.«
»Haben Sie fremde Maschinen in der Gegend gesichtet?«
»Nein, Sir.«
»Danke«, sagte ich und legte auf.
»Fehlanzeige?« fragte Burns.
»Ist dieser Kane in Ordnung?«
»Wie meinen Sie das? Ich halte ihn für ehrlich. Was er sagt,
stimmt«, meinte Burns. »Ich spiele manchmal Schach mit ihm. Spielen
Sie auch?«
»Ja«, sagte ich. »Ich bin darauf spezialisiert, meine Gegner
mattzusetzen — aber das schaffe ich nur, wenn die Regeln
respektiert werden. Ist Kane ein Mann, der sich an sie hält? Oder
würden Sie es für möglich halten, daß er bestechlich ist?«
»Wer sollte ihn bestechen — und weshalb?«
»Es könnte immerhin sein, daß er die Landung und den Start
einer fremden Maschine verschweigt.«
»Das kann er sich nicht leisten«, meinte der Sheriff. »Der
Flugplatz liegt in Sichtweite der letzten Häuser. Sie brauchten nur
dort herumzufragen, um herauszukriegen, ob Kanes Angaben stimmen.
Im übrigen wäre ein fremdes Flugzeug nicht auf den Klubplatz
angewiesen. Es könnte mühelos auf der Piste draußen am Meer landen
und starten.«
»An der Piste waren die Burschen mit einem Wagen. Ich habe die
Spuren gesehen.«
»Wenn Ihre Gegner mit einem Flugzeug gelandet sind, muß das
nicht unbedingt in Cutler geschehen sein. Es gibt eine Reihe
kleinerer Privatflugplätze in der Gegend. Im übrigen ist es für
eine Sportmaschine nicht allzuschwer, irgendwo auf dem flachen Land
runterzugehen.«
»Haben Sie viel Besuch aus New York?«
»Sicher«, sagte er. »Das ist ganz normal. Wir leben zu vierzig
Prozent vom Fremdenverkehr.«
»Ich muß schnellstens zurück«, erklärte ich. »Wie ist das zu
bewerkstelligen?«
»Moment«, sagte er. »Ich telefoniere mit Bangor. Wenn Sie
Glück haben, kriegen Sie von dort eine Maschine nach Portland. Der
Rest ist ein Kinderspiel.«
»Und wie komme ich nach Bangor?«
»Ich fahre Sie hin«, sagte er.
/
***
Ich erreichte New York um Mitternacht mit einer planmäßigen
Linienmaschine. Ein Taxi brachte mich nach Hause. Ich meldete mich
telefonisch im District Office und ging zu Bett, nachdem ich mich
heiß und kalt geduscht hatte. Am nächsten Morgen war ich schon sehr
früh im Office. Ich erstattete Milo und meinem Chef, Mr. John D.
McKee, ausführlich Bericht.
Gegen zehn Uhr dreißig kletterte ich vor dem Haus Westend
Drive 181 aus meinem Wagen. Ich war gespannt, wie der Portier auf
meinen Anblick reagieren würde und wurde nicht enttäuscht. Seine
Augen quollen sichtlich aus ihren Höhlungen.
»Haben Sie sich verschluckt?« erkundigte ich mich bei
ihm.
Er räusperte sich heiser. »Verschluckt, Sir?« stammelte er.
»Wieso sollte ich mich verschluckt haben?«
»Was war vorgestern mit den Fahrstühlen los?« fragte
ich.
»Mit den Fahrstühlen?« murmelte er fragend.
»Ganz recht. Einer war außer Betrieb. Der rechte.«
»Davon weiß ich nichts.«
»An ihm hing ein großes Schild mit dem Hinweis ›Out of Order‹«
sagte ich.
»Sie überraschen mich«, meinte er. »Davon ist mir nichts
bekannt.«
»Das wiederum«, sagte ich, »überrascht mich keineswegs.«
Ich ging an ihm vorbei in das Haus und fuhr mit dem Lift nach
oben, der am Vortag angeblich außer Betrieb gewesen war. Im
obersten Stockwerk glitten die Türen geräuscharm zur Seite. Eine
kunstvoll geschmiedete Gittertür versperrte den Zugang zum
Penthouse. Ich klingelte.
»Bitte?« tönte eine leicht unterkühlt klingende Männerstimme
aus dem Lautsprecher.
»Trevellian, FBI«, sagte ich nur.
Der Türsummer ertönte. Ich schwang die Tür zurück, ging ein
paar Stufen zum Dachgarten hinauf und stand vor der sich im
nächsten Moment öffnenden Tür des Penthouses. Der Butler, der mich
in die große Diele bat, wirkte so englisch wie eine Flasche
Guiness-Bier.
»Sie wünschen Miß Pratt zu sprechen, Sir?« fragte er.
»Hm, gern. Ist Mr. Pratt nicht zu Hause?«
»Er ist in seinem Büro, Sir.«
»Okay, ich unterhalte mich gern mit Miß Pratt«, sagte ich.
»Sehr gern sogar.«
Das Wohnzimmer, in das mich der Butler führte, hatte die
Ausmaße eines Kleinstadt-Ballsaals. Damit endete bereits die
Vergleichbarkeit. Alles andere war ultrasmart, elegant und teuer.
Allein die Bilder an den Wänden verkörperten ein
Millionenvermögen.
Hinter mir öffnete sich eine Tür. Ich wandte mich langsam um.
Sandy Pratt kam ins Zimmer. Sie war, fand ich, ansehenswerter als
die Millionensammlung.
Zu einer modisch geschnittenen, sehr knapp sitzenden Hose, die
in einem ungewöhnlich breiten Schlag endete, trug sie einen bunten
kurzen Pullover, der keine Mühe hatte, die Qualitäten ihrer
Oberweite herauszustellen.
Sandy wirkte jung, sportlich und selbstbewußt. Sie ging auf
mich zu und gab mir die Hand. »Hat William das richtig verstanden?«
fragte sie mit lächelndem, mildem Erstaunen. »Sie kommen vom
FBI?«
»So ist es«, bestätigte ich.
»Wollen wir uns nicht setzen?«
»Gern«, sagte ich und nahm in einem Sessel Platz, nachdem das
Girl sich auf die Couch gesetzt hatte.
»Kann ich Ihnen etwas anbieten?« fragte sie.
»Gewiß«, erwiderte ich und hielt der Blick ihrer hellen
goldfarbigen Augen fest. »Die Wahrheit.«
Sandys Lächeln vertiefte sich. »Ich habe keinen Grund, sie zu
verschweigen. Welchem Umstand verdanke ich die Ehre Ihres Besuches
— oder gilt er gar nicht mir?«
»O doch«, sagte ich. »Allerdings werde ich mich auch noch mit
Ihren Eltern unterhalten müssen. Wie ich hörte, sind sie die
Besitzer dieses Hauses.«
»Ja.«
»Haben Sie übrigens die Fotos schon abgeholt?«
»Welche Fotos?«
»Die Bilder, die Sie auf dem Friedhof knipsten.«
Sandy Pratt hob verdutzt die Augenbrauen. »Wie bitte?«
»Vorgestern«, sagte ich geduldig. »Auf dem St. John’s
Cemetary. Sie trugen Witwenkleidung und fuhren später mit Ihrem
Triumph in die Stadt. Dort lieferten Sie den Film in einem Kaufhaus
ab.«
»Wann soll das gewesen sein?«
Ich sagte es ihr.
»Ausgeschlossen«, meinte sie und hob das Kinn. »Ich war den
ganzen Nachmittag zu Hause.«
»Ich selbst bin Ihnen gefolgt.«
»Das ist nicht möglich.«
»Haben Sie für die fragliche Zeit ein Alibi?« begehrte ich zu
wissen.
»Aber gewiß«, erwiderte sie rasch. »Den Butler. William. Soll
ich ihn rufen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, nicht jetzt. Sie gaben sich in
der Fotoabteilung des Warenhauses als Leslie Brown aus. Das ist der
Name des Mädchens, das vorgestern begraben wurde.«
»Ich beginne mich zu fragen, ob Sie voll zurechnungsfähig
sind«, meinte sie stirnrunzelnd. »Es sei denn…« Sie führte den Satz
nicht zu Ende.
»Es sei denn was?«
»Ich überlege gerade… Nein, das ist unwahrscheinlich!« meinte
sie.
»Was ist unwahrscheinlich?«
»Ich gehe manchmal etwas leichtsinnig mit meinen
Zündschlüsseln um«, sagte sie. »Zuweilen lasse ich sie sogar
stecken. Ich frage mich, ob jemand, der mir ähnlich sieht, meinen
Wagen benutzt haben könnte.«
»Wirklich sehr komisch!« spottete ich.