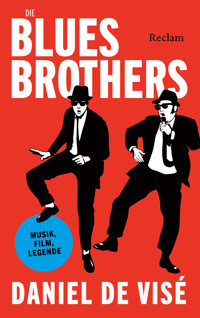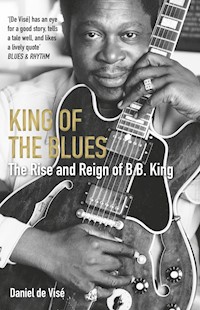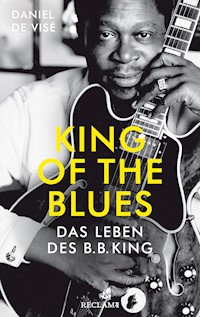
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Botschafter des Blues und Ikone der schwarzen Kultur Musik war die einzige Fluchtmöglichkeit für Riley »B.B.« King (1925–2015), der in großer Armut im Staat Mississippi aufwuchs und schon mit zehn Jahren beide Eltern verloren hatte. Inspiriert durch die Bluesgrößen Blind Lemon Jefferson, T-Bone Walker und Bukka White lernte er das Gitarrespielen und schaffte es weg von den Baumwollfeldern nach Memphis. Durch sein melodiöses Solospiel und seine packende Gesangsdarbietung entwickelte er einen völlig neuen Vortragsstil, der für viele die Grundlage ihres eigenen Schaffens wurde – etwa Jimi Hendrix, Eric Clapton und Carlos Santana. Pulitzer-Preisträger Daniel de Visé interviewte für diesen Band die Mitglieder des engsten Kreises um B.B. King: Band- und Familienmitglieder, Freunde und Manager. So zeichnet er nicht nur dessen Erfolge nach, sondern zeigt auch die dunklen Seiten des Musikbusiness auf: rassistische Vorurteile, die krummen Touren von Plattenlabels wie Konzertveranstaltern und die Erfolge der weißen Ziehsöhne, die ihren Übervater schnell abhängten. So erzählt Daniel de Visé weit mehr als die Lebensgeschichte des größten Blues-Gitarristen aller Zeiten – sein Buch ist zugleich eine Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, des Rassismus und der aufkeimenden Popkultur in den USA. »Er ist ohne jeden Zweifel der wichtigste Künstler, den der Blues je hervorgebracht hat.« Eric Clapton »Niemand arbeitete härter als B.B. King. Niemand inspirierte mehr aufstrebende junge Musiker. Niemand tat mehr dafür, das Evangelium des Blues zu verbreiten.« Barack Obama »Daniel de Visés Buch über B.B. King ist großartiger Lesestoff.« Joan Armatrading
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1044
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Daniel de Visé
King of the Blues
Das Leben des B. B. King
Reclam
Für Mom
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
King of the Blues. The Rise and Reign of B.B. King
Grove Atlantic Inc., New York
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Copyright © 2021 by Daniel de Visé
First published in the United States of America in 2021 by Atlantic Monthly Press, an imprint of Grove Atlantic Inc.
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962117-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011440-7
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
1. Kapitel: Sharecropper
2. Kapitel: Auf der Flucht
3. Kapitel: Indianola Mississippi Seeds
4. Kapitel: Der Blues
5. Kapitel: Memphis
6. Kapitel: Der Blues Boy
7. Kapitel: Lucille
8. Kapitel: On the Road
9. Kapitel: Big Red
10. Kapitel: Brache
11. Kapitel: Regal
12. Kapitel: Revival
13. Kapitel: Fillmore
14. Kapitel: Mythologie
15. Kapitel: Live and Well
16. Kapitel: Back in the Alley
17. Kapitel: Moskau am Mississippi
18. Kapitel: Heimkehr
19. Kapitel: Lovetown
20. Kapitel: Riding with the King
21. Kapitel: Eine Goldene Kette
Epilog
Anmerkungen
Anmerkungen des Übersetzers
Nachweis der Songtitel und Songtexte
Diskographie
Am Hof des Kings
Abbildungsverzeichnis
Danksagung
Register
B.B. King im LA Forum am 8. November 1969. Dieses Foto zierte später das Cover von B.B. Kings »Why I sing the Blues«.
Einleitung
Noch einmal ins Gefängnis zu gehen, das war wirklich das Letzte, was B.B. King wollte. Er hatte nur eine einzige Nacht in einer Zelle verbracht, nachdem ihn ein weißer Polizist auf einem Mississippi-Highway angehalten hatte, weil er 80 Meilen pro Stunde in einer 60-Meilen-Zone gefahren war. Das war 1950 gewesen. Damals rackerte sich B.B. als Musiker ab, war ein unterbezahlter Radio-DJ Mitte zwanzig, der immer noch Baumwolle pflückte, um über die Runden zu kommen, und raste in einem geliehenen Auto zum nächsten Auftritt. Das Bußgeld betrug 90 Dollar. Diese Summe konnte B.B. nicht aufbringen, und das wusste der ungemütliche, weiße Polizist.
Zwei Jahrzehnte später, am 10. September 1970, stand B.B. kurz vor seinem 45. Geburtstag. In diesen 45 Jahren war Riley B. King vom mittellosen Sharecropper*,1 Straßenmusiker und Sänger mit ersten Erfolgen in den Charts zum König des Blues aufgestiegen. Um 1970 definierten Gitarrenhelden das, was Pop- und Rockmusik war, und B.B. King war der erste Gitarrenheld.
B.B.s Geschichte ist die Geschichte der Großen Migration, jener nordwärts ausgerichteten Wanderungsbewegung, die Millionen von Afroamerikanern von den Plantagen des Südens in den städtisch geprägten Norden führte. B.B. hatte Mississippi per Anhalter verlassen, brachte es in Memphis zu Ruhm und tourte dann in einem Bus namens Big Red quer durch das Land. Nach zwei Jahrzehnten auf dem legendären schwarzen Chitlin’ Circuit* war ihm das Crossover, der Sprung aus dem eigenen Lager heraus, gelungen, und diesen symbolischen Durchbruch krönte er 1967 mit einer triumphalen Darbietung vor einer Menge weißer Hippies in San Francisco, genauer: im von Marihuana geschwängerten Fillmore Auditorium im Jahre 1967. Nach dieser Show hatte B.B.s Publikum die Farbe gewechselt. Von da an spielte er vor allem für die Weißen.
Doch war dieser Auftritt irgendwie anders: eine Show im berüchtigten Cook County Jail in Chicago. Die Anregung dafür war von einem Wärter afroamerikanischer Herkunft gekommen; 2400 Insassen sollten unterhalten werden, von denen die meisten ebenfalls Afroamerikaner waren. B.B. frohlockte, wieder vor einem schwarzen Publikum spielen zu können.
B.B. und seine Band betraten das Gefängnis an jenem Morgen gegen elf Uhr. Wärter mit versteinerten Mienen klopften die Musiker ab und führten sie durch schwere Stahltüren, die mit einem widerwärtigen Scheppern ins Schloss fielen. Die Band folgte dem Verlauf von schier endlosen, fensterlosen Gängen, vorbei an Verwaltungszimmern und Zellen und dem elektrischen Stuhl der Anstalt, bis zu einer Kantine – wohin die Musiker auch gingen, ihnen folgten Augenpaare, die »ausdruckslos waren und nur einen tiefen, betäubten Schmerz« erkennen ließen, wie sich ein Musiker erinnert. B.B. plauderte mit den Insassen, versuchte, die Urangst niederzuringen, in einem Gefängnis eingesperrt zu sein, an einem Ort, der »etwas Endgültiges hatte« und sich »angsteinflößend und knochenhart« anfühlte. Ein stämmiger Wärter wich dem Bluesmann nicht von der Seite, seine Augen unermüdlich auf der Suche nach der aufblitzenden Klinge eines improvisierten Messers. Die meisten der Männer waren jung genug, um B.B.s Kinder sein zu können. Einer nach dem anderen erzählten sie ihre Geschichten: wie sie über Monate in den Zellen schmachteten, auf eine Verurteilung warteten, keine Kaution hinterlegen konnten und nicht in der Lage waren, die Strafanstalt zu verlassen.
Nach einer faden Mahlzeit brachten die Aufseher die Band ins Freie, auf einen trostlosen und windigen Innenhof. Die Entourage begab sich zu einer kleinen Bühne, einer erhöhten Plattform, auf der einst abgeurteilte Männer gehenkt worden waren. Ein widerspenstiger Wind riss den Musikern die Noten von den Ständern, wehte die Blätter über die abschreckende, 30 Fuß hohe Steinmauer. Doch eine warme Herbstsonne schien in den Hof, die Temperatur lag bei angenehmen 20 Grad. Das Wetter hielt sich, und das war gut so, denn die Organisatoren hatten an diesem Tag alles unternommen, damit ein Konzert stattfinden konnte. B.B. spielte ohne Gage, aber sein Plattenlabel hatte 10 000 Dollar für Transportkosten, Gehälter und Ausrüstung investiert, um den Auftritt aufzunehmen – für eine mögliche Veröffentlichung als Live-Album.
Die Musiker spielten sich ein, machten einen Soundcheck und jammten eine Weile mit einigen Männern der Gefängnisband, während die Zuhörer nach und nach den Hof füllten. Mehr als 200 inhaftierte Frauen saßen links von der Bühne auf Klappstühlen. Mehr als 2000 Männer verteilten sich auf der grasbewachsenen Fläche, die mit Seilen abgesperrt war. Die Männer im Todestrakt mussten in ihren Zellen bleiben, konnten nur durch geöffnete Fenster lauschen.
Das Konzert begann um ein Uhr. »Hallo, alle zusammen«, rief eine Frau der Gefängnisverwaltung. Sie stellte der Menge in Overalls den weißen Sheriff und einen bekannten weißen Richter vor und löste damit aggressive Buhrufe aus, die weit über den Innenhof hallten. 50 Aufseher mit dicken Schlagstöcken und halbautomatischen Gewehren Kaliber 50 streiften über das Gelände oder hatten ringsum die Wachtürme besetzt. Wirklichkeitsgesättigter konnte kein Konzert sein. Da die Sprecherin merkte, dass Spannungen in der Luft lagen, kürzte sie die Ankündigung ab und rief: »Würden Sie dann bitte vortreten, Mr King?« Und dann steigt B.B. auf das alte Schafott, gekleidet in einen karierten, olivgrünen Anzug. Ein Knallen von Sonny Freemans Snare Drum kündigt den ersten Song an: »Every Day I Have the Blues«. Die sechsköpfige Band setzt sich in Szene, die Mitglieder nehmen ihre Plätze ein – und shuffeln in taubenblauen Anzügen, befeuert von Freemans galoppierendem Swing Beat. B.B. dreht den Lautstärkeregler auf, um Lucille aus ihrem Schlummer zu wecken, seine kurvenreich-symmetrische Gibson-Gitarre. Er spielt die ersten Töne, klettert zu einer »blue note«*, verschiebt die Saite mit seinen kräftigen Fingern, um vom Des einen Halbton höher zum D zu gelangen, ehe er zurücktänzelt und die Solophrase auf einer endlos gehaltenen Note ausklingen lässt. B.B. lässt sein linkes Handgelenk auf und ab wedeln, um das schimmernde Vibrato zu erzeugen, sein Markenzeichen. Er hat das Gefühl, dass er und Lucille mit einer Stimme sprechen: Ein Teil macht dort weiter, wo der andere aufhört. Einige Takte später ist B.B. an der Reihe. »Ev’ry day, ev’ry day I have the Blues«, singt er mit einem kräftigen, volltönenden Bariton, der weit hinten in der zusammengedrückten Kehle geformt wird. Zwei Minuten später ist der Song schon zu Ende, und der Innenhof bricht in Applaus und Jubelrufe aus. Dieses Publikum konnte sich mit dem Blues in Verbindung bringen.
Jetzt geht die Band über zu B.B.s Song, der sein Markenzeichen geworden war: »How Blue Can You Get«. Lucille entfacht ein Feuerwerk für die Ohren, das die Geschichte des urbanen Blues neu erzählt, und vieles zu dieser Geschichte hatte B.B. eigens auf seiner Gitarre beigetragen: ansteigendes Saitendehnen und Bending, Schnellfeuer-Staccato-Salven und gehaltene, sanft vibrierende Töne. Und dann singt B.B.: »I’ve been downhearted, baby, ever since the day we met«, faucht er und ruft seinem Publikum in Erinnerung, dass er nicht nur der weltbeste Blues-Gitarrist, sondern auch ein archetypischer Rhythm-&-Blues-Sänger ist. B.B. singt, und Lucille weint, und die Menge spricht mit ihm und jault und ruft zurück. Als B.B. ein wenig das Tempo herausnimmt und in eine affektierte, feminine Lesart der kulminierenden Bridge des Songs übergeht, droht das Lärmen des Publikums die Band zu übertönen – eine Freisetzung reiner, elektrisierender Energie, die B.B. wie Sauerstoff einatmet.
So sehr die neuen weißen Fans B. B. auch bewunderten, sie wussten nicht, wie man bei einer B.B. King-Show mitgeht, wie man sich einbringt, genauso wenig, wie sie gewusst hätten, was man bei einem Gottesdienst einer afroamerikanischen Gemeinde zu tun und zu lassen hat. Doch hier im Gefängnis, als die Band mit einer etwas obskuren Single aus den 1950ern mit dem Titel »Worry, Worry, Worry« weitermacht, ruft B.B. das Publikum an, und die Leute antworten ihm, einzeln und gemeinsam. »Throw your arms around him«, heult er, und die Menge ruft zurück: »Yeah!«
»Hold him close to you!«
»Yeah!«
»Look him straight in the eye!«
»Yeah!«
Der Song endet. Jetzt greift B.B. zurück auf Material, das fast 20 Jahre alt ist, um seine ersten großen Hits vorzutragen: »3 O’Clock Blues« und »You Know I Love You«; Songs, die er meist für ein schwarzes Publikum zurückhielt, wusste er doch, dass es viele in dieser Menge gab, die diese Hits schon damals in den 1950ern gehört hatten. Dies war B.B. King, der Blues Crooner.
»Vergiss nicht, ›Sweet Sixteen‹ zu spielen«, ruft ihm jemand zu. »All right, Baby«, gurrt B.B. Und spielt genau diesen Titel. Die lautesten Jubelrufe kommen von einigen verstreut stehenden männlichen Insassen, die Kleider und Perücken tragen. Zunächst hatte die Band sie für Frauen gehalten.
Das Konzert erreicht seinen Höhepunkt mit einer langsam köchelnden Version von »The Thrill Is Gone« über eine erkaltete Liebe – das war der Song, der B.B. eine Zukunft innerhalb des Popmusik-Pantheon des weißen Amerika ermöglicht hatte. »I’m free, free, free now, baby«, brüllt B.B. Die Männer auf der grasbewachsenen Fläche und die Frauen auf den Klappstühlen, nicht frei, brüllen zurück.
B.B. erinnerte sich, dass es ihn »traurig und froh stimmte«, wann immer er den Blick über das Meer aus schwarzen Gesichtern hatte schweifen lassen, »traurig, dass so viele meiner Brüder hinter Gittern saßen, aber trotzdem froh, dass ich bis zu meinen eigenen Leuten durchdringen konnte.« Solche Momente erinnerten B.B. an all die Meilen, die er zurückgelegt, und an die sonnengebleichte Hütte eines Sharecroppers, in der seine Reise begonnen hatte.
1. Kapitel: Sharecropper
B.B. Kings Vater, Albert King, wurde am 28. Februar 1907 geboren. Die King-Familie zog ständig kreuz und quer durch Mississippi, immer auf der Suche nach Arbeit auf den Farmen. Albert kam vermutlich in Glaston zur Welt, einem stecknadelkopfgroßen Ort im südlichen Mississippi, etwa 100 Meilen nördlich des Golfs von Mexiko.
Die Ereignisse rissen Alberts Familie auseinander. Seine Mutter verließ seinen Vater und verstarb prompt, ebenso eine Schwester. Der kleine Albert und sein Vater wanderten 200 Meilen nordwärts, um sich ihrer Verwandtschaft im Monroe County anzuschließen: Der Flecken Monroe gehörte zu dem größeren Hill Country, einer schroffen Scholle im nordöstlichen Mississippi, an der Grenze zu Tennessee im Norden und zu Alabama im Osten. Irgendwann nach 1910 verlor auch Alberts Vater sein Leben und hinterließ Albert in der Obhut eines älteren Bruders namens Riley, der Albert wiederum bei einer Sharecropper-Familie mit Namen Love ließ und selbst im Nebel verschwand. Albert kam als Adoptivneffe zur Familie Love. Diese Leute lebten im Sunflower County, einem Teil des legendären Mississippi Delta. Das Delta, ein flaches und fruchtbares Gebiet, liegt westlich von Hill Country, an der Grenze zu Arkansas, Wiege der Baumwollindustrie des Bundesstaates Mississippi. Die Loves nahmen den kleinen Albert in einem Fass mit auf die Felder, zugedeckt mit einem Baumwollsack, um die Moskitos abzuhalten.
Nora Ella Pulley, B.B.s Mutter, wurde wahrscheinlich 1908 im Chickasaw County geboren, in einer Region des Hill Country, die nach dem Indianerstamm benannt worden war, der dort lange ansässig gewesen war. Nora Ella war die Tochter von Elnora und Jasper Pulley. Elnoras Eltern, Pompey (»Pomp«) und Jane Davidson, waren als Sklaven geboren worden.
Um 1920 war Nora Ellas Vater verschwunden. Sie und ihre Mutter hatten sich dem weit verzweigten Haushalt von Elnoras neuem Ehemann namens Romeo Farr angeschlossen, der ebenfalls Sharecropper im Chickasaw County war. Einige Jahre später verließ Elnora Farr und nahm Nora Ella in die Gegend westlich des Deltas mit. Dort, vermutlich 1924, begegnete Nora Ella schließlich Albert King. Die beiden waren Teenager von 16 oder 17 Jahren. Als Albert Nora Ella einen Besuch abstattete, befolgte er die alten Regeln des Werbens, traf in ihrem Haus in Hemd und Krawatte ein und verabschiedete sich Schlag neun Uhr wieder. Schon bald wurden die beiden ein Paar. Gegen Ende des Jahres 1924 war Nora Ella schwanger.
Heutzutage befindet sich die offizielle Markierung für B.B. Kings Geburtsort an einer abseits liegenden Kreuzung, eine oder zwei Meilen südlich einer Siedlung mit Namen Berclair, an Schotterpisten, wo sich die Leflore County Routes 305 und 513 schneiden. Für den Geburtsort eines legendären Bluesmusikers ist das ein angemessener Ort. Der Blue Lake – wohl eher ein träger Flusslauf als ein See – liegt östlich dieser Kreuzung, ein Band stehenden Wassers, voller treibender Baumstämme und gesprenkelt von Schildkröten, die in der warmen Deltasonne dösen. Weiter südlich liegen Wälder, im Westen erstrecken sich Felder bis zum Horizont.
Die Gedenktafel verrät nicht den genauen Standort der Hütte der Kings, und vielleicht ist das auch gut so, denn von der Behausung ist keine Spur mehr zu sehen. Um dieses Fleckchen Erde zu erreichen, muss der Blues-Pilger dem Flusslauf ein Stück weit südlich, dann in östlicher Richtung folgen, entlang der Route 305 zur Route 281, dann muss man sich links halten und den Fluss überqueren. Dort stand einst die Hütte auf einem einsamen Feld. Jahrzehnte später führten Archivare B.B. zurück an jene Stelle und spielten ihm eine Aufnahme vor, die das gutturale Delta-Brummen des Albert King bewahrt hatte: Sein Vater erzählte von einer Reihe von überraschenden Wendungen in seinem Leben entlang dieser alten Straßen.
B.B. erklärte manchmal Berclair zu seiner Heimatstadt, obwohl dieser Ort kaum eine Stadt ist, sondern eher aus ein paar Hütten besteht, verstreut an einer Bahntrasse, die ostwärts nach Greenwood und in westlicher Richtung nach Indianola führt. Dann wiederum gab er Itta Bena als Geburtsort an (ausgesprochen wie »bean-a«), eine echte, wenn auch kleine Stadt. Tatsächlich gehörte das Land, auf dem B.B. zur Welt kam, nicht zu einer Stadt, sondern einem Mann. B.B. erinnert sich, dass seine Eltern auf der Plantage eines weißen Farmers mit Namen Jim O’Reilly lebten und arbeiteten.
Mittwoch, der 16. September 1925, begann als klarer, heißer Tag, und schon bald lag über der O’Reilly-Plantage die Schwüle der Delta-Region mit mehr als 30 Grad, die darüber hinwegtäuschte, dass der Herbst vor der Tür stand. An jenem Morgen wachte Nora Ella King mit heftigen Wehen auf, die die Geburt ihres Babys ankündigten. Sie weckte Albert, der sich gleich auf den Weg zu seinem Verpächter und Grundherrn machte. »Als bei Mama die Wehen einsetzten und Daddy auf der Suche nach einer Hebamme war«, erinnert sich B.B., »half O’Reilly ihm, die richtige Frau zu finden.« O’Reilly war bei der Entbindung dabei. Albert gab dem Baby den Namen seines Verpächters, den auch schon sein verschwundener Bruder getragen hatte. Auf der Geburtsurkunde stand »Rileigh«, vielleicht ein Hinweis auf die begrenzte Lese- und Schreibfähigkeit von B.B.s Eltern. Albert ließ das O weg, weil sein Sohn, wie er später scherzte, »nicht irisch aussah«. Das zweite B, das in Rileys späterem Leben so wichtig werden sollte, stand für gar nichts.
Die King-Familie lebte mehr als vier Jahre in der Hütte bei Berclair. Die Siedlung lag auf einer der höchsten Flächen der Delta-Region. Als die Große Mississippiflut 1927 eine Fläche von 27 000 Quadratmeilen Farmland überspülte, blieben Berclair und die Kings von der Katastrophe verschont. Benachbarte Siedlungen wie Moorhead, Indianola und Inverness, die nur wenige Meilen entfernt lagen, verschwanden unter den Schlammmassen.
Albert konnte weder lesen noch schreiben. Dennoch stieg er zum Traktorfahrer auf, hatte somit einen Job am oberen Ende der Hackordnung für Afroamerikaner, die auf den Delta-Farmen arbeiteten, und erhielt 50 Cent am Tag. Das Land wurde von Traktoren gepflügt und bestellt, mit der Zugkraft von fünf oder sechs Maultieren, die sie ersetzten. Farmer ließen ihre Traktoren rund um die Uhr fahren. Manchmal machte Albert mehrere Doppelschichten hintereinander, arbeitete also 48 Stunden am Stück und verdiente zwei Dollar an einem zweitägigen Marathon auf dem Sitz des Traktors, der einen gehörig durchschüttelte.
1928 brachte Nora Ella ein zweites Kind zur Welt, einen Sohn namens Curce. Ungefähr ein Jahr später starb Curce, offenbar nachdem er Glasscherben verschluckt hatte. Der Tod des kleinen Bruders und der nachfolgende Kummer sind beinahe die einzigen wirklichen Erinnerungen, die Riley aus jenen verschwommenen Jahren mit seiner Mutter und seinem Vater geblieben sind. »Meine Mutter erzählte mir, dass ich schlecht damit fertig wurde und es mir sehr zu Herzen nahm«, erklärte Riley später, womit er unheilvoll andeutete, dass er womöglich unachtsam Glasscherben hatte liegen lassen, die dann in Reichweite seines kleinen Bruders waren.
»Ich wünschte, er wäre jetzt hier«, schrieb Riley später über den verstorbenen Bruder, als er sich an das erinnerte, was er damals dachte. »Ich wünschte, ich hätte jemanden zum Spielen. Ich begreife den Tod nicht. Der Tod ist wie ein kalter Schauer, er macht mir Angst, die den Verstand übersteigt.«
Kurz nach Curces Tod, 1929 oder 1930, setzte Nora Ella ihren einzigen Sohn auf die Ladefläche eines alten Lastwagens und verließ Albert King. Riley erinnert sich an seinen Vater als an eine Gestalt vor dem Horizont, der zum Abschied winkte, während er immer kleiner wurde: »Er rückt in immer weitere Ferne, bis er schließlich ganz verschwindet. Es ist ein grauer Tag, und die Straßen sind holprig, und ich weiß nicht genau, was da eigentlich vor sich geht, ich weiß nur, dass ich noch nie eine solche Fahrt unternommen habe.« Als sie ihre Reise begannen, sagte Nora Ella zu Riley: »Es ist für dich schwer zu begreifen, aber dein Daddy und ich, nun ja, wir leben von jetzt an nicht mehr zusammen.«
Nora Ella verließ Albert wegen eines anderen Mannes. Der Schock, ein Kind zu verlieren, mag eine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt haben, sich von ihrem Mann zu trennen, vielleicht hat Albert sie aber auch mit seinem Alkoholkonsum vergrault. Im Frühjahr 1930, so die Erhebungen, lebten Mutter und Sohn im Haus eines gewissen George Herd, der wie Albert Farmer war und auf denselben Baumwollfeldern rund um Berclair arbeitete. Nachdem Nora Ella ihn verlassen hatte, hielt Albert sich zurück, den Mann zur Rede zu stellen, in dessen Arme sie sich geflüchtet hatte. »Wenn eine Frau beschließt, dass sie ihren Mann nicht mehr will«, erklärte er später, »dann lass sie gehen.«
Rileys Familie brach auseinander, während das Land in der Weltwirtschaftskrise versank. Von September bis November 1929 halbierten sich die Börsennotierungen. 1930 und ein Jahr darauf gingen Tausende Banken pleite, und die Arbeitslosenquote erreichte zweistellige Werte. Um 1932 und 1933, am tiefsten Punkt, hatte der Dow-Jones-Index neun Zehntel seines Werts eingebüßt, die Arbeitslosenquote stieg auf 25 Prozent, und zwei Millionen Amerikaner verloren ihr Zuhause.
Vielleicht litt niemand in der Wirtschaftskrise stärker als die Menschen in Mississippi. Zwei Drittel der Einwohner Mississippis waren Sharecropper oder Farmpächter, deren Lebensgrundlage vom Preis für Baumwolle abhing, doch der Preis stürzte von 20 Cent im Jahr 1929 auf weniger als fünf Cent im Jahr 1932 ab. Das Gesamteinkommen der Farmen sank in jener Zeit von 191 auf 41 Millionen Dollar.
»Ich wusste nichts von keinem Börsenkrach oder keiner Wirtschaftskrise«, erinnert sich Riley. »Unsere Welt war klein.« Er und seine Mutter lebten in einem abgelegenen Dorf, dessen Einwohner gerade so über die Runden kamen, als die Rezession zuschlug. Riley und seine Nachbarn besaßen in der Regel keine Bankkonten, ganz zu schweigen von Aktien. Sie hatten wenig zu verlieren.
Nora Ella blieb ein oder zwei Jahre bei George Herd und vermittelte Riley zumindest so etwas wie den Anschein eines stabilen Familienlebens. Die Hütte von Herd befand sich im Dorf Berclair, bei den Bahnschienen. Später erinnert sich Riley an das Geräusch der Zugpfeife und den Anblick des Schaffners, der winkte, wenn die Züge vorbeirumpelten. Es mag sein, dass Riley seinen ersten Schulunterricht an der Leflore County Training School genoss, die ausgewiesene »farbige« Schule für Afroamerikaner in Itta Bena und Umgebung.
Eines Tages im Jahr 1931 tauchte ein illustrer Besucher in George Herds Hütte auf. Er hieß Booker T. Washington »Bukka« White, ein Meister des Delta Blues, und er war Rileys älterer Cousin.
Bukka White wurde um 1904 im Chickasaw County geboren, der Wiege von Rileys Großeltern. Bukkas Mutter Lula war eine Schwester von Elnora, Rileys Großmutter. Um 1910 lebte Bukka bei Elnoras Verwandten im Hill Country. Von seinem Vater, der gelegentlich öffentlich auftrat, lernte er das Gitarrespielen. Bukka lehrte ihn auch den »Slide-Stil«: Die Delta-Bluesmusiker ließen ein kurzes Stück Metallrohr, eine Messerklinge oder einen Flaschenhals die Saiten rauf und runter gleiten, um ihre Gitarren zum Leben zu erwecken. Im Alter von ungefähr 13 Jahren machten sich Bukka und ein paar Freunde einen Spaß daraus, auf vorbeifahrende Güterzüge aufzuspringen, doch als ein Zug plötzlich Fahrt aufnahm, musste Bukka bis nach St. Louis mitfahren. Dort fand er Arbeit in einer Raststätte, fegte den Boden und spielte den Blues. Er heiratete mit 16 Jahren. Drei Jahre später starb seine Frau an einem geplatzten Blinddarm.
1930, im Alter von ungefähr 25 Jahren, fuhr Bukka nach Memphis, in die damalige kleinstädtische Musikhauptstadt, und spielte 14 Titel für das Label Victor ein, dessen Produzenten die landesweite Bluesbegeisterung ausschlachteten. Doch die um sich greifende Wirtschaftskrise dämpfte den Enthusiasmus des Labels, so dass nur vier Plattenseiten offiziell erschienen. Dennoch war er, als Bukka 1931 seinem jüngeren Cousin begegnete, bereits ein erfahrener Bluesmann.
Bukka White, B.B.s Cousin. Bukka war ein Meister der Slide-Gitarre aus dem Delta und übte einen maßgeblichen Einfluss auf B.B. aus, auch wenn B.B. das offenbar nicht zugeben wollte.
Bukka kam in die kleine Stadt, weil er im benachbarten Itta Bena einen Auftritt hatte. In seiner Erinnerung war der Ort Berclair »eine kleine Ein-Laden-Stadt am Ende einer Straße. Meine Tante Nora lebte dort, und Riley muss ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein. Also plauderte ich ein wenig mit meiner Tante, schaute rüber in eine Ecke und sah, dass der Junge meine Gitarre betrachtete, und er sah mich so bemitleidenswert an, als er dort stumm in der Ecke hockte.« Riley starrte auf Bukkas rote Stella-Akustikgitarre. Eine Stimme in Bukkas Kopf sagte ihm: »Du musst diesem Jungen eine Gitarre besorgen.« Also überließ er Riley die Stella. Der Junge antwortete mit einem kaum hörbaren »Danke«. Dann saß er da und starrte weiter auf das Instrument.
Mindestens drei Personen sollten später behaupten, Riley seine erste Gitarre gegeben zu haben. Wenn Bukkas Story wahr ist, dann hat Riley seine erste eigene Gitarre im Alter von sechs Jahren erhalten. Doch an ein solches Geschenk kann sich Riley nicht erinnern. Vielleicht erlaubte Bukka seinem kleinen Cousin bloß, ein paar Saiten zu zupfen, ehe er das Instrument wieder an sich nahm. Wie dem auch sei, Riley sollte sich erst ein paar Jahre später ernsthaft mit einer Gitarre beschäftigen.
Später besuchte Bukka seinen kleinen Cousin ein paar Mal im Jahr »und sah aus wie ein paar Millionen Kröten«, wie Riley sich erinnert. »Rattenscharf. Großer Hut, peinlich sauberes Oberhemd, gebügelte Hose, hochglänzende Schuhe. Er roch nach Großstadt und aufregenden Zeiten.« Bukka hatte ein rundes Gesicht, freundliche Augen und weit auseinanderstehende Zähne, die aufblitzten, wenn er den Mund zu einem breiten Lächeln verzog. Als geborener Geschichtenerzähler rasselte Bukka Storys von Kneipen in Arkansas und den Hochhäusern in Chicago herunter. Er spielte Riley etwas auf der Gitarre vor, entlockte dem Instrument herrliche Töne mit seiner Slide-Technik. »Sein Vibrato machte mir Gänsehaut«, erinnert sich Riley.
Doch nicht alle Verwandten brachten Freude in Rileys Leben. Schaudernd erinnert er sich an die Besuche bei »alten Leuten« aus der Familie seiner Großmutter, die unheimliche Geschichten über kopflose Körper in offenen Särgen erzählten, während Riley nebenan im Bett lag und vor Angst zitterte. »Die Dunkelheit wurde zum Grab«, erinnert er sich. Für den Rest seines Lebens schlief Riley immer bei Licht.
Einige der Älteren mögen Rileys Nachbarn gewesen sein. Die großen Familienverbände der Sharecropper wanderten oft gemeinsam von einer Siedlung zur nächsten, sobald ihnen zu Ohren kam, es gebe wieder eine Gelegenheit, sich woanders durchzuschlagen. Ein entfernter Verwandter erinnert sich, dass Riley um 1931 in Berclair bei Angehörigen von Nora Ellas weit verzweigter Familie lebte, zu jener Zeit, als sie mit George Herd zusammen war. Es ist also durchaus möglich, dass Riley abwechselnd bei seiner Mutter und ihren Verwandten lebte. Dieses Muster sollte die nächsten zehn Jahre seines Lebens bestimmen.
In Berclair hatte Riley eine Spielgefährtin. Sie hieß Peaches, war sieben Jahre alt und brachte dem sechsjährigen Riley die Grundzüge des Liebesspiels bei.
»Wir steigen in Mums Bett«, erinnert sich Riley, »ziehen uns aus, und Peaches zeigt mir, was sie sich heimlich bei ihren Eltern abgeschaut hat.«
Einmal erwischte Nora Ella ihren Sohn und Peaches beim Liebesspiel. Sie riss ihn von dem Mädchen herunter, schleuderte ihn durchs Zimmer und schlug ihn. Doch Peaches fasste sie nicht an. Riley fragte sie, warum sie das nicht tat. »Du müsstest eigentlich wissen, dass du so etwas nicht tun darfst«, lautete ihre Antwort.
Nora Ella verließ George Herd 1931 oder 1932, möglicherweise wegen ihres immer schlechter werdenden Gesundheitszustands. Wahrscheinlich litt Rileys Mutter an Diabetes, der nicht richtig behandelt wurde. Obwohl sie gerade einmal Anfang 20 war, verlor Nora Ella allmählich ihr Augenlicht. Vielleicht kam Herd zu dem Schluss, dass seine neue Frau sich nicht mehr voll einbrachte, eine harte, aber notwendige Überlegung in der grausamen Ökonomie des Sharecroppings. Daher verließen Nora Ella und ihr Sohn das Delta und reisten 100 Meilen ostwärts, um fortan bei Noras Mutter Elnora im Hill Country zu wohnen.
1932 war Elnora Farr wieder im Chickasaw County, ihrem Geburtsort in Mississippi. Sie lebte dort allein und arbeitete als Sharecropper auf dem Farmland in der Nähe des kleinen Landsitzes Houston. Zu dieser Zeit war Elnora Anfang 40. Die Männer in ihrem Leben, Jasper Pulley und Romeo Farr, waren schon lange fort. Sie sollte nicht wieder heiraten.
Elnora hatte drei Kinder, die alle Anfang 20 waren und immer wieder vom Hill Country zum Delta und zurück wanderten, stets auf der Suche nach einem existenzsichernden Arbeitslohn. In den frühen 1930ern lebten alle drei Kinder im Chickasaw County: William Pulley, Nora Ellas älterer Bruder, als strenger Patriarch des Pulley Clans; dann Nora Ella selbst; und Jack Bennett und seine Frau Nevada, Nora Ellas jüngere Schwester.
Riley selbst scheint nie jemand erzählt zu haben, dass er im Chickasaw County lebte. Vielleicht verschmolzen diese Erinnerungen mit anderen Erinnerungen an andere Orte zu einer Art Mississippi-Hill-Country-Montage. Doch laut Erhebungen und Aussagen von Verwandten lebte Riley ungefähr drei Jahre in Chickasaw, von ca. 1932 bis 1935, zusammen mit seiner Mutter, Großmutter und vielen Verwandten der verzweigten Familie.
»Als Albert und Nora sich trennten, nahm sie ihren kleinen Jungen mit und zog nach Houston, Mississippi, um bei ihrer Mama zu wohnen«, erklärte Lessie Fair, eine entfernte Verwandte, die ein paar Jahre später in Rileys Leben treten sollte. »Ihre Mama und sie und der Rest der Familie lebten alle in Houston.«
Die genaue Adresse Rileys in Chickasaw vom siebten bis zum zehnten Jahr ist schwer zu rekonstruieren. Charles Sawyer, sein erster Biograph, war der Ansicht, Riley habe diese Jahre bei seiner Großmutter Elnora verbracht. Andere erinnern sich, der Junge habe bei seinem Onkel William gelebt. Onkel Jack wiederum behauptete, Riley sei bereits bei den Erhebungen erfasst worden. Riley selbst erinnert sich, bei seiner Mutter gelebt zu haben.
Nora Ella war eine liebevolle Mutter, auch wenn sie in Rileys Leben kaum mehr als flüchtige Präsenz hatte. Er verehrte sie: »Sie hat ein strahlendes Gesicht, eine schimmernde braune Haut und einen wohlgeformten Körper«, erinnert sich Riley später im Leben. »Es regnet, und ihr Haar glänzt vor Nässe. Sie reicht mir ein Handtuch und bittet mich, sie abzutrocknen.«
Die gemeinsam mit seiner Mutter verbrachte Zeit die Riley in Erinnerung geblieben ist, liest sich stellenweise wie eine weichgezeichnete Rückblende in einem Film. In einer Momentaufnahme holt Nora Ella ihren Jungen zu sich in die Hütte und bringt ihm bei, ihr die Haare zu flechten, die ihr bis auf die Schultern fielen. Er wollte es unbedingt richtig machen, »damit jeder sieht, dass sie die hübscheste Frau der Welt ist«, wenn sie zur Arbeit auf den Feldern ging. An anderer Stelle erinnert Riley sich, dass er in der Kirche saß, heimlich zu den hübschen Mädchen schielte, die hinter ihm saßen, und gleichzeitig »zuhört, wie Mama im Chor singt, mit einer Stimme, die so süß ist«, dass er weinen möchte.
Rileys Mutter kommt auch in den beängstigenderen Erinnerungen aus seiner Kindheit vor. In einer Geschichte beschrieb Riley eine Nacht, in der »wilde Blitze am Himmel zuckten« und ein heftiges Sommergewitter losbrach, dass man meinen konnte, »das Ende der Welt wäre gekommen«. Riley und seine Mutter hockten eng beieinander »in der Ecke unserer kleinen Hütte«, sie hatte den Arm um ihn gelegt, während eine Trichterwolke* näher kam. Der Wind riss das Dach von ihrer Hütte. Und dann, urplötzlich, war der Sturm weg. Am nächsten Tag traten Riley und seine Mutter hinaus ins helle Sonnenlicht und entdeckten überall auf den Baumwollfeldern kleine Fische, die in den Pfützen zappelten. Riley konnte nicht glauben, dass der wütende Sturm ihnen nichts angetan hatte: »Nur Mama und ich, wir allein dort in der Ecke und Jesus für das Wunder dankend.«
In einer anderen Episode zog Nora Ella ihrem kleinen Jungen einen Matrosenanzug an, ehe sie losfuhren, weil sie einem Toten die letzte Ehre erweisen wollten, der aufgebahrt in einer Hütte lag. Seine Mutter schärfte ihm ein, nicht andere anzustarren und nicht das ganze Essen allein zu verdrücken. Ganz unter dem Eindruck des unheimlichen Leichnams, wollte sich Riley ein Stück von dem Süßkartoffelkuchen von der Anrichte schnappen. Doch dann erblickte er seine Mutter, die ihm einen strengen Blick zuwarf. Riley ließ das Stück von dem Kuchen in seiner Hosentasche verschwinden. Dann setzte er sich, und der noch heiße Kuchen verbrannte ihm durch die Hose das Bein. Der Junge fing an zu weinen. Seine Mutter führte ihn nach draußen und fragte ihn, was denn los sei. »Es tut mir leid, Mama«, erklärte er, »ich weiß, d-d-d-d-d-du wolltest nicht, dass ich noch m-m-m-m-m-mehr esse, deshalb hab ich diesen Kuchen eingesteckt.« Nora Ella war entsetzt: »Oh, Baby«, sagte sie zu ihm, »du hast meinen Blick falsch verstanden.« Mutter und Sohn schluchzten gemeinsam.
Soweit Riley sich zurückerinnern konnte, stotterte er stark, wenn er sprach. Vielleicht entstand dieses Stottern in dem Wirbel aus Emotionen, als seine Eltern sich trennten. Als Ursache von Stottern vermutet man oft ein emotionales Trauma. Rileys Urgroßvater Pomp Davidson, der als Sklave auf die Welt gekommen war, stotterte ebenfalls.
Riley lernte seinen Platz in der Gesellschaft in Mississippi direkt oder indirekt durch seine Urgroßeltern Pomp und Jane Davidson, Elnoras Eltern, kennen. Riley hat seinen Urgroßvater Pomp als furchtlosen Aufschneider in Erinnerung behalten, der »mit seiner Schrotflinte sprach, gerne auf seinem Maulesel durch die Gegend ritt und schwarzgebrannten Whiskey aus einem Krug trank … Keiner stellte sich Pomp in den Weg.« Großmutter Jane verströmte eine sanfte Autorität. »Sie nahm mich auf den Schoß, und weil sie mir so nah war, sah ich die Falten um ihre Mundwinkel und über ihren Lippen. Da war ein Glitzern in ihren Augen, und sie sprach mit ruhiger Stimme.«
Rileys Urgroßeltern wurden um 1860 in die Sklaverei hineingeboren. Sie hatten eine große Familie in Chickasaw County. Riley lernte Großmama Jane kennen, als er in den frühen 1930ern in Chickasaw ankam. Er konnte sich angeblich auch an Pomp erinnern, doch starb der Patriarch des Davidson-Clans schon 1923, also noch bevor Riley zur Welt kam. Rileys vermeintliche Erinnerungen an seinen Urgroßvater verdanken sich womöglich Großmama Janes lebhaften Geschichten.
Jane Davidson brachte Riley vieles über den Blues bei. Der Junge hatte schon field shouter, die Sänger auf den Feldern, gehört: Sein Vater Albert und sein Onkel Jack waren vollendete Blues-Shouter, deren heisere Stimmen weit über die Plantagen hallten. Der sogenannte »field holler« gehörte zu den afroamerikanischen Worksongs: Ein einzelner Arbeiter gab einen Rhythmus und eine Melodielinie mit einer Lautstärke, die auf dem ganzen Baumwollfeld zu hören war, vor, um den täglichen Arbeitsablauf zu ergänzen und zu strukturieren. Andere Arbeiter antworteten unmittelbar darauf im Chor – der klassische Call-and-Response-Gesang – und verbreiteten den jeweiligen Song auf der Plantage wie ein Signalfeuer. Der Ruf des Vorsängers klang stark nach unbegleitetem Blues. Volkskundler sind entsprechend der Ansicht, dass die Worksongs auf den Plantagen mehr oder weniger den Blues inspiriert haben.
Rileys Urgroßmutter erklärte dem Jungen, was das alles zu bedeuten hatte. Das Singen half dabei, dass der Tag rumging. »Doch die Blues-Shouter besangen mehr als nur die eigene Traurigkeit«, erklärte Riley. »Sie übermittelten auch Nachrichten, musikalisch verschlüsselt. Wenn der Master kam, sang man womöglich eine versteckte Warnung für die anderen Feldarbeiter. Vielleicht wollte jemand dem Master aus dem Weg gehen oder sich vor ihm verstecken. Das war besonders für Frauen wichtig, weil der Master alles haben konnte, was er wollte.« Riley begriff, dass es beim Blues ums Überleben ging.
Urgroßmama Jane erzählte eine alte Chickasaw-Geschichte über einen schwarzen Jungen, der sich in die Tochter seines weißen Masters verliebt hatte. »Um Neumond herum, wenn es nachts ganz dunkel war«, erinnert sich Riley, »trafen die beiden sich heimlich und küssten sich.« Irgendwann erwischte jemand die beiden und berichtete alles dem Master. Er fesselte den Jungen an einen Baum und ließ ihn teeren und federn. Er wollte den Jungen bei lebendigem Leib verbrennen. Dann kam das Mädchen angelaufen, ganz hysterisch, und flehte: »Er hat mich nicht vergewaltigt«, rief sie ihrem Vater zu. »Ich habe mich ihm hingegeben. Ich liebe ihn.« Der Vater fragte sie, was er ihrer Meinung nach tun solle. »Lass ihn nicht leiden«, erwiderte sie. »Es wäre gütiger, ihn zu erschießen.«
Ungefähr zu Jahresbeginn 1935 verließ Elnora Farr Chickasaw County und fuhr mehr als 50 Meilen in südwestlicher Richtung, zu einer Ansammlung benachbarter Farmen, die für die nächsten fünf Jahre ihr neues Zuhause sein sollte. Viele aus ihrer Familie folgten ihr nach, einschließlich Nora Ella und Riley. Ihr Ziel war Kilmichael, ein kleiner Weiler mit etwa 500 Einwohnern. Kilmichael lag im zentralen Norden von Mississippi und grenzte an die südlichen Ausläufer von Hill Country. Riley erinnert sich, dass damals, als er und seine Familie dort eintrafen, sie »vom Lastwagen runter und rauf auf ein wackeliges altes Fuhrwerk stiegen, das von einem Pferd gezogen wurde und uns tiefer in die Berge brachte, tief ins Landesinnere«, über den Big Black River, in ein Gebiet aus Farmland und Wald, das versteckt zwischen zwei Flüssen lag.
Elnora und ihre Familie richteten sich auf der Farm von George und Mary Booth häuslich ein, dem Hof eines Ehepaars mittleren Alters, das keine eigenen Kinder hatte. Dort blieben sie aber vermutlich nur für kurze Zeit. Die Familie Booth spielt, wie auch Chickasaw County, in der King-Legende so gut wie keine Rolle.
»Sie machten sich alle von Houston auf den Weg zu George Booths Farm«, erzählte Lessie Fair, eine von Rileys Verwandten aus Kilmichael. Nora Ella, der es gesundheitlich immer schlechter ging, schickte ihren Jungen zu Onkel William, ihrem Bruder, der eine neue Frau und ein kleines Mädchen hatte. Riley half mit, das Baby zu versorgen.
Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem Landgut der Booths zogen Elnora und ihre Verwandtschaft weiter zu einem benachbarten Hof, der Milchwirtschaft betrieb und Edwayne und Bertha Henderson gehörte. Der Grund und Boden der Hendersons umfasste ein paar hundert Acres* und lag sechs Meilen südlich von Kilmichael, am Rande des Highway 413. Zum Hof gehörten ungefähr 100 Milchkühe, Maisfelder, Heuwiesen und natürlich King Cotton.
Ein Großteil der tatsächlich anfallenden Landwirtschaft auf dem Grund und Boden der Hendersons verteilte sich auf eine Kolonie von Farmpächtern bzw. Sharecroppern. Das Sharecropping-System sah vor, dass der Landbesitzer jeder Pachtfamilie eine Parzelle von fünf bis zehn Acres zur Verfügung stellte, die dann bewirtschaftet wurde. Die Sharecropper wohnten in ungestrichenen Holzbaracken, ohne Sanitäreinrichtungen, ohne Strom und ohne Telefone – die Hütten hatten Fenster ohne Glasscheiben, als Lichtquelle dienten Kerosinlampen, geheizt wurde mit Öfen, die mit Holz befeuert wurden. (Der Besitzer der Farm lebte nicht unbedingt in besseren Verhältnissen, für gewöhnlich bewohnte er ein getünchtes Haus, das drei oder vier Zimmer hatte, jedoch meist auch ohne fließendes Wasser und ohne Strom.) Der Besitzer stellte Werkzeug zur Verfügung, auch Düngemittel und Saatgut. Sharecropper bauten große Teile ihrer Nahrung selbst an. Darüber hinaus steuerte der Besitzer eine monatliche »Versorgungsleistung« bei, eine Art Vorschuss auf die Ernte, der die Kosten des alltäglichen Lebens abdeckte, darunter etwa Kleidung und Medikamente. Zur Erntezeit teilten sich der Besitzer und die Sharecropper den Gewinn, indem sie die Ernte verkauften – doch erst, nachdem der Besitzer die Versorgungsleistung plus Zinsen und die Hälfte der Kosten für Saatgut, Düngemittel und allerlei andere Ausgaben von der Summe abgezogen hatte. In einem guten Jahr konnte ein Sharecropper einen kleinen Überschuss erwirtschaften. Doch meistens führte das Farmpächter-System in die Schuldenfalle. In der ökonomischen Nachfolge der Sklaverei lebten die Afroamerikaner zwar in Freiheit, dafür waren sie aber fortgesetzt an den Besitzer des Grund und Bodens gebunden.
Zu den Sharecroppern, die im Jahr 1935 auf dem Farmland der Hendersons und den benachbarten Schollen lebten, gehörten die meisten jener Menschen, die für die kommenden Jahre eine Rolle in Rileys Leben spielten: Rileys Onkel William und die neue Tante Lucille; sein Onkel Jack und Tante Nevada; Myony »Mima« Stell, eine Schwester von Rileys Großmutter, deren Grammophon das Leben des Jungen verändern sollte; dann die Familie Hemphill, deren fünf liebenswerte Mädchen den jungen Riley ständig vom Lernen abhielten; Archie Fair, ein Bruder von Tante Lucille, ein Prediger, dessen Gitarre der junge Riley begehrte; Denzel Tidwell, der junge Weiße, der seine rote Stella-Gitarre an Riley verkaufte; und Luther Henson, der Lehrer, der Riley eine Welt jenseits der Baumwollfelder zeigen sollte.
Riley lebte fortan in einem klar umgrenzten Gebiet, das von vier Eckpunkten definiert wurde: von der Henderson-Farm, die am Crape Creek lag, östlich vom Highway; von der Elkhorn School, einem Holzgebäude mit nur einem Raum und einer dazugehörigen Kirche auf einem Hügel mit Blick auf einen Teich, westlich von der Farm; von der Austin Chapel, einer gut besuchten Sanctified Church, die nordwestlich der Elkhorn School lag; und von der Kirche und dem Friedhof bei Pinkney Grove, zwei Meilen südlich gelegen.
Die Elkhorn School war das Reich von Luther Henson. »Professor« Henson wurde zu jener Vaterfigur, die Riley sich immer gewünscht hatte, vermutlich das nachhaltigste unter den männlichen Vorbildern, die den jungen Riley auf dem Weg in ein erfolgreiches Erwachsenenalter begleiten sollten.
Luthers Vater Syrus Henson kam 1835 auf der Henson-Plantage in North Carolina als Sklave zur Welt. Als sich die Henson-Familie in den 1850ern in südwestlicher Richtung nach Mississippi auf den Weg machte, lenkte Syrus den Ochsenkarren. Ein paar Jahre nach der Ankunft wurde Syrus freigelassen. Er erwarb mehr als 100 Acres in der Nähe von Kilmichael. Dort gründete er die Elkhorn Primitive Baptist Church und das dazugehörige Schulhaus. Er brachte seinen Kindern Lesen und Schreiben bei, vielleicht in der Hoffnung, dass sie eines Tages die Elkhorn School leiten würden. Diese Aufgabe fiel dann dem 20. von Syrus Hensons insgesamt 21 Kindern zu, nämlich Luther.
Fünf Dutzend Schüler, von der Vorschule bis zur High-School-Reife, drängten sich in der Elkhorn School in einem einzigen Klassenzimmer. In der Mitte des Raums stand ein gusseiserner Ofen, um diesen gruppiert die Reihen Schulbänke, damit die Kinder von der abstrahlenden Wärme profitierten. Die Kinder der Sharecropper in Kilmichael besuchten die Schule vier Monate im Jahr, vom Ende des jährlichen Erntezyklus im Winter bis zum Beginn des neuen Zyklus im Frühjahr. Jeden Morgen versammelten sich die Schüler draußen vor der Schultür nach Geschlecht und Größe aufgereiht. Sobald die Schulglocke ertönte, betraten die Kinder den kalten Klassenraum. Mr Henson ließ den Tag für die Kinder mit einem Vaterunser und einem fröhlichen Song beginnen, der einen wach machte: »Good morning to you. Good morning to you. We’re all in our places with sunshiny faces.«
Luther Henson, ein Mann Mitte Dreißig, zeigte stille Würde. Er sprach langsam und bedächtig, betonte jeden Satz mit einem freundlichen Lächeln. Seine Schule führte er mit einer fast militärischen Präzision, die einzige Möglichkeit, um in einem Raum für Ordnung zu sorgen, der mit Schülern aller Altersstufen angefüllt war. Henson rief jeden Jahrgang einzeln auf, erst die jüngsten, dann die ältesten Kinder; die Schüler gleichen Alters mussten sich dann für kurze Übungseinheiten nacheinander in kleineren Gruppen vor der Kreidetafel aufstellen.
»Wir hatten ungefähr fünf oder sechs Bücher«, erinnert sich Jessie Hemphill, einer von Rileys Klassenkameraden. »Lesen, Schreiben, Mathematik, Geographie, Aussprache. Wir hatten auch ein Schulbuch mit dem Titel Gesundes Leben.«
Hensons Pädagogik ging weit über das reine Lernen hinaus. Er brachte seinen Schülern das Handwerkszeug bei, das sie brauchten, um eines Tages dem Gefängnis aus schwerer Arbeit und Schulden zu entkommen, in das sie hineingeboren waren. (Henson sollte nie mehr als 30 Dollar im Monat verdienen.) Er vermittelte ihnen, was eine gute Ernährung ausmacht, ermutigte die Familien seiner Schüler, Hühner und Schweine als Proteinquelle zu züchten und Obstbäume zu pflanzen. »Von allem, was wir aßen, wussten wir immer, für welche Körperregion es gut war«, erinnert sich Fannie Henson Draine, Luthers Tochter.
Professor Henson schärfte seinen Schülern ein, das Wenige, das sie besaßen, gut zu verwalten und nach finanzieller Unabhängigkeit zu streben. Er brachte der Klasse kleine Songs bei, deren Textzeilen daran erinnern, die Zähne zu putzen und sich die Hände zu waschen und dass Kautabak »einem das kleine Leben wegschnieft.« Er erklärte ihnen, wie man den Ehealltag bestreitet. »Er brachte den Jungs bei, wie sie, wenn sie erwachsen waren, ihre Frauen behandeln sollten«, erinnert sich Jessie Hemphill. »So sagte er: ›Erspart euren Frauen Holz und Wasser. Holz auf dem Rücken treibt ihnen das Wasser in die Augen.‹«
Riley hatte schon von Weißen geführte Zeitungen gesehen, etwa die Greenville Democrat Times und die Memphis Commercial Appeal, die nur dann über Afroamerikaner schrieben, wenn diese eines Verbrechens bezichtigt wurden. Henson zeigte seiner Klasse afroamerikanische Zeitungen wie den Pittsburgh Courier und den Oklahoma City Black Dispatch, die Artikel über erfolgreiche Schwarze brachten, etwa über den Musiker Louis Armstrong und den Boxer Joe Louis. Er klärte die Klasse über den Pädagogen Booker T. Washington, den Abolitionisten Frederick Douglass und die Bürgerrechtlerin Mary McLeod Bethune auf. Inständig bat er seine Schüler, die Schule auf jeden Fall abzuschließen: »Wenn ihr das einmal habt, ist es das Einzige, was euch die Weißen nicht wegnehmen können.«
Die 1930er Jahre im Bundesstaat Mississippi waren für Afroamerikaner eine dystopische Gesellschaft, geprägt von dem Modell eines festgeschriebenen Rassismus, der »Jim Crow«genannt wurde – eine stereotype Figur der Minstrel Shows. Im Jahr 1896 hatte der U. S. Supreme Court entschieden, dass die Rassentrennung verfassungsmäßig zulässig sei, solange Schwarzen und Weißen die »gleichen« Einrichtungen und Dienstleistungen zugänglich waren. Luther Henson war Riley dabei behilflich, die Getrennt-aber-gleich-Fiktion zu entschlüsseln. Afroamerikaner tippten sich an die Mütze, wenn ihnen Weiße in den Straßen entgegenkamen, doch die Weißen erwiderten diese Höflichkeitsbezeugung nicht. Afroamerikaner redeten Weiße mit »Sir« oder »Ma’am« an, während Weiße ihre schwarzen Mitbürger mit Vornamen anredeten. Auf den Gehwegen hatten Weiße grundsätzlich Vorrang. Schwarze machten den Weißen Platz.
Henson half Riley, sich ein Leben jenseits der Jim-Crow-Realität vorzustellen, jenseits eines Systems, für das auch seine eigene rassengetrennte Schule ein Beispiel war. Im Jahr 1930 investierte der Bundesstaat Mississippi durchschnittlich 31 Dollar in einen weißen, jedoch nur sechs Dollar in einen schwarzen Schüler. Riley und seine Klassenkameraden gingen zu Fuß zur Schule. Die weißen Kinder aus Kilmichael wurden auf einem Pritschenwagen zu ihrer Schule gebracht, eine Ungleichheit, die Riley sein ganzes Leben verfolgen sollte.
»Ihr habt sicher alle von den Lynchmorden gehört, bei denen unsere Leute für etwas bestraft werden, was sie nicht getan haben«, erzählte Henson seinen Schülern. »Aber denkt daran, nicht alle Weißen stehen dahinter. Wenn die Weißen es wollten, könnten sie jeden Einzelnen von uns umbringen. Aber es gibt auch gute Menschen unter den Weißen, genauso wie es auch schlechte gibt. Verrückte Menschen gibt es in allen Hautfarben. Und schon bald werden die guten Menschen über die verrückten Menschen triumphieren.« »Mehr als alles andere«, erinnert Riley sich, »gab Mr Henson mir Hoffnung.«
Henson hatte auch einen Rat in Bezug auf Rileys Stottern. »Riley«, sagte er eines Tages, »lass es einfach langsam angehen und warte, bis dein Mund mit deinem Verstand Schritt hält.« Riley jammerte: »W-w-w-was soll ich machen, wenn die W-w-w-orte nicht r-r-r-rauskommen und alle auf mich w-w-w-warten?« Henson lächelte. »Nun, dann werden sie wohl warten müssen, oder?«
Riley erinnert sich an den Schulalltag als an eine tägliche Plackerei und behauptet, er habe zu den schlechtesten Schülern seines Jahrgangs gehört. »Er war ein sehr guter Schüler«, erinnert sich Ted Hemphill, der Bruder von Jessie. Jessie selbst sagte über Riley: »Er war lernbegierig, er hörte auf das, was sein Lehrer sagte, und er sog alles auf, was er hörte.«
Wie auch immer Rileys Lerneifer ausgesehen haben mochte: Nach seinen eigenen Worten fühlte er sich jedenfalls »mehr zu den Mädchen hingezogen als zu den Büchern« – insbesondere zu den Hemphill-Mädchen, von denen eines in der Bank vor ihm saß. Wann immer er eine Gelegenheit witterte, legte er einen Arm um das Mädchen und versuchte, es heimlich an sich zu drücken. Doch im Gegenzug biss sie ihm in die Hand. Manchmal erwischte Henson ihn dabei, wie er nach einer frühentwickelten Brust grapschte oder versuchte, den Mädchen unter die Röcke zu gucken. Lehrer Henson eilte dann nach draußen, riss einen Zweig von einer Ulme ab und prügelte den Jungen durch, wobei er jeden Hieb mit der Ermahnung versah: »DU … WIRST … FRAUEN … RESPEKTIEREN.«
Riley war kein großer Junge, doch hatte er Kraft, besonders in seinen Händen. Jessie Hemphill erinnert sich an ein Spiel auf dem Schulhof, das die Kinder »Let Buddy Out« nannten: herzzerreißend symbolisch, wenn die Kinder abwechselnd versuchten, einen Reigen aus Schülern zu durchbrechen, die sich alle an den Händen festhielten. »Ich achtete immer darauf, B.B.s Hand zu halten«, erzählte Jessie, »weil er deine Hand richtig festhalten konnte.«
Solange er denken konnte, war Riley mit seinen Gedanken bei den Mädchen. Als er ungefähr sieben Jahre alt war, dämmerte es ihm, dass er sie immer alle in der Kirche antreffen würde, hübsch aufgereiht auf den Bänken, adrett in ihren besten Kleidern. Von jenem Tag an verpasste der junge Riley keinen Gottesdienst.
Manchmal besuchte Riley die feierliche Elkhorn Primitive Baptist Church auf der Anhöhe gegenüber seiner Schule, und irgendwann wurde er zum Baptisten getauft. Doch er bevorzugte die Austin Chapel. Sie gehörte zu der Church of God in Christ, und dort waren die Gottesdienste sehr viel lebendiger als bei den Baptisten. Den Gottesdienst leiteten Reverend Archie Fair und seine Gitarre.
Die Sonntage in der Kirche gehörten Reverend Fair, einem Prediger der Sanctified Church, und seine Predigten waren »teils Séance, teils Zauberkunststücke«. Von der Kanzel aus beschwor er das Pfingstwunder, jenen Augenblick, als der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus niederfuhr, und als seine Jünger später vom heiligen Geist erfüllt waren und in Zungen redeten. Die Gemeinde ging mit, erwiderte die gesungenen Worte von Fair, begleitet von Händeklatschen, Fußstampfen und ekstatischem Schreien, während der Reverend die Kirche mit seiner rauen, tiefen Stimme und dem lieblichen Twang seiner Gitarre erfüllte.
In Rileys kleiner Welt war der Reverend so etwas wie ein Rockstar. »Ich kenne nichts, was Gott auf Erden näher käme als Archie Fair«, erinnert er sich. »Er spricht, als wären seine Worte bereits irgendwo in einem Buch aufgezeichnet … Seine Predigt ist wie Musik, und seine Musik – sowohl der Gesang, der aus seinem Mund kommt, als auch der Klang seiner Gitarre – begeistert mich so sehr, dass ich aufspringen und tanzen möchte. Er sagt etwas, und die Gemeinde antwortet ihm, so geht es hin und her und hin und her, bis wir uns alle in einem Rhythmus wiegen, der nicht enden will. Seine Stimme ist tief und rau, seine Gitarre klingt hoch und rein; sie scheinen einander zuzusingen, sich in einer Art himmlischen Sprache auszutauschen, die ich unbedingt lernen muss.«
An einem Sonntag wendete Riley seinen Blick weg von den Mädchen in den Kirchenbänken und entdeckte die Gitarre des Reverend, deren runde Formen und Kurven er plötzlich noch faszinierender fand als die Körper der schönen Mädchen.
Nach der Kirche besuchte der Reverend oft seine Schwester Lucille, eine Tante von Riley. Die Erwachsenen aßen zuerst, dann erst die Kinder, und die verputzten das, was ihnen ihre Eltern übrig gelassen hatten. Eines Abends hatte Riley bei dieser Regelung Zeit, sich ins Schlafzimmer zu stehlen, wo er die Gitarre des Reverend auf dem Bett liegen sah.
»Während die anderen nicht hinschauen, strecke ich die Hand aus und berühre oh-so-behutsam das Holz der Gitarre«, erinnert sich Riley. »Berühre ihre Saiten, um zu sehen, wie sie sich anfühlen. Es fühlt sich gut an. Fühlt sich wie etwas Magisches an. Und ich frage mich: Wie man sie wohl dazu bringt, einen solchen Klang zu erzeugen? Wie bringt man sie wohl zum Singen?«
Eine Stimme unterbrach den Jungen in seinen Tagträumen. »Nur zu, nimm sie in die Hand«, forderte ihn Archie Fair auf. Nora Ella war dagegen und wütend auf Riley, dass er etwas angefasst hatte, das ihm nicht gehörte, wie Riley sich erinnert, doch »der Reverend beruhigt sie. Der Reverend versteht mich.«
Archie Fair erklärte dem Jungen, seine Gitarre sei eine Silverstone, eine der preiswerten Modelle aus dem Sears-Roebuck-Katalog*.
»Du kannst sie ruhig anfassen, Junge«, sagte Fair zu Riley. »Wird dich schon nicht beißen.« Riley entsann sich dieses Augenblicks in einem sinnenfreudigen Ton: »Er zeigt mir, wie ich sie halten soll, wie ich sie in den Arm nehmen soll. Sie ist größer als ich, aber ich nehme sie dennoch auf den Schoß. Sie fühlt sich gut an meinem Körper an.«
Der Reverend führte Rileys Finger zu verschiedenen Kombinationen aus Saiten und Bünden und brachte ihm eine Folge von drei Akkorden bei. Es war die I-IV-V-Akkordfolge, jene Akkorde, die grundlegend waren für jeden beliebigen Bluessong, den Riley je lernen sollte.
Bei Rileys erster eigener Gitarre handelte es sich vermutlich um eine Diddley Bow, eine einsaitige Brettzither, die sich ein mittelloser Sharecropper aus Gegenständen zusammenbasteln konnte, die er zu Hause fand. (Wenn es stimmt, dass Cousin Bukka dem kleinen Riley eine Gitarre in Berclair überließ, so hatte es dieses Instrument nicht bis nach Kilmichael geschafft.) Eine Diddley Bow bestand im Grunde aus einer Faser (der eigentlichen Saite), die von zwei ins Holz geschlagenen Nägeln gehalten wurde. Die »Saite« konnte beispielsweise aus den Borsten eines Besens gewonnen werden. Der Volkskundler Alan Lomax vertrat die Ansicht, die Diddley Bow gehe auf den früher in Afrika verbreiteten Mundbogen, ein vergleichsweise einfaches Saiteninstrument, zurück: Man führt einen Jagdbogen zum geöffneten Mund und zupft die Bogensehne. Die Mundhöhle diente ähnlich wie bei einer Maultrommel als Klangkörper und verstärkte die gezupfte Saite. Aus dem Mundbogen entwickelte sich eine einsaitige Zither, bestehend aus einer schwingenden Palmfaser, die an einem Steg befestigt und auf einen hohlen Kürbis gespannt wurde. Lomax glaubte, die Diddley Bow oder etwas Vergleichbares sei mit den Sklaven in die Vereinigten Staaten gelangt, wo sie einen »entscheidenden Beitrag bei der Entstehung des Blues« leistete.
Eines Tages tauchte Riley an der Haustür der Hendersons auf. »Miss Bertha«, bat er die Dame des Hauses, »haben Sie vielleicht einen alten Besen?«
»Ja«, antwortete sie, »aber was hast du damit vor?«
Bertha Henderson sah zu, wie Riley den Draht abmachte, der die Borsten des alten Besens zusammenhielt. Den Besenstiel benutzte er als Steg. »Wenn ich die Saite spannte oder sie niederdrückte«, erinnert er sich, »veränderten sich die Töne, und ich bildete mir ein, Musik zu machen.«
Es dauerte nicht lange, und Riley träumte davon, ein Gitarre spielender Landprediger wie Archie Fair zu werden, wenn es ihm nur gelänge, sein Stottern in den Griff zu bekommen und sein Lernpensum in der Schule zu bewältigen. Riley bekam allmählich ein Ohr für Musik. Bereits vertraut mit den Blues-Shoutern der Baumwollfelder und den himmlischen Harmonien des Kirchenchors, entdeckte Riley neue Klänge in der Hütte seiner Großtante Mima.
Myony »Mima« Stell war die jüngere Schwester von Rileys Großmutter. Mima kam 1891 zur Welt und war Anfang 40, als Riley nach Kilmichael kam. Mima hatte die jugendlichste Einstellung in der ganzen Siedlung, sie war »die modernste« von allen Verwandten Rileys, erinnert er sich. Sie kaute Tabak und erdrückte Riley fast mit Umarmungen und feuchten Küssen, die nach Kautabak rochen, wenn der Junge zu Besuch kam. Riley erduldete diese überschwänglichen Begrüßungen, um Zugang zu ihrem Victrola-Grammophon zu bekommen, das mit einer Kurbel betrieben wurde. Mima besaß eine Plattensammlung, die erste, die Riley überhaupt je zu Gesicht bekommen hatte. Ihre Victrola hatte Walzen aus Kunststoff oder Wachs, kerzenförmige Rollen, die ersten Tonträger, die man als »Platten« bezeichnen konnte. Später drehte sich bei Mimas Gerät ein Plattenteller, und so sammelte sie die flachen, zerbrechlichen Schellackplatten mit 78 Umdrehungen pro Minute. Für Riley sahen diese Platten wie fliegende Untertassen aus. Tante Mima zeigte ihm, wie man die Platte auf den Teller legt und die Nadel aufsetzt. »Es dauerte eine Sekunde«, erinnert er sich, »und dann – wow! – flogen mir diese schönen, kratzigen Töne entgegen, sie durchdrangen mich, elektrisierten meine Seele.«
In diesen Plattenrillen entdeckte Riley eine ganz neue Welt aus aufgenommenen Tönen und Klängen. In Mimas Hütte hörte der Junge zum ersten Mal Blind Lemon Jefferson, einen Texaner, dessen kräftige, klagende Melodien und komplexe, lebhafte Gitarrenläufe Riley an die Blues-Shouter seiner Verwandten aus Mississippi erinnerten. Riley schwelgte im vollen, erdigen Blues einer Bessie Smith, in dem orchestralen Big-Band-Sound von Duke Ellington, er lauschte sogar den bahnbrechenden Country-Blues-Jodlern von Jimmie Rodgers aus Mississippi.
Blind Lemon Jefferson, der erste große Bluesmann, dessen Stimme auf Schallplatte verewigt wurde, tauchte nicht etwa im Mississippi-Delta auf, sondern in East Texas. Seine kratzigen Paramount-Aufnahmen inspirierten Riley »B.B.« King schon früh.
Doch nichts berührte Riley so sehr wie die sanften, melodischen Gitarrenklänge von Lonnie Johnson. Alonzo »Lonnie« Johnson stammte aus New Orleans und beherrschte die Geige, ehe er sich der Gitarre zuwandte. Er erkannte sofort, dass die Gitarre das Potential zum Soloinstrument hatte, und er legte den Grundstein für ein ganzes Vokabular an »Single-note«- bzw. Einzelton-Virtuosität, die jeden Gitarristen nach ihm beeinflussen sollte. Lonnie Johnson war wahrscheinlich der erste Gitarrist, der »seinen Stil auf sauber gespielte Einzelnoten ausrichtete, und nicht auf geschrummelte Akkorde – mit anderen Worten: Er war der erste Gitarrist, der wie ein Bläser phrasierte«, schreibt der Blues-Historiker Francis Davis. Johnson wechselte frei zwischen Blues und Jazz, als beide Musikrichtungen noch nicht in getrennte Schubladen gesteckt worden waren. Er spielte verminderte und übermäßige Akkorde, Gebilde, die das Vorstellungsvermögen vieler Bluesmusiker überstiegen. Er dehnte und entspannte die Saiten durch Bewegungen der Greifhand vertikal zum Griffbrett, um Töne höher oder tiefer klingen zu lassen. Er spielte blitzschnelle Riffs. Manchmal verharrte er auf einer einzelnen Note, wie Louis Armstrong, wedelte mit der Hand am Gitarrenhals und schlug die Saite an, um ein unverkennbares Vibrato zu erzeugen. Geigenspieler hatten das Vibrato über Jahrhunderte kultiviert, aber vor Lonnie Johnson scheint kein nennenswerter Gitarrist eine Saite so zum Flattern gebracht zu haben.
Niemand übte einen größeren Einfluss auf den jungen Riley King aus als Lonnie Johnson, ein virtuoser Jazz-Bluesgitarrist aus New Orleans und Pionier des Einzelton-Solos.
Johnson hätte der erste Superstar an der Jazz-Gitarre werden können, doch schritt das Schicksal in der Form ein, dass Johnson 1925 einen Blues-Talentwettbewerb in St. Louis gewann. Das brachte ihm einen Plattenvertrag ein, und fortan fand sich Johnson in der ersten Reihe des populären Blues wieder. Zwischen 1925 und 1932 nahm er ungefähr 130 Seiten für das Okeh Label auf und wurde auf diese Weise einer der erfolgreichsten und produktivsten Künstler seiner Zeit. Riley konnte von ihm gar nicht genug hören.
Während der letzten Monate des Jahres 1935 lebte Nora Ella in der French Camp-Siedlung, gut zwölf Meilen entfernt von ihrer Mutter und ihrem Sohn. Sie hatte einen neuen Mann, Elger (oder Elder) Baskin, der kein großes Interesse an ihren Verwandten aus Kilmichael hatte oder daran, ein Kind großzuziehen. »Soweit ich weiß, sah er Riley nur einmal«, erinnert sich Lessie Fair.
Nora Ella war gerade einmal knapp 25 Jahre alt, doch um ihre Gesundheit war es nicht gut bestellt. Riley traute sich nicht, seine Großmutter zu fragen, wie es seiner Mutter ging: »Ich hatte Angst vor den Antworten.« Eines Tages, vermutlich am Jahresende 1935, ließ Nora Ella die anderen wissen, dass ihr Ende nahe war. Elnora weckte Riley, der bereits ihrem Blick entnahm, dass etwas nicht stimmte. »Fahren wir zu Mama?«, fragte er. Seine Großmutter nickte. Sie stiegen auf einen von einem Pferd gezogenen Wagen und machten sich so auf den Weg zu Nora Ellas Sterbelager.
»Es ist Winter, und nichts wächst, und die Felder liegen brach, und ich frage mich, wie viele Menschen wohl zwischen diesem und dem letzten Winter gestorben sein mögen«, erinnert sich Riley. »Ich sage kein Wort, und Großmutter auch nicht. Der Klang der Pferdehufe, die auf dem Boden aufschlagen, ist wie das Schlagen einer Uhr, die nicht aufhört zu ticken. Meine Kehle ist ganz trocken, und meine Nase läuft und ist eiskalt … ich frage mich, ob mir jemals wieder warm wird.«
Endlich kommt der Wagen an einer alten Bretterbude an.
»Mamas Augen sind halb geschlossen«, erzählte Riley, und »von einem dünnen Film bedeckt, der ihr einen verschleierten, entrückten Ausdruck verleiht.« Entsetzt nimmt er wahr, dass Blut aus Nora Ellas Augen sickert. »Als ich mich über sie beuge, findet ihr Blick nicht meinen. In diesem Moment wird mir bewusst, dass sie blind ist.« In seiner Phantasie malt er sich aus, wie er sie zum Fuhrwerk führt und zurück nach Hause bringt, weiß aber , dass er das nicht vermag. »Ihre Arme sind dünn wie Zahnstocher, ihr Körper ist so zerbrechlich, als würde sie entzweibrechen. Sie atmet schwer, und als sie etwas sagt, kann sie dies nur mit großer Mühe.«
Nora Ella griff matt nach Rileys Hand und war im Begriff, etwas zu sagen. Ihre Lippen bewegten sich, doch fehlte ihr die Kraft, die Worte zu formen und hervorzubringen. Riley beugte sich weit zur ihr herunter, brachte sein Ohr dicht vor ihren Mund, um ihr heiseres Flüstern zu verstehen. »Freundlichkeit …« Er wartete auf weitere Worte, aber ihre Stimme versagte. Sie sammelte noch einmal Kraft auf und fuhr fort: »Die Leute werden dich lieben, wenn du ihnen mit Liebe begegnest … Vergiss das nicht, Sohn. Ich liebe dich, Riley.«
»Ich will nicht, dass du fortgehst«, flehte er. »Ich will nicht, dass du mich verlässt.«
»Ich werde dich niemals verlassen«, antwortete sie. »Ich werde immer bei dir sein. Ich werde immer deine Mutter sein.«
Und dann erklärte Elnora ihrem Enkel, dass es an der Zeit sei, aufzubrechen. »Es wird bald dunkel.«
Nora Ella starb in derselben Nacht. Sie war 26, vielleicht auch 27 Jahre alt. Ihr einziges überlebendes Kind war zehn. Nora Ellas Körper wurde einbalsamiert, wieder zur Hütte gebracht und auf einem gekühlten Brett aufgebahrt, einer perforierten Fläche mit daruntergelegtem Eis. Am nächsten Tag legte man ihre sterblichen Überreste in einen Sarg und brachte den Leichnam für die Beerdigung zum afroamerikanischen Friedhof nach Pinkney Grove. Jahre später konnte sich Riley nicht an die Beerdigung erinnern.
In der Rückschau wissen wir nicht viel über das kurze Leben von Nora Ella King. Offenbar gibt es keine offizielle Sterbeurkunde, kein Foto, das ihre Existenz hätte bestätigen können. Sie wurde in einem anonymen Grab in Pinkney Grove bestattet, auf einem schlichten Friedhof auf einer freien Fläche gegenüber der Kirche, an einer Stelle also, die den Mittelpunkt von Rileys kleiner Welt darstellte. Heute stehen einige Dutzend verwitterte Grabsteine auf dem Friedhofsgelände, verstreut inmitten von Laub und moosigen Stellen, auf einer Lichtung, in die langsam ein Kiefernwald vordringt. Keiner dieser alten Grabsteine trägt den Namen von Nora Ella. Riley lehnte immer wieder Bitten ab, einen Grabstein zu Ehren seiner Mutter zu errichten. Enge Freunde von ihm ahnten den Grund für Rileys ablehnende Haltung: Hätte er einen Stein am Grab seiner Mutter aufstellen lassen, hätte er sich eingestanden, dass sie fort war, und das war etwas, wozu Riley nie wirklich bereit war.2