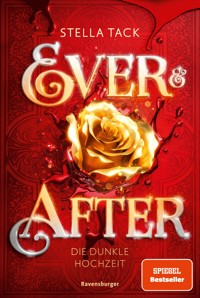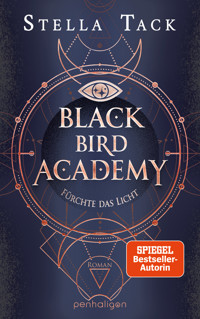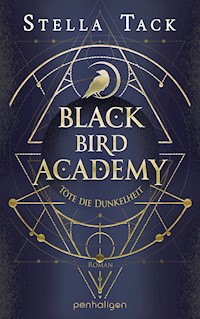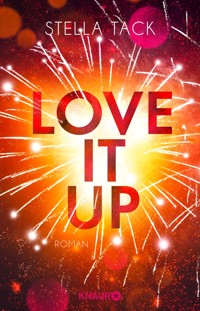Kiss Me Twice - Kiss the Bodyguard, Band 2 (SPIEGEL-Bestseller, Prickelnde New-Adult-Romance) E-Book
Stella Tack
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Kiss the Bodyguard
- Sprache: Deutsch
Ihr wichtigster Job: den Prinzen zu beschützen. Die größte Gefahr: die Anziehung zwischen ihnen. Silver ist Absolventin der Bodyguard-Academy in Miami. Sie ist knallhart und Jahrgangsbeste, und doch sind die Jobs rar. Bis Silver das Angebot erhält, undercover als Begleitschutz für Prinz Prescot zu arbeiten – niemand anderes als der Thronerbe von Nova Scotia. Von verwöhnten Royals hält Silver gar nichts, doch Prescot entpuppt sich als äußerst charmant. Und schon bald merkt sie, dass sie nicht nur Prescot vor Paparazzi schützen muss, sondern insbesondere ihr eigenes Herz vor dem Prinzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
OriginalausgabeAls Ravensburger E-Book erschienen 2020Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag© 2020 Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 RavensburgText © 2020 Stella TackDieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).Umschlaggestaltung: unter Verwendung von Fotos von © piyaphong/Shutterstock; © Maram/Shutterstock und © MrVander/ShutterstockLektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de)Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbHISBN 978-3-473-51067-2www.ravensburger.de
Für meine Tochter Aurora:ein Mami-Glitzer-Buch nur für dich!(Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du groß genug bist, um dieses Buch zu lesen, dabei rot wirst und mich schrecklich peinlich findest.)
Silver
»Ich bin was?«
»Du bist gefeuert, Silver.«
»Wiederhol das bitte noch mal, Boss. Ich habe mich sicher verhört. Für mich hat das gerade danach geklungen, als hätte mich dieser Schnöselschwanz gefeuert.«
»Dass du deinen Klienten Schnöselschwanz nennst, könnte einer der Gründe sein, aus denen er dich gefeuert hat!«, bellte mein Chef.
Harry MacCain lehnte sich mit verschränkten Armen in seinem Sessel zurück. Das Kunstleder knarrte, während er mich streng musterte, und die Uhr an der Wand neben ihm tickte viel zu laut und anklagend. Ein Ventilator versetzte die künstliche Zimmerpflanze in hektisches Flattern. Mein Herz flatterte panisch mit. Nein, nein, nein! Ich durfte diesen Job nicht verlieren. Nicht schon wieder! Obwohl ich innerlich vor Panik durch den Raum rannte, zog ich von außen sichtbar nur meinen linken Mundwinkel herab. Wenn ich was draufhatte, dann das Resting Bitch Face. Tief atmete ich durch und hob den Blick von der ausgedruckten E-Mail, die Harry mir in die Hand gedrückt hatte. Nein, nein, nein!
Hinter Harry zog sich an der Gebäudeseite eine gläserne Wand entlang, durch die man einen Blick quer über Miami werfen konnte. Wie überall in der Stadt wurde alles von dichtem Verkehr eingeschlossen, während weiter hinten die Meeresbrandung gegen den Sandstrand schlug. Die Sonne brannte selbst durch das Fenster auf meiner Haut, und die Klimaanlage hatte Mühe, ein wenig kühle Luft zu erzeugen.
Ich starrte so lange auf das Gatorade-Werbeplakat an der Hauswand schräg gegenüber, bis ich mir sicher war, dass ich Harrys Zimmerpflanze nicht durchs Fenster pfeffern würde. Oder mich selbst.
»Und warum genau hat der Schnö…«, setzte ich an, und Harry zog warnend eine Augenbraue hoch, »… hat Mr Langton«, verbesserte ich mich, auch wenn der Name mehr wie ein Knurren klang, »mich rausgeschmissen?« Ich pustete mir eine lange Strähne meines beinahe weißen Haars aus dem Gesicht.
Harry seufzte, was ebenfalls eher wie ein Knurren klang. Auch wenn er nicht mein leiblicher Vater war, erinnerten mich Augenblicke wie dieser daran, dass Harry mich quasi großgezogen hatte. Und mit meinen knapp einsachtzig war ich auch wirklich groß geworden.
»Das hab ich Mr Langton auch gefragt«, sagte Harry und sah mich scharf an. »Und stell dir vor, sein Assistent hat mir daraufhin eine Beschwerdeliste gefaxt, die fünfzehn Seiten umfasst.«
Harry entknotete seine muskulösen Arme und schob mir eine graue Mappe über den gläsernen Schreibtisch zu. Ich schnappte mir das Ding, schlug es auf und starrte fassungslos hinein.
»Himmel, Harry! Er lässt dir so einen Bullshit faxen? Faxen?! Welcher normale Mensch macht denn so was noch? Hat der Typ keine E-Mail-Adresse?«
»Überbezahlte Assistenten von Schauspielern machen so was. Von Schauspielern, die es nebenbei nicht gut finden, wenn du ihnen die Nase brichst«, erwiderte er trocken, und für eine Sekunde glaubte ich, so etwas wie Amüsement in seinen grünen Augen aufblitzen zu sehen.
Ich blickte auf und wusste, dass ich dabei weder zerknirscht noch reumütig aussah, sondern verdammt noch mal stolz. »Der Kerl war sturzbetrunken und hat mir an den Hintern gegrapscht«, sagte ich. »Er kann froh sein, dass es nur seine Nase war, die ich getroffen hab.«
»Das hab ich ihm auch erklärt«, sagte Harry ruhig. »Was der einzige Grund dafür ist, dass du nur deinen Job verloren hast, anstatt zusätzlich eine Klage wegen Körperverletzung am Hals zu haben.«
»Klage? Dieser … Was? Ich atme zu laut? Harry, in diesem Wisch steht, dass er meine Atmung zu penetrant findet, wenn ich neben ihm stehe.« Fassungslos hielt ich ihm die Zettel unter die Nase und tippte auf Punkt 8.
»Ich weiß. Ich habe alle fünfzehn Seiten gelesen«, brummte Harry mit der Leidensmiene eines Mannes, der zu alt für diesen Scheiß war.
»Und hier steht …« Ich blätterte um und spürte, wie sich meine Nasenflügel blähten. »Auf Seite 9 steht: Miss Silvers Erscheinungsbild entspricht nicht den gewünschten Kriterien. Ich bin … zu groß?« Fassungslos sah ich auf. »Ich … was? Einfach nur was?«
»Er fand es wohl unangenehm, zu dir aufsehen zu müssen.« Harry wirkte beinahe, als würde er sich ein Lachen verkneifen.
Ich hätte es vielleicht ebenfalls witzig gefunden, wenn die Situation nicht so übelst real gewesen wäre.
»Harry!« Ich ließ die Zettel auf seinen Schreibtisch fallen und stützte die Handflächen rechts und links davon auf. Mein dicker Flechtzopf fiel mir dabei über die tätowierte Schulter. »Was kann ich denn für seine Komplexe? Bei allem Respekt, der Kerl ist der totale Widerling! Er war andauernd betrunken und hat das Personal wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mich …«
»Natürlich konntest du das nicht, Silver«, unterbrach mich Harry. Ein warmer Ausdruck huschte durch seine Augen, aber zugleich bildete sich eine steile Falte zwischen seinen Brauen. »Ich hätte dich von Anfang an lieber woanders eingesetzt, aber er war zu diesem Zeitpunkt der einzige meiner Klienten, der einen weiblichen Bodyguard angefragt hat. Außerdem ist es bereits der zweite Job, den du innerhalb eines Jahres verloren hast, und … wie soll ich das sagen … die Leute wollen keinen …«
»… weiblichen Bodyguard«, beendete ich seinen Satz und spürte, wie sich in meinem Hals ruckartig etwas zusammenzog.
Harry seufzte. Der Straßenlärm unter uns drang durchs geschlossene Fenster, und irgendjemand hupte laut. Wahrscheinlich meine nicht existente Karriere, die gerade mit voller Wucht gegen die Wand krachte.
»Frauen sind in diesem Job schwer zu vermitteln, besonders wenn sie noch so jung sind wie du, Silver«, murmelte Harry und rieb sich die Stirn.
Besorgt beobachtete ich, wie er ein orangefarbenes Pillendöschen aus der Schublade seines Schreibtischs zog und drei Tabletten mit einem Schluck kaltem Kaffee hinunterspülte.
»Wird die Migräne schlimmer?«, erkundigte ich mich leise und richtete mich wieder auf.
Er winkte ab, schmiss jedoch noch zwei Tabletten nach. »Nicht der Rede wert. Es waren nur ein paar anstrengende Wochen.«
Skeptisch schürzte ich die Lippen. Seit ich Harry kannte – und das war im Grunde seit meiner Kindheit –, litt er schon unter Migräne. Vor allem schien es schlimmer zu sein, seit sein Sohn Ryan angeschossen worden war und sich in seine Klientin verliebt hatte. Nicht zwingend in dieser Reihenfolge.
Ryan! Ich ballte die Hände zu Fäusten und verschränkte die Arme vor der Brust. Noch so einer, mit dem ich ein Hühnchen zu rupfen hatte. Zumindest falls ich mich entschloss, wieder mit ihm zu sprechen. Seine letzten zwanzig Nachrichten hatte ich bisher unkommentiert gelassen. Was glaubte er denn? Dass ich ihm nur wegen eines Pandabären-Emojis mit verzeihungsheischenden Tränen in den Augen vergab, dass er ohne jedes Wort einfach nach Kanada abgehauen war? Ich hatte erst von Harry erfahren, was mit Ryan passiert war, nachdem ich meinen ersten Job in Las Vegas verloren hatte und nach Miami zurückgekehrt war.
Das kam davon, wenn man sich mit Kerlen wie Ryan MacCain befreundete. Sein Sandkuchen hatte damals grauenvoll geschmeckt! Das hätte mir eine Warnung sein sollen. Befreunde dich niemals mit einem Kerl, der nicht einmal einen Sandkuchen zustande bringt. Denn er wird dich fünfzehn Jahre später für ein Mädel hängen lassen.
»Silver, hörst du mir zu?«
»Nein«, gab ich ehrlich zu und blinzelte zu Harry hinüber.
Er sah mich streng an. »Interessiert dich, was ich zu sagen habe, oder tötest du lieber weiter meine Topfpflanze mit Blicken?«
»Verzeihung.« Ich räusperte mich und ließ die Arme wieder hängen. »Hast du einen neuen Job für mich?«, fragte ich leise und spürte den Stich der Enttäuschung und Frustration, als Harry den Kopf schüttelte.
»Ich werde mich umsehen. Bis dahin übernimmst du wieder das Training der Küken-Gruppe.«
»Was? Nein. Wieso?« Entsetzt starrte ich ihn an.
Harry massierte sich die Schläfen. »Betrachte es als Strafe, weil du einem Klienten die Nase eingeschlagen hast und ich sonst niemanden finde, der es freiwillig macht.«
»Nein, Harry! Bitte schick mich nicht wieder in diese Hölle.«
Mit wachsendem Entsetzen erinnerte ich mich an die grauenvollen Wochen vor sechs Monaten, als ich die Küken-Gruppe bereits einmal trainieren musste. Harrys Securityfirma bot neben der Ausbildung zum Bodyguard auch einige Programme für unter Zehnjährige an. Offiziell, um spielerisch erste Kampftechniken zur Selbstverteidigung zu lernen. Im Endeffekt rollten sich aber nur überzuckerte, aufgekratzte Grundschüler auf Turnmatten herum.
»Du schaffst das schon«, winkte Harry ab. »Meine Zwillinge sind schwer beeindruckt von dir. So begeistert sind sie sonst nur, wenn sie irgendwas in die Luft sprengen.«
Gequält verzog ich das Gesicht, als ich an Ryans Geschwister Sherly und Josh dachte. Die zwei waren Ausgeburten der Hölle. Sehr niedliche Ausgeburten, aber unbestritten aus der Hölle. Ryan und ich waren niemals so anstrengend gewesen … oder?
»Okay.« Ich seufzte.
Harry brummte zufrieden und schob mir wieder einen Zettel über den Tisch. Wo hatte er die nur immer so schnell her? »Hier ist dein Arbeitsplan. Ich melde mich, falls ein neuer Job für dich reinkommt.«
»Danke, Harry.« Zähneknirschend nahm ich den Plan entgegen und durchquerte das helle Büro.
»Ach, Silver, eins noch«, hielt mich Harry auf, als ich bereits dabei war, die Tür zu öffnen.
Mit erhobener Augenbraue drehte ich mich um.
»Wie geht es deinem Vater? Hast du was Neues von ihm gehört?«, fragte er sanft.
Mein Mundwinkel sank wieder hinab. Trotzdem antwortete ich ehrlich. Ehrlichkeit zählte zu den wenigen Dingen, die ich besaß und geben konnte.
»Nein. Das letzte Mal war vor drei Monaten. Da war er noch in Afghanistan stationiert, und es sah nicht so aus, als würde er dieses Jahr nach Hause kommen«, antwortete ich tonlos und war dankbar, dass sich nur mein Herz verkrampfte, die Tränen aber ausblieben. Ich hatte einfach keine mehr. Nicht für diesen Menschen. Schon lang nicht mehr.
Harry musterte mich ernst. »Du weißt, wenn du meine Hilfe brauchst, kannst du jederzeit zu uns zurückkommen, Silver. Mrs MacCain freut sich immer, wenn sie für dich kochen kann.«
Ein kaum merkliches Lächeln hob meinen Mundwinkel wieder an. »Danke. Aber ich komme sehr gut allein zurecht.«
»Ja, so warst du schon immer«, sagte Harry leise, aber sichtlich stolz.
Ich nickte und verließ sein Büro. Dabei tat ich so, als würde ich seinen besorgten Blick, der mir durch die Glastür folgte, nicht bemerken.
Silver
Völlig fertig ließ ich mich auf das billige Schlafsofa fallen und friemelte einen Chupa Chup aus meiner Hosentasche. Das Zeug war so süß, dass es einem beim Lutschen praktisch die Geschmacksknospen abtötete. Genüsslich biss ich in den Zuckerkörper und starrte an die Decke, an der nur eine nackte, tief hängende Glühbirne pendelte. Obwohl es bereits dunkel wurde, konnte ich nicht die Motivation aufbringen, das Licht einzuschalten. Draußen heulten Polizeisirenen, und wann immer die U-Bahn vorbeiratterte, bröckelte der Putz von der Decke. Morgens musste ich immer meine Kaffeetasse festhalten, damit sie mir nicht von dem Tischchen kippte, das ich mit alten Kinoplakaten beklebt hatte.
Ich ließ den Blick schweifen, von meiner dunkelroten Schlafcouch über die dünnen Wände, die ich im Lauf der vergangenen Jahre mit Bandpostern und alten Schwarz-Weiß-Horrorfilmplakaten verziert hatte. Es sah beinahe künstlerisch aus, obwohl ich eigentlich nur versucht hatte, die Wasserflecken zu überdecken. Neben dem Schlafsofa standen ein paar Regale, die ich aus alten Obstkisten zusammenschustert, mit schwarzer Farbe angesprüht und sorgfältig mit meiner DVD- und Kassettensammlung befüllt hatte. Allesamt Klassiker, angefangen von The Munsters über Psycho und Die Nacht der lebenden Toten bis hin zu Die Vögel. Das Ganze hatte ich mit ein paar Lichterketten aufzuhübschen versucht. Mein persönliches Schmuckstück war jedoch der alte Fernseher aus den Siebzigern, ein uralter Kasten mit brauner Holzvinylverkleidung. Wenn ich umschalten wollte, musste ich aufstehen und einen der vier weißen Knöpfe drücken. Die abstehenden Antennen sahen ein bisschen so aus wie von einem Alienraumschiff.
Das einzig wirklich Lebendige in diesem Raum war Mr Hyde, mein Kaktus. Ich hatte ihn von Ryan geschenkt bekommen, als ich mit zwölf unser gemeinsames Schulprojekt getötet hatte. Also die Sonnenblume, die wir hätten züchten sollen. Alles Grüne, was ich anfasste, starb innerhalb von wenigen Tagen. Ryan hatte mir den Kaktus damals mit den Worten übergeben: Der Kaktus ist wie du. Stachlig, aber unverwüstlich. Ihr werdet euch mögen.
Tja, wir mochten uns. Mr Hyde war das Einzige, was nicht einging, und zweimal im Jahr blühte er sogar. Schwere rosarote Knospen, die den etwas feuchten Geruch der Wohnung mit einem angenehmen Duft verdeckten. Mr Hyde hätte allerdings schon vor Wochen blühen sollen, doch er schien derzeit genauso zu bocken wie mein restliches Leben. Ich gab ihm zu trinken, drohte ihm, stellte ihn in die Sonne, dann wieder in den Schatten, schmollte ihn an, und trotzdem blühte er nicht.
Ich seufzte. Im Grunde war meine Wohnung eine einzige Bruchbude. Aber es war meine Bruchbude. Ich finanzierte diese vier dünnen Wände, seit ich mit sechzehn endlich bei meiner Tante ausgezogen war. Seitdem hatte ich mich neben der Highschool und meiner Ausbildung mit Kellnerinnen- und Babysitterjobs bei Sherly und Josh über Wasser gehalten. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte ich mehr bei den MacCains gewohnt als bei meiner charakterschwachen Tante und ihren ständig betrunkenen und wechselnden Kerlen.
Ich schnaubte, stand auf und drückte den Knopf meines Alienfernsehers. Die Röhren summten, das Bild flimmerte, und die letzte Kassette, die ich in den Videorekorder der ersten Stunde eingelegt hatte, begann abzuspielen. Der Unsichtbare. Ich ließ mich aufs Sofa zurückfallen und versuchte angestrengt, die Gedanken zurückzudrängen, die in mir hochkrochen, doch …
Fuck! Ich war wirklich neben der Spur. Ich schloss meine brennenden Augen und spürte, wie sich die Gedanken über meinen Vater einschlichen. Oft schaffte ich es, sie zu verdrängen, ihn zu verdrängen. Doch Harrys Frage nagte an mir. Mein Vater fiel mir immer dann ein, wenn ich es am wenigsten gebrauchen konnte. Wie ein Echo, das manchmal laut, manchmal leise in mir nachhallte. Auch ich hatte einen Unsichtbaren in meinem Leben: meinen Vater. Obwohl er noch lebte, noch existierte, sah ich ihn nicht. Nie.
Ich versuchte, ihm keinen Vorwurf daraus zu machen, dass er mich mit Tante Merryl alleingelassen hatte. Ich wusste, dass er glaubte, keine andere Wahl gehabt zu haben, aber … ich war mir trotzdem sicher, dass er sich anders hätte entscheiden können. Er und Harry kannten sich noch aus der Militärausbildung. Beide hatten zusammen fünf Jahre Militärdienst geleistet, bis Harry seine Securityfirma aufgemacht hatte. Mein Vater war dagegen beim Militär geblieben.
Während ich den Lolli zerbiss, krümmten sich meine Finger und fuhren in die Sofarille, wo ich auf ein gefaltetes Foto stieß. Langsam zog ich es heraus. Es war so oft gefaltet worden, dass sich die feinen Knicke wie Spinnweben durch das alte Papier zogen. Die Ränder waren abgestoßen und zerfranst. Das Schwarz-Weiß-Bild meines Fernsehers flackerte hell, sodass ich die drei Gesichter sehen konnte, die mir glücklich aus dem Foto entgegenlächelten: mein Vater in seiner Militäruniform, meine Mom mit ihren langen, beinahe weißen Haaren und ich mit einer Zahnlücke, wo eigentlich der rechte Schneidezahn hätte sein sollen, den ich beim Rollerfahren verloren hatte.
Das Foto war im Sommer an meinem vierten Geburtstag aufgenommen worden. Im Dezember desselben Jahres war meine Mom an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Mein Dad war damals schon viel fort gewesen, doch seitdem kam er fast gar nicht mehr nach Hause. Er war schlichtweg überfordert mit sich selbst, dem Verlust seiner Frau, der Welt und einer weinenden Vierjährigen gewesen. Er hatte mich zu Tante Merryl gebracht. Tante Merryl, die ein Talent dafür hatte, ihre Jobs zu verlieren und einen miesen Kerl nach dem anderen anzuschleppen. Das Unterhaltsgeld, das mein Vater schickte, bekam ich nie zu sehen. Tante Merryl war kein schlechter Mensch, aber sie war unglaublich schwach. Zu schwach, um sich selbst oder gar ihre Nichte vor der Welt beschützen zu können. Also war ich eben stark geworden. Stärker als sie, stärker als mein Vater.
Meine Finger ballten sich um das Foto, quetschten es zusammen, sodass das Lächeln meiner Mom Wellen schlug. Ich stopfte es zurück in die Sofaritze. Das war echt alles für den Arsch. Jetzt musste ich auch noch einen neuen Job finden. Sah ganz so aus, als ob Tante Merryls Einfluss doch auf mich abfärbte.
»Komm schon, Silver, reiß dich zusammen«, knurrte ich mir selbst zu und nahm den Lollistiel aus dem Mund. Entschlossen stapfte ich in die Miniküchenzeile, die eigentlich nur aus Schrank, Gasherd und einem geschrumpften blauen Kühlschrank bestand, den ich liebevoll »Schlumpfi« nannte. Eine Diele knackte und hob sich leicht an. Das Gefühl war beruhigend. Unter dieser Diele befand sich eine Spardose, und in der war mein Gehalt von beinahe zwei Jahren. Jetzt musste ich nur noch einen neuen Job finden und ein weiteres Jahr arbeiten, dann konnte ich all die Schulden zurückzahlen, die sich während meiner Ausbildung bei Harry angesammelt hatten. Ich hatte es fast schon geschafft. Und würde es ganz schaffen. Komme, was da wolle. Es musste einfach nur ein neuer Job her.
Ich riss den Kühlschrank auf und besah mir den Inhalt. Jupp, da war nichts drin außer … Was war das? Ich legte den Kopf schief. Seit wann hatte ich so ein kleines schwarzes Gemüse in meinem Kühlschrank? Und vor allem … warum starrte das kleine schwarze Gemüse zurück? »Scheiß Kakerlake!«, fluchte ich.
Die Kakerlake zuckte und begann blitzschnell auf mich zuzuwuseln. Ebenso blitzschnell knallte ich den Kühlschrank wieder zu und sprang auf. Nicht schon wieder! Die Dinger waren in den gesamten Südstaaten die reinste Plage. Hier in diesem miesen Viertel von Miami gehörten sie praktisch zur Grundausstattung. Trotzdem musste ich das Ganze dem Vermieter melden, und der würde aus Gründen der Schädlingsbekämpfung wieder mal die Miete erhöhen. Das Geld ging – das Ungeziefer blieb. Ich verpasste Kühlschrank Schlumpfi einen frustrierten Tritt, schnappte mir meine Schlüssel und zog mir die schwarzen Converse wieder an. Sparen war gut, doch hungern konnte ich mir auch nicht leisten. Ich schaltete den Fernseher aus und verließ das Haus. Mr Hyde schmollte mir hinterher.
Sobald ich die Haustür hinter mir schloss, mischte sich der salzige Geruch des Meers mit der typischen drückend schwülen Hitze Floridas. Das Gittertor zum Hinterhof klirrte, als ich es hinter mir zuschlug. Der Dobermann des Nachbarn begann zu kläffen, und drei Fenster über mir starrte die alte Miss Pips zwischen ihren gelblichen Spitzengardinen zu mir hinab. Fröhlich winkte ich ihr zu. Die Alte starrte mich so entsetzt an, als hätte ich ihr den Mittelfinger gezeigt, und zog ruckartig die Gardinen zu. Jupp, die Gegend hier war wirklich Zucker. Aber zumindest musste ich mir um meine Sicherheit keine Sorgen machen. Mit den wenigen Kerlen, die sich tatsächlich getraut hatten, mir blöd zu kommen, hatte ich den Asphalt aufgewischt. Ich würde Harry immer, immer, immer dankbar sein, dass er mir die Ausbildung zur Security finanziert hatte.
Ich trat eine Cokedose aus dem Weg und stapfte die Straße entlang. Das grünliche Licht der Laternen warf meinen Schatten gezackt auf den Asphalt, und ich erkannte mein Spiegelbild in der Scheibe der chinesischen Imbissbude, die ich ansteuerte. Was ich darin sah, ließ mich für einen Wimpernschlag innehalten. Eine junge Frau starrte mich aus ernsten, blauen beinah grauen Augen an. Einen Meter achtzig groß, mit einem langen, weißblonden Zopf, der ihr fast bis zur Hüfte hing. Die Arme, die aus den hochgekrempelten Ärmeln der Collagejacke hervortraten, von oben bis unten tätowiert. Ich war mir nicht sicher, ob mir gefiel, was ich sah. Denn immer wieder ertappte ich mich bei der Frage, ob ich wohl anders aussehen würde, wenn mein Leben anders verlaufen wäre.
Ich schüttelte den Kopf. Als ich in den Imbiss trat, klingelte eine Glocke, und Chao Lin grinste mich durch den Dampf an, der aus einer Wokpfanne aufstieg.
»Hi, Silver! Wieder nix im Kühlschrank gefunden, was?«, begrüßte er mich mit schwerem Südstaatenslang.
»Doch. Ungeziefer.«
Chao grinste breit. Er sah irgendwie immer glücklich aus, und oft unterhielt ich mich mit ihm, einfach um mich mit etwas Fröhlichem zu beschäftigen.
»Das haben wir hier auch«, meinte Chao, ohne mit der Wimper zu zucken. »Wenn es zwischen den Zähnen knirscht, dann tu einfach so, als wäre es der Pak Choi.« Er grinste.
»Toll. Dann nehme ich die Nudeln mit Hühnchen ohne Pak Choi.« Lächelnd schob ich ihm einen Fünfer über den speckigen Tresen.
»Okay, eine Extraportion ohne Kakerlaken, kommt sofort!«
»Warum extra?«
»Weil du aussiehst, als hätte dir eine Katze in deinen Morgenkaffee gepisst«, erwiderte er fröhlich und warf die Zutaten in seinen Wok.
»Hmpf.« Ich ließ mich auf den roten Barhocker fallen, während im Hintergrund eine schrille chinesische Melodie dudelte.
Chao lachte wieder und zog sein weißes Stirnband zurecht. »Du bist zu oft hier, Silver. Geh doch mal einkaufen oder such dir einen Freund, der für dich kocht.«
»Ich brauche keinen Typ, der mir sagt, was ich zu tun habe«, brummte ich.
Er grinste wieder und schob mir den vollen Teller über den Tresen. »Dann such dir einen Prinzen, dem du sagst, was er zu tun hat.«
»Klar. Weil es Prinzen ja im Dollar Tree im Angebot gibt«, witzelte ich und riss ein Paar Bambusstäbchen entzwei, ehe ich ungefähr ein Pfund Chili über mein Essen kippte. »Aber im Ernst«, wandte ich ein und hob eine Augenbraue. »Wenn jemals ein Kerl mit Krone auf mich zugeritten kommt, hau ich ihm …«
Chao lachte, als mein Handy brummte und mich mitten im Satz unterbrach. Irritiert zog ich es aus der Hosentasche. Auf dem Display leuchtete der Name MacCain auf.
»Was ist? Ruft dein Prinz an?«, fragte Chao amüsiert.
»Fast. Mein Boss«, murmelte ich und spürte, wie Hoffnung in mir aufkeimte. Konnte es sein, dass Harry in so kurzer Zeit einen neuen Job für mich gefunden hatte? Vor Aufregung stach ich mir mit den Stäbchen beinahe selbst ein Auge aus, als ich die grüne Taste drückte.
Chao zwinkerte und widmete sich dem nächsten Kunden, der gerade zur Tür hereinkam.
»Ja, was gibt’s? Schieß los«, sagte ich, sobald ich das Handy ans Ohr presste.
»Fuck, Silver, endlich! Ich dachte schon, du liegst tot in deiner Schrottwohnung. Hast du eine Ahnung, was ich mir für Sorgen um dich gemacht habe?«, schallte es aus dem Hörer.
Ich erstarrte, hielt das Handy weg und stierte auf den Namen. Verdammt, ich hatte den falschen MacCain an der Strippe.
»Silver? Silver! Wehe, du legst auf«, bellte Ryan so laut, dass ich ihn sogar hören konnte, ohne den Lautsprecher am Ohr zu haben. Seine tiefe, weiche Stimme war so erleichtert, dass ich prompt lächelte, ehe mir wieder einfiel, dass ich stinksauer auf den Kerl war.
»Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Ich rede nicht mehr mit dir.«
»Ach ja? Und was tust du dann gerade?«
»Oh, ist das Ryan?«, mischte sich Chao ein. »Sag ihm liebe Grüße von mir!«
»Gar nichts sag ich dem Verräter«, brummte ich, dann schwieg ich weiter in den Hörer, stocherte in meinen Nudeln herum und nahm einen großen Bissen, um mich abzulenken.
»Hey, Silly-Villy, bist du noch dran?«, fragte Ryan sanfter.
Bei der Erwähnung des dämlichen Spitznamens, den er mir schon als Kind verpasst hatte, musste ich prompt wieder gegen den Kloß in meinem Hals anschlucken. »Nein«, sagte ich knapp.
Ryan lachte und klang dabei … glücklich, was mich gleichzeitig faszinierte und irritierte. Wir waren uns in so vielen Dingen ähnlich, vor allem aber waren wir beide zusammen auf das Leben wütend gewesen. Jeder aus seinen eigenen Gründen, doch zusammen auf etwas wütend zu sein, war immer noch besser, als allein auf etwas wütend zu sein. Wir hatten viel geteilt, inklusive unseres sehr unbeholfenen ersten Kusses, der genauso peinlich endete, wie er begann, und ein für alle Mal klarstellte, dass unsere Gefühle füreinander rein platonisch waren. Wir waren uns immer sehr nahe gewesen. Als Menschen. Als Freunde. Wir kannten einander. Wir liebten einander auf eine sehr verkorkste, seltsame Art, die nur wir beide verstanden. Na ja, und manchmal verstanden nicht mal wir sie, aber die guten Dinge im Leben musste man schließlich nicht immer verstehen. Doch so gut ich Ryan auch kannte – dieses glückliche Lachen, das war neu.
»Silver?«
»Ja?«
»Es tut mir leid«, flüsterte er.
Ich legte die Essstäbchen zur Seite. »Ich hab dich vermisst, du Matschbirne«, sagte ich mit rauer Stimme. »Warum bist du einfach verschwunden?«
Ryan seufzte. Schwer. Aber er klang dabei immer noch glücklich. »Die letzten Monate waren ziemlich turbulent«, gestand er ein.
»Soll das eine Entschuldigung dafür sein, dass du plötzlich weg warst?«, fauchte ich.
»Nein. Aber du warst wegen deines Jobs in Las Vegas. Ich wollte dich nicht stören. Außerdem hast du damals ziemlich deutlich gemacht, dass du erst mal dein eigenes Ding durchziehen und dir nicht mein Gejammer wegen Ivy Redmond anhören willst.«
»Ja, aber das ist doch was völlig anderes!«, rief ich und funkelte die rote Papierlampe mit der goldenen Troddel über mir an. »Wenn mein bester Freund sterbend …«
»Jetzt übertreibst du aber.«
»… mit zehn Kugeln im Körper …«
»Es war nur eine.«
»… im Koma liegt …«
»Ich war nur in Narkose.«
»… und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion …«
»Wir sind tagsüber geflogen.«
»… in die Scheißwildnis flieht …«
»Kanada ist gar nicht so wild.«
»… dann will ich das verdammt noch mal wissen!«, brüllte ich ihn an. »Ich bin von dir ja hirnrissige Aktionen gewöhnt, aber das hier war sogar noch schlimmer als damals, als du mit fünfzehn unbedingt auf dieses Rockfestival wolltest und wir das Auto deiner Mom geklaut haben, das dann auf halber Strecke liegen geblieben ist.«
Ryan schwieg, ehe er etwas kleinlaut murmelte: »Das war eigentlich ziemlich episch.«
»Ja, war es«, fauchte ich. »Aber ich will und muss dir gerade nun mal den Arsch aufreißen. Übrigens hat dein Sandkuchen damals scheiße geschmeckt.«
»Was?«
»Du hast mich schon verstanden, Freundchen.«
Und damit legte ich auf. Einfach so. Ich hatte mich dermaßen in Rage geredet, dass mein Herz raste, als wäre ich einen Marathon gelaufen.
»Soll ich deine Nudeln aufwärmen?«, fragte Chao und schielte auf meinen Teller.
»Lass nur.« Seufzend schaufelte ich mir den Rest hinein, während das Handy wieder brummte. Ich aß die Portion auf und wartete, ob Ryan aufgab. Tat er nicht. Das Handy summte ohne Unterlass.
»Was ist?«, knurrte ich schließlich in den Lautsprecher.
»Ich hab gesagt: nicht auflegen! Nicht!«
»Du klingst wie ein Telefonbetrüger.«
»Silver!«
»Ryan!«, äffte ich ihn nach.
»Ich mach es wieder gut«, sagte er und schaffte es, dabei gleichzeitig bockig und reumütig zu klingen.
»Ach, und wie? Mit noch mehr Panda-Emojis?«
»Nein.« Er holte tief Luft, und seine nächsten Worte trieben mir eine Gänsehaut über den Rücken. »Dad hat mir erzählt, dass du gerade Flaute hast. Komm zu mir nach Kanada. Erst mal auf Urlaub, und wenn’s dir hier gefällt, dann helf ich dir, einen Job zu finden.«
Prescot
NOVA SCOTIA
»Prescot Leon Maximilian van Klemmt-Bloomsbury, würdest du mir bitte erklären, was das ist?«
Ich zuckte zusammen, als die Scotian News punktgenau auf meinem Frühstücksei landete. »Mein Frühstück?«, nuschelte ich und schluckte den Bissen Speck herunter, während ich zu meinem Vater hochsah.
Er funkelte mich durch seine randlose Brille an. In seinem schlichten grauen Anzug und mit dem grau melierten Haar sah er aus wie ein Steuerberater. Manchmal glaubte ich, mein Vater wäre auch lieber ein einfacher Steuerberater gewesen als Prinz Phillip Bloomsbury, der potenzielle neue König von Nova Scotia.
»Prescot«, sagte mein Vater streng und schaffte es mit einem einzigen Blick, dass ich mich wieder fühlte wie vier. Also etwas dämlich und mit klebrigen Fingern. Wobei inzwischen beides nicht mehr auf mich zutraf.
Ich wischte mir die Finger heimlich am T-Shirt ab und lugte auf den kleinen Marmeladenklecks, der dabei zurückblieb. Okay, es traf fast nicht mehr auf mich zu.
»Prescot!«, wiederholte mein Vater noch schärfer, und mein verschlafenes Hirn lief prompt Gefahr zu implodieren.
Seufzend sah ich auf. »Ja, Prescot ist der unsäglich peinliche Name, den ihr mir bei meiner Geburt gegeben habt. Nur Gott weiß, warum. Ach was, wahrscheinlich nicht mal der«, sinnierte ich und fischte die Zeitung aus meinem Frühstück.
Ich musste nicht hinsehen, um zu wissen, was – oder besser gesagt wer – auf dem Titelblatt prangte. Ich hatte es heute Morgen schon online gesehen. Zum Glück dachte mein Vater immer noch, Instagram hätte etwas mit einem Fertiggericht zu tun, sodass sein Ärger immer etwas verzögert ankam. So konnte ich mich zumindest gedanklich und nervlich darauf vorbereiten.
»Das ist eine Katastrophe«, sagte mein Vater, und seine Geheimratsecken wirkten im einfallenden Sonnenlicht des Speiseraums noch tiefer als sonst. »Warum um alles in der Welt hast du …«
Der Knall einer dramatisch aufgerissenen Tür unterbrach ihn. Der Kronleuchter über uns klimperte, während die Kaffeetassen gegen ihre Untersetzer klirrten. Meine Schwester Penelope kam in den Raum gerauscht. Das blonde Haar floss ihr dabei wie ein goldener Wasserfall über den Rücken, während ihre Beine in dem engen Alexander-McQueen-Kostüm schier endlos wirkten.
»Dad!«, stieß sie hervor, und alles an ihr – angefangen bei dem goldenen Funkeln der Haare bis hin zu dem leicht schockierten Zittern in ihrer Stimme – wirkte so perfekt inszeniert, als hätte sie den Auftritt den ganzen Morgen lang geübt. »Hast du gesehen, was Scotty gemacht hat?«
»Wenn nicht: Hier sind die Bilder«, ergänzte Helena, ihre Zwillingsschwester, die direkt dahinter in den Speisesaal gestürzt kam.
Ich verdrehte die Augen, während Helena amüsiert auf ihr Handy hinabstarrte. Ihr Zeigefinger wischte so schnell über das Display, dass er praktisch verschwamm.
»Und …« Sie legte den Kopf schief, blinzelte und zuckte zusammen. »Iiih, Scotty!« Sie bedachte mich mit einem Naserümpfen. »So viel wollte ich niemals von meinem kleinen Bruder sehen«, neckte sie mich, während sie sich neben mich fallen ließ und die Füße in den Doc Martens ausstreckte, die sie zu Hause trug, wann immer wir unbeobachtet waren und sie nicht darauf achten musste, wenigstens ansatzweise so auszusehen wie eine Prinzessin in spe.
Penelope setzte sich daneben und überkreuzte elegant die Füße, die in High Heels steckten.
»Ach, hört auf! So schlimm ist es doch gar nicht«, schnaubte ich und nahm einen tiefen Schluck von meinem Kaffee. Mein Kopf dröhnte immer noch, ich hatte eindeutig zu wenig Schlaf abbekommen.
Dad massierte sich seinerseits den Nasenrücken und ließ sich auf den gedeckten Platz mir gegenüber fallen. Der Tisch war so groß, dass wir uns, wenn wir uns auf die ganze Länge aufgeteilt hätten, SMS hätten schicken müssen, um einander zu verstehen. Zum ersten Mal seit wir in den Palast eingezogen waren, wünschte ich mir, sie hätten die Raumakustik auf der anderen Seite des Speisesaals getestet. Ich ließ den Kopf hängen und atmete tief durch. Ich hätte auf mein Bauchgefühl achten und im Bett bleiben sollen.
»Prescot, hörst du uns zu?«, knurrte mein Vater über den Blumenstrauß zwischen uns hinweg, der trotz seiner gigantischen Ausmaße einfach nur lächerlich wirkte.
»Leider ja.«
»So viel gibt es da gar nicht zu sehen, wenn ihr mich fragt«, sagte Penelope, die über Helenas Schulter lugte, spitz.
»Ja … aber am Minigolfplatz? Bei der Windmühle?«, warf Helena ein, ehe sie mich breit angrinste. »Wie hast du es denn geschafft, dich in diese kleine Öffnung reinzuquetschen? Und wo zum Teufel ist deine Hose?«, fragte sie, während sie weiterklickte.
Ich spähte über ihre Schulter und sah mich selbst, wie ich versuchte, aus dieser verdammten Windmühle wieder herauszukommen. Im Rückwärtsgang. Mein Po in der straff gespannten Unterhose prangte klar und deutlich im Bild. Ich legte den Kopf noch schiefer. Wieso hatte ich nur die Unterhose mit der Aufschrift Best Prince Ever angezogen?
»Keine Ahnung«, gab ich zu und runzelte die Stirn, während wir alle drei gleichzeitig den Kopf schief legten und das nächste Bild musterten. »Was da passiert ist, weiß ich auch nicht«, murmelte ich. Wo kam auf einmal der Gartenzwerg her?
Helena kicherte, und Penelope verdrehte die Augen, während unser Vater sein Brötchen ausgesprochen brutal butterte.
»Ich glaube, ich hab sie in der Windmühle vergessen«, murmelte ich.
»Deine Hose?«
»Nein, Evangeline«, brummte ich, und Penelope verschluckte sich an einem Schluck Kaffee, während mein Vater eine Streichwurst skalpierte.
»Was? Deine Cousine war mit dir dort? Was habt ihr da gemacht?«, fragte er streng und auch ein wenig besorgt.
Ich rutschte unruhig auf meinem Sitz herum und versuchte, mich zu erinnern. »Na ja, sie war nach dieser Gala ziemlich betrunken …«
»Nicht nur sie …«, warf Penelope spitz ein.
»Stimmt, Helena auch«, murmelte ich und erntete dafür einen Rippenstoß, den ich königlich ignorierte, während ich den gestrigen Abend Schritt für Schritt zu rekonstruieren versuchte. »Ich glaube, irgendwann kam sie dann auf die Idee, dass ich ihr beibringen soll, wie man Minigolf spielt, so wie es das gemeine Volk tut.« Ich setzte die letzten Worte in Gänsefüßchen, und alle am Tisch verdrehten die Augen. Sogar mein Vater.
»Warum bist du ihr überhaupt gefolgt? Lass doch so was die Bodyguards machen«, warf Dad scharf ein, doch mir entging nicht, dass sich ein deutlich milderer Ausdruck in seine Augen geschlichen hatte.
Ich fuhr mir frustriert durchs Haar. »Was hätte ich denn tun sollen? Die Bodyguards waren irgendwo, aber nicht bei uns, und sie hat sich wie eine Irre in der Windmühle versteckt. Irgendjemand musste sie da doch wieder rausholen, oder?«
Helena zog eine Schnute. »Und wo ist deine Hose abgeblieben?«
Ich zog eine Grimasse, während mein Hirn quälend langsam auch noch die letzten fehlenden Puzzleteile an ihren Platz zurückschob. »Die habe ich ihr angezogen. Und meinen Blazer auch, weil sie sich das Kleid vollgekotzt hat«, erinnerte ich mich erleichtert und wusste jetzt endlich auch wieder, warum mir heute beim Aufwachen dieser eklige Geruch in den Haaren gehangen hatte.
Ich grinste erleichtert und vielleicht auch mit ein wenig Arroganz, die mir gelegentlich dabei half, besonders nervige Leute, die Welt und manchmal auch mich selbst auf Abstand zu halten. »Seht ihr? Alles, was in der Klatschpresse rüberkommt, ist schlichtweg überzogen. Ich bin gar kein …«
»… Perversling?«, schlug Helena vor.
»… Idiot?«, konterte Penelope.
»… verzogener Snob?«, schob Helena nach.
Ich funkelte beide an. »Wenn das so ist, lasse ich Evangeline nächstes Mal einfach in der Windmühle stecken«, brummte ich und riskierte noch einen Blick auf das Titelblatt der Zeitung. Räuspernd spülte ich das Schamgefühl mit einem Schluck Kaffee hinunter.
»Genau das solltest du tun, Prescot«, sagte mein Vater ernst. »Selbst wenn du Evangeline nur helfen wolltest, bist am Ende du auf der Titelseite gelandet, nicht sie. Solche Presse können wir uns nicht leisten. Evangeline kann auf sich selbst …«
»Es ist mir lieber, die Leute sehen auf solchen Bildern mich als meine vierzehnjährige Cousine, die sturzbetrunken und heulend auf einem Minigolfplatz sitzt. Ich halte den Spott aus. Sie nicht«, unterbrach ich ihn ernst.
Carla, unser persönliches Dienstmädchen, kam hereingehuscht. Ihre Schritte klickten auf dem Marmorboden, als hätte sie Elfenfüßchen, während sie den Zwillingen Kaffee einschenkte und frische Brötchen auf den Tisch stellte. Ich nahm mir eines und beschmierte es so fett mit Nutella, dass es mehr Nutella als Brot war.
»Weißt du, was dein Problem ist?«, fragte Helena und deutete mit ihrem Buttermesser auf mich.
»Seine perverse Neigung zu Nutella?«, warf Penelope angeekelt ein.
»Meine Schönheit? Mein Charme? Meine Fähigkeit, die Zunge einzurollen?«, schlug ich vor.
»Falsch!« Helena fuchtelte mit ihrem Buttermesser herum. »Du hast dich verändert, Scotty. Seit der Uni bist du ein viel zu nettes Weichei. Wenn du so weitermachst, bricht dir eines Tages noch ein Mädchen das Herz, und auf die Heulerei danach kann ich getrost verzichten.«
Ich musterte sie und spürte das schale Lächeln auf meinen Lippen, während ich mein Spiegelbild in der Messerschneide betrachtete. Nett. Weichei. Ich erinnerte mich an eine Zeit, da hatten mir die Leute ganz andere Worte an den Kopf geworfen. Die Person, die mir jetzt entgegensah, war vielleicht weich und landete mit solchen Peinlichkeiten auf den Titelblättern des Landes, doch zumindest konnte ich mich wieder ansehen, ohne dabei Übelkeit zu empfinden.
»Danke«, sagte ich daher nur und lächelte meiner Schwester zu.
Penelope und Helena bedachten mich mit exakt demselben mitleidigen Blick. »Fakt ist: Du lässt dich viel zu schnell in Schwierigkeiten bringen.«
»Evangeline ist unsere Cousine, das ist was anderes«, erwiderte ich finster.
»Sie ist eine total verzogene Göre, die dich schamlos ausnutzt. Hör auf, ihr andauernd aus der Patsche zu helfen, Scotty.«
»Dir helfe ich auch andauernd«, erinnerte ich sie.
Helena grinste, und ich bekam einen Kuss auf die Wange. »Ich weiß, aber ich bin auch deine Schwester. Bei mir darfst du das.«
»Können wir bitte bei der Sache bleiben?«, unterbrach uns Dad, und ich beobachtete besorgt, wie er das Essen auf seinem Teller mit der Gabel malträtierte, anstatt es zu essen. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen, während ich das Brötchen weglegte.
»Es tut mir leid, Dad«, sagte ich ernst. »Ich wollte nicht …«
»Ich weiß, mein Junge«, unterbrach er mich und lächelte müde. Die Fältchen um seine Augen waren tiefer geworden, seit Grandpa gestorben war. Wobei es sich bei unserem Grandpa um Lewis Leopold Leon Bloomsbury, König von Nova Scotia, a.k.a. Leopold II., gehandelt hatte. Wenn man mich fragte, ein garstiger alter Kauz, der es selbst noch aus seinem Grab heraus schaffte, seine Familie – also uns – zu terrorisieren.
Unser Vorvorvorvorvorfahr, ein gewisser Sir William Alexander Bloomsbury, hatte vor etwa dreihundert Jahren vom damaligen König von England für das erfolgreiche Zerschlagen des Jakobitenaufstands das gesamte Gebiet zwischen Neuengland und Neufundland erhalten. Die damalige ostkanadische Provinz Nova Scotia, die bis dato unter der englischen Krone regiert worden war, wurde ab diesem Zeitpunkt zu einem unabhängigen Königreich. Wenn die Briten damals gewusst hätten, über welch hohe Goldvorkommen das Land verfügte, das sie gerade abgetreten hatten, dann hätten sie es sich wahrscheinlich dreimal überlegt.
Bereut haben sie es auf alle Fälle, zumindest eine Zeit lang. Vor allem in den Siebzigerjahren, in denen Nova Scotia durch die Entdeckung weiterer Goldvorkommen von einem wohlhabenden Königreich zu einem der reichsten Länder der Welt aufstieg. Die Briten bissen sich in den Hintern, und die Könige von Nova Scotia, die Minister, das ganze Land schwamm im Prunk, bis … bis die Goldvorkommen deutlich schneller versiegten als erwartet. Vielleicht hatte es aber auch Anzeichen dafür gegeben, und mein Großvater hatte die Warnsignale schlichtweg ignoriert. Wer weiß, jedenfalls war Nova Scotias Wirtschaft von einem Tag auf den anderen zusammengebrochen. Vielleicht war mein Großvater deshalb so ein garstiger Zausel gewesen. Immerhin war unter seinen Händen das Königreich mehr oder weniger zerfallen.
Die Krone litt seitdem immer noch unter heftiger Kritik. Die Löcher, die der Verlust des Goldeinkommens in unsere Taschen geschlagen hatte, heilten nur langsam. Und wenn die Bewohner von Nova Scotia eines nicht waren, dann flexibel. Das ganze winzige Land schien aus starrköpfigen, traditionalistischen Eigenbrötlern zu bestehen. Und mein Großvater war bis zu seinem Tod der perfekte König dieser Sturköpfe gewesen.
»Wir müssen das besprechen, bevor …«, setzte Dad an, als die Tür erneut aufging.
»Ich erwarte eine Erklärung«, bellte uns eine tiefe Stimme quer durch den Raum an.
Ruckartig stellten sich mir die Nackenhärchen auf, und Penelope versteifte ihren Rücken noch mehr als ohnehin schon, während Helena besorgt ihr Handy sinken ließ. Die Falten meines Vaters wurden noch eine Spur tiefer.
»Bruder, was führt dich zu uns in den Westflügel?«, fragte er in einem Ton, den er sich üblicherweise für schwierige Politiker aufhob.
Onkel Oscar schnaubte, während ich ihn in der Spiegelung des hohen Spitzbogenfensters betrachtete. Er hatte etwas extrem Irritierendes an sich. Der Mann, der gerade mit großen Schritten den Speisesaal betrat und uns mit seinen scharfen hellblauen Augen musterte, wirkte keinen Tag älter als fünfunddreißig, obwohl er bereits auf die fünfzig zuging. Schon seit meiner Kindheit sagten mir die Leute, dass ich meinem Onkel wie aus dem Gesicht geschnitten war, obwohl wir durch die Adoption meines Vaters nur entfernt über meine Mutter blutsverwandt waren. Rein optisch gesehen nahm ich an, dass es sich dabei um ein Kompliment handelte. Wir besaßen das gleiche dunkelblonde Haar und ähnlich breite Schultern sowie schlanke, muskulöse Körper. Während ich im Augenblick jedoch noch T-Shirt und Jogginghose von heute Nacht trug, steckte Onkel Oscar bereits um acht Uhr morgens in einem maßgeschneiderten Anzug, der ihn noch breiter aussehen ließ. Die goldene Nadel an seiner Krawatte blitzte im Sonnenlicht auf, als er näher kam. Er bewegte sich wie ein Raubtier, kurz bevor es seine Beute riss. Und in etwa so fixierte er uns gerade auch.
»Spar dir die Floskeln«, sagte Oscar, und ich fragte mich, ob meine Stimme auch einmal genauso dunkel und erbarmungslos klingen würde, wenn ich älter war.
Obwohl sich meine Schultern anspannten, heuchelte ich weiterhin Desinteresse, während sich mein Vater die Brille zurechtrückte und seinen jüngeren Stiefbruder kühl musterte.
»Wenn es um diese Fotos von Prescot geht: Wir haben bereits darüber gesp…«
Onkel Oscar unterbrach Dad mit einem harten Schnauben und knallte seine Hände so stark auf den Tisch, dass Helenas Orangensaftglas umkippte. Der Inhalt breitete sich wie ein Blutfleck auf dem blütenweißen Tischtuch aus. Niemand rührte sich. Die Angestellten hatten sich zurückgezogen, wie immer wenn Oscar den Raum betrat. Wie Geister, die vor der Sonne zurückwichen. Oder vor einem Exorzisten.
»Ich rede nicht von den Fotos. Wenn Prescot sich vor der ganzen Welt lächerlich machen will, dann soll er das tun«, schnaubte Onkel Oscar. »Ich bin hier, weil ich Meldung erhalten habe, dass Prescot seinen Bodyguard gefeuert hat.«
»Was? Schon wieder? Wann?«, fragte mein Vater sichtlich erstaunt.
Oscars Blick fühlte sich an wie ein kalter Eiswürfel, der mir den Rücken hinabrutschte.
»Die Frage ist nicht wann, sondern warum. Ich habe dem Bengel bereits x-mal gesagt, dass er sich nicht in Personalangelegenheiten einmischen soll. Die Bodyguards sind speziell für ihre Posten im Königshaus ausgebildet. Diese Männer wissen, was sie tun, und sind seit Jahren Angestellte der Krone. Er hat ihnen also nichts zu befehlen, geschweige denn, ihnen zu kündigen.«
Ich zwang eine kühle Miene auf mein Gesicht, ehe ich mich umwandte und meinem Onkel einen abschätzigen Blick zuwarf. »Und wer hat das dann zu entscheiden?« Ich zog eine Augenbraue hoch. »Du etwa?«
»Scott«, sagte mein Vater scharf, doch mein Onkel lehnte sich bereits so weit vor, dass mir sein Aftershave in der Nase brannte.
Niemals, schwor ich mir, während ich mich innerlich wand, niemals werde ich wie dieser Mann werden. Egal wie ähnlich wir uns sahen: Wenn ich ein Weichei sein musste, um nicht so zu werden wie mein Onkel, dann war ich liebend gern ein Weichei. Eines, das seine Familie liebte und nicht einschüchterte.
»Ich bin die Krone«, sagte Oscar gefährlich ruhig. »Ich entscheide über das Personal. Nicht dein Vater, und schon gar nicht du.«
Ich legte ein spöttisches Lächeln auf meine Lippen, obwohl sich mein Herz vor Angst zusammenzog. Jeder hatte Angst vor meinem Onkel. Sein heißblütiges Temperament war berüchtigt, alle kuschten, alle flüsterten, wenn er die Gänge entlangkam. Doch ich hatte es satt, vor ihm zu kuschen. Ich mochte viel sein, aber definitiv kein Feigling. Ich lehnte mich ebenfalls vor. »In Großvaters Testament steht klar und deutlich, dass er meinen Vater als seinen Nachfolger einsetzt. Solange das Parlament keine Entscheidung getroffen hat, ob das Testament anerkannt wird, solange also die Nachfolge unklar ist, feuere ich meine Bodyguards, so oft ich will. Vor allem, wenn sie schlechte Arbeit leisten.«
Wir starrten uns an, und die Pupillen meines Onkels zogen sich ruckartig zusammen, bis sie wie pechschwarze Stecknadelköpfe wirkten. Seine Hand schnellte nach vorn, packte mich am Kragen und zog mich so abrupt zu ihm hinüber, dass mein Stuhl bedrohlich kippte.
»Du mieser kleiner …«, zischte Oscar mir direkt ins Gesicht.
»Genug!«, brüllte mein Vater, und im nächsten Moment löste sich der harte Griff von meinem Shirt.
Schwungvoll krachte ich zusammen mit dem Stuhl zurück, rieb mir den Hals und sah in das zornige Gesicht meines Onkels.
»Reiß dich zusammen, Oscar«, sagte mein Vater schroff.
»Dein Sohn sollte sich zusammenreißen, wenn er weiß, was gut für ihn ist!« Oscar sagte die Worte nicht, er kläffte sie wie ein Hund in die Luft. »Du und Leigh, ihr habt die Kinder verzogen. Solch eine Respektlosigkeit hätte unser Vater niemals zugelassen, und ich werde es auch nicht tun. Die Erbfolge mag wegen des Testaments infrage gestellt sein, doch seit jeher bin ich als der Nachfolger des Königs von Nova Scotia vorgesehen. Du bist doch nichts weiter als das Balg seiner zweiten Frau. Dieses bürgerliche Flittchen! Vater mag dich damals adoptiert haben, aber ich werde niemals zulassen, dass du Nova Scotia regierst und unseren Familiennamen in den Schmutz ziehst«, fuhr Oscar kalt fort, während er sich seine goldenen Manschettenknöpfe richtete.
Ich zuckte bei den harten Worten zusammen, doch das Gesicht meines Vaters blieb absolut ungerührt, während er sich die Brille zurechtrückte.
Es war kein Geheimnis, dass mein Vater nicht der leibliche Sohn von König Leopold II. war. Mein Großvater hatte schon immer gern für saftige Skandale gesorgt. Nach dem Tod von Oscars Mutter hatte er sich seine zweite Frau aus dem Volk ausgesucht. Und als wäre das nicht genug, war sie auch noch geschieden und brachte einen Sohn aus erster Ehe mit. Meinen Vater. Noch vor hundert Jahren hätte so etwas wahrscheinlich einen Krieg ausgelöst. Zumindest hatten in Großbritannien Könige für solche Vorkommnisse bereits abdanken müssen. Doch mein Großvater war stur und pfiff nicht nur auf die Meinung der anderen, sondern war auch noch Meister darin, Schlupflöcher im Gesetz zu finden. Er hatte meinen Vater als seinen Sohn adoptiert, weshalb wir ebenfalls den Namen Bloomsbury trugen. Doch einen Platz in der Thronfolge hatte Dad damals nicht erhalten.
Aber vor genau einem Jahr hatte Großvater schließlich mit seinem plötzlichen Tod einen erneuten Skandal losgetreten, wie es ihn in Nova Scotia noch nicht gegeben hatte. Denn in seinem Testament hatte er einfach ohne Ankündigung das Gesetz geändert und seinen Adoptivsohn zum Thronfolger bestimmt. Wir alle waren geschockt darüber gewesen, aber am meisten wohl Onkel Oscar. Ich hätte sogar Verständnis für ihn gehabt, wenn er dabei nicht so ein absolutes Arschloch gewesen wäre. Bei solch einem Vater war es kein Wunder, dass seine Tochter Evangeline außer Rand und Band war und bei jeder Gelegenheit aus dem Palast türmte.
»Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt, Oscar. Mein Terminplan ist bis zum Platzen voll, und es würde mich wundern, wenn deiner anders aussieht«, sagte mein Vater. Ich bewunderte ihn dafür, wie ruhig und beherrscht er dabei klang.
Onkel Oscar schnaubte und warf mir einen weiteren abschätzigen Blick zu. »Dein Geleitschutz bleibt. Und wenn ich noch ein einziges Mal deinen Hintern auf der Titelseite sehe, verfrachte ich dich nach Großbritannien zurück. Das Internat hätte dir weiß Gott mehr Disziplin einprügeln sollen!«
Mit einem letzten kalten Blick verschwand Oscar endlich aus dem Frühstückszimmer. Als er die Tür hinter sich zuschlug, schien er die Hälfe des Sauerstoffs mit sich zu nehmen. Uns allen war der Appetit vergangen.
»Das war …«, setzte Helena an.
»… grauenvoll, jedoch zu erwarten«, beendete Penelope trocken.
Helena warf ihr einen wütenden Blick zu, ehe sie mich in eine Umarmung zog, die mir beinahe den Rücken brach. Helenas Liebe war immer ein wenig ungestüm.
»Hör nicht auf sie«, murmelte sie mir ins Ohr, während ich sie liebevoll zurückdrückte. »Niemand traut sich, so mit Onkel Oscar umzugehen. Nicht mal Dad. Nur du. Ich bin stolz auf dich.«
»Genau aus diesem Grund möchte ich eigentlich, dass du Ärger vermeidest, Prescot«, seufzte mein Vater. »Die Situation ist ohnehin schon angespannt genug, warum musst du dann auch noch andauernd mit dem Kopf durch die Wand? Außerdem, was soll diese Sache mit dem Bodyguard?« Mit jedem Wort schien er einige Zentimeter in sich zusammenzusacken. Wie ein Ballon, dem die Luft ausging.
Helena löste sich von mir und zog Dad ebenfalls in ihre Knochenbruchumarmung.
»Ist schon gut, Liebes«, presste er hervor, während er ihr hektisch den Kopf tätschelte, damit sie ihn wieder losließ.
»Dieser Bodyguard …«, schnaubte ich und deutete abfällig mit dem Kinn auf die Zeitung am Tisch. »Wer, glaubst du, hat dieses hübsche Foto geschossen? Soweit ich mich erinnern kann, war niemand in der Nähe, bis Coldwin plötzlich angerannt kam und meinte, er hätte uns aus den Augen verloren.«
»Du meinst, der Bodyguard hat das Foto gemacht und der Presse zugespielt?«, fragte Dad.
»Das ist doch lächerlich«, sagte Penelope.
Ich musterte sie beide genervt. »Tut doch nicht so, als wäre es euch nicht auch schon aufgefallen«, fuhr ich sie härter an als beabsichtigt. »Jeder hier in diesem Palast arbeitet für Onkel Oscar. Wundert ihr euch nicht, dass auf diesem Bild nur ich zu sehen bin? Keine Spur von Evangeline! Andauernd tauchen Bilder von uns in der Klatschpresse auf. Nur von uns! Es sind immer Fotos, die niemand außer den Bodyguards oder irgendwelchen anderen Angestellten gemacht haben kann.«
»Ich mag die Bodyguards des Palasts auch nicht«, warf Helena ein und knibbelte an ihrem dunklen Nagellack herum. »Sie schleichen dauernd so seltsam um uns rum.«
»Sie machen einfach nur ihren Job, das ist alles«, wandte Penelope pragmatisch wie immer ein.
»Nein, ich glaube auch, dass sie uns für Onkel Oscar bespitzeln«, widersprach ihr Helena.
»Es macht außerdem Sinn«, warf ich grimmig ein. »Es kommt Oscar zugute, wenn er uns vor dem Volk als unfähig darstellt.« Ich mahlte mit den Kiefern, als Penelope und mein Dad gleichzeitig die Augen verdrehten.
»Solange die Thronfolge nicht geklärt ist, müssen wir dieses Spiel eben mitspielen«, wandte mein Vater müde ein. »Und dazu gehören auch die Bodyguards.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Dann will ich einen Bodyguard, der nicht für Onkel Oscar arbeitet«, sagte ich bestimmt. »Ich will meinem Bodyguard vertrauen können.«
»Viel Glück! Du wirst in ganz Kanada keinen Geleitschutz finden, der nicht von Oscar geschmiert wurde«, wandte Penelope ein.
Ich funkelte sie an. »Dann lasse ich mir eben was einfallen.«
Penelope zog eine Augenbraue hoch. »Kennst du denn eine Securityfirma, die gegen die Erlaubnis der Krone einen Bodyguard zur Verfügung stellen würde? Und dann auch noch einen unbestechlichen?«
»Nein«, gab ich zu und kratzte mir das Kinn. Mit so etwas hatte ich mich noch nie beschäftigen müssen. Mit einem ganzen Haufen Zeug, das jetzt plötzlich wichtig wurde, hatte ich mich bisher nicht beschäftigen müssen. Aber so war das wohl, wenn man plötzlich lernen musste, Verantwortung zu übernehmen. »Obwohl, vielleicht wüsste ich jemanden, der helfen könnte«, wandte ich ein.
»Wen denn?«, bohrte Helena nach.
Ich zögerte. »Unseren Cousin Alex. Er hat mir mal von diesem Bodyguard an seiner Uni erzählt, der persönlichen Geleitschutz …«
»Schluss jetzt, Prescot«, unterbrach uns Dad, während er seine Brille gerade rückte. »Du wirst erst einmal gar nichts tun. Habt ihr schon alles vorbereitet? Unser Flug nach Vancouver geht in zwei Stunden. Unser Terminkalender platzt aus allen Nähten, das Parlament tritt in wenigen Tagen zusammen, und ich brauche euch alle hinter mir.« Er sah mich vorwurfsvoll an.
»Ich habe schon vor drei Tagen alles Notwendige gepackt«, sagte Penelope.
»Und ich bin heute fertig geworden«, ergänzte Helena und tippte auf ihrem Handy herum.
Dad sah mich an. »Ich … gehe ja schon«, murmelte ich und fuhr mir durchs Haar.
»Eine Stunde, Prescot«, rief mir mein Vater nach.
Ich winkte als Zeichen, dass ich ihn gehört hatte. Vielleicht konnte ich eines der Dienstmädchen bestechen, meine Koffer zu packen, während ich ein Nickerchen machte.
Prescot
Der Palast der Königsfamilie von Nova Scotia war seit jeher im Besitz der Bloomsburys. Das aus hellem Sandstein errichtete Gebäude war mir so bekannt, dass ich praktisch jede Delle kannte, von denen ich als Dreijähriger selbst einige mit dem Laufrad hineingeschlagen hatte. Ich kannte jede Rüstung, in der sich bestimmt noch der ein oder andere Joint versteckte. Und ich wusste, dass der Kronleuchter im zweiten Stock ein billiges Replikat war, dessen Original … nun, auf unglückliche Art und Weise zu Bruch gegangen war, was schnellstens hatte vertuscht werden müssen. Trotzdem hatte sich der Palast nie wie ein wirkliches Zuhause angefühlt, ebenso wenig wie das Familienanwesen in Vancouver. Dafür hatte ich viel zu lange in England im Internat gelebt. Jahre meines Lebens, die mich jetzt noch verfolgten wie ein Albtraum, der damals stets von vorn losgegangen war, wenn ich nach den Sommerferien aus Nova Scotia oder Vancouver nach England zurückkehrte.
Nach zwölf Jahren Internatshölle hatte ich kurz die Hoffnung gehegt, ein echtes Leben beginnen zu können. Eines, das ich mochte. Ein Leben, in dem ich mich selbst mochte, mich an der Uni von Vancouver in Clubaktivitäten integrierte und in einem Wohnheim lebte. Doch dieses Leben war mir nur ein halbes Jahr vergönnt gewesen. Dann starb mein Großvater, und seitdem bestand mein Leben nur noch aus Pflichten und Zwängen, die mir folgten wie Schatten, sich langsam um meinen Hals legten und zudrückten.
Ich atmete tief durch und schüttelte das einsame Gefühl ab, bis heute keinen Ort gefunden zu haben, an den ich wirklich gehörte. Mein Zimmer im Palast lag im dritten Stock. Trotzdem machte ich einen großen Bogen um den uralten, fast schon antiken quietschenden Aufzug und joggte nach oben. Seit ich als Sechsjähriger in diesem Ding festgesteckt hatte … und seit dem Zwischenfall im Internat … Nun, ich ging sehr engen Räumen lieber aus dem Weg.
Im Treppenhaus begegneten mir gefühlt zehn porträtierte Generationen meiner Familie, die mir alle mit demselben Blick nachstarrten. Vor allem Urgroßonkel Fridolin sah aus, als wäre er schwer enttäuscht von mir.
»Schau mich nicht so an. Ich kann ja auch nichts dafür, dass unser Land politisch auseinanderbricht. Und nebenbei bemerkt hast du sicher Schlimmeres getan, als in der Öffentlichkeit blankzuziehen.«
Ja, zu Fridolins Zeiten musste hier so einiges anders gewesen sein. Der Goldabbau hatte floriert, die Leute schwammen in Reichtum. Mit Sicherheit machte Geld nicht glücklich, doch zumindest sorgte es innerhalb der Bevölkerung für eine gewisse Art von Stabilität. Und die schwankte heftig, seitdem Nova Scotia über Nacht nahezu mittellos geworden war. Weshalb Kanada schon vor Jahrzehnten unter der britischen Monarchie »großzügig« zur Unterstützung herangeeilt war – natürlich um den Preis eines gewissen Einflusses auf die politische Situation in Nova Scotia, den wir seit dem Tod meines Großvaters nun besonders deutlich zu spüren bekamen.
Durch die Unstimmigkeiten im Testament gab es keinen König, das Land befand sich im Zwist: Mein Vater wurde von der liberal eingestellten Bevölkerung unterstützt, mein Onkel von der konservativen. Wie stets bei Uneinigkeiten innerhalb des Königreichs hatte Kanada auf sein Mitspracherecht gepocht, und die Zukunft unseres Landes hing nun von der Entscheidung eines unabhängigen Parlaments ab, das darüber befinden musste, ob das Testament rechtsgültig war oder nicht. Zumindest war es in der Theorie so. Praktisch war meiner Meinung nach nur die Frage, wie viel Bestechungsgeld mein Onkel in die Hand nahm.
»Na, irgendwelche Tipps für uns, Fridolin?«, fragte ich, aber der starrte mich nur arrogant an. Seufzend ging ich weiter.
Ich schlug den Weg zu meinem Zimmer ein und sah die wuchtige Doppeltür am Ende eines dunklen Flurs, der mit einem potthässlichen grün-lila karierten Teppich ausgelegt war, den Nationalfarben von Nova Scotia. Auf dem Weg wählte ich rasch die Nummer meines Cousins. Es begann zu tuten, als ich gerade eine Ritterrüstung passierte, die das Wappen Nova Scotias in Händen hielt: zwei verschränkte Hände über einer Distel.
Es klickte in der Leitung. »Hey, hier ist Alex. Nerv mich nicht, außer es ist wichtig, aber dann sollte es superwichtig sein. Wenn du es bist, Mom: Ich hab zu tun, ich kann nicht kommen.«
Schnaubend wartete ich auf das Piepsgeräusch und knurrte: »Scheiße, Alex, wo bist du? Ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. Nein, eigentlich versuche ich es schon seit Wochen. Ich verstehe ja, dass du viel Stress mit der Uni hast, aber es wäre nett, zu hören, dass du nicht mit gebrochenem Genick im Graben liegst. Hör zu: Ich brauch echt deine Hilfe. Du hast mir doch von diesem Bodyguard erzählt, der mit dir auf die Uni geht, oder? Glaubst du, der könnte mir vielleicht helfen, einen Bodyguard für mich zu finden? Oder … ach, verdammt, das ist schwer zu erklären. Jetzt geh gefälligst ran oder ruf mich zurück, sonst ruf ich deine Mom an. Ach ja, hier ist dein Cousin Prescot.«
Ich legte auf, öffnete schwungvoll die Tür zu meinem Zimmer und kämpfte innerlich gegen das Gefühl an, wirklich paranoid zu sein. Doch ich vertraute den Bodyguards meines Onkels einfach nicht. Vielleicht hegte ich auch einfach nur eine krankhafte Abneigung gegen alles, was mit Onkel Oscar zu tun hatte. Doch ich hätte nun mal eher einen Besen gefressen, als zu glauben, dass die Bodyguards wirklich dazu instruiert waren, uns zu beschützen. Und wenn Oscar mich keinen Bodyguard einstellen ließ, dem ichvertraute, dann musste ich mir eben einen suchen, der undercover für mich arbeitete. Quasi einen heimlichen Bodyguard, der meinen offiziellen Bodyguard im Blick behielt. Einen Secret Bodyguard, sozusagen.
Ach du meine Güte, war mein Leben schräg!
Was für ein Tag. Ich wollte nur noch ins Bett fallen und …
»Hoheit!«, quiekte eine Stimme.
»Scheiße, Carla! Erschreck mich doch nicht so!«
Das Dienstmädchen und ich machten gleichzeitig einen Satz nach hinten, während Carla zusätzlich so heftig zusammenzuckte, dass ihr ein Stapel frisch gewaschener Hemden aus den Händen fiel, die sich raschelnd auf dem dunkelblauen Teppichboden verteilten.
»Was machst du hier?«, stieß ich hervor und presste mir die Hand auf die Brust, um den nahenden Herzinfarkt aufzuhalten. Penelope hatte recht, ich sollte aufhören, so viel Nutella zu essen.
Carla wurde rot im Gesicht, während sie stammelte: »Hoheit, es tut mir leid, ich habe nur gehört, dass … Ich dachte, Sie könnten vielleicht Hilfe beim Packen gebrauchen. Sie sind eine ganze Weile in Vancouver, und da dachte ich, ich könnte Ihnen schnell zur Hand gehen.«
Verlegen, dass das Personal offensichtlich so genau über mich Bescheid wusste, räusperte ich mich. »Das ist nett. Aber wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann hör mit deinem dauernden Hoheit auf. Erstens kennen wir uns dafür schon ein bisschen zu lange, und zweitens fühle ich mich so alt dabei.«
»Aber laut Protokoll sind Sie eine Ho…«
»… bin ich ein Prescot!«, erinnerte ich sie streng.
Sie wurde rot. »Mr Prescot«, stieß sie hervor, als würde sie Schmerzen dabei empfinden.
Ich lachte leise. »Damit kann ich leben. Wenn wir jetzt noch den Mister wegbekommen …«, sagte ich und half ihr währenddessen, die Hemden wieder zusammenzulegen.
Carla hatte sogar schon meine Koffer angeschleppt, die offen auf dem Bett lagen. So sorgfältig wie möglich faltete ich meine Hemden wieder zusammen und begann, sie in den Koffer zu stapeln.
»Sie müssen das nicht machen, Mr Prescot. Sie sehen müde aus. Legen Sie sich ruhig ein wenig hin«, flüsterte Carla, und ihre Wangen wurden noch röter, als ich sie anlächelte.
»Aber eigentlich sollte ich packen, Carla, nicht du. Vater möchte, dass wir solche Dinge noch selbst tun, und er hat recht. Wenn mich alle Dienstmädchen von vorn bis hinten verwöhnen, brauche ich irgendwann noch Hilfe beim Schuhezubinden.« Ich zwinkerte Carla zu, und sie lächelte.
»Ich helfe gern«, entschied sie und wuselte davon, nur um kurze Zeit später mit einem ganzen Armvoll teurer Anzüge wieder aufzutauchen.
Kurz war es still, während wir meine Sachen packten, wobei Carla definitiv besser darüber Bescheid zu wissen schien, was ich brauchte, als ich selbst. Ich hätte wahrscheinlich sowohl die Unterhosen als auch meine Zahnbürste vergessen. Als wir beinahe fertig waren, musterte ich sie. »Carla, darf ich dich etwas fragen?«, hörte ich mich plötzlich sagen.
»N-natürlich, Mr Prescot«, hauchte sie, und unsere Finger berührten sich flüchtig, als ich ihr eine der Hosen abnahm und sorgfältig faltete.
»Das gesamte Personal hier wurde von meinem Onkel persönlich eingestellt, oder?«, tastete ich mich vorsichtig heran.
Sie warf mir einen verunsicherten Blick zu, ehe sie nickte. »Nach dem Tod Ihres Großvaters, ich meine, König Leopolds II., wurden viele Angestellte ausgetauscht. Nur alteingesessene Mitarbeiter, zu denen es ein Vertrauensverhältnis gab, durften bleiben. So wie meine Mutter und ich.«
»Das ist jetzt vielleicht eine seltsame Frage, aber muss das Personal meinem Onkel Bericht erstatten?«
Ich sah zu ihr auf und nahm wahr, wie sie sich auf die Unterlippe biss, während sie sich verstohlen umsah. »Ich …«
»Du musst es mir nicht sagen«, beschwichtigte ich schnell.
»Nein, es ist schon gut«, erwiderte Carla und atmete tief durch, ehe sie mich eindringlich ansah. »Ja, wir Angestellten müssen einmal die Woche Berichte abgeben. Manchmal werden uns auch Fragen gestellt, manchmal nicht. Die Bodyguards berichten sogar täglich«, flüsterte sie, und ich spürte, wie meine Schultern sich anspannten, obwohl mich die Bestätigung meines Verdachts innerlich beinahe entspannte. Die Bodyguards und die Angestellten bespitzelten uns also tatsächlich.
Ich versuchte, meinen Gesichtsausdruck neutral zu halten, während ich Carla anlächelte. »Interessant. Danke für deine Ehrlichkeit.«
»Natürlich.« Sichtlich nervös stand sie auf und klopfte ihre Schürze ab. Warum auch immer. »Ihre Sachen sind gepackt, Mr Prescot. Ich werde Sie jetzt allein lassen. Eine Dusche täte Ihnen sicher gut«, murmelte sie mir zu und schien ein Grinsen zu unterdrücken, während ich es vermied, total unsexy unter meinen Achseln zu schnüffeln.
»Danke, Carla«, stieß ich hervor.
Sie schmunzelte und verschwand mit raschelndem Kleid aus meinem Zimmer, während ich ins Bad flüchtete.
![Kiss me twice [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a0fe1b9f1c7d56660f1a6ac471e68968/w200_u90.jpg)
![Kiss me once [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/58f14f2f022cec4e8263fb50dc264ae2/w200_u90.jpg)
![Night of Crowns. Spiel um dein Schicksal [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f3ef0064b2dcb6a110ec6f7cc33ca401/w200_u90.jpg)
![Kiss Me Now [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2814e535c98fcfda1cfdcb79ccfd3a8/w200_u90.jpg)

![Night of Crowns. Kämpf um dein Herz [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f13c50da50588357fe7b60b5de49bf54/w200_u90.jpg)
![Ever & After. Der schlafende Prinz [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1a15fb283a4db3ffe16e7b163009952b/w200_u90.jpg)
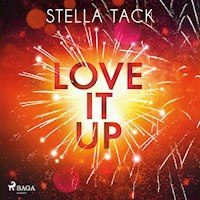


![Ever & After. Die dunkle Hochzeit [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8868ef4c8bf07024c89e72b8d2c844ea/w200_u90.jpg)