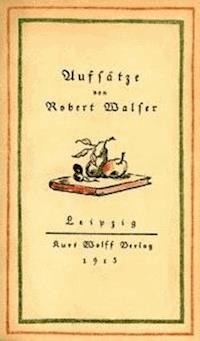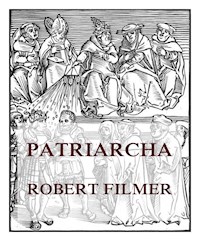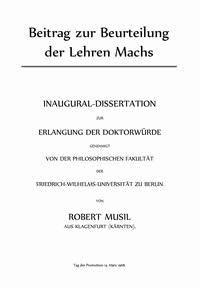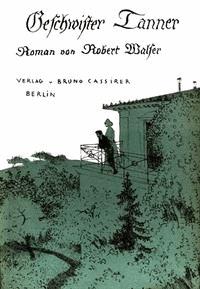0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Ähnliche
Anmerkungen zur Transkription:
Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Änderungen sind im Text so gekennzeichnet. Der Originaltext erscheint beim Überfahren mit der Maus. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.
Kleine Dichtungen
vonRobert Walser
Erste Auflage hergestellt für den Frauenbund zur Ehrung rheinländischer Dichter
Leipzig
Kurt Wolff Verlag 1914
Copyright 1914 by Kurt Wolff Verlag, Leipzig
Inhalt
Brief eines Dichters an einen Herrn
9
Mittagspause
14
Die Göttin
16
Der Nachen
18
Pierot
20
Sommerfrische
22
Frau von Twann
24
Die Insel
27
Meta
29
Fußwanderung
34
Der Kuß
37
Das Traumgesicht
40
Nächtliche Wanderung
43
Johanna
46
Der Bursche
49
Der Knabe
51
Das Götzenbild
54
»Apollo und Diana«
56
Zwei Bilder meines Bruders
»Die Frau am Fenster«
59
»Der Traum«
61
Die Gedichte
65
Rinaldini
67
Lenau
70
Tobold
73
Helblings Geschichte
86
Brief eines Vaters an seinen Sohn
111
Spazieren
116
Der Schäfer
119
Die Einladung
121
Der nächtliche Aufstieg
124
Die Landschaft
127
Der Dichter
129
Das Liebespaar
131
Der Mond
134
Ein Nachmittag
136
Die kleine Schneelandschaft
139
Das Mädchen
141
Das Eisenbahnabenteuer
143
Die Stadt
146
Das Veilchen
149
Die Kapelle
152
Der Tänzer
155
Die Sonate
158
Das Gebirge
161
Der Traum
165
Der Jagdhund
168
Der Vater
171
Der Träumer
174
Der Pole
177
Der Doktor
181
Der Liebesbrief
184
Der Hanswurst
187
Sonntagmorgen
189
Ausgang
191
Die Millionärin
193
Erinnerung
196
Die Schneiderin
199
Das Stellengesuch
202
»Geschwister Tanner«
205
Eine Stadt
208
Spaziergang
212
Das Kätzchen
216
Tannenzweig, Taschentuch und Käppchen
218
Der Mann
220
Das Pferd und die Frau
222
Die Handharfe
224
Die Fee
226
Kleine Wanderung
228
Wirtshäuselei
230
Der Morgen
232
Der Ausflug
234
Schnee
236
Der Blick
238
Der Heidenstein
240
Der Waldberg
242
Zwei kleine Sachen
246
Herbstnachmittag
248
Der Felsen
252
Die Eisenbahnfahrt
255
Das Lachen
258
Der Berg
261
Schwärmerei
264
Oskar
267
Die Einfahrt
271
Die Vaterstadt
274
Das Grab der Mutter
276
Abend
278
An den Bruder
281
Brief eines Dichters an einen Herrn
Auf Ihren Brief, hochverehrter Herr, den ich heute abend auf dem Tisch fand, und worin Sie mich ersuchen, Ihnen Zeit und Ort anzugeben, wo Sie mich kennen lernen könnten, muß ich Ihnen antworten, daß ich nicht recht weiß, was ich Ihnen sagen soll. Einiges und anderes Bedenken steigt in mir auf, denn ich bin ein Mensch, müssen Sie wissen, der nicht lohnt, kennen gelernt zu werden. Ich bin außerordentlich unhöflich, und an Manieren besitze ich so gut wie nichts. Ihnen Gelegenheit geben, mich zu sehen, hieße, Sie mit einem Menschen bekannt machen, der seinen Filzhüten den Rand mit der Schere halb abschneidet, um ihnen ein wüsteres Aussehen zu verleihen. Möchten Sie einen solchen Sonderling vor Augen haben? Ihr liebenswürdiger Brief hat mich sehr gefreut. Doch Sie irren sich in der Adresse. Ich bin Der nicht, der verdient, solcherlei Höflichkeiten zu empfangen. Ich bitte Sie: Stehen Sie sogleich ab von dem Wunsch, meine Bekanntschaft zu machen. Artigkeit steht mir schlecht zu Gesicht. Ich müßte Ihnen gegenüber die notwendige Artigkeit hervorkehren; und das eben möchte ich vermeiden, da ich weiß, daß artiges und manierliches Betragen mich nicht kleidet. Auch bin ich nicht gern artig; es langweilt mich. Ich vermute, daß Sie eine Frau haben, daß Ihre Frau elegant ist, und daß bei Ihnen so etwas wie ein Salon ist. Wer sich so feiner und schöner Ausdrücke bedient wie Sie, hat einen Salon. Ich aber bin nur Mensch auf der Straße, in Wald und Feld, im Wirtshaus und in meinem eigenen Zimmer; in irgend jemandes Salon stünde ich da wie ein Erztölpel. Ich bin noch nie in einem Salon gewesen, ich fürchte mich davor; und als Mann von gesunder Vernunft muß ich meiden, was mich ängstigt. Sie sehen, ich bin offenherzig. Sie sind wahrscheinlich ein wohlhabender Mann und lassen wohlhabende Worte fallen. Ich dagegen bin arm, und alles, was ich spreche, klingt nach Ärmlichkeit. Entweder würden Sie mich mit Ihrem Hergebrachten oder ich würde mit meinem Hergebrachten Sie verstimmen. Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie aufrichtig ich den Stand, in welchem ich lebe, bevorzuge und liebe. So arm ich bin, ist es mir doch bis heute noch nie eingefallen, mich zu beklagen; im Gegenteil: ich schätze, was mich umgibt, so hoch, daß ich stets eifrig bemüht bin, es zu hüten. Ich wohne in einem wüsten, alten Haus, in einer Art von Ruine. Doch das macht mich glücklich. Der Anblick armer Leute und armseliger Häuser macht mich glücklich; so sehr ich auch denke, wie wenig Grund Sie haben, dies zu begreifen. Ein bestimmtes Gewicht und eine gewisse Menge von Verwahrlosung, von Verlotterung und von Zerrissenheit muß um mich sein: sonst ist mir das Atmen eine Pein. Das Leben würde mir zur Qual, wenn ich fein, vortrefflich und elegant sein sollte. Die Eleganz ist mein Feind, und ich will lieber versuchen, drei Tage lang nichts zu essen als mich in die gewagte Unternehmung verstricken, eine Verbeugung zu machen. Verehrter Herr, so spricht nicht der Stolz, sondern der ausgesprochene Sinn für Harmonie und Bequemlichkeit. Warum sollte ich sein, was ich nicht bin, und nicht sein, was ich bin? Das wäre eine Dummheit. Wenn ich bin, was ich bin, bin ich mit mir zufrieden; und dann tönt alles, ist alles gut um mich. Sehen Sie, es ist so: schon ein neuer Anzug macht mich ganz unzufrieden und unglücklich; woraus ich entnehme, wie ich alles, was schön, neu und fein ist, hasse und wie ich alles, was alt, verschabt und verbraucht ist, liebe. Ich liebe Ungeziefer nicht gerade; ich möchte Ungeziefer nicht geradezu essen, aber Ungeziefer stört mich nicht. In dem Haus, in welchem ich wohne, wimmelt es von Ungeziefer: und doch wohne ich gern in dem Haus. Das Haus sieht aus wie ein Räuberhaus, zum ans Herz drücken. Wenn alles neu und ordentlich ist in der Welt, dann will ich nicht mehr leben, dann morde ich mich. Ich fürchte also quasi etwas, wenn ich denken soll, ich solle mit einem vornehmen und gebildeten Menschen bekannt werden. Wenn ich befürchte, daß ich Sie nur störe und keine Förderlichkeit und Erquicklichkeit für Sie bedeute, so ist die andere Befürchtung ebenso lebendig in mir, nämlich die (um ganz und gar offen zu reden), daß auch Sie mich stören und mir nicht erquicklich und erfreulich sein könnten. Es ist eine Seele in eines jeden Menschen Zustand; und Sie müssen unbedingt erfahren, und ich muß Ihnen das unbedingt mitteilen: ich schätze hoch, was ich bin, so karg und ärmlich es ist. Ich halte allen Neid für eine Dummheit. Der Neid ist eine Art Irrsinn. Respektiere jeder die Lage, in der er ist: so ist jedem gedient. Ich fürchte auch den Einfluß, den Sie auf mich ausüben könnten; das heißt: ich fürchte mich vor der überflüssigen innerlichen Arbeit, die getan werden müßte, mich Ihres Einflusses zu erwehren. Und deshalb renne ich nicht nach Bekanntschaften, kann nicht danach rennen. Jemand Neues kennen lernen: Das ist zum mindesten stets ein Stück Arbeit, und ich habe mir bereits erlaubt, Ihnen zu sagen, daß ich die Bequemlichkeit liebe. Was werden Sie denken von mir? Doch das muß mir gleichgültig sein. Ich will, daß mir das gleichgültig sei. Ich will Sie auch nicht um Verzeihung wegen dieser Sprache bitten. Das wäre Phrase. Man ist immer unartig, wenn man die Wahrheit sagt. Ich liebe die Sterne, und der Mond ist mein heimlicher Freund. Über mir ist der Himmel. Solange ich lebe, werde ich nie verlernen, zu ihm hinaufzuschauen. Ich stehe auf der Erde: Dies ist mein Standpunkt. Die Stunden scherzen mit mir, und ich scherze mit ihnen. Ich vermag mir keine köstlichere Unterhaltung zu denken. Tag und Nacht sind meine Gesellschaft. Ich stehe auf vertrautem Fuß mit dem Abend und mit dem Morgen. Und hiermit grüßt Sie freundlich
der arme junge Dichter.
Mittagspause
Ich lag eines Tages, in der Mittagspause, im Gras, unter einem Apfelbaum. Heiß war es, und es schwamm alles in einem leichten Hellgrün vor meinen Augen. Durch den Baum und durch das liebe Gras strich der Wind. Hinter mir lag der dunkle Waldrand mit seinen ernsten, treuen Tannen. Wünsche gingen mir durch den Kopf. Ich wünschte mir eine Geliebte, die zum süßen duftenden Wind paßte. Da ich nun die Augen schloß und so dalag, mit gegen den Himmel gerichtetem Gesichte, bequem und träg auf dem Rücken, umsummt vom sommerlichen Gesumm, erschienen mir, aus all der sonnigen Meeres- und Himmelshelligkeit herab, zwei Augen, die mich unendlich liebenswürdig anschauten. Auch die Wangen sah ich deutlich, die sich den meinigen näherten, als wollten sie sie berühren, und ein wunderbar schöner, wie aus lauter Sonne geformter, feingeschweifter und üppiger Mund kam aus der rötlich-bläulichen Luft nahe bis zu dem meinigen, ebenfalls so, als wolle er ihn berühren. Das Firmament, das ich zugedrückten Auges sah, war ganz rosarot, umsäumt von edlem Sammetschwarz. Es war eine Welt von lichter Seligkeit, in die ich schaute. Doch da öffnete ich dummerweise plötzlich die Augen, und da waren Mund und Wangen und Augen verschwunden, und des süßen Himmelskusses war ich mit einmal beraubt. Auch war es ja Zeit, in die Stadt hinunterzugehen, in das Geschäft, an die tägliche Arbeit. Soviel ich mich erinnere, machte ich mich nur ungern auf die Beine, um die Wiese, den Baum, den Wind und den schönen Traum zu verlassen. Doch in der Welt hat alles, was das Gemüt bezaubert und die Seele beglückt, seine Grenze, wie ja auch, was uns Angst und Unbehagen einflößt, glücklicherweise begrenzt ist. So sprang ich denn hinunter in mein trockenes Bureau und war hübsch fleißig bis an den Feierabend.
Die Göttin
Ich ging einst, ganz in Gedanken, die elegante Hauptstraße entlang. Viele Menschen spazierten in derselben. Die Sonne schien so freundlich. Die Bäume waren grün, der Himmel war blau. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Sonntag war. Ich erinnere mich nur, daß etwas Süßes, etwas Freundliches um mich war. Doch etwas noch Schöneres sollte folgen, indem sich nämlich vom ungewissen leichten Himmel herab eine schneeweiße Wolke auf die Straße niedersenkte. Die Wolke glich einem großen und graziösen Schwan, und auf dem weichen, weißen, flaumigen Rücken der Wolke saß, in liegender Haltung, den Arm nachlässig ausgestreckt, voller freundlicher, kindlicher Majestät, eine nackte Frau. So hatte ich mir stets die Göttinnen aus Griechenland vorgestellt. Die Göttin lächelte, und alle Menschen, die sie sahen, waren genötigt, mitzulächeln, bezaubert von der holdseligen Schönheit. O wie ihr Haar in der Sonne schimmerte! Mit ihren großen blauen gütigen Augen schaute sie die Welt an, die sie gleichsam mit ihrem hohen kurzen Besuch beehrte. Die Wolke flog auf, gleich einem Luftschiff, und nach kurzer Zeit war mir und allen andern der herrliche Anblick wieder entschwunden. Da gingen die Leute ins nächstgelegene Kaffeehaus und erzählten einander die wunderbare Neuigkeit. Noch schien die Sonne freundlich, auch ohne Göttin.
Der Nachen
Ich glaube, ich habe diese Szene schon geschrieben, aber ich will sie noch einmal schreiben. In einem Nachen, mitten auf dem See, sitzen ein Mann und eine Frau. Hoch oben am dunklen Himmel steht der Mond. Die Nacht ist still und warm, recht geeignet für das träumerische Liebesabenteuer. Ist der Mann im Nachen ein Entführer? Ist die Frau die glückliche, bezauberte Verführte? Das wissen wir nicht; wir sehen nur, wie sie beide sich küssen. Der dunkle Berg liegt wie ein Riese im glänzenden Wasser. Am Ufer liegt ein Schloß oder Landhaus mit einem erhellten Fenster. Kein Laut, kein Ton. Alles ist in ein schwarzes, süßes Schweigen gehüllt. Die Sterne zittern hoch oben am Himmel und auch von tief unten aus dem Himmel herauf, der im Wasserspiegel liegt. Das Wasser ist die Freundin des Mondes, es hat ihn zu sich herabgezogen, und nun küssen sich das Wasser und der Mond wie Freund und Freundin. Der schöne Mond ist in das Wasser gesunken wie ein junger kühner Fürst in eine Flut von Gefahren. Er spiegelt sich im Wasser, wie ein schönes liebevolles Herz sich in einem andern liebesdurstigen Herzen widerspiegelt. Herrlich ist es, wie der Mond dem Liebenden gleicht, ertrunken in Genüssen, und wie das Wasser der glücklichen Geliebten gleicht, umhalsend und umarmend den königlichen Liebsten. Mann und Frau im Boot sind ganz still. Ein langer Kuß hält sie gefangen. Die Ruder liegen lässig auf dem Wasser. Werden sie glücklich, werden sie glücklich werden, die zwei, die da im Nachen sind, die zwei, die sich küssen, die zwei, die der Mond bescheint, die zwei, die sich lieben?
Pierot
Auf den Maskenball war auch ein langer, hochaufgeschossener, ungelenkiger Gesell gekommen. Er nannte sich Pierot. Vielleicht wäre es für ihn besser getan gewesen, hübsch ruhig zu Hause zu bleiben und zwischen seinen eigenen vier Wänden Trübsal zu blasen, als hier im schönen Vergnügungssaal durch Langeweile hervorzuragen. Er schlenkerte und schleuderte die langen Arme hin und her. Es sah zum Verzweifeln aus, wie er seinen Kopf zur Erde hängen ließ. Wo wollte er hinaus mit sich, und was gedachte er auf dem lustigen Maskenball zu beginnen? Übermütig tanzten die Liebespaare rund um ihn herum. O wie schön die Kerzen strahlten, wie süß die Musik spielte! War es nicht, als wenn Mondstrahlen in den Saal hineinfliegen? Pierot legte sich, wie ein geschlagener Hund, in einen Winkel an den Boden und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Unterdessen wirbelte und wedelte und hüpfte, einem artigen, guterzogenen Hündchen gleich, die Tanzlust hin und her. Gläser klirrten, Pfropfen knallten, Wein wurde getrunken, und Gelächter ertönte. Ein glühender Verehrer hatte die Geliebte und abgöttisch Verehrte aus den Augen verloren und suchte sie. Ein anderer, vom Entzücken hingerissen, kniete vor der Dame seines Herzens nieder. Zwei Glückliche küßten und liebkosten sich. Jedermann schien das Seinige zu haben. Alles war bewegt; alles war in Bewegung. Nur er, der arme, arme Pierot, war unbeweglich. Für ihn gab es keine Lust. Er begriff sich selbst und die Welt nicht. Leblos, einer weißen Statue ähnlich, oder einem Gemälde ähnlich, lag er da und schaute verständnislos vor sich hin. Ein kaum merkliches trauervolles Lächeln spielte ihm um die blassen Lippen. Sein Gesicht war ganz mehlern. Er hatte sich gepudert, der Dummkopf. Armer Dummkopf, armer Bursche! Wo alles außer sich war, wo alles lebte und lachte, wo alles, was Beine hatte, tanzte und Luftsprünge machte, glich er dem tödlich getroffenen Verwundeten, verblutend an den spitzfindigen, dolchähnlichen Melancholien. Ja, er hätte zu Hause bleiben sollen. Derlei hoffnungslose Menschen sollen der Lust, dem Glanz, dem Glück und der Freude fernbleiben. Sie sollen in der Einsamkeit leben.
Sommerfrische
Was tut man in der Sommerfrische? Du mein Gott, was soll man viel tun? Man erfrischt sich. Man steht ziemlich spät auf. Das Zimmer ist sehr sauber. Das Haus, das du bewohnst, verdient nur den Namen Häuschen. Die Dorfstraßen sind weich und grün. Das Gras bedeckt sie wie ein grüner Teppich. Die Leute sind freundlich. Man braucht an nichts zu denken. Gegessen wird ziemlich viel. Gefrühstückt wird in einer lauschigen, sonnendurchstochenen Gartenlaube. Die appetitliche Wirtin trägt das Frühstück auf, du brauchst nur zuzugreifen. Bienen summen um deinen Kopf herum, der ein wahrer Sommerfrischenkopf ist. Schmetterlinge gaukeln von Blume zu Blume, und ein Kätzchen springt durch das Gras. Ein wunderbarer Wohlgeruch duftet dir in die Nase. Hiernach macht man einen Spaziergang an den Rand eines Wäldchens, das Meer ist tiefblau, und muntere braune Segelschiffe fahren auf dem schönen Wasser. Alles ist schön. Es hat alles einen gewinnenden Anstrich. Dann kommt das reichliche Mittagessen, und nach dem Mittagessen wird unter Kastanienbäumen ein Kartenspiel gespielt. Nachmittags wird im Wellenbad gebadet. Die Wellen schlagen dich mit Erfrischung und Erquickung an. Das Meer ist bald sanft, bald stürmisch. Bei Regen und Sturm bietet es einen großartigen Anblick dar. Nun kommen die schönen stillen Abende, wo in den Bauernstuben die Lampen angezündet werden und wo der Mond am Himmel steht. Die Nacht ist ganz schwarz, kaum durch ein Licht unterbrochen. Etwas so Tiefes sieht man nirgends. So kommt ein Tag nach dem andern, eine Nacht nach der andern, in friedlicher Abwechslung. Sonne, Mond und Sterne erklären dir ihre Liebe, und du ihnen ebenfalls. Die Wiese ist deine Freundin, und du ihr Freund, du schaust während des Tages öfters hinauf in den Himmel und hinaus in die weite zarte weiche Ferne. Am Abend, zur bestimmten Stunde, ziehen die Rinder und Kühe ins Dorf hinein, und du schaust zu, du Faulenzer. Ja, in der Sommerfrische wird ganz gewaltig gefaulenzt, und eben das ist ja das Schöne.
Frau von Twann
Waren Sie schon einmal bei Frau von Twann? Nicht? Dann beeilen Sie sich, dieser Frau eine Artigkeit zu sagen, damit Sie eine Einladung bekommen, bei ihr zum Essen zu erscheinen. Frau von Twann ist geistvoll, aber sie ist noch mehr als das, sie ist schön. Sie ist in ihrer Art eine reife Birne, weich, doch von ausnehmend schöner Form. Das Essen, das sie gibt, ist vorzüglich; die Weine sind ausgezeichnet. Doch das ist das wenigste. Wenn du Frau von Twann die Hand küßt, schwebst du schon im Himmel. Ein Lächeln hat diese Frau. Geh hin zu ihr und sieh zu, daß sie dir ein Lächeln schenkt. Ihr Lächeln ist wie ein Kuß. Sie weiß das, und daher hütet sie sich, es zu verschwenden. Die Blumen, die Lichter, die Musik bei Frau von Twann. Schon der bloße Gedanke macht mich schwelgen. B…, dieser Kenner der Genüsse, lechzt danach, der seltenen Frau vorgestellt zu werden, und sie wird sicherlich den ausgezeichneten Mann gern empfangen. Sie besitzt Geschmack, doch sie besitzt mehr, sie besitzt Größe. Sie ist von einer Munterkeit durchdrungen, die auf denjenigen überspringt, der die Freude empfindet, sich an der Unterhaltung beteiligen zu dürfen, deren Lenkerin und Leiterin sie ist. Sie ist die Herrin und Gebieterin vieler reizender Einfälle, und zu wem sie ein Wort spricht, der ist von ihr bezaubert. Ihr Eßzimmer ist schneeweiß, von zartem Gold durchbrochen. Süße Malereien schmücken die Wände. Der Empfangsraum ist grün, gleich der frohlockenden Hoffnung, die Gunst der Herrin des Hauses zu gewinnen. Wer bei ihr im Hause ist, der muß frohlocken, ob er will oder nicht. Die Bedienung ist tadellos. Die Diener der Frau von Twann sind derart einexerziert, daß man gar nicht merkt, daß sie überhaupt da sind. Kann man einer Dienerschaft ein besseres Zeugnis ausstellen? Die unsichtbare Musik, die während des Essens in die Ohren der Schmausenden niederträufelt, ist so schön, daß man sich einbildet, Mozart selbst dirigiere sie. Poeten tragen gern bei Frau von Twann ihre neuesten, noch ganz warmen und feuchten Gedichte vor, und sie ernten meist reichen Beifall, den sie redlich verdienen. Wen lädt die holde hohe Frau ein? Nun, alle, die von der Absicht beseelt sind, sich ehrlich zu amüsieren. Sie liebt die Ausgelassenheit. O das Mondlicht, das zarte, silberne, das dort in die heimlichen, duftenden Gemächer hineinbricht. Eines ihrer Zimmer ist ganz blau, wie ein Himmel. Dorthin verlieren sich die Liebenden, um sich zu küssen. Noch hat kein Mensch sich bei Frau von Twann gelangweilt. Das müßte ein elender Mensch sein, der sich bei der Liebenswürdigen, Anbetenswerten langweilen könnte. Aber das ist ja unmöglich. Sie macht den, der sie kennen lernt, zum guten, edlen und unterhaltenden Menschen.
Die Insel
Ein Hochzeitspaar aus Berlin ging auf die Reise. Die Fahrt war lang. Endlich kamen die beiden jungen Vermählten in einer Stadt an, die war ganz aus roten ernsten Steinen gebaut, und ein breiter blauer Strom floß daran vorüber. Ein hoher majestätischer Dom spiegelte sich im Spiegel des Wassers. Doch die Stadt schien ihnen nicht geschaffen, längeren Aufenthalt zu nehmen, und sie zogen weiter, und da es regnete, spannten sie einen großen Regenschirm auf und versteckten sich unter demselben. Sie kamen vor ein altes, in einem weitläufigen Garten verborgenes Schloß und gingen schüchtern hinein. Eine schöne steinerne Wendeltreppe, geschaffen wie für einen regierenden Fürsten, führte hinauf ins erste Stockwerk. Alte dunkle Gemälde hingen an den hohen, schneeweißen Wänden. Sie klopften an einer schweren alten Türe. »Herein.« Und da saß, in eine gelehrte geheimnisvolle Arbeit vertieft, ein uraltes Männchen am Schreibtisch. Die Leute aus Berlin fragten, ob sie im Schloß wohnen könnten, es gefiel ihnen. Doch es war nichts anzufangen mit dem alten Mann, der nur schwerfällig den Kopf schüttelte. So zogen sie weiter. Sie kamen in ein Schneegestöber hinein, arbeiteten sich aber wieder heraus, und so ging es fort durch Wälder, Dörfer und Städte. Nirgends wollte sich ein passendes Lustplätzchen ausfindig machen lassen, und in den Hotels waren obendrein noch die Kellner frech, die Spitzbuben. Sie übernachteten einmal in einem Hotel, wo es freilich die weichsten und schönsten Roßhaarbetten gab und liebliche Gardinen vor den Fenstern, aber die Preise, unverschämt teuer, drückten ihnen beinahe das Herz ab. Bis nach Venedig kamen sie, zu den höhnischen Italienern. Die Schurken, sie singen Serenaden, pressen aber dafür den Fremden das Geld mit Hebeln und mit Schrauben ab. Schließlich hatten sie Glück. Sie erblickten aus der Ferne, mitten in einen anmutigen See gelegt, eine liebliche, hellgrün schimmernde Insel, auf diese steuerten sie zu, und dort fanden sie es so schön, daß sie nicht mehr fort konnten. Sie blieben auf der Insel wohnen. Die Insel glich an landschaftlicher Schönheit einem holden süßen Mädchenlächeln. Dort logierten sie und waren glücklich.
Meta
Es trug sich zu, daß ich eines Nachts, nur noch dunkel erinnere ich mich der kleinen aber rührenden Szene, von einer wilden Trinkwanderung verstört und taumelnd heimkehrend, in einer der monotonen Straßen der großen Stadt eine Frau antraf, die mich aufforderte, mit ihr nach Hause zu gehen. Es war keine schöne und doch eine schöne Frau. Entsprechend dem Zustand, in welchem ich mich befand, richtete ich allerhand mich selber höchlich belustigende, törichte, wenngleich vielleicht witzige Redensarten an das nächtliche Geschöpf, wobei ich mit der Gabe, die den Leuten eigen ist, die einen Rausch haben, merkte, daß ich ihr sehr amüsant erschien. Noch mehr: ich gefiel ihr, und ich gewann den Eindruck, daß sie sich einer liebenswürdigen Schwäche in bezug auf mich hinzugeben begann. Ich wollte sie verlassen, doch sie ließ mich nicht los, und sie sagte: »O, geh nicht von mir weg. Komm mit mir, lieber Freund. Willst du kaltherzig sein und nichts empfinden für mich? Nicht doch. Du hast viel getrunken, du kleines Kerlchen. Trotzdem sieht man dir an, daß du lieb bist. Willst du nun böse sein und mich so schmählich abweisen, wo doch ich dich so rasch liebgewonnen habe? Nicht doch. O, wenn du wüßtest – – doch man darf ja den Herren nicht mit Gefühlen kommen, sonst verachten und verlachen sie unsereinen nur. Wenn du wüßtest, was ich leide unter der Kälte, unter der Leere all dieser Sinnlichkeiten, die mein trauerspielgleiches, schreckenerregendes Gewerbe sind. Ich erschien mir bis heute nur immer wie ein Ungeheuer, wert, mit Fußtritten behandelt zu werden. Ich habe jetzt eine milde, süße, fromme Empfindung in mir, erweckt durch dich, mein Lieber, und du, du willst mich jetzt wieder in den Scheusalabgrund zurückwerfen? Nicht doch. Bleib, bleib, und komm mit mir. Wir wollen die ganze Nacht verscherzen miteinander. O, ich werde dich zu unterhalten wissen, du sollst sehen. Wer Freude hat, ist der nicht am ehesten zur Unterhaltung geschaffen? Und ich, ich habe jetzt, nach langer, langer Zeit, wieder einmal eine Freude. Weißt du, was das für mich, die Entmenschte, bedeutet? Weißt du das? Du lächelst? Du lächelst hübsch, und ich liebe dein Lächeln. Und willst du nun lieblos, und ganz entfernt von aller schönen Freundschaft, treten auf die Freude, die ich bei deinem Anblick empfinde? Willst du zerstören und zunichte machen, was mich glücklich, was mich, nach so langer, langer Zeit, wieder einmal glücklich macht? Süßer Freund! Soll ich, nachdem ich immer mit dem Grausen und mit dem bleiernen Entsetzen mich habe einlassen müssen, nun mich nicht auch einmal mit dem wahrhaftigen Vergnügen befassen dürfen? Sei nicht grausam. Bitte, bitte. Nein, du wirst es nicht bereuen. Du wirst die Stunden, mit der Verachteten und Entehrten zugebracht, willkommen heißen und in deinem Innern segnen. Sei weich und komm mit mir. Sei sonst meinetwegen nie weich, aber jetzt, jetzt sei es und knüpfe vertraulich an mit der Geschmähten. Sieh, wie die Tränen mir in die Augen kommen, und höre, wie ich flehe. Wenn du gehst, ohne freundlich zu mir zu sein, ist mir alles schwarz vor den Augen; hingegen, wenn du lieb bist, strahlt in der Nacht die helle Sonne. Sei du heute nacht der glückversprechende, freundliche Stern an meinem Himmel. Du bist gerührt? Du gibst mir die Hand? Du willst mit mir kommen? Du liebst mich?« – –
Nachwort: Könnte dies nicht Kirke sein, die den seefahrenden ritterlichen Griechen bittet, bei ihr zu bleiben? Er will heim, doch sie, sie fleht ihn an, sie nicht zu verlassen. Sie ist eine böse Zauberin, die diejenigen, die sie anschaut, in grunzende Schweine verwandelt. Sie bestreitet es zwar; sie sagt, sie sei keine böse Zauberin, sondern unterliege selber dem bösen Zauber. Das kann schon möglich sein. Übrigens ist sie rührend schön. Sie besitzt eine weiche, lispelnde Stimme, und aus ihren meergrünen und -blauen Augen, wie wir sie oft bei ausländischen Katzen sehen, bricht ein wunderbarer, stolzer und lieber Glanz. Sie ist nicht unglücklich und doch auch wieder nicht glücklich. Bei dem Griechen sucht und findet sie ihr Glück, und nun will er sie verlassen, um zur harrenden Gattin zurückzukehren. O zartes Trauerspiel. Unter anderem sagt sie ihm, daß die Gefährten sich ja ganz von selbst in Schweine verwandelt hätten. Nicht bei ihr, sondern bei ihnen selber sei die Schande und die Schuld zu suchen. Weil sie wollen Schweine sein, sind sie's. Sie lächelt, und in das Lächeln schleicht sich eine Träne. Sie ist ironisch und zugleich tiefernst, frivol und gleichzeitig schwermütig. »Siehst du denn nicht,« spricht sie, seine Hand erfassend, »daß nicht ich die Zauberin jetzt bin, sondern daß du der Zauberer bist? O, sei mein Freund, mein Schützer, mein lieber, herrlicher Zauberer. Schütze mich vor der Kirke. Ich bin nicht die Kirke, wenn du bei mir bist. Sie geht weg, wenn du nicht weggehst.« So redet sie und überschüttet ihn mit süßen Liebkosungen, doch er, er – – geht. Er überläßt sie der Kirke, er überläßt sie sich selbst, er überläßt sie der ihr innewohnenden Grausamkeit, er überläßt sie der Schmach, deren Sklavin sie ist. Kann er gehen? Ist er so hart?
Fußwanderung
Wie war der Mond auf dieser Wanderung schön, und wie blitzten und liebäugelten die guten, zarten Sterne aus dem hohen Himmel auf den stürmischen ungeduldigen Fußgänger herab, der da fleißig weiter und weiter marschierte. War er ein Dichter, der da von dem leuchtenden Tag in den sanften blassen Abend hineinlief? Wie? Oder war es ein Vagabund? Oder war er beides? Gleichviel, gleichviel: Glücklich war er und bestürmt von beunruhigendem Sehnen. Das Sehnen und Suchen, das Niebefriedigtsein und der Durst nach Schönheit trieben ihn vorwärts, und hinter, weit hinter ihm schlummerten die bilderreichen Erinnerungen. Was hinter ihm lag, ging ihm durch den Wanderkopf, und was Unbekanntes vor ihm lag, zog wie Musik durch seine begierige Seele. Die Sonne brannte, und der Himmel war blau, und der blaue weite große Himmel schien sich immer mehr auszudehnen, als werde, was groß sei, immer größer, und was schön sei, immer schöner, und was unaussprechlich sei, immer unermeßlicher, unendlicher und unaussprechlicher. Aus golden-dunklen, dämonisch blitzenden Abgründen duftete edle wilde Romantik herauf, und Zaubergärten schienen rechts und links von der Landstraße zu liegen, lockend mit reifen, süßen, schönfarbenen Früchten, lockend mit geheimnisvollen unbeschreiblichen Genüssen, die die Seele schon schmelzen und schwelgen machen im bloßen flüchtig-zuckenden Gedanken. O was war das für ein lustiges, tanzendes Marschieren, und dazu zwitscherten die Vögel, daß das Ohr am Gesang noch lange hing, wenn es von dem Herrlichen schon nichts mehr hörte, daß das Herz meinte aus dem Leib heraustreten und in den Himmel hinauffliegen zu müssen. Dörfer wechselten mit weiten Wiesen, Wiesen mit Wäldern und Hügel mit Bergen ab, und wenn der Abend kam, wie wurde da nach und nach alles leiser und leiser. Schöne Frauen traten aus dem Düster, Geflüster und Dunkel groß hervor und grüßten mit stiller, königinnen- und kaiserinnengleicher Gebärde den Wanderer. Und wie war es doch erst in den stillen, von der heißen mittäglichen Sonne beschienenen und verzauberten Dörfern, wo das heimelige Pfarrhaus stand in der grünen rätselhaften Gasse, und die Leute dastanden mit großgeöffneten, erstaunten und sorgsam forschenden und fragenden Augen. Wunderbar war das Einkehren in das Gasthaus und das Schlafen im sauberen, nach frischem Bettzeug duftenden Gasthausbett. Das Zimmer roch zum Entzücken nach reifen Äpfeln, und am frühen Morgen stellte sich der Wanderbursche an das offene Fenster und schaute in die bläulich-goldene, grüne und weiße Morgenlandschaft hinaus und atmete die süße Morgenluft in seine wildbewegte Brust hinein, von all der Schönheit, die er sah, überwältigt. Wieder und wieder wanderte er weiter, mit heiteren und mit düsteren Gedanken, unter dem Tag- und unter dem Nachthimmel, unter der Sonne und unter dem Mond, unter schmerzenden und unter glücklich lächelnden Gefühlen. Ach, und wie schmeckten ihm Käs und Brot und die zwiebelbelegte köstliche, ländlich zubereitete Bratwurst. Denn wenn dem rüstigen Wandersmann das Essen nicht schmeckt, wem sonst soll es dann noch schmecken?
Der Kuß
Was habe ich Merkwürdiges geträumt? Was widerfuhr mir? Welch eine seltsame Heimsuchung ist gestern nacht, als ich im Schlafe dalag, urplötzlich, wie aus einem hohen Himmel herab, dem fürchterlichen Blitz ähnlich, über mich gekommen? Ahnungslos und willenlos und gänzlich bewußtlos, der Sklave des Schlafes, der mich fesselte und mich in seinen Kerker schloß, lag ich da, ohne Wehr und ohne Waffen, ohne Voraussetzung und ohne Verantwortung (denn im Schlaf ist man unverantwortlich), als das Herrliche und Schreckliche, das Große und Süße, das Liebe und Furchtbare, das Entzückende und Entsetzliche über mich herfuhr, als wolle es mich mit seinem Druck und Kuß ersticken. Der Schlaf hat innere Augen, und so muß ich denn gestehen, daß ich mit einer Art von zweiten und anderen Augen dasjenige sah, was auf mich zustürzte. Ich sah es, wie es mit Windes- und Blitzesgeschwindigkeit, den unendlichen Raum zerschneidend, aus der unermeßlichen, gigantenartigen Höhe herabschoß auf meinen Mund. Ich sah's, und ich war entsetzt, und ich war doch nicht imstande, mich zu