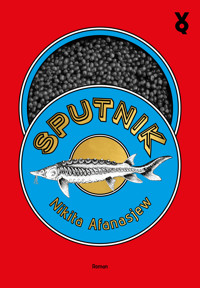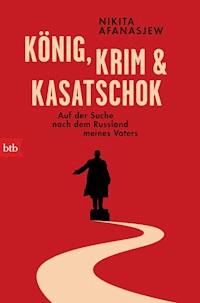
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
„Was später eine lange Reise in den Osten werden sollte, von der Krim über Moskau durch Sibirien und bis an den Pazifik, begann auf dem Sofa im Ruhrgebiet. Dort leben meine Eltern: Margherita und Sergej.“ 1993 übersiedelt der damals zehnjährige Nikita Afanasjew mit seinen Eltern aus der russischen Industriemetropole Tscheljabinsk nach Deutschland. Er und sein Vater geraten immer wieder in Streit über die politische Situation in Russland: der Sohn ist kritisch, der Vater nicht. Afanasjew nimmt den Zwist zum Anlass, sich auf Spurensuche zu begeben: nach dem Russland seines Vaters und in seiner Heimatstadt. Dabei begegnet er Freunden des Vaters, Verwandten, Funktionären und Schurken, und manchmal beidem in einer Person. So präsentiert er ein sehr persönliches und zugleich hochaktuelles Bild von dem Land, das er als Kind verließ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Ähnliche
Zum Buch
»Was später eine lange Reise in den Osten werden sollte, von der Krim über Moskau durch Sibirien und bis an den Pazifik, begann auf einem Sofa im Ruhrgebiet. Dort leben meine Eltern: Margherita und Sergej.« 1993 übersiedelt der damals zehnjährige Nikita Afanasjew mit seinen Eltern aus der russischen Industriemetropole Tscheljabinsk nach Deutschland. Er und sein Vater geraten immer wieder in Streit über die politische Situation in Russland: der Sohn ist liberal eingestellt, der Vater ist von westlichen Idealen enttäuscht. Afanasjew nimmt den Zwist zum Anlass, sich auf Spurensuche zu begeben: nach dem Russland seines Vaters und in seiner Heimatstadt. Dabei begegnet er Freunden des Vaters, Verwandten, Funktionären und Schurken, und manchmal beidem in einer Person. So präsentiert er ein sehr persönliches und zugleich hochaktuelles Bild von dem Land, das er als Kind verließ.
Zum Autor
NIKITA AFANASJEW wurde 1982 in Tscheljabinsk geboren. Aus der grauen Industriestadt am Ural folgte 1993 der Umzug ins deutsche Ebenbild, das Ruhrgebiet. Als Journalist machte er zahlreiche Reisen in den postsowjetischen Raum und schrieb für Tagesspiegel, taz, Zeit online, 11 Freunde u.a. 2015 wurde er mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet.
Nikita Afanasjew
KÖNIG, KRIM & KASATSCHOK
Auf der Suche nach dem Russland meines Vaters
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Er zog hinaus in die deutsche Steppe und Kriegsgeheimnis:© Sergej Afanasjew
Mit freundlicher Genehmigung
Die Übersetzung der Erzählungen von Sergej Afanasjew besorgte Sabine Baumann.
1. Auflage
Copyright © 2018 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Shutterstock/Oleg Troino
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21599-6V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Inhalt
1. Auf dem Sofa im Ruhrgebiet
2. Agenten, Sonne, Tod: Krim
3. Meine Anfänge im Westen
4. Alle Wege führen nach Moskau
5. Der Westen: Die Fortsetzung
6. Auferstanden aus Ruinen
7. Von Äpfeln und Birken: Im Zug, zum Ersten
8. Hallo, Mr. Stalin
9. Peruaner in Kasan
10. Mein wilder Osten
11. Ein netter Küchenchef: Im Zug, zum Zweiten
12. Deutsche in der Sowjetunion
13. Mein Tscheljabinsk
14. Die Geister von Arkaim
15. Aljoschas langer Weg
16. Wenn ich geblieben wäre
17. Baukran-Ballett
18. An den inneren Rändern Russlands
19. New Age in Sibirien
20. Im Angesicht der Unendlichkeit
21. Ein Spion auf Abwegen:Im Zug, zum Dritten
22. Für immer und er
23. Der Weltraum hat heute geschlossen
24. Russische Freiheit
25. Zurück auf dem Sofa
1. Auf dem Sofa im Ruhrgebiet
Was später eine lange Reise in den Osten werden sollte, von der Krim über Moskau in meine Heimatstadt Tscheljabinsk, durch Sibirien und bis an den Pazifik, begann auf einem Sofa im Ruhrgebiet. Dort leben meine Eltern: Margherita und Sergej.
Der Fernseher läuft. Der russische Nachrichtensender »Rossija 24« sendet Bilder aus dem ostukrainischen Krisengebiet Donbass. Da ist ein bewaffneter Glatzkopf. Er schreit einen russischen Gefangenen an, schlägt ihm die Mütze vom Kopf. Irgendwelche Nazis, die den Hitler-Gruß zeigen. Einfache Menschen, die berichten, dass der Beschuss ihrer Wohngebiete durch Kiews Regierungstruppen seit Tagen nicht aufhöre. Das Wasser werde knapp.
Dann kommt Werbung. Und nach der Werbung das Gleiche wie vor der Werbung. Die Krise als Dauerschleife, unterbrochen nur von schnellen Schnitten und mit bebender Stimme vorgetragenen Appellen: »Die neuesten Entwicklungen gleich bei uns! Bleiben Sie dran!«
Mein Vater schüttelt missmutig seinen Kopf. »Da sieht Europa mal, was für nette Neuzugänge aus der Ukraine kommen.«
Ich hatte mir vorgenommen, diese Diskussion nicht mehr zu führen, aber … »Papa, du weißt doch, dass die absichtlich nur die Idioten zeigen.«
»Ich weiß«, sagt mein Vater, »dass die Russen in der Ukraine einfach Russen sein wollen und dafür umgebracht werden. Als Allererstes haben die nach ihrer Revolution ein Gesetz verabschieden wollen, das die russische Sprache herabstuft, damit …«
»Aber das Gesetz wurde nicht verabschiedet«, unterbreche ich ihn.
Meine Mutter kommt aus der Küche, bleibt an der Türschwelle stehen und sagt: »Die haben zuletzt in einer Reportage junge Ukrainer gezeigt, die gesagt haben, dass sie nur nach Europa wollen, um Sozialhilfe zu kassieren.«
»Mama, nur weil ein paar Typen …«
»Oh, es brennt an!«, ruft meine Mutter, schon mit dem Rücken zu mir, unterwegs in die Küche.
Mein Vater rutscht auf dem Sofa etwas nach vorne und schaut aus dem Fenster. Auch er kann die Dauerkrisenschleife manchmal nicht mehr sehen, denke ich. »Natürlich ist das ein Informationskrieg. Die russischen Sender versuchen, ihre Sicht zu zeigen. Aber im Westen läuft das nicht anders.« Dann schaut er ernst zu mir. »Du bist voll von westlicher Propaganda.«
Ich drehe mich zu meinem Vater, will gerade ansetzen …
»Schluss jetzt!«, sagt meine Mutter, die plötzlich wieder im Zimmer steht. »Bitte, nicht schon wieder! Nicht diese Debatte, bitte, bitte. Der Borscht ist sowieso fertig. Setzt euch an den Tisch.«
So wie an diesem Tag lief es meistens, wenn ich meine Eltern besuchte, seit der neue Ost-West-Konflikt begonnen hatte. Manchmal stritten mein Vater und ich stundenlang, bis ich uns selbst in einer Rossija-24-Dauerschleife glaubte, unterbrochen nicht von Werbung, sondern von den Bitten meiner Mutter, endlich die Sendung einzustellen. Wir kriegten uns meistens irgendwie wieder ein, ohne je etwas zu lösen. Viele Familien aus der ehemaligen Sowjetunion sind an dem neuen Kalten Krieg kaputtgegangen. Lautes Propaganda-Geschrei führt manchmal zu vollständiger Stille. Das wollte ich unbedingt vermeiden.
Ich bin 1982 in Tscheljabinsk geboren, einer Industriestadt mit etwa 1,2 Millionen Einwohnern. Sie liegt anderthalb Tage Zugfahrt östlich von Moskau, an der Grenze zwischen Europa und Asien. Die vielen Industrierohre und authentisch rauen Menschen machen Tscheljabinsk zu einer Art russischem Ruhrgebiet. Von daher war es irgendwie konsequent, dass die ganze Familie Afanasjew 1993 dorthin zog. Dorthin, ins Ruhrgebiet, aber irgendwie auch dorthin: auf die Couch. Denn meinem Vater ist es nicht gut ergangen in Deutschland. Er hat sich nicht integriert.
»Ich wohne hier nicht. Ich halte mich hier auf«, hat er mir einmal gesagt. Da waren wir schon über zwanzig Jahre da.
Mein Vater war einmal regimekritisch gewesen, ein halber Dissident, der in seinem Job Panzer entwickelte und in seiner Freizeit verbotene Bücher las, der noch zu Sowjetzeiten der Rüstungsindustrie den Rücken kehrte, um die im Land so viel dringender benötigten medizinischen Geräte zu entwickeln. Erst in den vergangenen Jahren hat er sich die neue Härte der russischen Außenpolitik voll auf die Fahne geschrieben.
Ich selbst wurde Journalist und ging nach Berlin. Auch dort verbrachte ich viel Zeit mit Diskussionen über den neuen alten Konflikt Ost gegen West – nur unter umgekehrten Vorzeichen. In den Debatten mit vielen deutschen Freunden und befreundeten Journalisten verteidige ich oft Russland, weil mir das westliche Dominanzstreben als zu ausgeprägt erscheint, die russische Position als zu wenig verstanden. Irgendwann war ich an dem Punkt angelangt, wo ich gegen Russland und gegen den Westen war und sowieso in jeder Diskussion auf der anderen Seite.
Es gibt Russland mehrfach, einmal das Russland meiner Wahrnehmung und der meines Vaters – wobei das Russland meines Vaters natürlich auch aus vielen Schichten besteht. Da ist zunächst seine Erinnerung an die früher oft verfluchte und nun ebenso oft glorifizierte sowjetische Vergangenheit. Dann ist da das ambivalente Russland, wie er es bei seinen regelmäßigen Besuchen selbst erlebt – und dieses Land aus dem Staatsfernsehen, das sich heldenhaft gegen moralisch völlig verkommene westliche Aggressoren zur Wehr setzt.
Die Besuche meines Vaters in Russland aber hatten in den vergangenen Jahren eine traurige Note, was nicht an der großen Weltpolitik lag.
Mein Cousin Alexej, genannt Aljoscha, versteckte sich zweieinhalb Jahre vor der Polizei. Dabei ist Aljoscha selbst Polizist. Er und seine Mutter – die Schwester meines Vaters – sind die engsten Verwandten, die wir noch in Russland haben. Bei seiner Schwester wohnt mein Vater auch, wenn er in Tscheljabinsk ist.
Aljoscha hatte gegen Autodiebe ermittelt, die von korrupten Polizisten und Geheimdienstlern gedeckt wurden. Statt der Diebe wanderten ehrliche Polizisten ins Gefängnis. Aljoscha aber tauchte unter. Der Fall wurde in Russland groß verhandelt, sogar in der Administration von Präsident Wladimir Putin sprachen die Unterstützer der Polizisten vor. Ein Polizeichef ist gegangen worden, ein russischer Ministerpräsident wurde durch den Vorfall geschwächt. Mein Cousin Aljoscha war bei all diesen Vorfällen mittendrin.
Mein Vater hatte Aljoscha in dieser Zeit unter höchst konspirativen Umständen einmal getroffen – und mich danach damit überrascht, nicht einmal in einer solchen Situation an Russland zu verzweifeln.
Es gibt aber nicht nur Aljoscha, sondern weitere Verwandte, die ich kaum kannte. Es gibt Freunde meines Vaters. Es gibt dieses Russland, ein ganzes Universum, über das ich ständig diskutierte, ohne es einmal wirklich gesehen zu haben. Ich war zwar auch nach meinem Wegzug dort, aber zumeist ging es nach Moskau und selten tief ins Gewebe.
Es gibt da dieses riesige Land, in dem ich geboren wurde und aus dem meine Eltern mich wegbrachten, was ich als Zehnjähriger natürlich nicht wollte. Später war ich glücklich darüber, in Deutschland zu leben, dafür begannen meine Eltern zu bereuen, mit mir fortgegangen zu sein. Es ist dieses Land, in dem sich scheinbar alles irgendwann in sein Gegenteil verkehrt, in dem Zukunftsutopien vergehen, ohne je Gegenwart zu werden, in dem so viel in Beton gegossen wird, aber nie etwas gewiss zu sein scheint, noch nicht einmal das Vergangene.
Es ist das Land, welches meine Eltern und ich vor mehr als zwanzig Jahren hinter uns gelassen hatten, das mich aber nie ganz losgelassen hat. Im Sommer 2016 beschloss ich, Russland zu erkunden.
2. Agenten, Sonne, Tod: Krim
Ich war drei Mal auf der Krim, und jedes Mal gehörte sie zu einem anderen Staat.
Das erste Mal war 1988, ich war noch nicht ganz sechs und die Sowjetunion noch nicht ganz untergegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eigene Erinnerungen an diesen Sommer habe oder ob meine Eltern mit ihren Geschichten und Fotos das für mich übernommen haben. Russische Eltern pflegen ihren Kindern alles abzunehmen, vom angeknabberten Apfelstrunk bis zur Berufswahl. Warum also nicht auch ihre Erinnerungen?
Auf den Fotos bestehe ich nur aus Haut und Knochen. Ich sah früher so aus, obwohl meine Eltern mich, wie es sich so gehörte, fortwährend fütterten. Irgendwie wirke ich auch gebräunt, was auf etwas verblichenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen aber nicht so leicht auszumachen ist. Meine Mutter erzählte mir später, dass sie keine Essensmarken für Butter und Käse hatte und dass einmal die ganze Nachbarschaft trauerte, weil eine Frau den Sarg mit ihrem Sohn empfangen musste, der in Afghanistan gefallen war. Meine Mutter sagt, es war trotzdem eine gute Zeit.
Das zweite Mal war ich im Sommer 2013 auf der Krim. Ich reiste mit eigenem Auto aus Berlin an, zahlte nur fünf Minuten hinter der polnisch-ukrainischen Grenze Schmiergeld an zwei gut gelaunte ukrainische Polizisten und fuhr später in ein so großzügig bemessenes Schlagloch, dass die Gurte in meinem westlich-dekadenten Fiat Brava wie bei einem Unfall blockierten.
Ein halbes Jahr später sollte die zweite Maidan-Revolution die Ukraine erschüttern, aber davon war noch nichts zu spüren. Statt einer sich andeutenden Zeitenwende schien die Zeit auf der Krim stillzustehen. Der Sommer war sehr heiß, die Hügel grün, die Strände voll, abseits der größeren Orte ragten Betonskelette nicht fertig gebauter Hotels aus dem Boden.
In der günstigsten Herberge von Jalta gab mir die Rezeptionistin ein Anmeldeformular in die Hand, das neben den üblichen Angaben nach dem Namen des zuständigen KGB-Abschnittsleiters fragte, der meine Dienstreise genehmigt hatte. »Diese Zeile lasse ich mal aus«, sagte ich.
Sie lachte. »Die Zettel wurden länger nicht aktualisiert.«
Die Krim blieb in meiner diesmal definitiv eigenen Erinnerung ein sympathisch unaufgeregtes Idyll in slawischer Südsee.
Nach dem Umsturz in Kiew regten sich dagegen alle wegen oder um die Krim auf, die Krim-Krise beherrschte lange die Schlagzeilen. Am Ende verleibte sich Russland die Halbinsel ein, und nichts war mehr wie zuvor zwischen Ost und West. Anders ausgedrückt, wurde es zwischen Ost und West wieder in etwa so, wie es noch zu Zeiten meines ersten Besuchs gewesen war. Die Geschichte hatte sich scheinbar im Kreis gedreht. Doch sicher war die aktuelle Situation nicht einfach eine Kopie vergangener Tage, sondern … ich wusste eben nicht genau, wie die aktuelle Situation war. Deshalb wollte ich ja hin: um zu verstehen. Um zu sehen, ob die Krim nun ein »Militärstützpunkt mit angeschlossener Badeanstalt« geworden war, wie es in ukrainischen Medien oft hieß, oder ob dort jene patriotische Euphorie herrschte, diese Aufbruchstimmung, von der das russische Staatsfernsehen immer sprach. Und ob die Menschen dort ihr Glück fühlten, endlich (wieder) Russen sein zu dürfen, wie mein Vater überzeugt war.
Während das Flugzeug aus einem wolkenlosen Himmel zur Landung in der Inselhauptstadt Simferopol ansetzte, versuchte ich, mir nochmals klarzumachen, weshalb ich überhaupt unterwegs war.
Die Krim sollte die erste Station meines russischen Sommers werden. Ich wollte das größte Land der Erde vom Westen bis an die Pazifikküste durchreisen. Ich wollte das Russland meines Vaters entdecken. Ich wollte verstehen, was aus dem Land geworden ist, das einmal meine Heimat war.
Ich wollte nicht nur Russland, sondern den gesamten Ost-West-Konflikt für mich neu vermessen. Etwas vermessen waren vielleicht auch so viele Ziele für einen Sommer, aber eines wusste ich über dieses riesige Fragezeichen von einem Land: auf leiser Sohle ist Russland nicht beizukommen.
Lautes Klatschen riss mich aus meinen Überlegungen, aus Gedanken über die Vergangenheit in die Gegenwart. Ja, Russen klatschen, wenn ein Flugzeug sicher landet. Nicht nur in Urlaubsorten, wie Deutsche auf Mallorca, sondern überall, als wäre das russische Leben Ferien für immer.
So gelange ich im Sommer 2016 zum dritten Mal in meinem Leben auf die Krim – und zum ersten Mal beginnt alles mit Applaus.
In Simferopol treffe ich die ukrainische Journalistin Nina, die ich von einem Reporterseminar kenne. Sie heißt eigentlich anders, aber ihr echter Name tut hier nichts zur Sache. Sie stammt von der Krim, ist aber nach Kiew gezogen und hat sich zur Revolution auf dem Maidan bekannt. Nina ist noch keine dreißig – sie hat alle ihre Freunde und ihre Familie aufgeben müssen, in dieser Zeit, als sich alle entschieden haben: dafür oder dagegen. Als es keinen Platz für Zwischentöne gab. Als ihr Vater sich eine riesige russische Flagge ins Wohnzimmer hängte, während sie umgeben vom Gelb und Blau der Ukraine auf dem Maidan ausharrte.
Als ich beschloss, meine Reise auf der Krim zu beginnen, kam mir sofort Nina in den Sinn, und ich war froh, als sie spontan zusagte, zum ersten Mal seit vielen Monaten von Kiew aus auf die Krim zu kommen.
In gewisser Weise hat Nina mit ihrem Vater den gleichen Konflikt auszutragen wie ich mit meinem. Diffuse europäische Werte der jüngeren Generation treffen auf erstarrte Ideen ihrer Eltern, die in die Gegenrichtung beschleunigen: nach vorne in die Vergangenheit. Doch natürlich war die Geschichte von Nina eine ukrainische – und meine eine russische. Schließlich hatte sie mit der Krim ihre Heimat an mein Heimatland verloren.
Wie verworren alles ist, daran muss ich denken, während Nina neben mir durch Simferopol läuft. Wir bleiben neben einem Lastwagen stehen, bei dem am Seitenspiegel neben der weiß-blau-roten russischen Trikolore auch noch das schwarz-orange Sankt-Georgs-Band hängt, Symbol der russischen Armee, Erkennungszeichen der Patrioten. Nina schaut dorthin, wendet dann den Kopf ab und sagt: »Es ist komisch, hier zu sein. Das ist meine Heimatstadt, sie sieht auch noch so aus, aber … sie ist es nicht mehr.«
Wir gehen dann ins Hotel, wo wir unsere Zimmer beziehen wollen. Auch Nina will lieber im Hotel bleiben, um »nicht gleich von meinem alten Leben eingeatmet zu werden«. Es ist die größte Herberge der Stadt, heißt Hotel Moskau und liegt in der Kiew-Straße. Für Unverfängliches scheint man auf der Krim nicht viel übrigzuhaben.
Ich checke ein, problemlos; warum auch nicht? Hinter der Rezeption sind gleich vier junge Frauen, was angesichts der leeren Lobby etwas überambitioniert wirkt. Nina reicht ihren ukrainischen Pass über die Theke. Er wird, wie meiner zuvor, mehrfach kopiert, gescannt, Formulare werden ausgefüllt. Es dauert.
Dann kriegen wir Pässe und Schlüssel und wollen hoch. »Einen Moment noch«, sagt dann die älteste Rezeptionistin, Typ strenge Lehrerin. Sie schaut zu Nina: »Es fehlt noch eine Angabe. Welchem Beruf gehen Sie bitte noch mal nach?«
Nina ist sichtlich irritiert. Auch in meinem Kopf rattert es. Will die Rezeptionistin darauf hinaus, dass Nina Ukrainerin ist? Ist sie jetzt offiziell Staatsfeind? In diesem Hotel gab es im Vorfeld des Referendums über den Beitritt der Krim zu Russland eine Großrazzia gegen Journalisten aus allen möglichen Ländern, bei der auch Speicherkarten und Computer zerstört wurden. Oder will die Rezeptionistin Nina als Bordsteinschwalbe hinstellen, weil sie als Ukrainerin zusammen mit jemandem mit einem westlichen Pass eincheckt?
Nina wartet einen Augenblick zu lange und sagt: »Ich bin arbeitslos.«
Nina ist eine gute Journalistin. Eine gute Lügnerin ist sie nicht.
»Arbeitslos. Ich verstehe«, sagt die Rezeptionistin, mit süffisantem Unterton. Arbeitslose auf der Krim leben einen Monat von dem Geld, das Nina und ich gerade für unsere Zimmer zahlen.
Ich muss später an diesem Abend an eine Episode denken, die mein Vater gerne erzählt. Auch zu Sowjetzeiten gab es natürlich Hotels, doch ganz unnatürlich konnte nicht jeder Sowjetbürger einfach in einem Hotel absteigen, selbst wenn er das Geld hatte und Zimmer frei waren. Es ist eines dieser sowjetischen Mysterien, denn Erklärungen für Kränkungen gab es damals nicht. Geht also ein Sowjetbürger in ein Hotel mit Dutzenden leeren Zimmern. Der Rezeptionist sagt: »Wir können leider nichts für Sie tun.« Der Bürger setzt nach, bis der Rezeptionist schroff fragt: »Wollen Sie Ärger machen? Soll ich jemanden holen?«
Eine solche Begegnung hatten auch mein Vater und ein Freund von ihm in den 70er-Jahren gerade hinter sich. Resigniert verließen sie das Hotel, doch der Freund meines Vaters wollte die erneute sinnlose Demütigung nicht auf sich sitzen lassen. Er ging zurück und fragte den Rezeptionisten: »Würden Sie mir das Zimmer denn geben, wenn ich, wenn ich … beispielsweise Schwede wäre?« Der Rezeptionist schaute den Worten meines Vaters nach etwas verächtlich und sagte nur trocken: »Ja, dann schon.«
Der Freund meines Vaters holte seinen Pass heraus. Sein Nachname war Schwed, was auf Russisch Schwede heißt. Es war purer Zufall, mit Schweden hatte der Freund so viel zu tun wie eine Atombombe mit Weltfrieden. Aber dann geschah etwas Seltsames: der Rezeptionist lachte. Lachte – und legte die Zimmerschlüssel auf die Theke.
Die Zeiten, in denen Rezeptionisten eine diffuse Macht über Hotelgäste hatten, sie schienen auf immer verschwunden, nur um wiederzukehren, so unaufhaltsam frostig wie eine ungeliebte Jahreszeit.
Der unangenehme Ton der Rezeptionistin bleibt noch eine Weile haften, auch am nächsten Tag. Nina ist froh, als wir Simferopol verlassen und nach Jalta fahren. Nach Jalta, ans Meer. Nach Jalta, in die Subtropen. Aber auch: nach Jalta, weg von der Politik. Denn auch auf der Krim ist nicht alles Kalter Krieg, sondern vieles vor allem ein sonniger Tag am Strand. Gerade in Jalta, das aus Simferopol über einen Bergpass zu erreichen ist. Die Schwere bleibt auf der anderen Seite der Berge. Es wartet das Schwarze Meer.
Die lange Promenade von Jalta war Sehnsuchtsort für Generationen von Sowjetbürgern. Hier wurde flaniert, als dieses Wort den Russen noch unbekannt war. Hier war die Sowjetunion so unsowjetisch, wie es nur geht. Wie für DDR-Bürger auf Hiddensee schien in Jalta eine Ausreise innerhalb der Landesgrenzen möglich.
In der Erinnerung meiner Mutter hatte sich alles zum Entspannten gewendet, als wir damals endlich diese Promenade erreicht hatten. Unser Sommer auf der Krim begann 1988 unweit des Urlaubsorts Aluschta, wo wir bei einer entfernten Verwandten wohnten, beengt, so erinnert sich meine Mutter, »und am Strand gab es einen Quadratmeter Platz pro Person«. Sie habe erst später, in Jalta, begriffen, »dass Sommerurlaub ja auch schön sein kann«. Das erzählt mir meine Mutter heute und muss selbst lachen. Sie erzählt auch, dass für den Strand in Aluschta jedes Mal Eintritt gezahlt wurde, nur einige Kopeken, aber »für uns war es zu viel«. Finanzielle Sorgen ziehen sich durch alle Geschichten von damals. Dabei waren meine Eltern beide Ingenieure.
Nach Jalta schafften wir es damals erst, als mein Vater in den Urlaub nachkam. Wie das zu dieser Zeit war, wollte ich auch von ihm wissen, im Vorfeld meiner Reise, auf der Couch im Ruhrgebiet. »Wir waren im Tschechow-Haus, es war Sommer. Das hatte jetzt nicht Politisches, falls du darauf hinauswillst«, sagte mein Vater. Will ich nicht, erklärte ich ihm, sondern einfach nur wissen, wie es war. »Gut«, sagte er. Thema beendet. Mein Vater ist wirklich nicht immer redselig.
Heute ist das Finanzielle wieder allgegenwärtig, in Russland, auf der Krim. Die Frage, wie es den Menschen dort geht, ist eine hochpolitische geworden, seit die Krim russisch ist, denn das Versprechen auf ein besseres Leben ist allen noch präsent. Die meisten Menschen, die Nina und ich fragen, erzählen das Gleiche: Sie Finden es schon gut, jetzt zu Russland zu gehören. Aber das Leben sei seither schwieriger geworden. Sie hoffen darauf, dass die Touristenströme endlich kommen, dass die Brücke zum Festland endlich fertig wird, dass die Früchte endlich auf der Halbinsel angebaut und billiger werden, dass die Milliarden Rubel endlich bei den Menschen ankommen, dass …
Es ist der größte Unterschied zur ukrainischen Krim von 2013, der mir auffällt: Damals haben die Menschen in einer Art apathischer Glückseligkeit gelebt. Heute erwarten sie etwas und spüren dennoch, dass es vielleicht niemals kommen wird. Unter ukrainischer Flagge hatten sie sich damit abgefunden, dass der Staat nichts macht, aber hey: Er lässt uns in Ruhe! Und wisst ihr, was? Das Wetter ist spitze! Von Russland erwarten sie mehr. Es soll doch endlich beginnen, dieses versprochene tolle Leben.
Nina und ich wollen in Jalta nicht ins Hotel. Wir finden eine Frau, die privat Zimmer vermietet, einer der wichtigen Geschäftszweige in Jalta. »Wie alles ist?«, fragt Natascha auf meine Nachfrage hin zurück. »Für den Arsch ist es!«
Wir laufen mit Natascha zur Wohnung. Sie ist siebenunddreißig, telefoniert mit zwei Telefonen, nennt ihre Putzfrau »meine Liebste« und »meine Teuerste« und wirkt sympathisch verrückt. Als wir an einer riesigen russischen Flagge vorbeigehen, bemerkt sie die Blicke von Nina und mir und sagt: »Aber wir reden hier von Russland. Also ist es selbstverständlich der größte und prächtigste Arsch, in dem hier alles ist!«
Natascha erzählt, dass sie früher umgerechnet einhundert Dollar pro Wohnung und Nacht erlöst hat und heute nur noch ein Drittel davon. »Aber wir kommen klar«, sagt sie, während ihr zweites Handy klingelt. »Du weißt doch, wie das ist«, sagt sie ins Telefon und atmet extralaut aus. »Ich selbst war dieses Jahr erst zwei Mal im Wasser! Wann soll ich denn baden?«
Natascha wartet wie so viele auf die Brücke. Zunächst seien die Russen noch im »nationalen Freudentaumel« auf die Krim gestürzt. Doch sie würden gerne mit dem Auto anreisen. »Aber wer einmal mit Kindern bei fünfunddreißig Grad zwanzig Stunden ohne Sonnenschutz auf diese Fähre gewartet hat, muss schon ein ganz harter Masochist sein, um sich das noch mal anzutun.«
Abends laufen Nina und ich über die Promenade von Jalta. Sie ist voller entspannter Erwachsener, voller lachender Kinder. Es riecht nach Zuckerwatte.
Wir bleiben vor einem Mann stehen, der für karge Touristen-Münzen Mandoline spielt. Er trägt eine traditionelle blaue ukrainische Tracht, die aus Seide gemacht sein muss, so leicht und glänzend fällt sie über seine Knie. Nina geht zu ihm, er lächelt, was mit seinem Zwirbelbart irgendwie artistisch aussieht. Sie kennen sich. Nina spricht mit dem Mann und legt ihm eine Hand auf seine Schulter, und irgendwann sieht es so aus, als würde sie ihn stützen, bis er so alt wirkt, wie sein graues Haar es vermuten lässt.
»Er saß schon früher hier«, erklärt mir Nina. Der Mann hat fünf Kinder, und alles Geld, was ihm die Touristen hinschmeißen, geht an sie. Dass er als traditioneller Ukrainer gekleidet ist, scheint hier nichts zu machen, die Leute spenden eifrig, während Nina und ich weggehen. Der aktuelle Konflikt führt dazu, dass die Russen die Ukrainer nicht wegstoßen, sondern sie eher stützen, ja, sie umarmen wollen. Sie merken nur nicht, dass die Ukrainer diese Umarmung oft als Würgegriff empfinden.
Abends schauen Nina und ich Fußball in einer Bar am Strand. Deutschland spielt bei der Europameisterschaft gegen Italien. Nina und ich freuen uns laut, als Deutschland im Elfmeterschießen gewinnt, und sind die Einzigen, die das tun. Wir kassieren böse Blicke. Was haben die Menschen hier für Italien übrig, was haben sie gegen Deutschland? Ist jetzt alles Politik, oder ging es einmal einfach um etwas so belanglos Wichtiges wie Fußball?
Es ist ein seltsames Gefühl, als russischer Deutscher, Deutschrusse oder als was auch immer ich mich in einem bestimmten Moment fühle, nun überall auf der anderen Seite zu stehen. Denn so wenig, wie die Deutschen die Russen verstehen, mit alldem, was im Westen als Revanchismus und Aggression ankommt, so wenig können Russen nachvollziehen, warum der Westen es als einzig gerechte Situation empfindet, wenn er eine totale Kontrolle über die Welt ausübt. So sehen das viele. Als halber Russe und halber Deutscher, der beide Positionen nicht uneingeschränkt teilt, fühle ich mich eingequetscht. Ich will eine genauere Position für mich suchen – und wenn es nur auf eine elegantere Begründung hinausläuft, warum ich mich gerne als Weltbürger bezeichne. Wobei auch dieses pazifistisch angehauchte Wort in der national aufgeheizten Debatte der vergangenen Jahre zum Kampfbegriff taugt.
Vor der Weiterreise schlendern Nina und ich noch an der Lenin-Statue von Jalta vorbei. Hinter dem Revolutionsführer ragt das bis zu anderthalb Kilometer hohe Krim-Gebirge auf. Lenin selbst blickt auf das Schwarze Meer. Zu seinen Füßen skaten Jugendliche. Einer trägt ein Shirt mit einem Cannabisblatt und der Aufschrift High Life. Er springt, das Skateboard klebt an seinen Füßen, dann fällt es doch, er fällt fast, kann sich gerade noch halten. Lenin scheint all das wenig auszumachen. Der hat sein langes Exil in der neutralen Schweiz überlebt und Verbannungen in die Kälte. Der kann alles ab.
Wir fahren dann nach Sewastopol. Die Straße schlängelt sich oberhalb der Küstenlinie durch grüne Hügel. Immer noch ragen unfertige Hotelbauten wie Pfeile aus dem Boden, aber dann entschädigen abgelegene Buchten mit kleinen Häuschen dafür. Schroffe Felsen, die aus dem Meer ragen, lassen die Hügel des Hinterlandes noch sanfter wirken.
Nina und ich wechseln von einem Kleinbus in den nächsten. Der Fahrer bittet alle, sich anzuschnallen, etwas ungewöhnlich in dieser Gegend. Die meisten folgen widerwillig dem Aufruf, nur ein etwa fünfjähriger Junge und sein Vater nicht. Der Junge sagt fröhlich: »Wir schnallen uns nicht an!« Der Vater tätschelt den Kopf des Jungen und sagt gutmütig: »Genau. Wir schnallen uns nämlich nie an!«
In Deutschland habe ich früher oft mit Freunden diskutiert, weil ich mich nicht angeschnallt habe. Aber bei Kindern sehe ich die Sache anders, sie sollten schon … das ist etwas, das Russland in diesem Sommer noch oft mit mir machen wird: Mich zwingen, eine nicht unbedingt geliebte Position zu verteidigen, weil die andere vorhandene Option noch ungeliebter ist. Sei es nun, dass ich mich für Anschnallgurte oder Angela Merkel einsetzen muss. Dieses Mal schweige ich aber. Zu überzeugt sind Junge und Vater.
Etwa eine Stunde später stehen wir in einer Serpentine im Stau. Nina ist eingeschlafen. Ein Auto steht am Straßenrand, das vordere Drittel ist zerknautscht, wie ein Hemd in einer Waschmaschine. Weiter hinten ist ein rotes Metallknäuel, das kürzlich noch ein Auto gewesen sein muss. Davor liegt eine Frau, die Bluse aufgerissen, der Rock verrutscht. Ein Mann presst mit beiden Händen auf ihren Brustkorb. Sie bewegt sich nicht.
Je näher Sewastopol rückt, desto mehr Schilder stehen entlang der Straße, von denen Wladimir Putin zum Volk spricht. Die Zitate des Präsidenten lauten etwa: »Wir wollen die Krim und Sewastopol zu dynamisch entwickelten Subjekten der Russischen Föderation machen.«
Oder: »Die Rechte der Minderheiten und ihre Kultur und Sprache auf der Krim müssen geschützt werden.«
In Sewastopol selbst stechen dann auch andere große Plakate ins Auge, auf denen einfach mit roter Farbe auf weißem Hintergrund steht: »Russland ist uns mehr als die ganze Welt!«
Nina und ich erreichen die Stadt an einem klaren Sonnentag. Wir machen dann, was alle in Sewastopol machen: eine Bötchentour.
Historische Militärschiffe liegen im Hafen und die berühmte russische Schwarzmeerflotte. »Da, die Schiffe waren früher ukrainisch«, sagt Nina und zeigt auf zwei Truppentransporter. Sie erklärt mir, dass nicht nur die Krim das Land gewechselt hat, sondern auch vieles, was auf der Krim der Ukraine gehörte. Als wir später wieder an Land gehen, kaufen viele Touristen Kühlschrankmagnete, die es von den einzelnen Schiffen gibt. In Sewastopol sind Raketenkreuzer die Posterboys.
Nur ein Junge, der Flöte spielt und Geld in einer Box sammelt, auf der »Donezk« steht, erinnert daran, dass unweit der Krim, im ostukrainischen Donbass, immer noch Menschen in einem Konflikt sterben, der theoretisch schon befriedet ist – und in dem in der Praxis Ukrainer und Russen aufeinander schießen. »Hauptsache, kein Krieg«, sagen sie deshalb oft in Sewastopol.
Ich sehe später einen Leichenwagen und muss daran denken, wie meine Mutter mir von dem Sarg aus Afghanistan erzählt hatte, anno 1988 auf der Krim. Die Mutter des toten Soldaten habe damals vor dem Haus gestanden und laut ausgerufen: »Mein Junge ist gestorben. Mein Junge ist tot!« Immer und immer wieder. So ist es alter Brauch in Russland, das laute Wehklagen. Heute kommen wieder Särge mit toten russischen Soldaten, diesmal aus dem Donbass. Die Männer kämpfen nicht als reguläre russische Soldaten dort, sondern als Freiwillige, aber ein Sarg bleibt ein Sarg.
Sewastopol hat am frühen Abend etwas von einem Ausflug in die 70er- und 80er-Jahre. Zu seichter Musik tanzen Senioren paarweise und einzeln, die meisten haben ein Lächeln auf dem Gesicht, sie wirken glücklich. Keine einhundert Meter weiter singen ältere Damen im Chor, sie tragen hellblaue Roben, das Ensemble nennt sich Metschta – Traum. Die Zuhörer sind zumeist über siebzig, sie klatschen begeistert. Die gute alte Sowjetzeit. Mir kommt der Gedanke, dass es so leicht gewesen wäre, diesen Menschen in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren etwas anzubieten, mehr jedenfalls, als ihnen zu erklären, dass ihr Leben so falsch war wie das System, in dem sie es gefristet haben.
So bleibt von Sewastopol ein gemischter Eindruck, zwischen Meer, Melancholie und Militär. Kommt, wir singen die Lieder unserer Jugend und übertönen den Donnerschlag der Kanonen.
Nina und ich fahren dann zurück nach Simferopol. Vor meiner Abreise wollen wir noch jemanden treffen, den sie gut kennt. Es ist die Mutter von Gennadi Afanasjew.
Afanasjew ist einer der Mitstreiter des ukrainischen Filmregisseurs Oleg Senzow, der wegen Terrorismus zu zwanzig Jahren Haft verurteilt wurde. Sie sollen die Außentür eines Büros der Kremlpartei Einiges Russland in Simferopol angezündet sowie geplant haben, eine der zwei Lenin-Statuen der Stadt zu sprengen. Die Staatsanwaltschaft stützte sich im Prozess auf die Aussage von Afanasjew. Später hat er aber angegeben, diese Aussagen unter schwerer Folter gemacht zu haben. Im Zuge eines russisch-ukrainischen Austausches kam er frei und lebt jetzt in Kiew.
Er ist mir nicht persönlich bekannt und auch nicht mit mir verwandt oder verschwägert. Es ist eine seltsame Namensgleichheit, die aber doch etwas in mir auslöst. Hätte das ich sein können, wenn wir damals auf der Krim gelebt, wenn wir in der Sowjetunion geblieben wären?
Wir sitzen in einem Café. Die Mutter von Gennadi Afanasjew trägt ein rotes Kleid, hat eine blonde Dauerwelle und macht auf mich einen etwas nervös-aufgeregten Eindruck. Wie eine Mutter eben, deren Sohn erst kürzlich aus einem Straflager entlassen wurde und die das alles noch nicht ganz fassen kann. »Eigentlich will ich ja nicht weg«, sagt sie irgendwann und meint damit ihren bevorstehenden Umzug nach Kiew. Von der Krim nach Kiew, also aus Russland in die Ukraine. Sie macht es, um bei ihrem Sohn zu sein, der als verurteilter Terrorist natürlich nicht auf die russische Krim zurückkehren wird.
Die ukrainische Regierung hat Gennadi angeboten, ihm beim Start ins neue Leben zu helfen, einen Job zu suchen. »Ich habe ihm gesagt: Natürlich musst du das machen. Es kommen Ukrainer ohne Arme oder Beine aus dem Donbass wieder und kriegen nichts vom Staat. Du hast Glück, habe ich ihm gesagt«, erklärt Gennadis Mutter.
Weitere Freunde der Familie kommen dazu. Ich will wissen, ob Gennadi und die anderen wirklich etwas gemacht haben, also etwas ganz konkret gegen Russland Gerichtetes, wenn auch nicht, wie von der Anklage behauptet, die versuchte Sprengung einer Lenin-Statue.
Im Internet für die ukrainische Sache mobilisiert, bekomme ich als Erstes zu hören. An der Sache mit der angezündeten Tür sei etwas dran, der Schaden sei allerdings klein gewesen, die Tür wurde ersetzt. Und Suppe hätten sie gekocht. Für ukrainische Soldaten, die von den Russen in ihren Kasernen festgesetzt waren und von jeglicher Versorgung abgeschnitten, damit sie sich ergeben und abziehen. Sieben Jahre Lager für Suppe.