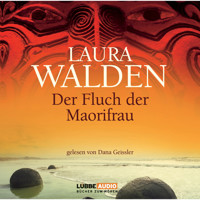8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eine mitreißende Australiensaga
für alle Fernwehleser
Cairns / Australien, 1897: Hier beginnt die Suche der verwaisten Zwillingsschwestern Lucy und Miranda nach ihrem verloren geglaubten Vater … hier entschließt sich Mandu zur Flucht, ein verschleppter Mischlingsjunge, der das Erbe seiner Aborigine-Ahnen wiederfinden will. Und an diesem Ort begegnen sie dem wohlhabenden jungen Neuseeländer Brian, der von seiner Familie nach Australien abgeschoben wurde. So gegensätzlich sie sind, so verschieden ihre Träume – auf ihrem gemeinsamen Weg nach Brisbane entlang der paradiesischen, aber auch gefährlichen Küste werden ihre Schicksale und ihre Herzen unauflöslich miteinander verknüpft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Ähnliche
Laura Walden
Korallenherz
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlagin der Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform1. Auflage 2014
© 2014 cbj Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Kerstin Kipker
Umschlagbild: Shutterstock (shyn_Andrei, kuleczka, Martin Maun, rodho)
Umschlaggestaltung: *zeichenpool, München
MI · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-11004-8www.cbj-verlag.de
1. Teil
This story’s right, this story’s true
I would not tell lies to you
Like the promises they did not keep
And how they fenced us in like sheep.
Said to us come take our hand
Sent us off to mission land.
Taught us to read, to write and pray
Then they took the children away,
Took the children away,
The children away.
Snatched from their mother’s breast
Said this is for the best
Took them away.
Archie Roach»Took the children away«, 1. Strophe
Das Haus zum heiligen Engel
Die alte Villa präsentierte sich am Ufer des Brisbane River zwischen den mächtigen Bäumen des verwunschenen Parks. Es gab wohl kaum ein stolzeres Gebäude in der Stadt und vor allem keines mit mehr Türmchen. Ortsfremde Sonntagsausflügler suchten sich gerne ein Loch in der Hecke oder reckten den Hals, in der Hoffnung, den glücklichen Besitzer zu erspähen. Unter den Einheimischen hatte sich für die Traumvilla allerdings der Name »Das Haus der hundert Tränen« eingebürgert, weil man in Brisbane wusste, dass es nicht das Glück war, das dort regierte.
Offiziell hieß die Villa, die vormals der vermögenden, kinderlosen Witwe Mrs Leary gehört und die diese der katholischen Kirche gestiftet hatte, »Haus zum heiligen Engel« und war ein Waisenheim für Mädchen.
Mrs Learys einstiges Anwesen befand sich an einer markanten Stelle am Fluss, genau gegenüber dem Rathaus und dem Regierungsgebäude, die auf der anderen Flussseite hoch emporragten. Der Brisbane River schlängelte sich durch die Stadt und beherrschte sie – im Sommer diente sein blaues Wasser der Erfrischung und Freude; im Winter dagegen war keiner vor der braunen Gischt des reißenden Gewässers sicher. Überschwemmungen waren an der Tagesordnung.
Davon war an diesem milden Herbsttag allerdings nicht das Geringste zu spüren. Der Brisbane River floss dahin, als könne er kein Wässerchen trüben.
Was für ein ruhiger Fluss, dachte Mr Taylor, als er die Brücke überquerte und den Weg zum Waisenheim einschlug. Ihm war schwer ums Herz, weil seine Frau ihn förmlich gezwungen hatte, die Mädchen im »Haus zum heiligen Engel« abzuliefern. Er hätte die beiden gerne in seinem Haus behalten. Zumindest Lucy. Miranda hätte er zur Not geopfert, weil sie eine robuste Natur besaß und wohl keinen Schaden an der Seele erleiden würde, aber die zartbesaitete Lucy, die sich alles so zu Herzen nahm … Nein, die Zwillinge wegzugeben, das war grausam von seiner Frau Christin. Nur weil sie befürchtete, dass Lucy mit ihrem sanften Wesen Stella später einmal die Männer ausspannen würde. Er musste den Kopf schütteln, wenn er nur dran dachte … Stella und die Zwillinge waren vierzehn Jahre alt, und wer sich wann für sie interessieren würde, stand seiner Meinung nach noch in den Sternen. Doch seine Frau Christin hatte sich nun einmal auf den Gedanken versteift, alle jungen Männer würden Lucy schon bald zu Füßen liegen – und ihre eigene Tochter Stella ginge leer aus. Daran, dass Lucy in ein paar Jahren der Schwarm aller jungen Männer Toowoombas sein würde, hatte Mr Taylor zwar keinen Zweifel, doch wenn eines der Mädchen ehelos bleiben würde, dann wohl eher Miranda und nicht Stella. Wer wollte schon so ein burschikoses, vorlautes Ding zur Frau? Und trotzdem hing er an beiden Mädchen wie ein Vater. Und er allein wusste, warum.
Sein Kiefer malmte vor Wut bei dem Gedanken, dass er zu feige gewesen war, seiner Frau die Stirn zu bieten.
»Aussteigen!«, bellte er, als er vor dem Portal des Waisenheims hielt. Er wählte den scharfen Ton, um seinen Abschiedsschmerz zu verbergen. Es war Miranda, die als Erste gazellengleich aus der Kutsche sprang, als würde ihr das Ganze gar nichts ausmachen. Obwohl sich seine Frau alle erdenkliche Mühe gegeben hatte, Miranda in ein hübsches Kleid zu stecken und ihr Haar mit einer Schleife zu bändigen, sah sie schon wieder aus, als käme sie gerade von der Pferdekoppel. Das rosafarbene Kleid war voller Flecken von dem Obst, das sie auf der langen Fahrt gegessen hatte, die Schleife saß schief im Haar, und ihre blonden Locken standen wild vom Kopf ab. Mr Taylor verkniff sich ein Schmunzeln. Er bewunderte Mirandas Mut und ihre Stärke. Um sie machte er sich keine Sorgen, während Lucys Anblick ihm schier das Herz brechen wollte. Das Mädchen in seinem ordentlichen Kleid und mit dem fein gestriegelten Haar erweckte den Eindruck, als würde es ins Höllenfeuer geschickt. Tränen standen ihr in den Augen.
»Komm, mein Kind, das Heim ist eines der besten im Land, und die Schwestern vom Heiligen Engel sind gottesfürchtige Frauen, bei denen es dir gut ergehen wird«, sagte er sanft und reichte ihr die Hand. Lucy ergriff sie und wollte sie gar nicht mehr loslassen. Sie hatte auf der ganzen Fahrt kein Wort gesprochen, während Miranda sich begierig aus dem Picknickkorb bedient hatte. Seine Frau hatte sich nicht lumpen lassen und nur das Beste mitgegeben: Bratenstücke, Brot, Eier, Melone und sogar einen selbst gekochten Pudding.
Miranda vermutete, Mrs Taylor habe das aus schlechtem Gewissen getan. Schließlich hatte sie ihrer Hausangestellten Sophie auf dem Totenbett hoch und heilig versprochen, sich um ihre Töchter Lucy und Miranda wie eine Mutter zu kümmern. »Nun mach doch nicht so ein Gesicht, als würdest du zur Schlachtbank geführt«, raunte sie Lucy zu. »Freu dich doch, dass wir nicht mehr unter Stellas ständiger Petzerei leiden müssen.« Sie fügte lauter hinzu: »Sieh nur, was für ein prächtiges Haus. Ich wollte immer schon in einem Schloss wohnen.«
Lucy rang sich zu einem müden Lächeln durch. »Und was ist mit all unseren Freundinnen, die wir in Toowoomba zurücklassen mussten?«
»Um diese dummen Gänse tut es mir nicht leid«, entgegnete Miranda und zog spöttisch die Augenbrauen hoch.
»Aber hier sind nur Mädchen. Du wirst keinen einzigen jungen Mann finden, der mit dir um die Wette reitet«, erwiderte Lucy mit Nachdruck.
»Bitte, streitet euch nicht«, mischte sich Mr Taylor ein. »Die Mutter Oberin beobachtet uns. Macht ein freundliches Gesicht und benehmt euch.«
Lucys und Mirandas Blicke gingen gleichzeitig zu der hageren Frauengestalt, die wie in Stein gemeißelt vor der Eingangstür stand.
»Um Himmels willen«, zischte Miranda ihrer Schwester zu, »der Frau steht die Boshaftigkeit ja geradezu ins Gesicht geschrieben. Von wegen barmherzige Schwester.«
»Zügel dein vorlautes Mundwerk. Hast du verstanden?« Mr Taylor schickte Miranda einen warnenden Blick und nickte der Oberin übertrieben freundlich zu.
Lucy wurde noch blasser. Seufzend nahm sie ihr kleines geflochtenes Köfferchen zur Hand und trottete mit gesenktem Kopf neben Mr Taylor her.
»Sieh doch nur, wie viele Papageien auf den Ästen hocken!«, rief Miranda begeistert aus und deutete auf einen riesigen Eukalyptusbaum. Lucy aber hob nicht einmal den Kopf. Ihr stand nicht der Sinn danach, sich an der Flora und Fauna zu erfreuen. Ihre Gedanken waren im fernen Toowoomba, aus dem sie sich im Morgengrauen mit der Kutsche nach Brisbane aufgemacht hatten. Sie vermisste schon jetzt ihre Freundinnen und sogar Stella. Abgesehen von ihrer Unart, Miranda ständig bei Mrs Taylor zu verpetzen, hatten sie sich sehr gut verstanden. Lucy hatte Angst vor dem fremden großen Haus, das ihr, obwohl es mit seinen Türmchen und Verzierungen sehr hübsch anzusehen war, unheimlich erschien. Und dann diese hagere Frau, ganz in Schwarz gehüllt, mit der weißen Haube und einer eisigen Miene. Nein, das wirkte alles nicht besonders einladend. Warum hatte ihre Mutter sie nur verlassen müssen? Das war nicht fair!
»Ja, das sind die beiden Mädchen, die wir Ihnen schweren Herzens anvertrauen müssen, Mutter Oberin.« Mr Taylor räusperte sich. »Sie wissen ja, meine Frau kränkelt und schafft es nicht, sich um fünf Kinder zu kümmern. Wir haben ja auch noch die zwei Kleinen«, hörte Lucy Mr Taylor sagen. Er lügt, ohne rot zu werden, dachte sie. Lucy kannte den wahren Grund, hatte sie doch ein Streitgespräch zwischen den Eheleuten belauscht. Die Schamesröte trat ihr ins Gesicht, als sie an den Inhalt des Gesprächs dachte. Mrs Taylor hatte über sie geredet, als würde sie nur darauf lauern, die Herzen der wohlhabenden Burschen für sich zu gewinnen, um eine gute Partie zu machen. Was für ein Unsinn! Natürlich waren ihr die bewundernden Blicke mancher jungen Männer nicht entgangen, aber die waren ihr herzlich gleichgültig. Sie träumte insgeheim von einem fremden Prinzen, der sie aus Toowoomba entführen würde – und nicht von den grobschlächtigen Bengeln, die sie ständig anschmachteten. Es war ungerecht von Mrs Taylor, sie dafür zu bestrafen!
Lucy hob den Kopf und blickte in ein Paar mausgrauer Augen, die sie unter der weißen Haube prüfend musterten. Sie zuckte zusammen, als die Oberin ihr die Hand entgegenstreckte.
»Wie heißt du, mein Kind?«
Lucy knickste, während sie ihr die Hand gab. »Ich heiße Lucy Clayton«, sagte sie mit leiser Stimme.
»Du wirst dich hier sehr wohl fühlen.« Die Oberin wandte sich an Miranda, die ihre Hände hinter dem Rücken verschränkt hatte. »Und wer bist du?«
»Miranda!« Lucys Schwester machte keinerlei Anstalten, die Hand der Oberin zu ergreifen, aber da spürte sie bereits Mr Taylors harten Griff und ließ es geschehen, dass er ihre Hand nahm und sie der Oberin entgegenstreckte.
»Dir werde ich noch Benehmen beibringen, mein Kind!« Obwohl die Oberin mit sanfter Stimme sprach, waren ihre Worte eine unmissverständliche Drohung.
Mr Taylor räusperte sich verlegen. »Ist es Ihnen recht, wenn ich die Mädchen noch auf ihr Zimmer begleite?«
»Nein, das ist bei uns nicht üblich. Besser, Sie verabschieden sich jetzt von ihnen.«
Mr Taylor schluckte, aber dann straffte er die Schultern und versuchte als Erstes, Miranda zu umarmen, die allerdings einen Schritt beiseitetrat, sodass der Farmer ins Leere griff.
»Sie wollten uns doch unbedingt loswerden! Dann tun Sie jetzt nicht so scheinheilig.«
Die Oberin musterte Miranda mit einem Blick, der nichts Gutes verhieß. »Sieh dich vor, meine Liebe, solche Respektlosigkeiten gegenüber Erwachsenen dulden wir in diesem Haus nicht. Entschuldige dich bei Mr Taylor für deine Frechheit!«
Ehe Miranda sichs versah, hatte die Oberin sie im Genick gepackt und krallte sich mit knochigen Fingern in ihren Nacken.
»Entschuldigung, Mr Taylor«, zischte Miranda, nur damit die schreckliche Person sie losließ.
»Schon gut, Miranda.« Mr Taylor wandte sich der strengen Heimleiterin zu. »Mutter Oberin, das hat sie doch gar nicht so gemeint. Sie ist manchmal ein wenig eigenwillig, aber ansonsten ein gutes Mädchen. Üben Sie Nachsicht mit ihr!«
»Das lassen Sie mal meine Sorge sein!«, gab die Oberin spitz zurück. »Wenn wir derartige Disziplinlosigkeiten zuließen, würden uns die Mädchen auf der Nase herumtanzen.« Und nach einem flüchtigen Blick auf Lucy fügte sie, an Miranda gewandt, hinzu: »Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester, sie ist bescheiden und benimmt sich!«
Miranda verdrehte die Augen. Wie oft hatte sie das schon gehört in ihrem Leben! Auch aus dem Munde ihrer Mutter. Wie sie diesen Vergleich hasste. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Lucy zusammenzuckte, weil sie unter diesem Vergleich genauso litt.
»Es ist schrecklich, wenn ich dir immer als gutes Beispiel vorangestellt werde«, hatte Lucy ihr einmal anvertraut. »Das heißt doch nur, dass ich langweilig bin.«
Miranda griff nach Lucys Hand und drückte sie, worauf Lucy sich zu einem Lächeln durchrang. Wenn der alte Drache, der aussieht wie ein Pinguin, denkt, er könne einen Keil zwischen uns treiben, hat er sich geirrt, dachte Miranda triumphierend.
Mr Taylor sah mit unglücklicher Miene von einer zur anderen. Miranda kam es fast so vor, als ob er mit sich haderte und es bereute, sie in die Obhut dieser Person zu geben. Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus, bevor er Lucy umarmte. Sie wehrte sich nicht. Im Gegenteil, sie klammerte sich an ihn und brach in verzweifeltes Schluchzen aus.
Mr Taylor hatte einige Mühe, sich aus der Umklammerung wieder zu befreien. Miranda entging nicht, dass auch seine Augen feucht wurden. Wie konnte das sein? Dass er ein guter Kerl war, der unter der Fuchtel seiner herrischen Frau stand, hatte sie immer schon gewusst. Er hatte sie und Lucy ja immer, wenn seine Frau nicht dabei gewesen war, ausgesprochen väterlich behandelt. Aber dass ihm der Abschied so ans Herz ging … Miranda konnte kaum den Blick von seinem gequälten Gesicht lassen. Plötzlich tat es ihr leid, dass sie ihn weggestoßen hatte. Aus einem Impuls heraus trat sie entschieden auf Mr Taylor zu und umarmte ihn.
»Ich weiß doch, dass Sie das nicht gewollt haben. Wir haben Sie doch gern. Vielleicht besuchen Sie uns mal.«
Damit war es um Mr Taylors Fassung geschehen. Er schluchzte laut auf. Erschrocken ließ Miranda ihn los.
»Mr Taylor! Nun reißen Sie sich mal zusammen«, erklang die barsche Stimme der Oberin. »Und ihr geht jetzt auf der Stelle ins Haus. Ich habe mit Mr Taylor noch etwas zu besprechen.« Die Oberin rief lauthals nach einer Schwester Mary, schob die beiden Mädchen ins Haus und schloss geräuschvoll die Tür hinter sich.
Miranda und Lucy fassten einander bei den Händen. Befangen sahen sie sich um. Die Empfangshalle war mit dunklem Holz getäfelt, was dem Raum etwas Düsteres verlieh. Über ihnen schwebte ein riesiges Holzkreuz mit einem Jesus, dessen Dornenkrone auf dem Kopf erschreckend real aussah und dem das Blut in Strömen übers Gesicht rann. Jetzt erschauderte selbst Miranda. Nein, Gottes Sohn würde ihnen in diesem Haus bestimmt nicht zu Hilfe kommen, denn das hier war alles andere als das Paradies.
Eine jüngere Ordensschwester trat auf sie zu. »Ihr seid die Neuen? Ich bin Schwester Mary und zeige euch die Schlafsäle. Gleich gibt es Abendessen und dann geht es ab ins Bett.«
»So früh?«, fragte Miranda ungläubig. »Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr!«
»In diesem Haus ist Schlafenszeit, wenn es dunkel wird, und das ist im Mai nun einmal achtzehn Uhr. Versucht ja nicht, die Regeln zu hinterfragen. Das ist noch keinem gut bekommen. Schon gar nicht einer Neuen.«
Mary klang bemüht streng, aber Miranda merkte sofort, dass die junge Schwester eine Seele von einem Mensch war und nur so tat, als wäre sie eine hartherzige Respektsperson.
»Wie heißt ihr beiden eigentlich?«
»Ich bin Miranda und das ist Lucy.«
»Warum sprichst du für deine Schwester? Ist sie stumm?«
»Nein, aber traurig, dass man uns in dieses Waisenhaus abgeschoben hat. Und wenn sie traurig ist, redet sie nicht viel!«
Der Hauch eines Schmunzelns umspielte Schwester Marys Mund. »Und dann bist du also ihr Sprachrohr? Macht dir der Abschied denn gar nichts aus? Alle Mädchen, die zu uns kommen, sind in den ersten Tagen traurig. Das ist völlig normal und in Ordnung.«
Miranda zuckte mit den Schultern. »Mir ist das alles egal. Ich war traurig, als unsere Mutter starb, aber ob wir jetzt bei den Taylors sind oder hier …«
Miranda erschrak, als Mary ihr mitleidig über das zerzauste Haar fuhr.
»Ihr werdet euch schon schnell im ›Haus zum heiligen Engel‹ einleben.«
Miranda lag eine Erwiderung auf der Zunge, aber sie schluckte sie hinunter. Sie roch den Ärger, der auf sie zukam, förmlich.
Die Zwillinge folgten Mary die Treppe hinauf in das erste Stockwerk. Auch hier waren die Wände mit dunklem Tropenholz vertäfelt. An den Wänden hingen Ölgemälde, die den Leidensweg Jesu nach Golgatha darstellten. Miranda kannte das aus der Bibelstunde. Ihre Mutter hatte stets großen Wert darauf gelegt, dass ihre Töchter im richtigen Glauben erzogen wurden. Miranda fand die Bilder grausam und wandte den Blick ab.
»Das ist dein Schlafsaal, Lucy«, erklärte Mary, während sie am Ende des langen dunklen Ganges eine Tür öffnete. In dem großen Saal befanden sich nichts als endlose Bettenreihen zu beiden Seiten.
»Und wo sind unsere Betten?«, fragte Miranda skeptisch.
»Ihr beiden schlaft nicht in einem Saal«, entgegnete Mary hastig.
»Was soll das denn heißen?« Miranda blickte die junge Ordensschwester durchdringend an.
»Die Mutter Oberin hält es für besser, euch zu trennen, damit ihr euch nicht von den anderen absondern könnt.« In ihrer Stimme lag wenig Überzeugungskraft.
»Ich schlafe da, wo Lucy schläft«, erklärte Miranda entschlossen. »Wenn sie traurig ist, dann schlafen wir immer in einem Bett ein. Ich lasse sie doch nicht allein!«
»Was höre ich da? Du wagst es, dich meinen Anordnungen zu widersetzen?« Miranda, Lucy und Mary wandten sich erschrocken um. Die schneidende Stimme aus dem Hintergrund gehörte der Oberin.
Miranda erholte sich schnell von dem Schrecken und baute sich kämpferisch vor ihr auf. »Aber ich lasse es nicht zu, dass Sie Lucy und mich trennen!«
»Du lässt das nicht zu? Habe ich richtig gehört? Ich glaube, du brauchst wirklich eine Lektion.« Ohne Vorwarnung zog die Oberin so brutal an Mirandas rechtem Ohr, dass sie laut aufschrie.
»Kommst du freiwillig mit oder muss ich dich an den Ohren in den Schlafsaal schleifen?«
Der Schmerz in Mirandas Ohr war so heftig, dass ihr Tränen in die Augen schossen.
»Anda, bitte, tu, was sie sagt. Bitte!« Lucy wollte Mirandas Hand nehmen, um sie zu trösten, doch die Oberin schlug sie weg.
»Schluss jetzt mit dem Theater! Du beziehst dein Bett und lässt dich von Schwester Mary in den Speisesaal zum Abendessen bringen und du, mein Fräulein …«, sie wandte sich an Miranda, »… kommst jetzt mit mir!«
Mit den Tränen kämpfend, folgte Miranda der Oberin. Der Schmerz in ihrem Ohr war kaum zum Aushalten.
Mirandas feuchte Augen stimmten die Oberin offenbar milder. »Mein liebes Kind, du musst noch viel lernen, aber ich werde davon absehen, dich am ersten Tag zu bestrafen, wie du es verdient hättest.«
Was sie damit wohl meint, schoss es Miranda durch den Kopf. Schlimmer konnte es doch gar nicht mehr kommen, als dass man ihr einfach das Ohr umdrehte. Noch nie zuvor hatte ihr ein Erwachsener solche Schmerzen zugefügt. Ihre Mutter hatte nie die Hand gegen sie erhoben, ganz gleich, was sie angestellt hatte. Und auch Mrs Taylor hatte sie niemals geschlagen. Sie hatte zwar geschimpft wie ein Rohrspatz, aber so etwas Grausames wie die Oberin hätte selbst sie nicht übers Herz gebracht. Miranda beschloss, die schreckliche Frau insgeheim »die Hexe« zu taufen. »Oberpinguin« wäre doch allzu harmlos für dieses böse Weib.
Der Schlafsaal am anderen Ende des Flures sah ganz genauso aus wie der, in den man Lucy gebracht hatte. Betten, so weit das Auge reichte. In der Mitte des tristen Raums blieb die Oberin stehen.
»Das ist deines!«
Miranda erschauderte, als sie die kratzige Wolldecke zurückschlug. Ihr lag bereits eine Beschwerde auf der Zunge, aber sie schluckte sie hinunter.
»Lisa, das Mädchen, das hier geschlafen hat, wurde kürzlich von einem Ehepaar aus Sydney adoptiert. Aber das ist eher die Ausnahme, dass jemand Halbwüchsige wie euch in sein Haus holt.«
Miranda ballte die Fäuste. Offenbar beabsichtigte die Hexe, sie ins Bockshorn zu jagen, um ihren Willen zu brechen. Aber das würde sie nicht schaffen! Was auch immer geschieht, sie wird mich nicht kleinkriegen, beschloss Miranda.
»Und nun beeil dich. Das Abendessen wartet nicht! Aber vorher zieh das an.« Die Oberin reichte Miranda ein blaues Wollkleid, eine Schürze und schwarze derbe Strümpfe. Angewidert nahm Miranda die Uniform entgegen. Sie machte sich zwar nichts aus schönen Kleidern, aber das blaue war nicht nur besonders hässlich, sondern kratzte mindestens so wie die Wolldecke. Außerdem war sie es nicht gewohnt, bei diesen Temperaturen Strümpfe zu tragen. Zu Hause ging sie bis weit in den Juni barfuß und entledigte sich ihrer Strümpfe, sobald die Temperaturen im August wieder anstiegen. Seufzend öffnete sie die Knöpfe des von Mrs Taylor selbst genähten Sommerkleides und schlüpfte widerwillig in die Schuluniform. Die Strümpfe allerdings übersah sie einfach. Sie hoffte, damit durchzukommen, doch als die Mutter Oberin sich umwandte, deutete sie mit dem Zeigefinger auf die am Boden liegenden Strümpfe.
»Anziehen!«, bellte sie.
»Aber ich mag keine Strümpfe. Es ist doch draußen noch so warm.«
»Hier werden keine Extrawürste gebraten, mein Fräulein!«
Betont langsam zog Miranda die Wollstrümpfe an, die nicht nur entsetzlich kratzten, sondern für die Temperatur, die an diesem Tag herrschte, viel zu warm waren.
»Du wirst noch lernen, dich den Regeln unseres Hauses zu unterwerfen«, zischte sie. Dann trat sie ganz nahe an ihren Zögling heran. »Heute hast du noch Schonfrist! Und nun komm endlich!«, fügte sie drohend hinzu.
Miranda folgte der Oberin mit zusammengebissenen Zähnen in den Speisesaal, der nicht viel freundlicher wirkte als die Schlafräume. So schön das Haus auch von außen anzusehen ist, drinnen ähnelt es einer Gruft, durchfuhr es Miranda beim Anblick der langen schlichten Tische und der Holzbänke. Die waren eng besetzt mit Mädchen in blauen Wollkleidern, die seltsam starr dasaßen. Mit gefalteten Händen und gesenkten Köpfen. Miranda wollte beinahe das Herz stehen bleiben, als sie erkannte, dass viele der Mädchen noch Kleinkinder waren. Und keines gab auch nur einen einzigen Mucks von sich.
Da erblickte sie ihre Schwester in der Menge und konnte sich nicht mehr beherrschen. »Lucy!«, rief sie erfreut aus, rannte quer durch den Saal und quetschte sich zwischen Lucy und deren Tischnachbarin.
»Sei leise. Du bekommst sonst Ärger«, warnte Lucy Miranda, doch da war es schon zu spät. Die »Hexe« stand bereits hinter ihr, packte sie unter den Achseln, riss sie von der Bank und schleifte sie zum Kopf der Tafel. Hier musste Miranda stehen, während die Mutter Oberin sie immer noch umklammert hielt und die Stimme erhob: »Das hier ist Miranda. Sie weiß noch nicht, wie man sich im ›Haus zum heiligen Engel‹ zu benehmen hat. Sie ist neu hier. Und deshalb werde ich sie für die Ungebührlichkeit nicht bestrafen. Vivian, steh auf und sage der Neuen, wie wir uns im Speisesaal zu verhalten haben.«
Ein Raunen ging durch den Saal, als sich ein blasses rothaariges Mädchen mit traurigen Augen von seinem Platz erhob. Sie betete mit gesenktem Kopf folgende Worte herunter: »Im Speisesaal wird geschwiegen. Bis auf das Gebet, das wir vor dem Essen sprechen. Wir falten die Hände und senken den Blick, bis das Gebet beendet ist. Dann nehmen wir schweigend das Essen zu uns und danken Gott für diese Gabe.«
»Brav, Vivian, an dir kann sich unsere Neue ein Beispiel nehmen.« Mit diesen Worten ließ die Oberin Miranda endlich los. Statt eingeschüchtert auf diese Demonstration des dressierten Gehorsams zu reagieren, funkelte Miranda die Ordensschwester wütend an, aber sie war schlau genug, den Mund zu halten. Doch die Oberin hatte sie auch ohne Worte verstanden. Ihr Blick war eine einzige Kampfansage. »Marsch, zu deinem Platz. Du sitzt neben Schwester Mary.«
Miranda tat widerspruchslos, was diese »Hexe« verlangte, aber der Zorn, der in ihr kochte, war so stark, dass sie keinen Bissen hinunterbekam, was Schwester Mary mit Sorge beobachtete.
»Du musst etwas essen. Sonst bekommst du morgen kein Frühstück«, raunte sie ihrem Zögling zu. Miranda schüttelte stumm den Kopf, was Schwester Mary einen tiefen Seufzer entfahren ließ. Die Schwester griff in einem Augenblick, in dem sie sicher war, dass die Oberin nicht hersah, das trockene Brot von Mirandas Teller und ließ es unauffällig in die Tasche ihrer schwarzen Tracht gleiten.
»Ich bringe es dir gleich in den Schlafsaal, falls du doch noch Hunger bekommst.«
Miranda aber hörte ihr gar nicht mehr zu. Wehmütig suchte sie den Blick ihrer Schwester, die ihr schräg gegenübersaß. Lucy zwinkerte ihr kurz zu. Ihr gemeinsames Zeichen, dass alles gut werden würde. Miranda zwinkerte eifrig zurück und bemerkte zu spät, dass die Hexe die Blicke der Zwillinge mit finsterer Miene verfolgt hatte.
Die Oldfield-Farm
Etwa zweihundertdreißig Kilometer nordöstlich von Brisbane, zwischen Cecil Plains und Kumbarilla, lag eine große Rinderfarm. Für die Einwohner Brisbanes war das bereits das sogenannte Outback, das Hinterland, das sich fern jeder Zivilisation befand. Die Farm gehörte Mr Oldfield, einem alten knurrigen Mann, der nach dem Tod seiner Frau noch sonderbarer geworden war, als er ohnehin schon gewesen war. Er litt sehr darunter, dass seine Söhne das Weite gesucht und nach Sydney gegangen waren. Notgedrungen hatte er sich einen familienfremden Nachfolger ausgeguckt, für den Fall, dass er aus Altersgründen nicht mehr würde arbeiten können oder sterben würde. Seine Wahl war auf seinen besten Mitarbeiter – wie er jedenfalls glaubte –, Tim Miles, gefallen. Der hatte sich mit den Jahren auf der Oldfield-Farm unersetzlich gemacht, sodass Mr Oldfield gar keine ernst zu nehmende Alternative blieb. Und Tim verstand es wie kein Zweiter, dem alten Herrn nach dem Mund zu reden. Der Stockman, wie man die australischen Cowboys nannte, lebte nach der Devise: nach oben buckeln und nach unten treten!
Tim Miles’ Lieblingsopfer war ein großer dunkelhaariger junger Bursche, den sie »Jack« nannten und der gerade damit beschäftigt war, Pferdemist zusammenzukehren. Der junge Mann hasste diesen Namen, den man ihm gegen seinen Willen gegeben hatte, nachdem ihn die Polizei als fünfjähriges Kind aus den Armen seiner schreienden Mutter gerissen und zur Oldfield-Farm verschleppt hatte. Das war mehr als zehn Jahre her, aber er würde niemals vergessen, wie ihm die Mutter verzweifelt seinen wirklichen Namen hinterhergerufen hatte.
»Mandu, Mandu!«
Mandu heißt »die Sonne«, hatte sie ihm einst verraten. Immer wenn er an diesen Tag dachte, der sich wie ein Mal in seine Erinnerung eingebrannt hatte, spürte er einen unbändigen Zorn auf diese Weißen, die ihn, trotzdem er sich mit Händen und Füßen wehrte, mitgenommen hatten. Wochenlang hatte er einfach nur geschwiegen, sodass Mrs Oldfield, die damals noch lebte, Mitleid mit dem »taubstummen« Jungen bekommen hatte. Mandu durfte im Haus der Oldfields schlafen und musste nicht wie die anderen sogenannten »Mischlinge« in den Stallungen nächtigen. Er hatte sogar an ihrem Tisch gegessen, ja, die gute Mrs Oldfield hatte ihn regelrecht verwöhnt, als wäre er ihr eigener Sohn. Und Mandu ahnte auch, warum. Ihre beiden eigenen Söhne waren schon in jungen Jahren aus der Einsamkeit der abgelegenen Farm in die große Stadt geflüchtet. Und es hatte sicherlich auch mit seinem Aussehen zu tun. Mandu hatte zwar dunkles Haar, aber stahlblaue Augen. Und in seinem Gesicht war nicht die Spur seiner wahren Herkunft zu erkennen. Die meisten hielten ihn für einen Weißen.
Mr Oldfield hatte diese bevorzugte Behandlung, die seine Frau diesem Mischlingsbalg gewährt hatte, stets skeptisch beäugt, aber geduldet. Manchmal unter vier Augen hatte er Mandu gedroht, dass diese »Prinzentage« gezählt seien: »Sollte Mrs Oldfield einmal etwas zustoßen, Abo, dann arbeitest du wie die anderen – und gehst nicht mehr in die Schule.«
Mandu hatten diese Drohungen nicht besonders einschüchtern können, weil die rotbäckige Mrs Oldfield wie das blühende Leben aussah und ihren grimmigen Ehemann mit Sicherheit überleben würde. Daran glaubte jedenfalls Mandu und er fühlte sich unverletzbar. Mrs Oldfield zuliebe ging er auch in ihre Kirche und ließ sich von ihr zum Einschlafen aus der Bibel vorlesen. In der Schule kam er besser zurecht als manche seiner weißen Schulkameraden. Trotzdem spürte er eine ungestillte Sehnsucht, zu seinen wahren Wurzeln durchzudringen. Und immer wieder fragte er sich, warum die Männer ihn einst seiner schreienden Mutter entrissen hatten.
Doch erst an seinem zehnten Geburtstag hatte er sich endlich ein Herz gefasst und Mrs Oldfield gefragt, warum man ihn seiner Familie gestohlen habe. Und warum man ihn Jack und nicht Mandu nannte. Die gute Frau hatte sich wie ein Aal gewunden. »Ich, ich werde es dir erzählen, wenn du alt genug bist. Aber sei nur froh, dass wir dich zu uns ins Haus genommen haben und du nicht als Arbeitskraft gebraucht wirst«, hatte sie gestammelt.
»Wann ist das?«, hatte er gefragt. »Wann bin ich alt genug?«
»An deinem zwölften Geburtstag«, hatte sie hastig erwidert, und Mandu konnte ihr vom Gesicht ablesen, dass sie hoffte, er hätte das Versprechen bis dahin vergessen. Aber das Gegenteil war der Fall gewesen. Er hatte diesem Tag regelrecht entgegengefiebert.
Doch dann war Mrs Oldfield einige Monate vor seinem zwölften Geburtstag an der Beulenpest gestorben, wie viele andere Menschen in jenen Sommertagen des Jahres 1901.
Auch Mr Oldfield hatte es damals erwischt, aber er hatte die Epidemie knapp überlebt. Sosehr sich Mandu auch nach einer Antwort auf seine brennenden Fragen sehnte, er hätte sich nie getraut, den grimmigen Alten nach der Wahrheit zu fragen. Die hatte ihm schließlich Apari erzählt, ein gestandener Aboriginal, der auf der Oldfield-Farm als Stockman arbeitete. Er wurde von allen respektiert, weil keiner so gut wie er es verstand, Wildpferde einzureiten und sie damit nutzbar zu machen. Apari war nach Mrs Oldfields Tod Mandus Beschützer geworden. Der alte Mr Oldfield hatte Mandu noch am Morgen nach der Beerdigung seiner Frau aus dem Haus geworfen und zu den anderen in den Stall stecken wollen. Apari hatte das noch rechtzeitig verhindern können, indem er Mandu in seiner Hütte aufgenommen hatte. Von einem Tag zum anderen war aus Mrs Oldfields einstigem Schoßkind Jack eine billige Arbeitskraft geworden. Auch die Schule durfte er nicht länger besuchen, was ihn aber nicht davon abhielt, sich Bücher zu besorgen und auf eigene Faust weiterzulernen.
Wenn Apari nicht gewesen wäre, wer weiß, ob er je die Wahrheit erfahren hätte. Er liebte den Stockman, der schwarz wie die Nacht war, wie einen Vater. Dieser versuchte, auf Mandus Fragen Antworten zu finden, und behandelte ihn nicht wie ein Kleinkind, sondern wie einen Erwachsenen, der ein Recht hatte, alles über seine Herkunft zu erfahren. Und die ganze schreckliche Wahrheit spukte seitdem ständig in Mandus Kopf herum. Die Weißen hatten ein Gesetz geschaffen, das es ihnen erlaubte, die sogenannten Mischlingskinder zu ihrem eigenen Wohl aus ihren Familien zu reißen, um sie in Heime oder in christliche Missionen zu bringen oder um Adoptiveltern für sie zu finden.
»Aber warum?«, hatte Mandu Apari fassungslos gefragt. »Und weshalb durfte ich nicht wenigstens meinen Namen behalten?«
»Sie wollen euch alle Wurzeln austreiben, die ihr von dem Elternteil habt, das zu den Ureinwohnern gehört.«
»Aber dich nennen doch auch alle Apari!«
Der Stockman hatte traurig gelächelt. »Ich bin ein Aborigine durch und durch. Meine Eltern waren beide schwarz. Bei dir ist das etwas anderes. Du bist für sie wertvoller, denn du hast ein weißes Elternteil. Deshalb wollen sie euch ›Mischlingen‹ die weiße Kultur aufzwingen. Für einen Vollblut-Aborigine habe ich einen ganz guten Stand hier auf der Farm. Es sähe weitaus schlechter aus, wenn ich es nicht schaffen würde, ihnen jedes noch so widerspenstige Pferd gefügig zu machen. Das ist mein Pfund.« Er lächelte. »Tim Miles wäre ohne mein Können aufgeschmissen.«
Mandu war völlig in diese Gedanken versunken. Er hatte den Kopf auf seine Schaufel gelehnt und starrte in den blauen Himmel, an dem kein Wölkchen zu sehen war. Es war an diesem Vormittag schon so heiß, dass man am Horizont die Luft vibrieren sehen konnte. Eine unendliche Sehnsucht nach dem Land, das weit weg von hier lag und in dem sein Stamm lebte, erfüllte ihn.
»Mandu, schlaf nicht ein«, ertönte Aparis Stimme mahnend. »Wenn das Miles sieht, dann hat er wieder einen Grund, dich zu schikanieren.« Tim Miles ließ keine Gelegenheit aus, an Mandu herumzunörgeln. Dessen enges Verhältnis zu Apari war ihm ein besonderer Dorn im Auge. Er hatte alles versucht, beim alten Oldfield zu erreichen, dass man diesen Bastard zu den anderen brachte, über die er die Aufsicht führte, doch Apari hatte wie ein Löwe für ihn gekämpft. Der alte Oldfield wusste, was er an dem Aboriginal hatte, und so hatte er Mandu bei ihm wohnen lassen. Tim Miles sah darin eine persönliche Niederlage und drohte Mandu bei jeder Gelegenheit, das würde sich ändern, sobald der Alte ihm endlich das Kommando über die Farm übergeben würde. Dann würde er bei ihm wohnen und beten lernen wie die Weißen. Das war eine Drohung, die Mandu allerdings eher amüsierte. Er hatte bei Mrs Oldfield bestimmt mehr über den christlichen Glauben gelernt, als der grobschlächtige weiße Tim Miles es je getan hatte.
Zögernd setzte Mandu seine stumpfe Arbeit fort. »Ich würde so gerne bei dir auf der Koppel mitarbeiten«, sagte er trüb und seufzte.
Apari klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Ich grübele schon Tag und Nacht darüber nach, Mandu, wie ich es schaffen könnte, die Erlaubnis zu bekommen, dich zum Stockman ausbilden zu dürfen, aber du kennst doch den guten Miles. Er erträgt es nicht, wenn du das erlernst, was er in hundert Jahren nicht beherrschen wird. Ich habe selten jemanden erlebt, der so ein schlechtes Händchen im Umgang mit den Pferden hat.«
Ein Grinsen huschte über sein vom Wetter gegerbtes Gesicht. Auch Mandus Miene erhellte sich. Alle hatten noch in lebhafter Erinnerung, wie Tim Miles neulich versucht hatte, einen Hengst zu zähmen, der ihn daraufhin abgeworfen und beinahe zertrampelt hätte. Er war so wütend geworden, dass er das Tier erschießen wollte, was Apari aber verhindern konnte.
»Was meinst du, wie er mich dafür hasst, dass ich etwas kann, was er niemals schaffen wird«, fügte Apari nachdenklich hinzu. »Wenn er mich nicht brauchen würde, um vor dem Alten seine Unfähigkeit zu vertuschen, dann würde er mich lieber heute als morgen rauswerfen.«
»Es ist so unglaublich ungerecht. Wie viel sinnvoller wäre es, mich dort einzusetzen, wo ich eine echte Hilfe wäre? Du weißt doch, dass ich reiten kann wie ein Teufel …«
»Pst! Nicht so laut. Wenn Miles von unseren heimlichen Ausritten erfährt, wer weiß … Wenn er nun auch noch erführe, dass an dir ein gestandener Pferdeflüsterer verloren gegangen ist«, seufzte Apari und drehte sich prüfend nach allen Seiten um. »Und er hat seine Spitzel überall, die sich bei ihm einschleimen möchten und sich eigene Vorteile versprechen, wenn er erst einmal der Boss ist.«
Während Apari das sagte, blickte er Mandu durchdringend an, wie er es oft tat, wenn sie miteinander sprachen. Und Mandu wusste inzwischen genau, was er sich in solchen Augenblicken dachte, wenn er seine Stirn skeptisch kräuselte. Was Mandu außer seinen dicken schwarzen Locken wohl von seiner Aboriginal-Seite geerbt hatte? »Du siehst aus wie ein Weißer«, hatte Apari damals mit einem merkwürdigen Unterton festgestellt, nachdem er ihn in sein Haus geholt hatte. »Weißt du, wer dein Vater ist?«
»Meine Mutter hat ihn nie erwähnt. Jedenfalls nicht dass ich mich daran erinnern könnte.«
Zu Aparis großem Kummer konnte Mandu sich ohnehin nicht an besonders viel aus seiner frühen Kindheit erinnern – außer dass sie in einer Hütte gelebt hatten, seine Mutter jeden Tag zum Arbeiten in das hochherrschaftliche Haus gegangen und er als Kleinkind oft sich selbst überlassen gewesen war. Zu gern würde Apari herausfinden, woher der junge Mann kam und welchem Stamm seine Mutter angehörte, aber das Einzige, was Mandu noch im Gedächtnis behalten hatte, war die feuchte Hitze, die dort, wo er herkam, oft in der Luft gehangen hatte wie ein feuchter Schleier. Auch einer braunen Schlange, die ihm einmal beim Spielen im Garten begegnet war und die er hatte fangen wollen, entsann er sich. Und dann an den markerschütternden Schrei seiner Mutter: »Mandu, rühr dich nicht vom Fleck!« Und Mandu hatte Apari von seinem Freund, einem kleinen Känguru, berichtet, das auf einem Baum lebte.
Nach diesen spärlichen Informationen zu urteilen, vermutete Apari, dass sein Schützling aus den Feuchttropen Queenslands stammte, die nördlich von Townsville begannen und sich 450 Kilometer gen Norden zogen. In den Regenwäldern dieser Region war nämlich das Baumkänguru zu Hause, das Mandu beschrieben hatte. Apari wusste das so genau, weil er selbst aus Innisfail stammte, einem kleinen Ort südlich von Cairns, und in den Tiefen des Regenwaldes aufgewachsen war.
Doch in diesem Augenblick dachte Apari weniger an die Frage von Mandus Herkunft als vielmehr daran, dass es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit war, ein solches Talent wie das dieses jungen Mannes nicht zu fördern. Apari war sicher, dass Mandu die Sprache der Pferde genauso gut verstand wie er selbst. Nur deshalb konnte er sie überhaupt bändigen, weil er sich mit ihnen zu einem Wesen verband, ihnen Liebe und Vertrauen schenkte. Ganz anders als Tim Miles, der glaubte, die stolzen Tiere mit Peitsche und Sporen gefügig machen zu können. Apari schüttelte sich bei dem Gedanken an den unflätig fluchenden und um sich schlagenden Miles. Er hatte es gar nicht verdient, sich ein Stockman zu nennen.
»Mandu«, flüsterte er. »Ich mache es. Ich werde dich in die Geheimnisse des Einreitens einweihen. Nächste Woche Sonntag fährt Miles zum Viehmarkt nach Dalby, um am Montagmorgen als einer der ersten Käufer vor Ort zu sein. Dann treffen wir uns nach Einbruch der Dunkelheit an der Außenkoppel. Einverstanden?«
»Wirklich? Ja, gern!« Mandus finstere Miene erhellte sich und er rieb sich begeistert die Hände.
»Jack! Du bist nicht zum Blödsinnmachen hier!« Tim Miles’ unangenehm krächzende Stimme ließ Mandu mitten in der Bewegung erstarren.
»Ich habe ihn gebeten, die Hufe der Pferde zu säubern«, log Apari beherzt. »Das ist eine Arbeit, die ihm Freude macht. Oder ist es Ihnen lieber, wenn er flucht und unzufrieden ist?«
»Seit wann bestimmst du Viehhirt, wo die Kerle arbeiten?«, bemerkte Tim Miles verächtlich und spie in hohem Bogen in den Sand.
»Ich dachte, wenn er hier fertig ist, sollte er sich nützlich machen«, wandte Apari ein.
Tim Miles musterte ihn herablassend. »Aber nicht bei den Pferden. Da hat der faule Kerl nichts zu suchen! Kapiert? Wie oft soll ich dir das noch sagen, Apari? Du hast dem Bastard gar nichts zu sagen.«
»Aber er hat ein Händchen für die Pferde«, widersprach Apari mit Nachdruck.
»Und das willst du beurteilen, Buschmann? Dass ich nicht lache!« Tim Miles packte Mandu unsanft an den Schultern. »Du kommst jetzt mit mir, Jack! Der Bottich im Toilettenhaus muss geleert werden.«
Mandu wurde blass. »Aber das habe ich gerade vor drei Tagen gemacht, Sir. Kann das nicht mal …«
»Wenn ich sage, du leerst die Bottiche, dann hast du das zu erledigen! Verstanden?« Er warf Apari einen hasserfüllten Blick zu. »Hast du nichts zu tun, als dem verwöhnten Bürschchen irgendwelche Flausen in den Kopf zu setzen? An die Arbeit, Mann!«
Widerstrebend wandte sich Apari um und schlenderte betont gemütlich in Richtung der Pferdekoppel.
»Was versprichst du dir eigentlich davon, dass du dich wie eine Klette an diesen Wilden hängst?«, schnaubte Miles. »Du würdest gut daran tun, deinen blöden Stolz endlich aufzugeben. Denk nicht, du bist etwas Besseres als die anderen Bastarde, nur weil du deiner Sippe nicht die Bohne ähnlich siehst. Deine Mutter, diese Hure, war schwarz wie die Nacht.«
Mandu reckte sein Kinn vor, wollte gerade etwas erwidern, was ihm zumindest Ohrfeigen, wenn nicht gar eine Tracht Prügel eingebracht hätte, als er stutzte. Hatte Tim Miles gerade tatsächlich von sich gegeben, dass seine Mutter schwarz wie die Nacht war? Aber dann musste er sie ja kennen und wissen, wo sie war und woher man ihn entführt hatte. Mandus Herzschlag beschleunigte sich. Nein, es wäre unklug, Tim Miles an den Kopf zu werfen, dass er der eigentliche Bastard war.
»Ich bin froh, dass ich ihr nicht ähnlich sehe«, gab Mandu vor. »Ich verabscheue diese … Schwarzen«, fügte er schnell hinzu. So überzeugend, dass Tim Miles ihm anerkennend auf die Schulter klopfte. »Das ist die richtige Einstellung.«
Mandu zwang sich zu einem Lächeln.
»Dann halte dich besser von dem Buschmann fern. Wenn du meinen gut gemeinten Rat befolgst, wird es dir in Zukunft besser ergehen.«
»In Ordnung, Sir!«, entgegnete Mandu und wunderte sich, dass seine Stimme nicht verriet, wie sehr er Tim Miles und seine miese Art verabscheute. Aber wie in aller Welt sollte er Miles sonst dazu bringen, ihm mehr über seine Herkunft zu verraten? Ihm blieb wohl nur der direkte Weg. Sein Herz klopfte bis zum Hals, als er fragte: »Woher kennen Sie meine Mutter denn überhaupt, Sir?«
Tim Miles blieb abrupt stehen und musterte den jungen Mann von Kopf bis Fuß. Der befürchtete schon, dass Miles sein falsches anbiederndes Getue durchschaut hatte. Mandu hielt den Atem an. Er erwartete jeden Augenblick einen niederschmetternden Schlag seines Gegners. Stattdessen lief ein breites Grinsen über Miles’ feistes Gesicht.
»Na ja, ich überlasse es ja nicht dem Zufall, welche Bastarde wir für die Oldfield-Farm einkaufen. Ich habe die Polizei damals auf ihrer Jagd nach Cairns begleitet. Sie haben mir versprochen, dass es dort besonders kräftige Burschen gibt. Normalerweise habe ich keine Kleinkinder mitgenommen, aber bei dir habe ich eine Ausnahme gemacht, weil Mrs Oldfield sich unbedingt so einen kleinen Balg als Sohnersatz gewünscht hat. Und dann wollte so ein vornehmer Herr aus Cairns den kleinen, ach so ›süßen‹ Bastard seiner Haushaltshilfe loswerden und hat dich uns quasi auf dem Silbertablett serviert.«
Mandu war nach Kräften bemüht, sich sein Entsetzen nicht anmerken zu lassen.
»Ist ja auch egal, ob ich aus Cairns komme oder von woandersher. Meine Zukunft liegt hier!«
»Junge, Junge, so viel Einsicht hätte ich dir gar nicht zugetraut, aber es ist nicht richtig, was du sagst. Es ist nämlich überhaupt nicht gleichgültig, aus welcher Ecke ihr kommt. Du wirst es nicht glauben, aber alle Jungs, die ich von jener Reise in den Norden mit zurückgebracht habe, waren besonders kräftig. So wie du! Schau doch nur, was du für Muskeln hast.«
Mandu zweifelte daran, dass er dieses falsche Spiel noch lange durchhalten würde. Er wusste, dass er einen durchtrainierten Körper besaß, aber er wollte das partout nicht aus dem Mund dieses Widerlings hören. Zumindest hatte er wichtige Dinge erfahren: Er stammte also aus Cairns, wo immer das auch lag. Das musste er umgehend Apari erzählen, denn der kannte diesen Ort mit Sicherheit. Doch erst einmal musste er versuchen, Tim Miles loszuwerden, denn langsam konnte er ihn echt nicht mehr ertragen. Da sah er im Augenwinkel, dass sie in Höhe der Toilettenhäuser angekommen waren. Was ihn vorher angeekelt hatte, schien ihm jetzt als Rettung.
»Entschuldigung, Sir, dort sind die Häuschen, die ich säubern soll«, erklärte er mit belegter Stimme.
»Ach was, mein Junge«, erwiderte Tim Miles in jovialem Ton. »Das macht ein anderer. Du reparierst den Zaun zur Außenkoppel. Kannst du das?«
»Natürlich, Sir, ich weiß, wie man mit Hammer und Nagel umgeht!« Das klang überzeugend, weil es die Wahrheit war. Mandu war nicht nur geschickt im Umgang mit Pferden, nein, er nahm es auch mit jeder handwerklichen Arbeit auf.
»Dann geh in südöstliche Richtung, bis du an ein großes Loch im Zaun gelangst. Ich glaube, da wollten ein paar Buschmänner unser Vieh stehlen, die haben es aber nicht geschafft. Flicke du den Zaun!«
Mit den Pferden zu arbeiten war Mandus absoluter Traum, aber das Flicken eines Zaunes zählte immerhin zu jenen Aufgaben, die er zumindest mit Freude erledigen würde.
Mandu nickte seinem Herrn betont dankbar zu, obwohl ihm übel war, weil Miles es sichtlich genoss, vermeintlich einen Keil zwischen Apari und ihn getrieben zu haben. »Wenn du fertig bist mit dem Zaun, dann hast du den Rest des Tages frei. Drüben in Dalby gibt’s ein Bullenreiten. Das wird sicher ein Spaß. Ein paar Burschen reiten nachher mit den Pferden rüber. Du kannst doch reiten, oder?«
Mandu überlief es heiß und kalt. Genau das war sein großes Geheimnis. »Ich, ich weiß nicht, ich habe ja noch nie auf einem Pferd gesessen. Wenn Sie sich erinnern, Sir, Sie haben es mir verboten.«
»Dann versuchst du es einfach. Wird schon schiefgehen.« Mit diesen Worten spuckte Miles den Tabak aus, auf dem er die ganze Zeit herumgekaut hatte. Mandu erschauderte, als er einen flüchtigen Blick auf Miles’ gelbe Zähne erhaschte. Wie konnte sich dieses Ekel bloß einbilden, ihn auf seiner Seite zu haben?
Zu Mandus Erleichterung verabschiedete sich der Stockman nun hastig und eilte davon. Mandu atmete tief durch und begab sich schnellen Schrittes zur Scheune, um sich das Handwerkszeug zu holen.
Wenig später hatte er die Stelle im Zaun gefunden. Da hatte offenbar wirklich jemand versucht, Rinder zu klauen. Aber es waren sicher keine Aboriginals gewesen, sondern eher andere Outback-Farmer, die auf diese Weise ihren Viehbestand zu vergrößern versuchten. Seufzend machte er sich an die Arbeit. Die Mittagssonne brannte erbarmungslos vom Himmel herunter. Trotzdem trug Mandu keinen Hut wie die weißen Männer. Sein dichtes Haar diente als Schutz und ließ keinen Sonnenstrahl durch. Das Gesicht schützte er mit einem Halstuch vor dem Verbrennen. Mandu mochte es nicht, wenn er zu viel Farbe bekam und dann den armen Teufeln, die in der Scheune arbeiteten, immer ähnlicher wurde. Mandu wusste auch nicht, warum ihn das störte. Manchmal litt er darunter, dass er als Einzelgänger galt. Ihn überkam häufig ein Gefühl, dass er nirgendwo hingehörte. In diesem Augenblick aber so ganz allein in der weiten Natur, dazu mit einer halbwegs sinnvollen Arbeit betraut, fühlte er sich rundherum wohl. Und in Gedanken war er schon längst auf der Koppel im Schutz der Dunkelheit, wo Apari ihn am kommenden Sonntag in die Geheimnisse des Pferdeflüsterers einweihen würde.
Lucys mutiger Plan
Lucy und Miranda lebten nun schon seit über vier Wochen im »Haus zum heiligen Engel«. Ein Tag war schlimmer als der andere. Miranda hatte inzwischen bitter erfahren, zu welchen Gräueltaten die »Hexe« fähig war. Das Mädchen hatte schon mit den Füßen in eiskaltem Wasser stehen müssen und war geschlagen worden. Der Entzug des Abendessens war eine der Lieblingsstrafen der Oberin. Wie oft war Miranda in den letzten Wochen hungrig ins Bett gegangen! Lucys Versuch, ihr beim ersten Mal nachts heimlich einen Kanten Brot zuzustecken, war kläglich gescheitert. Die Hexe hatte Lucy dabei erwischt und sie unter groben Beschimpfungen in ihr Bett geschickt. Als Strafe hatte Lucy am nächsten Morgen kein Frühstück bekommen. Seitdem versuchte Miranda, sich ein wenig zusammenzureißen. Obwohl sie jegliche Strafmaßnahmen, die über sie verhängt wurden, stoisch ertrug, konnte sie es jedoch nicht aushalten, wenn ihre Schwester Lucy leiden musste. Leider hatte das auch die Oberin inzwischen spitzgekriegt und ließ immer häufiger ihren Ärger an Mirandas Zwillingsschwester aus. Dabei war Miranda wirklich nach Kräften bemüht, sich nichts mehr zuschulden kommen zu lassen. Und in den letzten Tagen war es ihr tatsächlich gelungen, den Zorn der Oberin kein einziges Mal auf sich zu ziehen.
Miranda schluckte ihre Widerworte gegen die vielen, ihrer Meinung nach unsinnigen Regeln tapfer hinunter. Auch die Anordnung, am heutigen Sonntag im dunklen Büro der Oberin zu sitzen und fadenscheinige Schuluniformen zu flicken, hatte sie zähneknirschend entgegengenommen. Dabei grauste ihr davor. Es war nicht ihre Sache, mit Nadel und Zwirn zu hantieren.
Dementsprechend grimmig blickte sie vor sich hin, als sie sich auf den Weg zum Büro der Oberin machte. Dort würde Schwester Mary auf sie warten, um sie in die Arbeit einzuweisen. Kurz vor der Tür des Büros begegnete ihr Lucy. Miranda rang sich zu einem Lächeln durch. »Was machst du heute?«
Lucy zuckte die Achseln. »Ich habe frei und werde ein wenig im Park spazieren gehen.«
»Ich beneide dich glühend«, seufzte Miranda.
»Und du? Glücklich siehst du nicht aus.«
»Pah, von wegen glücklich. Ich möchte dich mal sehen, wenn man dich dazu verdonnert hätte, den ganzen schönen Tag lang verschlissene Kleider zu flicken.«
»Aber du hast doch erst letzten Sonntag den ganzen Tag die Küche putzen müssen.«
»Sie kann mich eben nicht leiden, die alte Hexe. Sie weiß genau, dass ich ihr das liebe Mädchen nur vorspiele.«
»So schlimm?«
»Schlimmer. Stopfen ist die Hölle. Ich hasse Handarbeiten.«
»Ich weiß.« Lucy konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen bei dem Gedanken, wie oft sie Mirandas lustlos angefangene Handarbeiten einigermaßen gerettet hatte, sodass ihre Schwester sie in der Schule als ihre eigenen hatte abgeben können.
»Aber was soll ich tun? Die Hexe wird mich zwar nicht kontrollieren, weil sie Familienbesuch hat, aber ich möchte Schwester Mary nicht in Schwierigkeiten bringen. Wahrscheinlich würde sie mich nicht mal verpetzen, wenn ich das Flicken schwänze …« Mirandas Miene verfinsterte sich. »Wie ich die Hexe hasse. Warum musste alles nur so kommen?« Ganz leise, kaum hörbar, fügte sie hinzu: »Wenn Mutter doch nur den Kampf gegen das scheußliche Fieber gewonnen hätte …«
Lucy nahm Miranda in den Arm und drückte sie fest an sich. Ja, nach der Mutter sehnte sie sich auch. Und auch nach dem Leben bei den Taylors. Wie oft musste sie daran denken, wie unbeschwert ihr Alltag dort gewesen war. Im Gegensatz zu dem freudlosen Dasein in diesem Gefängnis.
Lucy seufzte tief, dann riss sie sich zusammen. Sie musste Miranda irgendwie helfen – sie sah gar zu traurig aus. Es war ganz offensichtlich, dass die Oberin Miranda schikanierte. Und das, obwohl sich ihre Schwester eine ganze Woche lang zusammengerissen hatte. Lucy wusste genau, warum Miranda sich lammfromm gab: Miranda wollte ihre Schwester schützen, denn sie war wie umgewandelt, seit sie dabei hatte zusehen müssen, wie die Oberin Lucy mit einem Stock auf die Finger geschlagen hatte. Lucy hatte ihre Tränen nicht zurückhalten können. Sie war eben nicht so tapfer wie ihre Schwester, der keine Bestrafung auch nur einen Laut entlocken konnte. Lucy grübelte, was sie für Miranda tun könne. Plötzlich erhellte sich ihre Miene. Sie hatte einen Plan, wie sie ihrer Schwester diese Arbeit ersparen und ihr einen Sonntag in der Natur bescheren konnte.
»Miranda«, flüsterte sie verschwörerisch. »Zieh deine Sachen aus!« Ohne eine Antwort abzuwarten, schlüpfte Lucy aus ihrer ordentlichen Schuluniform und reichte sie ihrer verblüfften Schwester. »Nimm schon. Wenn du deine Schürze anbehältst, klappt das nicht.«
Miranda schien nicht zu verstehen. Ein breites Grinsen umspielte Lucys Lippen. Das kannte sie gar nicht von ihrer immer zu Streichen aufgelegten Schwester, dass sie so schwer von Begriff war.
»Ich gehe als Miranda dorthin«, erklärte sie triumphierend, während sie ihr ordentlich aufgestecktes Haar mit den Fingern verwuschelte.
»Aber das geht doch nicht. Wenn sie das spitzkriegt, wird sie dich schlagen, und das überstehst du nicht.«
»Kannst du auch mal auf deine kleine Schwester hören?« Lucy war ein paar Minuten später auf die Welt gekommen als Miranda. »Nun gib schon her!«
Zögernd zog Miranda ihre beschmutzte und löchrige Schuluniform aus und reichte sie Lucy. In ihrem Blick lag Bewunderung.
»Und das willst du wirklich für mich riskieren?«, fragte sie skeptisch.
»Ich bin doch froh, wenn ich auch mal was für dich tun kann. Glaubst du, ich weiß nicht, warum du dich so beherrschst, seit sie mich in deiner Gegenwart geschlagen hat?«
Miranda schluckte, doch dann zog sie schnell Lucys Schuluniform an.
»Nun noch das Haar!«, befahl Lucy, und schon hatte sie die Spange in der zerzausten Mähne ihrer Schwester geöffnet und fuhr mit den Fingern geschickt durch ihre Locken. Als sie die Spange wieder festgesteckt hatte, betrachtete sie stolz ihr Werk.
»Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du wärest ich«, kicherte Lucy. »Und wie findest du mich?« Sie drehte sich einmal um ihre Achse.
»Ich würde sagen, du bist Miranda.« Doch so richtig freuen konnte sich Miranda noch nicht über diese gelungene Verwandlung. »Ich habe Sorge, dass du dafür büßen musst, wenn sie uns erwischen.«
»Was ist nur los mit dir? Du bist doch sonst so mutig – oder schlüpfst du gerade überzeugend in die Rolle deiner kleinen ängstlichen Schwester Lucy?«
»Das habe ich über dich nie gesagt, Lucy«, protestierte Miranda mit Nachdruck.
»Gesagt vielleicht nicht, aber gedacht. Lass mich doch auch mal etwas Aufregendes tun!«
»Ja schon, aber ich habe doch nur Sorgen, dass …«
Lucy legte ihr den Finger zum Zeichen, dass sie schweigen solle, auf den Mund. »Wir werden nicht erwischt. Wie soll sie uns das denn beweisen? Wenn wir beide behaupten, die jeweils andere zu sein, kann sie gar nichts gegen uns ausrichten. Außerdem ist die Oberin beschäftigt. Ihr Bruder mit seiner Familie ist zu Besuch.«
Stürmisch umarmte Miranda ihre Schwester, die in diesem Augenblick tatsächlich wie ein Spiegelbild ihrer selbst aussah.
»Vorsicht, du musst dich ein bisschen zurückhaltender benehmen, wenn du ein braves Lucy-Mädchen abgeben willst«, scherzte Lucy.
»Ich verspreche es! Danke, du hast mir den Tag gerettet!«, rief Miranda überschwänglich aus und schwebte glücklich davon.
Kopfschüttelnd sah Lucy ihr hinterher. Es erfüllte sie mit Stolz, dass sie sich endlich auch einmal etwas getraut hatte. Auch wenn der Gedanke an die drohende Arbeit mit Nadel und Faden nicht gerade der angenehmste war. Immerhin gingen ihr diese Arbeiten leichter von der Hand als Miranda.
Mit einem Lächeln auf den Lippen öffnete sie wenig später die Tür zum Büro der Oberin. Schwester Mary blickte kurz von ihrer Arbeit auf.
»Komm her. Ich habe dir ein Glas Zitronenlimonade gemacht. Als kleinen Trost, dass du den schönen Tag drinnen verbringen musst.«
»Ach, ist doch halb so schlimm«, erwiderte Lucy.
Schwester Mary musterte sie irritiert.
»Solltest du dich tatsächlich in eine Musterschülerin verwandelt haben, Miranda Clayton?«
»Ich bin eine Musterschülerin, Schwester Mary«, gab Lucy artig zurück.
»Langsam wirst du mir unheimlich. Wenn du am Kopf nicht wie ein wild gewordener Handfeger aussehen würdest, müsste ich glatt daran zweifeln, dass du wirklich Miranda bist.«
Lucy lief rot an und versuchte hastig, ihren Schrecken, dass man ihr doch auf die Schliche kommen könnte, zu überspielen. »Wenn Sie darauf anspielen, dass ich meiner Schwester immer ähnlicher werde und mir letzte Woche meine Widerworte verkniffen habe, kann ich Sie beruhigen. Ich spiele das Theater nur, damit die Oberin mich und vor allem Lucy endlich in Ruhe lässt.«
»Das ist vernünftig, mein Kind. Komm her, dann will ich dir mal zeigen, wie du so ein Loch in der Schürze am besten stopfst.« Mit prüfendem Blick auf die Löcher in Mirandas Schuluniform seufzte sie. »Ich denke, wir beginnen mit dem, was du am Leib trägst. Deine Schürze hat ein paar Ausbesserungsarbeiten bitter nötig.«
Lucy knüpfte die Schürze ab, nahm zielstrebig Nadel und Faden zur Hand und begann gedankenverloren mit dem Stopfen des ersten Lochs. Sie dachte daran, wie verblüfft Miranda auf ihren Plan reagiert hatte. Bin ich wirklich so langweilig, dass man mir nicht das kleinste Abenteuer zutraut?, überlegte sie.
Dabei bemerkte sie gar nicht, dass Schwester Mary sie mit einer Mischung aus Zweifel und Zuneigung musterte. Erst als sie die Schwester fragen hörte: »Hast du dich nicht gerade bei mir bitterlich beklagt, dass du zwei linke Hände hast, wenn es um das Löcherstopfen geht?«, hielt Lucy erschrocken inne. Wieder färbten sich ihre Wangen rot.
»Ich, ich habe mir das gestern Abend von Lucy zeigen lassen. Ich dachte, dann geht das hier alles schneller, und ich komme vielleicht doch noch an die Luft«, versuchte sie ihren Fehler auszubügeln.
»Aha, und ihr beiden hattet auch Nadel und Faden zur Hand?«, erwiderte Schwester Mary nachdenklich.
Lucy sah auf. Schwester Marys und ihr Blick trafen sich. Lucy konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sie das falsche Spiel durchschaut hatte, aber sie wusste, dass Schwester Mary sie niemals verraten würde.
Der Pferdeflüsterer
M