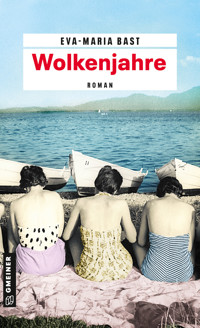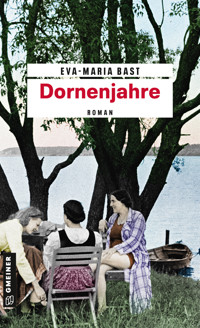Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jahrhundert-Saga
- Sprache: Deutsch
1923 wird das Ruhrgebiet von Franzosen besetzt. Der Hass gegen die Besatzer wächst, die Bevölkerung leidet. Johanna, Luise und Sophie müssen um ihr Glück kämpfen. Am Bodensee wird auf Sophie, Mutter eines Halbfranzosen, ein Anschlag verübt und sie flieht zu Luise ins Ruhrgebiet. Als deren Gatte Siegfried davon erfährt, bedroht er die Frauen, die in ihrer Verzweiflung eine schreckliche Tat begehen. Und dann begegnet Sophie ihrem einstigen Verlobten, dem Franzosen Pierre, wieder ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva-Maria Bast
Kornblumenjahre
Zweiter Teil der Jahrhundert-Saga
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Friedrich Mueller
ISBN 978-3-8392-4664-1
Widmung
Für Thomas
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen werden den ersten Teil der Mondjahre-Trilogie bereits kennen. Für diejenigen, die Band 1 nicht gelesen haben, habe ich hier eine kurze Zusammenfassung geschrieben. Auch wenn jeder Band in sich abgeschlossen ist, sind manche Handlungsstränge doch besser zu verstehen, wenn man weiß, was sich in Band 1 ereignet hat.
Deutsches Reich 1914: Johanna Gerstett ist voller Idealismus, mutig und ein wenig unkonventionell. Sie hat Lust auf das Leben und will die Welt erobern. Und sie ist zum ersten Mal verliebt – in den Studenten Sebastian Bigall. Auch ihre Tante Sophie, die nur wenige Jahre älter ist als Johanna, hat ihr Herz verloren: an Pierre Didier, einen französischen Journalisten, der über den weltweit Aufsehen erregenden Ferdinand Graf Zeppelin recherchiert. Sowohl Sophie als auch Johanna interessieren sich – für die damalige Zeit ungehörigerweise – für Politik. Und so sind sie denn auch beunruhigt über die Aufrüstungen und beobachten besorgt die Wolken, die am Horizont aufziehen. Dann wird der österreichische Thronfolger in Sarajevo erschossen. Johanna und Sophie erleben die Wirren jener Tage des Kriegsausbruches mit, die Hamsterkäufe, die Jagd nach Gold, die Aufbruchsstimmung und die Angst. Als sich die Fronten zwischen Deutschland und Frankreich verhärten, verlässt Sophies Geliebter das Land – vor seiner Abreise verloben sich die beiden und schlafen miteinander, ein verzweifelter Akt. Sophie wird schwanger, schwanger vom Feind.
Auch Sebastian und Johannas Onkel Siegfried müssen in den Krieg ziehen. Siegfried ist beim Kampf um Neidenburg in Ostpreußen dabei und verliebt sich in Luise, bei deren Familie er einquartiert ist. Als die Russen vorrücken, ziehen sich die deutschen Truppen aus Neidenburg zurück – und Siegfried beschwört Luise, mit ihm zu kommen. Aber sie muss auf ihre Eltern warten, die dann jedoch grausam ermordet werden. Schier besinnungslos vor Schmerz, Wut und Hass erlebt Luise die Tage, in denen Neidenburg in russischer Hand ist.
Sophie macht derweil im Lazarett an der Westfront schreckliche Erfahrungen und wird schließlich, als ihre Schwangerschaft nicht mehr zu verbergen ist, entlassen. Siegfried und Luise haben sich inzwischen wiedergefunden und planen ihre Hochzeit in Memel. Während der Vorbereitungen werden Johanna und Luise von den Russen gefangen genommen. Siegfried sieht die beiden Frauen in der Gewalt der Russen und wird beim Versuch, sie zu retten, niedergeschossen. Luise bricht im Zug, der sie nach Russland bringen soll, völlig zusammen. Sie weiß nicht, ob er noch lebt. Doch Siegfried überlebt – stürzt aber in eine tiefe Krise, weil er sein Bein verliert und sich nur noch wie ein halber Mann fühlt.
Johanna und Luise landen in einem russischen Gefangenenlager. Johanna soll dem dort arbeitenden Arzt assistieren – und hat eines Tages ihre große Liebe, den als vermisst geltenden Sebastian, vor sich auf dem OP-Tisch. Gerade als die beiden Wiedersehen feiern, werden Johanna und Luise nach Petrograd an ein Krankenhaus beordert. Sebastian und sein Freund Karl flüchten aus dem Lager und reisen den Frauen hinterher. Während in Petrograds Straßen die Revolution tobt, spürt Sebastian Luise und Johanna auf. Gemeinsam mit Karl und der jungen russischen Krankenschwester Irina fliehen sie, Irina und Karl verlieben sich ineinander.
Derweil trauert Pierre im feindlichen Frankreich immer noch seiner Sophie nach. Doch seine Mutter versucht, ihn zu verkuppeln. Schließlich heiratet Pierre eine andere, sein Herz gehört aber nach wie vor Sophie.
Sebastian und Karl müssen an die Front zurück. Bei einem Angriff wird Karl vor Sebastians Augen in Stücke gerissen. Sebastian verliert den Verstand. Es dauert lange, bis man ihn findet, er ist zutiefst verstört. Während der Kaiser abdankt und die Straßen in Deutschland unter der Revolution brennen, bringt Johanna ihre Tochter Susanne zur Welt. Und Sebastian findet langsam ins Leben zurück.
Der zweite Handlungsstrang spielt in der Gegenwart. Zita, eine junge Frau aus Stuttgart, ersteigert bei eBay ein winziges altes Notizbüchlein aus Silber, das an einem Band um den Hals getragen werden kann. Als sie das Büchlein in der Hand hält, entdeckt sie, dass sich noch lauter kleine Blätter, die man in das Büchlein klemmen kann, darin befinden. Gebannt entziffert sie die verblassten Aufschriebe, die offensichtlich aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs stammen. Was sie dort liest, fasziniert sie so sehr und ist so rätselhaft, dass sie beschließt, sich auf Spurensuche zu begeben. Ihre Suche führt sie nach Überlingen an den Bodensee, wo die Nachfahren derer leben, die ins Notizbüchlein schrieben: die Nachfahren von Sophie, Johanna und Luise. Zu jener Zeit ahnt Zita noch nicht, dass der Fund des Notizbüchleins ihr Leben komplett verändern soll: Sie verliebt sich in Philippe, den Urenkel Sophies, den die Suche nach der Wahrheit ebenfalls nach Überlingen führt. Und sie entgeht knapp einem Mordanschlag, den Franziska, Johannas kleine Schwester, die inzwischen hochbetagt ist, auf sie verübt. Der Grund: Sie fühlt sich durch Zita und das Notizbüchlein bedroht, denn Franziska hat etwas zu verbergen …
1923 – 1925
1. Kapitel
Überlingen, Bodensee, August 2013
Das silberne Notizbuch lag auf dem kleinen Sekretär in Zitas Hotelzimmer. Sie hatte es wieder bezogen, nachdem Franziska, die alte Dame, die ihr nach dem Leben getrachtet hatte, um die Aufzeichnungen in ihren Besitz zu bringen, verhaftet worden war. Franziska Gerstett war die Inhaberin der Pension, in der sich Zita eingemietet hatte, und deshalb war Zita auf Anraten der Polizei sicherheitshalber ausgezogen. Nun aber saß Franziska hinter Schloss und Riegel und Zita war zurückgekehrt. Nachdenklich ließ sie ihre Finger über den ziselierten Deckel des Notizbüchleins wandern.
Noch immer war sein Rätsel nicht gelöst, im Gegenteil: In den Wochen, seit sie das winzige Büchlein, das man mit einem Lederband um den Hals tragen konnte, bei eBay ersteigert hatte, waren die unbeantworteten Fragen zu einem riesigen Berg angewachsen, ihr ganzes Leben hatte sich verändert. In dem Büchlein hatten sich Notizen befunden, merkwürdige Notizen aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Geheimnisvolle Aufzeichnungen, deren Sinn Zita unbedingt hatte herausfinden wollen. Ihre Suche hatte sie an den Bodensee geführt, in eine Pension, die Altes Schulhaus hieß. Hier hatte sie den Mordanschlag überlebt, neue Freunde gefunden, hatte sich verliebt – und war entschlossener denn je, das Rätsel, das sich um dieses Büchlein rankte, zu lösen. Denn inzwischen war klar: Die Verfasserin der Notizen war eine mittlerweile verstorbene Verwandte Franziska Gerstetts, Franziska selbst hatte gewaltig Dreck am Stecken. Und anscheinend unglaubliche Angst, dass in dem Notizbüchlein etwas stand, das ihr dunkles Geheimnis verraten könnte.
Wieder strich sie über den Deckel. Er fühlte sich ganz warm an unter ihren Händen. Während sie das Büchlein betrachtete, dachte sie darüber nach, wie seltsam es doch war, dass ein solcher Gegenstand das Leben mehrerer Menschen bestimmen und verändern konnte. Dass er ihr Leben plötzlich mit dem der Familie Gerstett verwob. Obwohl sie als Außenstehende ja eigentlich nichts mit all dem zu tun hatte, war sie plötzlich mitten im Geschehen.
»Was machst du denn da?«, riss Philippes schläfrige Stimme sie aus ihren Gedanken. Lächelnd drehte Zita sich um. Philippe war Mediziner, hatte ihr nach dem Giftanschlag das Leben gerettet und sie hatten sich ineinander verliebt. Auch Philippes Geschichte war eng mit der des Büchleins verwoben, die Suche nach der Wahrheit hatte sie zueinandergeführt. Er gehörte dem französischen Teil der Familie an und auch er war auf der Suche nach dem Geheimnis des Notizbüchleins. Sie ging zu ihm und gab ihm einen Kuss. »Ich versuche, das Rätsel zu lösen. Oder vielmehr: die vielen Rätsel.«
»Kann das nicht noch warten?«, brummte Philippe und versuchte, sie an sich zu ziehen.
Zita wollte schon nachgeben und sich in die verführerische Umarmung fallen lassen, als jemand an die Tür hämmerte. »Zita!«, rief Mia von draußen. »Zita, mach auf, schnell!«
Philippe knurrte unzufrieden, doch Zita band den seidenen Morgenmantel, der bei Philippes Umarmung aufgegangen war, wieder zu, um Mia, Franziskas Großnichte, die gemeinsam mit ihrer Mutter Melissa ebenfalls im Haus wohnte, die Tür zu öffnen.
»Was gibt’s?«, fragte sie.
»Großtante Franziska liegt im Sterben«, sprudelte Mia hervor. »Die Nacht im Gefängnis ist ihr anscheinend nicht gut bekommen, und sie haben sie ins Krankenhaus eingeliefert. Die haben grade angerufen. Sie will unbedingt mit mir und Mutter sprechen. Und mit dir auch!«
»Mit mir?«, fragte Zita erstaunt, »warum denn mit mir?«
Mia zuckte die Achseln. »Keine Ahnung, aber wenn sie wirklich im Sterben liegen sollte, will sie sich vielleicht bei dir entschuldigen. Eine Art Beichte? Immerhin hat sie versucht, dich umzubringen!« Sie musterte Zita, die immer noch in ihrem schwarzen Morgenmantel vor ihr stand. »Beeil dich, zieh dir was über. Ach …, und ist Philippe bei dir?«
»Ja!«, rief Philippe von hinten und erschien verstrubbelt und mit einem um die Hüften geknoteten Handtuch in der Tür. »Will sie mich etwa auch sehen?«
»Nein«, erwiderte Mia verlegen. »Aber meine Mutter möchte gerne mitkommen. Auch wenn die beiden sich nie gemocht haben – es könnte doch sein, dass es das letzte Mal ist, dass sie Franziska lebend sieht.«
»Und da soll ich unten die Rezeption machen und anreisenden Gästen ihre Schlüssel aushändigen?«, fragte Philippe. »Kein Problem. Gebt mir fünf Minuten.«
»Ich brauche drei«, versicherte Zita ihrer Freundin. »Ich bin gleich unten.«
Das Gesicht der alten Dame war so weiß wie die Laken, in denen sie lag. Zita erschrak, wie eingefallen und faltig Franziska wirkte, dabei war sie ihr immer schon wie der Inbegriff einer Greisin erschienen. Die Alte wandte leicht den Kopf, als die drei Frauen das Zimmer betraten.
»Kommt herein«, sagte sie. Ihre Stimme klang heiser, rau und irgendwie auch hohl und unheimlich. Unwillkürlich musste Zita an den Mann denken, der ihr im Zug begegnet war, neulich, als sie mit dem Notizbüchlein im Gepäck an den Bodensee gereist war. Er hielt sich, wenn er sprechen wollte, einen Verstärker an die Stimmbänder, weil er Kehlkopfkrebs hatte. Ganz ähnlich klang nun Franziskas Stimme, als sie hasserfüllt hervorstieß: »Sophie und Luise, sie haben Siegfried getötet. Einen, der fürs Vaterland kämpfte, einen mutigen Mann, der für seine Sache einstand.« Mia, Zita und Melissa wechselten einen erschrockenen Blick. Sophie war Philippes Urgroßmutter gewesen. Und sie sollte Siegfried, ihren eigenen Bruder, getötet haben? Gemeinsam mit dessen Frau Luise?
Mia ging zögernd auf das Bett zu. Franziska atmete keuchend aus. »Ich habe das immer gewusst. Ich war die Einzige aus der Familie, die wusste, wie meine Tanten, von denen alle sagten, sie seien so wunderbar und so gut, wirklich waren.«
»Hast du sie verraten, Tante Franziska?«, bohrte Mia. »Ist das der Grund, warum du wegen des Notizbüchleins so erschrocken bist? Dachtest du, dass darin etwas über deinen Verrat zu finden sei?«
Franziska wandte den Kopf ab und presste die Lippen aufeinander. »Bitte, Tante Franziska«, flehte Mia, »du musst es mir sagen!«
Franziska sah sie wieder an mit ihren trüben alten Augen. Ihre Stimme klang keuchend und pfeifend, als sie sagte: »Ich war die Jüngste, die Kleinste, mein Kind. Ich habe früh gelernt, dass es von Vorteil ist, Dinge zu wissen. Nur so kommt man durch im Leben.«
»Hast du sie verraten?«, fragte nun auch Melissa. »Ist es das, was dich quält? Haben sich Johanna und Sophie deshalb überworfen? Ist das der Grund?«
Johanna war Mias Großmutter. Philippe hatte erzählt, dass das Zerwürfnis mit Johanna seine Urgroßmutter immer gequält hatte – aber auch er wusste nicht, wodurch es zustande gekommen war.
»Ach, mein liebes Kind.« Franziska legte ihre faltige Hand an Mias Wange. »Mein liebes Kind, es ist danach noch so viel geschehen. Ich war immer diejenige, die alles wusste und die das zu nutzen verstand.« Ein trotziger Ausdruck trat auf ihr Gesicht, als sie wiederholte: »Ich war ja auch die Kleinste, ich musste sehen, wo ich bleibe.«
Nachdenklich sah sie Mia an. »Ich weiß auch Dinge über dich, Mia-Kind, die du nicht weißt.« Ihr Blick schweifte zu Melissa. »Dinge, die auch deine Mutter betreffen. Und die selbst sie nicht weiß.«
»Was für Dinge?«, rief Mia. »Rede doch mit mir, Tante Franziska!« Und auch Melissa trat einen Schritt vor. Im Gegensatz zu ihrer Tochter war sie ganz ruhig, als sie sagte: »Bitte, Franziska, du hast uns diese Dinge ein Leben lang verschwiegen und uns damit belastet. Bitte lass uns nicht im Ungewissen.«
Im Blick der alten Frau begann es zu flackern. »Es gibt so vieles, was ihr nicht wisst«, sagte sie, nahm dann Mias Hand und krallte sich an ihr fest. Es schmerzte und Mia biss die Zähne zusammen.
»Es ist alles ganz anders, als ihr immer glaubtet«, stieß Franziska hervor. »Johanna ist gar nicht deine Großmutter, Mia. Und nicht deine Mutter«, wandte sie sich an Melissa.
Mia schrie leise auf. »Aber was … aber wer …«, stammelte sie, während Melissa Franziska mit großen Augen anstarrte.
Doch die schüttelte nur den Kopf.
Zita, die schweigend ein wenig abseits gestanden hatte, legte Melissa die Hand auf die Schulter.
Mia war vollständig verwirrt. »Aber Mutter hat immer gesagt, Johanna sei ihre Mutter gewesen.« Sie sah Melissa an, doch die erwiderte ihren Blick nur erschrocken und ratlos.
»Das hat deine Mutter auch geglaubt.« Wieder klang Franziskas Stimme seltsam tonlos und unheimlich. »Johanna wollte, dass sie es glaubt. Alles andere wäre gefährlich gewesen.«
In Mias Kopf drehte sich alles. »Wieso gefährlich? Wer ist denn nun meine Großmutter? Und was hat das alles mit dir zu tun und mit dem Büchlein?«
Franziska wandte den Kopf ab. »Es ist so lange her. Ich habe die Dinge damals in die richtigen Bahnen gelenkt.«
Melissa erwachte aus ihrer Schockstarre und trat noch näher an Franziskas Bett. »Tante Franziska«, flehte sie, »wer ist meine Mutter? Bitte sag es mir. Du kannst mich nicht mit einer solchen Wahrheit konfrontieren und dann nicht konkret werden. Das ist … das ist grausam.«
Franziska sah Melissa ruhig an. »Ich habe dich immer geliebt, Melissa, bei dir war deine Abstammung egal. Ich bin alt, ich möchte die Vergangenheit nicht aufwühlen. Raphael, er könnte noch etwas wissen.«
Dann fiel ihr Kopf zur Seite, und Franziska Gerstett segnete 100 Jahre, nachdem sie das Licht der Welt erblickt hatte, das Zeitliche.
2. Kapitel
90 Jahre zuvor
Essen, Ruhrgebiet, 11. Januar 1923
Die Stadt brannte. Die Flammen, die über ihren Dächern zusammenschlugen, waren Flammen der Wut. Die Wut der Essener auf die Franzosen, die bewaffnet und in Uniform in ihre Stadt einmarschierten. Das Ruhrgebiet wurde besetzt, die Reparationsforderungen der einstigen Kriegsgegner sollten mit Gewalt durchgesetzt werden. Luise stand inmitten der aufgebrachten Menge, beobachtete den Einmarsch der Franzosen und überlegte, ob sich die Wut der Einheimischen so anfühlte wie die Wut der Russen während der Revolution, damals, 1917. Sie überlegte das sehr genau und stellte dann fest, dass sie sich die Antwort nicht geben konnte. Denn in jenem bitterkalten Winter, da hatte auch sie gekämpft, gemeinsam mit den Genossen, bei denen sie, die Kriegsgefangene aus Deutschland, überraschenderweise eine Heimat gefunden hatte. Das Mädchen, das voller Hass auf die Russen die erzwungene Reise von Ostpreußen nach Russland angetreten hatte, das so voller Groll gewesen war, hatte sich irgendwann mit ihnen angefreundet, solidarisiert. Weil es gut tat,füretwas zu sein,füretwas zu kämpfen.Für die Heimat zu kämpfen.Aber die russische Heimat, für die sie gekämpft hatte, war nicht die ihre gewesen, ihre Heimat war untergegangen, zusammen mit der von Russen ermordeten Großmutter, den ermordeten Eltern. Sie war zurückgekehrt zu ihrem Verlobten, hatte ihre Heimat in ihm zu finden geglaubt, doch auch er, Siegfried, war untergegangen. Ersoffen im gierigen, menschenverschlingenden Meer des Kriegs. Nein, er war nicht gefallen. Das nicht. Aber sie hatten ihm das Bein weggeschossen und ihm damit seinen Stolz genommen, als halber Mann fühlte er sich seither und badete im Teich des Selbstmitleids. Dabei hatte es anfangs noch so ausgesehen, als könnten sie es schaffen. Justus, ihr Schwager, der in Konstanz eine Textilfabrik besaß, war in Gefangenschaft gewesen, Siegfried hatte die Firma in seiner Abwesenheit geleitet, ins Feld konnte er mit seinem einen Bein ja nicht mehr. Er war gut gewesen, wirklich gut. Siegfried hatte so viel geleistet und Justus wollte ihn auch behalten, er hätte ihn gut gebrauchen können. Aber Siegfried ließ es nicht zu. Als Justus aus der Gefangenschaft heimkehrte, gab es bitteren Streit zwischen den beiden Männern, und Siegfried schleuderte Justus entgegen, er brauche sein Mitleid nicht. Er werde es allein schaffen, allen zeigen im Ruhrgebiet, bei den Krupp-Werken. Grob hatte er sie, Luise, entwurzelt. Sie, die gerade zaghaft und schüchtern erste Wurzeln in den neuen Heimatboden am Bodenseeufer gesteckt hatte, hatte er gepackt und nach Essen geschleift, in diese hässliche, hässliche Stadt.
Und nun stand sie hier. Siegfried hatte einen schlechten Posten bei den Krupp-Werken, war nicht mehr als ein Arbeiter, aber er gab es nicht zu. Er sei immerhin Arbeiterführer, sagte er stolz. Ja, nun stand sie hier und sah den Truppen zu, die in die Stadt einzogen.
Aus Siegfried, ihrem einst so leuchtenden Helden, der sie küsste, bevor ihre Welt unterging, damals, im ostpreußischen Neidenburg, war ein verbitterter, verkniffener, selbstmitleidiger Mann geworden.
Trüb blickte Luise auf die Empörung, die ihr entgegenschlug. Die Deutschen schrien, spuckten, erhoben die Fäuste. Wie gerne würde sie mit ihnen schreien. Wie gerne wieder etwas fühlen – und sei es Empörung. Aber wie viele Kämpfe kann man im Leben kämpfen? Für wie viele Revolutionen brennen? Was bleibt nach all der Empörung? Die Flamme verbrennt mich, dachte Luise müde und hörte mit halbem Ohr zwei Männern zu, die eifrig und wortgewaltig über den Einmarsch der Franzosen diskutierten. Darüber, dass die Deutschen sich angeblich nicht an die Reparationsverpflichtungen gehalten und zu wenig Holz und Kohle geliefert hätten. »Das ist doch nur ein Vorwand!«, empörte sich der eine. »Sie wollten das Ruhrgebiet schon lange besetzen.«
Die Schreie und Pfiffe übertönten die Schimpferei der Männer. In Luises Kopf mischte sich alles zu einem schier unerträglichen Lärm. Fest presste sie beide Hände auf die Ohren und wandte sich ruckartig um, um zu gehen. In ihr Zuhause, das keines war.
3. Kapitel
Überlingen, Bodensee, 12. Januar 1923
»Ach, Sophie!« Seufzend legte Johanna den Kopf an die Schulter ihrer Tante, die ihr viel mehr Freundin als Tante war, vielleicht auch, weil Sophie nur wenige Jahre älter war als sie selbst. »Ich langweile mich. Ich schäme mich dafür, aber ich langweile mich ganz furchtbar.«
Sophie strich Johanna über das dunkle Haar. Beide Frauen saßen dick eingepackt nebeneinander auf der Bank in der Küche, auf der sie schon so oft ihre Sorgen und Nöte miteinander geteilt hatten.
»Aber du musst dich doch nicht schämen, meine Liebe«, sagte Sophie sanft. »Du hast Schwangersein schon immer als unerträglichen Zustand empfunden, das war bei Susanne und Robert auch so.« Sie deutete lächelnd auf Johannas gewölbten Leib. »Außerdem ist es ganz normal, dass du dich langweilst, nach allem, was du im Krieg erlebt hast. Wer kann schon von sich sagen, von den Russen gefangen genommen worden und schließlich aus Russland geflohen zu sein? Und an der Front warst du auch noch, im Lazarett. Kein Wunder, dass dir das Leben hier furchtbar eintönig erscheint. Es ist ja auch trostlos.«
Sie umfasste den Raum mit einer Handbewegung. »Was haben wir denn? Jahrelanger Krieg, jahrelanges Sterben – und was hat es uns gebracht? Nichts als Verzicht und Entbehrungen. Es ist kalt, wir haben nichts zu essen, wir haben keine Hoffnung und alle hassen die Franzosen.«
Sophie hatte sich regelrecht in Rage geredet und schluchzte nun trocken auf.
»Sophie!« Erschrocken zog Johanna die Freundin an sich. »Der Franzosenhass macht dir zu schaffen, nicht wahr? Es geht dir gar nicht um all die Entbehrungen, die wir hinnehmen müssen.«
Sophie nickte, während ihr die Tränen über die Wangen liefen, verbarg sie ihr Gesicht schutzsuchend an Johannas Schulter.
»Du hoffst immer noch, ihn wiederzufinden?«
Wieder nickte Sophie. Sie hatte wenige Wochen vor Ausbruch des Krieges einen französischen Journalisten kennengelernt, der über den aufstrebenden Grafen Zeppelin berichten sollte und deshalb in Friedrichshafen weilte. Die beiden hatten sich Hals über Kopf ineinander verliebt und schnell beschlossen zu heiraten. Doch dann wurde der österreichische Thronfolger in Sarajewo ermordet, und die ganze Welt veränderte sich. In der Verzweiflung des Abschieds hatten Sophie und Pierre miteinander geschlafen, Raphael, Sophies heute siebenjähriger Sohn, war gezeugt worden, dann musste Pierre abreisen, und Sophie hatte nie wieder etwas von ihm gehört. Sie hatte sich als Lazarettschwester an die Westfront gemeldet, um ihm nahe zu sein, wenn er auch auf der anderen Seite kämpfte und nun plötzlich Feind war. Nach dem Krieg wartete sie Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr darauf, dass er käme, um sie und seinen Sohn, von dem er freilich nichts wusste, zu holen. Doch Pierre kam nicht. Und als Sophie nach Frankreich fuhr um ihn zu suchen, fand sie ihn nicht. Sie wurde immer trauriger, dann wütend, dann verbittert, schließlich siegte die Angst. Die Angst um den Menschen, den sie mehr liebte als ihr Leben. Dass er eine andere Frau geheiratet und sie vergessen haben könnte, konnte, wollte sie sich nicht vorstellen. Die Alternative aber war noch schlimmer: Sophie glaubte inzwischen fest, dass Pierre gefallen war und Raphael keinen Vater mehr hatte, Halbwaise war. Dennoch: Jetzt, wo die Franzosen im Ruhrgebiet einmarschierten, wuchs die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch am Leben sein könnte. Sie wagte den Gedanken eigentlich gar nicht zu denken, verbot ihn sich, doch er ließ sich nicht beiseiteschieben. Und noch etwas quälte sie: der Franzosenhass. Auch Raphael hatte das eine oder andere Mal schon einen franzosenfeindlichen Satz fallen lassen, und Sophie hatte an sich halten müssen, um ihren ahnungslosen Sohn nicht anzuschreien. So hatte sie die Kommentare ignoriert, denn auch wenn sie ihn nur sanft zurechtgewiesen hätte und Raphael hätte in der Schule erwähnt, dass seine Mutter franzosenfeindliche Kommentare nicht dulde, wäre das gefährlich gewesen. Franzosenhass gehörte zum guten Ton in diesen Tagen, vor allem, seit die Feinde aus dem Westen das Ruhrgebiet besetzt hatten, um die Deutschen zur Einhaltung der Reparationszahlungen zu zwingen.
»Irgendwann wirst du es Raphael sagen müssen«, unterbrach Johanna ihre Gedanken.
»Das kann ich nicht«, wehrte Sophie erschrocken ab. »Wie sollte er damit klarkommen? Jetzt, wo alle Welt die Franzosen hasst?«
»Das wird sich auch wieder ändern«, versuchte Johanna zu beruhigen.
Sophie schloss ihre Hand fest um das winzige silberne Notizbüchlein, in dem ein Foto Pierres steckte, dem sie ihre intimsten Gedanken anvertraute und das sie an einem hellblauen Seidenband stets um den Hals trug. »Glaubst du wirklich?«
»Aber natürlich. Denk doch nur daran, wie oft die Welt sich allein in den letzten zehn Jahren verändert hat.«
»Da hast du natürlich recht.« Ein Hauch von Hoffnung glomm in Sophies Augen. Doch sie ahnte nicht, wie extrem ihr Leben und auch das von Raphael, wie extrem ihrer aller Leben sich noch verändern würde. Sie hatten schon so viel hinter sich. Und noch so viel vor sich.
4. Kapitel
Essen, Ruhrgebiet, 12. Januar 1923
»Ich werde dortnichthingehen.« Siegfried ließ wieder etwas von seiner alten Kraft und seinem alten Feuer erkennen, als er in der kleinen, düsteren Wohnung, die er mit Luise bewohnte, auf den Tisch hieb und ihr seine Entscheidung mitteilte. »Ich werde dort genauso wenig erscheinen wie unsere Direktoren!« Leicht hob er das Kinn, und Luise sah plötzlich wieder den Mann vor sich, in den sie sich einst verliebt hatte. Sie fühlte, dass ihr Herz unwillkürlich schneller schlug, als sie die Woge seiner Entrüstung einatmete. Als sie wieder sein Feuer spürte und sein Leuchten. Schüchtern und doch kraftvoll wie ein Schneeglöckchen durch hartgefrorenen Boden bohrte sich die Hoffnung durch den Winter ihres Gemüts. Es war der 12. Januar 1923, ein ausnehmend kalter Tag. Die französischen Behörden hatten die Direktoren der Krupp-, Stinnes- und Thyssenwerke zu einer gemeinsamen Konferenz eingeladen, an der von deutscher Seite allerdings niemand teilnahm. Auch die Arbeiter dachten nicht daran, den Franzosen ihre Mitarbeit zuzusagen oder ihnen gar die Informationen zu geben, auf die sie hofften.
»Sie wollen, dass wir ihnen Auskunft geben.« Siegfried spie auf den Boden, und Luise, so sehr sie sich über seinen wiedererwachten Kampfgeist freute, zuckte angesichts dieser groben Geste zusammen. Früher war er beides gewesen: mutiger Kämpfer und Kavalier. Jetzt war er ein Kämpfer mit verrohten Gesten, aber wenigstens, dachte Luise, kämpft er wieder und badet nicht mehr nur in Selbstmitleid.
Siegfried hielt Wort. Und er hielt Stand und wich keinen Deut von seinem Vorhaben, seiner Haltung und seiner Überzeugung ab. Auch nicht, als er nach der Mittagspause auf dem Weg zur Arbeit die Krupp-Statue auf dem Marktplatz passierte und drei Männer aus dem französischen Panzer sprangen, der dort stationiert war. Groß, drohend und breit kamen sie dem humpelnden Mann entgegen. Einer zog eine Peitsche hervor und hieb damit genau auf den Stumpf. Siegfried erblasste vor Schmerz und Wut, aber er verzog keine Miene.
»Einem Mitglied der Besatzungsmacht haben Sie Platz zu machen und zu grüßen!«, bellte der französische Offizier. »Haben Sie mich verstanden?«
Siegfried hob den Blick, starrte dem Mann trotzig in die Augen und spuckte aus, wie er das schon in seiner Küche getan hatte.
Plötzlich wurde er von hinten gepackt und zu Boden geworfen. Der Offizier trat mit dem Stiefel nach ihm und schlug ihm mit der Peitsche ins Gesicht. Die Stelle brannte, aber noch heißer brannte die Scham, die in Siegfried emporstieg.
»Der Besatzungsmacht haben Sie sich zu beugen und den Befehlen Folge zu leisten!«, brüllte der Offizier mit zornrotem Gesicht.
Siegfried antwortete nicht. Auch wenn er vor Angst zitterte und einen neuen Schlag mit der Peitsche fürchtete, blieb sein Stolz doch ungebrochen.
Der Offizier trat ihm mit aller Gewalt in die Nieren und er krümmte sich vor Schmerz.
»Sie sind verhaftet!«, bellte der Franzose. »Man wird Ihnen schon noch Manieren beibringen.«
Er drehte Siegfried den Arm auf den Rücken, zog ihn zu sich herauf und führte ihn ab.
5. Kapitel
Deauville, Frankreich, 12. Januar 1923
Michelle Didier wurde ihrer Mutter, Madame Legrand, immer ähnlicher. Hatte sie früher die strengen Ansichten ihrer Mutter verurteilt und war ein freidenkender und geradliniger Mensch gewesen, so hatten die letzten Jahre sie verbittern lassen und sie zu einer ewig nörgelnden und unzufriedenen Person gemacht.
Schuld daran war sicher das Bewusstsein, dass ihr Mann Pierre sie nicht liebte und sie nur aus Mitleid geheiratet hatte. Dass er in jeder Minute, die er mit ihr zusammen verbrachte, eigentlich an diese Deutsche, diese Sophie, dachte.
Michelle war ein sehr romantisches Mädchen gewesen, das an die große Liebe glaubte, und eine ganze Zeit lang hatte sie Pierre für diese große Liebe gehalten. Aber gab es eine große Liebe ohne Gegenliebe? So hatte Michelle es sich in ihren Träumen jedenfalls nicht vorgestellt! Als Pierre ihr kurz vor seinem Heiratsantrag gestanden hatte, dass er eigentlich eine andere Frau liebe und dass er sie nur heirate, weil ihre Mutter die Verlobung schon öffentlich verkündet hatte und er ihr die Schande ersparen wolle, war sie tief verletzt gewesen und hatte den Antrag stolz abgelehnt. Sie wollte, dass er sie aus Liebe und nicht aus Mitleid heiratete.
Schließlich aber hatte sie festgestellt, dass sie ohne ihn nicht leben konnte, und sich entschlossen, den Antrag anzunehmen. Sie würde ihm eine gute Frau sein und ihn, dessen war sie sich sicher, im Lauf der Zeit dazu bringen, diese Deutsche zu vergessen und sie, Michelle, von ganzem Herzen zu lieben.
Doch Pierre vergaß Sophie nicht. Zwar sprach er nie von ihr, denn er wusste, was sich gehörte, aber Michelle spürte, dass Sophie zwischen ihr und Pierre stand und dass das vermutlich auch immer so sein würde. Sie versuchte, seine Liebe zu gewinnen, opferte sich regelrecht für ihn auf. Doch je mehr sie sich selbst aufgab, desto mehr zog er sich von ihr zurück. Und Michelle dachte verzweifelt, wie leicht es diese Sophie doch hatte. Eine Liebe, die nie über den Zustand der ersten aufregenden Phase hinauskam, ließ sich leicht glorifizieren, schließlich hatten die beiden keinen Alltag miteinander geteilt, sich nie aneinander gewöhnt. Kein Wunder, dass ihm Sophie da nur in den leuchtendsten Farben in Erinnerung geblieben war. Sie, Michelle, hingegen teilte sein Leben. Sie bemühte sich zwar immer, schön und gepflegt zu sein, aber er hatte sie nun auch mal verschwitzt gesehen, nachdem sie ihm die Kinder geboren hatte. Er sah sie hustend und krank während einer Grippe, er wusste, wie sie morgens nach dem Aufwachen aussah. Sie kam nicht auf die Idee, dass solche Momente Liebe stärken konnten. Und dass es Momente waren, die die gegenseitige Zuneigung vertieften, selbst wenn es sich nicht um die große Liebe handelte. Michelle dachte, sie müsse immer schön und gut gelaunt sein, um mit Sophie konkurrieren zu können, und sie begann, sich eine Maske zuzulegen, die das Einzige verdeckte, was Pierre an ihr gemocht hatte: ihre Natürlichkeit. Sie achtete darauf, vor ihm aufzustehen, um ihm geschminkt entgegenzutreten, und ihr Umgang miteinander wurde beherrscht von ihrem oberflächlichen, scheinbar gut gelaunten Geplauder. Was Pierre, den menschliche Tiefe anzog wie nichts anderes, immer weiter von ihr forttrieb.
Michelle war verzweifelt und sehnte sich nach dem Rat und den tröstenden Armen ihrer Mutter. Doch die Mutter war für sie unerreichbar geworden, denn Pierre und Michelle hatten unmittelbar nach ihrer Hochzeit den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen, da sie ihnen nicht verzeihen konnten, was sie ihnen angetan hatten. Sie verkündeten die Verlobung der beiden öffentlich, bevor sie selbst etwas davon wussten. Pierre, als Mann der guten Manieren, sah danach keinen anderen Weg mehr, als Michelle tatsächlich zu heiraten. Vor allem er war es gewesen, der darauf drängte, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen, denn ihn hatte man zu etwas gezwungen, was er nicht wollte. Michelle hingegen war zwar zunächst ärgerlich auf ihre Mutter gewesen, hatte sich dann aber schnell damit abgefunden, denn es brachte ihr den Mann, den sie liebte.
Als Michelle Pierre zwei Kinder geschenkt hatte, einen Jungen und ein Mädchen, dachte sie, nun müsse alles gut sein und Pierre würde sich ihr endlich ganz zuwenden.
Aber Pierre änderte sich nicht. Er liebte seine Kinder zärtlich, doch er distanzierte sich unmerklich nur noch mehr von Michelle, weil er dem Band entgehen wollte, das die Kinder automatisch zwischen ihnen knüpften. Und weil er Michelles Oberflächlichkeit nicht ertragen konnte.
Eines Tages brach Michelle zusammen. Sie konnte nicht immer nur Liebe geben, ohne auch nur das kleinste bisschen zurückzubekommen. Sie fühlte sich gedemütigt und ungeliebt, wurde hysterisch und brach beim geringsten Anlass in Tränen aus.
Pierre hielt diese ständig weinende Frau, die er nicht liebte, noch weniger aus als die, die eine Maske und ein ständiges Lächeln zur Schau trug, und floh, so oft es ging, von zu Hause. Er machte lange Spaziergänge und dachte an Sophie, seine Sophie.
Vier Jahre, nachdem sie begonnen hatte, war die Ehe zwischen Michelle und Pierre völlig am Ende.
»Geh doch zu deiner Sophie!«, keifte Michelle.
»Michelle«, sagte Pierre gereizt, »ich würde dich nie verlassen, das weißt du doch.« Es klang gelangweilt, resigniert, ein unendlich oft wiederholter Satz.
»Du hast mich schon längst verlassen.«
»Das stimmt nicht«, erwiderte Pierre und faltete ärgerlich seine Zeitung zusammen. »Ich lebe seit über vier Jahren mit und bei dir.«
Michelle ließ nicht locker. »Du weißt genau, wie ich es meine.«
Pierre schwieg, denn sie hatte recht. Aber so gesehen, hatte er sie nicht verlassen, weil er nie wirklich bei ihr gewesen war. Er hatte sich immer große Mühe gegeben, Sophie zu vergessen und sich ganz auf Michelle einzulassen, aber es wollte ihm einfach nicht gelingen.
»Siehst du«, triumphierte Michelle, »du weißt nicht, was du darauf sagen sollst, weil dir klar ist, dass ich recht habe.«
Pierre schwieg noch immer. »Ich habe dir nie etwas vorgemacht, Michelle«, sagte er schließlich leise. »Vom ersten Tag an habe ich dir gesagt, dass ich diese Frau liebe und dass ich dir nicht versprechen kann, sie je zu vergessen.«
»Oh doch, du hast mir etwas vorgemacht, Pierre.« Michelles Stimme wurde schrill. »Du hast mir erst gesagt, dass du diese andere liebst, als es schon zu spät war.«
»Jetzt mach aber mal einen Punkt!« Pierre knallte die Zeitung auf die Glasplatte des Korbtisches im Wintergarten, der eine herrliche Sicht auf den Strand von Deauville eröffnete. Die Tasse aus dem teuren Service fiel auf den harten Steinboden und zerbrach in tausend Stücke.
»Die schöne Tasse!«, rief Michelle hysterisch. »Kannst du nicht aufpassen!«
Pierre ignorierte den Vorwurf. »Für diese öffentliche Verlobung kann ich nichts«, sagte er stattdessen. »Die haben wir ganz allein deiner Mutter zu verdanken.«
»Das meine ich nicht. Ich meine die Zeit davor, bevor du wieder an die Front musstest. Du bist mit mir ausgegangen und hast mir den Hof gemacht. Ich habe mich in dich verliebt und Mutter dachte natürlich auch …«
Pierre riss der Geduldsfaden. »Willst du mir jetzt etwa auch noch die Schuld für diese Verlobung geben?«, brüllte er. »Willst du sagen, ich hätte deiner Mutter Anlass gegeben zu denken, dass wir uns über eine Überraschungsverlobung freuen würden?«
Michelle zuckte die Schultern. »Schließlich sind wir oft genug zusammen ausgegangen. Aber das meinte ich nicht, als ich sagte, es sei zu spät gewesen.«
»Was meintest du dann?«, fragte Pierre scharf.
»Ich habe es dir bereits gesagt. Du hattest mir Hoffnungen gemacht und ich hatte mich in dich verliebt.«
»Ich habe nie Anlass gegeben …«
»Oh doch.«
»Aber ich dachte damals, dass das alles ganz ungezwungen gewesen wäre. Schließlich hattest du ja selbst gesagt, dass du diese ständige Hofmacherei satthast.« Pierres Stimme klang nun leise, verzweifelt.
Michelle traten die Tränen in die Augen. Er wollte sie einfach nicht verstehen. Sie fühlte eine ungeheure Wut in sich aufsteigen. Wut auf Pierre, der sie nicht liebte, Wut auf Sophie, die an allem schuld zu sein schien, und vor allem Wut auf sich selbst, weil sie so schwach war und ihr schon wieder Tränen in den Augen standen. Sie musste sich zusammenreißen, sie würde nicht wieder vor ihm weinen. Diesmal nicht.
»Geh doch nach Deutschland«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Geh zu den Verrätern.«
»Wieso Verräter?«
»Nun, sie halten sich nicht im Mindesten an die Bedingungen des Versailler Vertrags. Mit ihren Kohlelieferungen sind sie ganz schön hinterher.«
»Sie können nicht anders, Michelle. Sie haben wahrscheinlich nichts mehr, was sie uns geben können.« Kalt fügte er hinzu: »Und seit wann interessierst du dich überhaupt für Politik? Es geht dir doch nur darum, Sophie eins auszuwischen.«
»Mein Gott, bist du gutgläubig!«, zischte Michelle. »Wahrscheinlich verherrlichst du das Land, weil deine Sophie eine Deutsche ist. Denk daran, was die Deutschen uns alles angetan haben im Krieg. Sie sind Banausen! Wilde!«
Pierre schwieg. An seiner Schläfe pochte eine Ader. Sie redet wie meine Mutter, dachte er angewidert. Ich hätte sie für klüger gehalten.
Michelle sah ihm seine Wut an und provozierte ihn bewusst. »Es ist schon ganz gut, dass unsere Truppen jetzt im Ruhrgebiet einmarschieren. Denen muss mal wieder gezeigt werden, wer hier das Sagen hat.«
Pierres Augen verengten sich. Sie weiß genau, dass mir die Besetzung des Ruhrgebietes nicht gefällt, dachte er. »Du wirst immer mehr wie deine Mutter«, sagte er kalt. »Du tust mir leid.« Damit drehte er sich um und verließ das Zimmer.
Als die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, sank Michelle auf einen der Korbsessel und ließ den lange zurückgehaltenen Tränen freien Lauf. Sie spürte, dass sie ihn nun ganz verloren hatte. Bisher hatte er sie zwar nicht geliebt, aber zumindest doch respektiert. Nun war auch das letzte bisschen Achtung verschwunden, und Michelle hatte niemanden mehr. Sie war ganz alleine auf der Welt.
6. Kapitel
Essen, Ruhrgebiet, 12. – 20. Januar 1923
Sie sperrten Siegfried in eine Zelle, in die bereits viele andere Männer eingesperrt waren, und ohne es zu wissen, hatte er die gleiche Empfindung wie seine Frau am Tag zuvor: dass die Luft brannte. Auch hier schlug die Empörung wellenartig hoch über den Köpfen der Inhaftierten zusammen, man badete darin, fühlte Patriotismus, Zusammengehörigkeit. Die meisten Männer waren wegen ähnlicher Vorkommnisse wie Siegfried festgenommen worden. Unter den Gefangenen waren auch viele höhere Beamte und Offiziere, die sich französischen Befehlen widersetzt hatten. Aufgeregt empfingen sie Siegfried, fragten ihn aus, was er denn getan habe, und nachdem er Bericht erstattet hatte, streckte ihm einer, der sich als Hannes Meinchen vorstellte, die Hand entgegen. »Freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte er. »Ich habe ein Hotel und mich selbstverständlich geweigert, einen französischen Offizier zu bedienen. Der meinte doch tatsächlich, er würde bei mir einen Kaffee bekommen.« Er lachte laut und siegesgewiss.
Siegfried grinste zurück. Der Mann wirkte distinguiert und selbstbewusst. Natürlich bediente er keinen französischen Offizier! Sicherlich war er hocherhobenen Hauptes in das Gefängnis geschritten und hatte nicht, wie Siegfried mit seinem Stummelbein, Mühe gehabt, das Gleichgewicht zu halten, um ihnen wenigstens diesen Triumph nicht zu gönnen: ihn stolpern und fallen zu sehen. Verschämt schob Siegfried sein gesundes Bein vor den Stumpf. Hannes Meinchen mit seinen wachen Augen bemerkte es sofort und deutete mit dem Kinn darauf. »Kriegsverletzung, nicht wahr?«
Siegfried zuckte zusammen. Es war lange her, dass ihn jemand auf sein fehlendes Bein angesprochen hatte. In der Familie schwieg man das Thema tot, weil man wusste, wie empfindlich Siegfried darauf reagierte. Das Totschweigen aber war für ihn nur ein weiterer Beweis dafür, dass sie ihn für seine Verstümmelung verachteten, ihn als Versager ansahen. Das Trauma saß tief und war an den Rändern verhärtet, hatte Schorf angesetzt, niemand, schon gar nicht die Familie, war in der Lage, diese Ränder, diesen Schorf zu durchdringen. Und keiner merkte, dass eben nur die Ränder des Traumas verhärtet waren und Siegfried innerlich stark blutete. Und blutete. Und blutete, ja drohte, in der Flut des Blutes zu ertrinken.
Und nun kam Hannes Meinchen einfach daher und sprach ihn darauf an. Als wäre es die normalste Sache der Welt. Siegfried wurde rot und warf hastig einen Blick in die Runde, es war ihm peinlich, dass der Hotelier so deutlich darauf hingewiesen hatte. Doch keiner beachtete sie. Die anderen hatten ihre Gespräche längst wieder aufgenommen, niemand zeigte mehr Interesse an dem Neuzugang.
Hannes Meinchen war ein kluger Mann. Mit einem Blick erkannte er Siegfrieds Dilemma. »Sie sind ein Held«, sagte er leise. »Ein wahrer Held.«
Siegfried hob den flackernden Blick, sah Meinchen zaghaft ins Gesicht. Der nickte bekräftigend. »Ich meine das sehr ernst«, erklärte er und setzte sich auf eine der schmalen Pritschen. Siegfried ließ sich neben ihm nieder, dankbar, nicht der Erste zu sein, der sich setzte und damit seine Schwäche eingestand. Dass Meinchen so weit in ihn hineinblicken konnte, dass er auch das begriff und aus diesem Grund als Erster Platz genommen hatte, ahnte er nicht.
»Sie sind ein Held«, wiederholte Hannes Meinchen. »Nicht nur, weil Sie Ihr Bein im Krieg verloren, es geopfert haben für das Vaterland. Sondern auch, weil Sie dem Besatzer Widerstand geleistet haben. Wie wir alle hier.« Er machte eine vage Bewegung in den Raum, wo sich die anderen Gefangenen inzwischen ebenfalls auf den Pritschen niedergelassen hatten und die Ereignisse weiterhin eifrig diskutierten.
Meinchen wandte sich wieder zu Siegfried um und starrte ihm in die Augen. »Wer ein Held ist, hat Verantwortung«, erklärte er, »Verantwortung für unser Vaterland.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Siegfried. Ein klitzekleines Bläschen platzte in seinem Unterbewusstsein und setzte eine bittere Warnung frei. Doch die Warnung stieg nur als winzige Ahnung bis in sein Bewusstsein empor, er beachtete sie nicht, weil das, was er hier hörte, aufregend war. Weil es ihm eine Bedeutung gab. Weil es Balsam für die Wunden war, die nun schon seit Jahren einfach nicht heilen wollten.
Hannes Meinchen, der Kluge, wusste genau, was in Siegfried vorging. Die, die ihn gut kannten, sagten, er besitze ein außergewöhnliches psychologisches Gespür. Und sie sagten, dass er es verstehe, sein Gegenüber innerhalb kürzester Zeit intuitiv zu erfassen und es besser zu verstehen als der Betreffende sich selbst.
»Was machen Sie beruflich, Herr Seiler?«, fragte er höflich, obwohl er es wusste. Die Kleidung wies Siegfried ganz deutlich als Arbeiter der Krupp-Werke aus.
»Ich arbeite bei den Krupp-Werken«, sagte der auch erwartungsgemäß.
Hannes Meinchen nickte sehr langsam und sehr bedeutungsvoll.
»Kündigen Sie!«
»Wie bitte?«, Siegfried starrte ihn an.
»Sie verschleudern doch Ihre Fähigkeiten!« Meinchen musterte ihn eindringlich. »Ein Mann wie Sie ist doch kein Arbeiter! Sie sind ein gebildeter Mann, ein Offizier, das sehe ich Ihnen doch an.«
Hier pokerte Meinchen. Er wusste nicht, ob Siegfried tatsächlich aus gutem Hause war, vermutete es nur anhand seiner völlig dialektfreien Sprache. Aber selbst wenn er sich täuschen sollte, würden diese Worte das zerstörte Selbstbewusstsein dieses Mannes ungemein stärken. Und darauf kam es am Ende an.
»Da haben Sie recht«, bestätigte Siegfried. Und fügte dann, zutiefst geschmeichelt, hinzu: »Ich hätte nicht gedacht, dass man mir das so deutlich anmerkt.«
»Aber ich bitte Sie!«, rief Meinchen. »Das merkt man sofort! Darf ich fragen, was Sie gemacht haben, bevor Sie hierherkamen?«
»Nun«, erwiderte Siegfried, »nach meiner … Verwundung konnte ich nicht mehr ins Feld und da habe ich in Konstanz die Textilfirma meines Schwagers geleitet. Und als er aus dem Krieg zurückkam, bin ich … ich bin aus freien Stücken gegangen.«
Er brauchte nichts mehr hinzuzufügen. Hannes Meinchen begriff auch so, dass Siegfried nach der Rückkehr des Schwagers nicht hatte bleiben wollen, weil er sich dann wie ein Bittsteller vorgekommen wäre.
Meinchen nickte. »Männer wie Sie kann ich in meinem Hotel gut gebrauchen«, sagte er. »Ich suche einen Geschäftsführer.«
»Meinen Sie das ernst?« Siegfried dachte an Luise. Wenn das wahr würde, dann könnte sie endlich einmal wieder stolz auf ihn sein. Auf ihn, ihren Mann.
»Aber natürlich meine ich das ernst. Männer wie Sie sind viel zu wichtig, als dass sie ihre Kraft in Produktionshallen vergeuden dürften.« Meinchen schnaubte. »So schnell wie möglich fangen Sie bei mir an«, bestimmte er.
Siegfried strahlte. In seinem Glück merkte er nicht einmal, dass er gar nicht gefragt worden war.
»Noch was«, sagte Meinchen.
»Ja?«
»Wir müssen dafür sorgen, dass die Franzosen verschwinden. Auch dafür brauchen wir Männer wie Sie.«
»Ich werde weiterkämpfen«, versprach Siegfried entschlossen.
»Gut«, befand Meinchen. »Es gibt viel zu tun. Denn leider denken nicht alle so wie Sie. Es gibt Spitzel, die mit den Franzosen gemeinsame Sache machen. Und die müssen wir finden.«
Als Fritz Thyssen am 20. Januar verhaftet wurde, weil er sich der Anordnung widersetzte, der französischen Besatzungsbehörde Kohle zu liefern, war Siegfried schon wieder auf freiem Fuß. Es war der Tag, an dem er kündigen wollte. Er saß gerade bei Meinchen in dessen feinem Büro, als sie von der Verhaftung erfuhren. »Ich kann jetzt nicht kündigen«, sagte Siegfried. »Es würde wie ein Verrat wirken. Sie würden denken, ich sei aufseiten der Franzosen. Ich muss doch zu ihnen stehen.«
Meinchen sah ihn aufmerksam an und tippte mit seinem Füllfederhalter ungeduldig auf das Blatt Papier, das vor ihm lag. Tinte spritzte und hinterließ hässliche schwarze Flecken auf dem Dokument. Meinchen bemerkte es nicht, er hatte Siegfried fest im Visier. »Sie sind ein kluger Mann, Seiler, das hat mir schon von Anfang an an Ihnen gefallen. Und Sie haben recht, Sie können nicht kündigen. Sie bleiben dort. Und beobachten Ihre Leute. Wir müssen die undichten Stellen finden. Sie haben eine äußerst wichtige Rolle inne, Seiler.«
Obwohl er es selbst vorgeschlagen hatte, fühlte Siegfried Enttäuschung in sich aufsteigen. Er hatte Luise schon von seinem neuen Posten erzählt. Und auch davon, dass sie in eine neue Wohnung umziehen würden. Er hatte das Leuchten der Bewunderung in ihren Augen gesehen. Und nun sollte er ihr sagen müssen, dass er doch ein einfacher Arbeiter blieb?
Meinchen ahnte, was der Grund für die finstere Miene des anderen war. »Das Stellenangebot steht«, beruhigte er. »Und in die neue Wohnung können Sie gleich einziehen. Ich muss Sie nur bitten, das unauffällig zu tun und mit niemandem darüber zu sprechen. Wir müssen alles vermeiden, was Verdacht erregt. Die Sache ist zu wichtig, als dass wir irgendetwas riskieren könnten.«
»Selbstverständlich«, versicherte Siegfried erleichtert.
»Gut.« Endlich bemerkte Meinchen das Gekleckse auf seinem Blatt und legte den Füllfederhalter mit einer verärgerten Bewegung rasch beiseite.
»Sie begreifen doch, dass der Posten, den Sie bekleiden, im Moment viel wichtiger ist als der des Geschäftsführers? So dringend ich Sie hier sofort brauchen könnte?«
Siegfried nickte.
»Gut«, wiederholte Meinchen. »Dann lassen Sie uns ans Werk gehen.«
7. Kapitel
Überlingen, Bodensee, 20. Januar 1923
Die Wellen des Franzosenhasses schlugen hoch, nicht nur im Ruhrgebiet. Die Flaggen standen im ganzen Reich auf Halbmast, der Protest war lang schon zu einem nationalen Anliegen geworden.
Am 13. Januar hatte die Reichsregierung im Reichstag den passiven Widerstand verkündet. Alle Reparationsleistungen an Frankreich und Belgien wurden eingestellt, und die deutschen Behörden und Zechenbesitzer erhielten strikte Anweisung, den Besatzungsmächten jegliche Zusammenarbeit und Unterstützung zu verweigern. Die Folge: Die komplette Industrie lag brach. Wieder und wieder kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Franzosen und Deutschen. »Gestern sollen die Franzosen auch in Bochum eingerückt sein. Aber die haben’s ihnen gezeigt!«, verkündete Elsa Kleinschmitt beim wöchentlichen Nähkränzchen im Alten Schulhaus, während sie mit der ihr eigenen Vehemenz auf das zu bestickende Deckchen einstach, das auf ihren Knien lag. »Das haben die sich nicht gefallen lassen, die Bochumer. Sie haben gesungen: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen. Jawohl!« Zufrieden biss sie ein Stück Faden ab, eine Geste, mit der sie das Gesagte zu bekräftigen pflegte. Doch es war weniger diese altbekannte Geste als vielmehr Elsas Aussage, die Johanna reizte.
»Ich finde dieses Siegeslied viel unbedeutender als die Tatsache, dass ein 17-jähriger Schüler ums Leben kam, als die Franzosen in die Menge schossen«, wendete sie ein.
»Ja«, ließ sich Johannas Mutter Helene vernehmen und fügte mit einem spitzen Blick auf ihre Schwester Sophie betont laut hinzu: »Und von Luise höre ich, dass sie in Essen einer jungen Frau die Haare abgeschnitten haben. Sie ist selbst schuld, mit zwei Franzosen soll sie im Kino gesehen worden sein.«
Sophie warf ihr einen bösen Blick zu, pfefferte ihr Nähzeug in den Korb und verließ das Zimmer. »Also Mutter, wirklich«, sagte Johanna gereizt. »Kaum bist du mal zu Besuch, machst du Ärger. Musste das sein?« Sie legte ihr Nähzeug ebenfalls in den Korb und folgte ihrer Tante.
Elsa hatte die Auseinandersetzung mit großem Interesse verfolgt. »Was war denn das?«, fragte sie voll lüsterner Neugierde.
Helene seufzte, als sie die Nadel in den brüchigen Stoff steckte. Sie genoss es, die Wissende zu sein, diejenige, die Neugier befriedigen durfte. Sie hielt keine Stickerei in der Hand, sondern änderte alte Kleidungsstücke. Daraus ein Kleid nach der neuesten Mode zu machen, war schier unmöglich. Man trug jetzt zweckmäßige Kleidung aus robusten und haltbaren Stoffen. Der Krieg hatte seinen Tribut gefordert, die Reparationszahlungen ließen, auch wenn sie jetzt auf Anweisung der Regierung eingestellt waren, nicht viel Raum für feines Material. Aber Helene dachte an die Kleider, die in ihren Modezeitschriften abgebildet waren, die die Frauen wenigstens träumen ließen, wenn die Realität sie ihnen schon aberkannte. Wunderbar bestickte Seidenroben in den herrlichsten Farben. Diamantcolliers und – wie mondän, wie verwerflich – tiefrot geschminkte Lippen. Dieserart würde sich Helene freilich nie herausputzen. Sie wusste schließlich, was sich gehörte.
Helene verachtete diese neue Frau – sie fand sie ungehörig. Aber gleichzeitig und ganz heimlich träumte sie davon, auch einmal so verrucht zu sein. Und vor allem: sich so etwas leisten zu können, so wie früher. Bevor ihnen der Krieg alles genommen hatte. Bevor diese schreckliche Inflation eingesetzt und das Wenige, was ihnen noch geblieben war, auch noch zerstört hatte. Justus, ihr Gatte, verdiente zwar im Vergleich zu anderen Männern nicht schlecht mit seiner Textilfabrik – und vor allem war er nicht arbeitslos wie so viele andere –, aber zu großem Wohlstand reichte es keineswegs. Im Gegenteil. Wenn er Geld nach Hause brachte, musste das Mädchen sofort einkaufen gehen, denn wenig später war die Mark schon wieder so weit entwertet, dass sie nichts mehr dafür bekamen. Und davon, so wie früher, in seiner Firma schöne Stoffe und Kleider zu produzieren, war Justus auch weit entfernt.
»Ich muss schon sagen, meine Liebe«, riss Elsa Kleinschmitt sie aus ihren Träumereien, »dass ich es sehr genieße, wieder einmal mit Ihnen beisammensitzen zu können. Es ist fast wie damals im Krieg!« Sie schnaubte leicht und wagte dann einen neuen Vorstoß: »Wenn ich auch anmerken muss, dass ich das abrupte Verschwinden Ihrer Tochter und Ihrer Schwester äußerst befremdlich und unhöflich finde.«
Helene errötete leicht, die offen bekundete Zuneigung Elsa Kleinschmitts machte sie verlegen. Zugleich genoss sie das Spiel, das sie miteinander spielten. Sie wusste, wie sehr Elsa auf eine Erklärung brannte, und Elsa wusste wiederum, dass sie, Helene, darauf brannte, ihr alles zu erzählen. Dass man sich jedoch zuvor noch umkreisen und umschmeicheln musste, gehörte zum guten Ton. Übertrieben konzentriert wandte Helene sich der Arbeit in ihren Händen zu. »Nun ja«, begann sie schließlich. »Ich muss zugeben, dass mir das Zusammensein mit Ihnen und den anderen Damen auch sehr fehlt. Das Leben in Konstanz ist doch oft recht einsam. Und die Kriegsjahre, die wir miteinander hier in Überlingen verbracht haben, haben uns einfach aneinandergeschmiedet. Finden Sie nicht?«
Elsa Kleinschmitt legte ihre Handarbeit zur Seite und musterte Helene bedauernd über den Rand ihrer Brille hinweg. »Sie sollten öfter nach Überlingen kommen«, schlug sie vor. »Wir könnten uns regelmäßig zum Nähen treffen. Jetzt, wo wir die Franzosen im Ruhrgebiet haben, wird es wohl auf längere Sicht nichts werden mit neuen Kleidern. Das Elend wird nur noch größer, glauben Sie mir.«
»Ich weiß nicht, ob ich mich noch trauen kann, hierherzukommen«, lenkte Helene das Gespräch nun endlich geschickt auf das Thema, das sie schon die ganze Zeit über hatte anschneiden wollen. Sie musste einfach darüber sprechen.
Elsa war auch sofort hellwach: »Was meinen Sie?« Ihre Augen leuchteten sensationslüstern.
»Ich sollte ja eigentlich nicht darüber sprechen«, zierte sich Helene.
Elsa beugte sich vor. »Meine Liebe«, raunte sie. »Sie wissen, dass Sie sich mir jederzeit anvertrauen können.«
Helene seufzte. »Es wird mich erleichtern. Ich kann diese Last nicht mehr alleine tragen.« Sie legte die Hand mit einer übertriebenen Geste an ihr Herz.
Elsa zitterte vor Spannung.
»Da ist diese Sache mit meiner Schwester und diesem Franzosen.« Helene presste die Worte hervor.
Elsas Nasenflügel begannen zu beben. Sophie und ein Franzose! Das war ja die Höhe!
»Sie wollen doch nicht etwa sagen …«
Helene schluckte. Jetzt, da sie es ausgesprochen hatte, hätte sie ihre Worte am liebsten zurückgenommen. Aber nun war es zu spät. »Diese Geschichte liegt lange zurück«, sagte sie rasch. »Vor dem Krieg war Sophie doch verlobt, erinnern Sie sich?«
»Natürlich«, erwiderte Elsa, »mit dem Vater von Raphael, der dann im Krieg gefallen ist.«
»Dieser Mann«, verkündete Helene und genoss es nun doch, mit der Neuigkeit herauszurücken, »ist ein Franzose. Und soweit wir wissen, ist er im Krieg nicht gefallen, sondern er lebt.«
»Nein!«, Elsa Kleinschmitt schlug sich die Hand vor den Mund und machte große Augen. »Das ist ja unglaublich!«
»Nicht wahr?«, jammerte Helene. »Sie verstehen doch sicher, dass ich über diese Sache einfach sprechen musste. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie sehr mich die Angelegenheit belastet hat.«
Elsa sah sie in einer Mischung aus Mitgefühl und Sensationslust an. Nicht auszudenken, wenn das herauskäme! Sie beugte sich vor und legte ihre Hand auf die der anderen. »Sie haben mein tiefstes Mitgefühl«, erklärte sie. Nach kurzem Zögern fügte sie hinzu: »Ich finde es äußerst egoistisch von Ihrer Schwester, dass sie keinerlei Rücksicht genommen hat. Sie hätte sich doch denken können, was sie ihrem Umfeld damit antut.«
»Danke«, seufzte Helene. Dann sah sie Elsa ängstlich an. »Ich kann mich doch auf Ihre Diskretion verlassen?«
»Aber meine Liebe!«, versicherte Elsa empört. »Natürlich! Sie kennen mich doch!«
Deswegen frage ich mich ja, ob es ein Fehler war, mich Ihnen anzuvertrauen, dachte Helene. Ihre Befürchtungen waren nicht ganz unberechtigt. Sie sollte noch bitter bereuen, dass sie Sophies Geheimnis ausgeplaudert hatte.
8. Kapitel
Überlingen, Bodensee, 20. Januar 1923
Johanna ging wie ein gefangener Tiger in ihrem Zimmer auf und ab, während sie sich mit der Hand unermüdlich über ihren dicken Bauch strich.
»Wenn du nur endlich geboren werden würdest«, flüsterte sie dem Kind in ihrem Leib zu. »Vielleicht wäre dann diese schreckliche Unruhe weg.« Aber sie wusste: Es lag nicht nur an ihrer Schwangerschaft, dass sie so unzufrieden war. Ich bin noch so jung, dachte sie manchmal wütend, und dennoch scheint mein Leben schon vorbei zu sein. Ich sitze als Frau Pastor hier in dieser Stadt, in der sich nie etwas ändert. Und Sebastian hat über seiner Arbeit als Pfarrer völlig vergessen, dass es mich gibt.
Beinahe freute sie sich, dass die Franzosen im Ruhrgebiet einmarschiert waren, auch wenn sie diesen Gedanken natürlich nie zugegeben hätte. Aber es bot zumindest etwas Abwechslung in der Eintönigkeit ihres Lebens.
Ein nagendes Hungergefühl riss sie aus ihren Gedanken. Sie presste die Hand auf den Bauch und dachte an das Kind. Ob es ihren Hunger spürte? Ob es darunter litt? Immer dieser Hunger! Sie war es so leid!
Wenn nur Amalia, ihre Großmutter, noch leben würde! Die hätte schon gewusst, was zu tun wäre. Amalia hatte immer einen Rat gehabt. Sie hätte notfalls die Gärten des Alten Schulhauses umgegraben und Gemüse angebaut. Sie hätte Hühner angeschafft, auch wenn diese noch so schwer zu bekommen waren, und sie hätte dafür gesorgt, dass niemand hungern musste.
Mit einem Mal schämte sich Johanna. Da klagte sie über Hunger und Langeweile und trauerte ihrer Großmutter nach, statt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen! Sie hatte doch genau die gleichen Möglichkeiten wie Amalia! Und noch mehr, denn sie war viel jünger als ihre Großmutter es in den Kriegsjahren gewesen war.
Sie lächelte zufrieden und plötzlich voller Tatendrang. »Sobald du geboren bist«, flüsterte sie ihrem Kind zu, »werde ich mich an die Arbeit machen.«
9. Kapitel
Petrograd, Russland, 21. Januar 1923
Irina hatte den Bürgerkrieg überlebt. Äußerlich zumindest. Innerlich war sie beinah daran zerbrochen und heimatloser und haltloser als je zuvor. Sie hatte die Kriegsjahre auf dem Land verbracht, bei ihren Eltern, die Bauern waren. Und ihr Glaube an den von ihr einst so bewunderten Lenin war zutiefst erschüttert worden. Der Grund für den Umzug zu ihren Eltern waren die Hyperinflation und der damit einhergehende Hunger in der Großstadt gewesen – den Lenin zu verantworten hatte. Sein Plan war es gewesen, Geld als Zahlungsmittel quasi abzuschaffen – was jedoch nicht einfach per Dekret durchgesetzt werden konnte. Also ließ die Regierung Geld drucken, was bis zum Jahr 1922 zu einer Hyperinflation führte. Unternehmer wurden enteignet, ihr Vermögen verstaatlicht.
Es hatte lang gedauert, bis Irina begann, Lenins Methoden anzuzweifeln. Als glühende Bewunderin hinterfragte sie erst spät, ließ die Seiten, die ihr nicht gefielen, außer Acht, erhob das Positive zur Heldentat. Die Bildungspolitik zum Beispiel: Verpflichtete Lenin nicht Analphabeten, den Unterricht zu besuchen? Richtete er nicht Bibliotheken ein, um dem breiten Volk den Zugang zu Büchern zu ermöglichen? War es durch ihn nicht auch der ärmeren Bevölkerung möglich, Hochschulbildung zu erfahren? All das hob Irina hervor und wollte nicht sehen, dass Lenin den Roten Terror im Bürgerkrieg förderte und Konzentrationslager einrichten ließ. Sie wiederholte seine Worte, der Rote Terror sei nur eine Antwort auf den Weißen Terror der Gegner und der Terror sei ihnen durch die Interventionen der kapitalistischen Staaten aufgezwungen worden.
Doch irgendwann hatte Irina so sehr hungern müssen, dass sie zu ihren Eltern aufs Land floh. Und da lernte sie Lenin von einer ganz anderen Seite kennen. Plötzlich schämte sie sich vor ihren Eltern, die ihr Leben lang hart gearbeitet hatten, dafür, eine Bolschewikin zu sein. Denn die Bolschewiki verlangten von den Bauern, ihre Ernte billig an den Staat abzugeben. Irina wurde Zeugin der Wut ihrer Eltern, wurde Zeugin, als Lenins Truppen gegen den Widerstand der Bauern mit Waffengewalt vorgingen und zahlreiche Menschen starben. Sie wurde Zeugin der unendlichen Trauer in dem Dorf, in dem ihre Eltern lebten. Und sie dachte verwundert, dass das ja genau die gleiche Wut war wie die, die sich damals gegen den Zaren gerichtet hatte. Sie hatte gedacht, die Bolschewiki kämpften für Gerechtigkeit. Für Frieden, Land und Brot. Wie hatte sie sich doch getäuscht! Abend für Abend hörte sie sich die Wut ihres Vaters an, erlebte, wie er seine Anbauflächen verkleinerte, damit sie ihm weniger wegnehmen konnten. Doch die Regierung richtete Parteikomitees ein, die die Bauern zur Aussaat zwangen. Die Bauern tobten, revoltierten – und töteten ihre Peiniger. Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1920 brach die Regierung den Widerstand: Sie erschoss die Konterrevolutionäre, rund 50.000 Bauern landeten in den Konzentrationslagern von Tambow, und die Rote Armee setzte Gasbomben ein, um die Aufständischen, die sich in den Sümpfen versteckt hielten, auszuräuchern. Irina hatte mit ihrer Mutter in diesen Sümpfen gesessen, ihren Vater hatte man schon vor langer Zeit ins Konzentrationslager verschleppt. Als die Mutter über Umwege die Nachricht erreichte, der Vater sei zu Tode gefoltert worden, starb sie wenige Monate später vor Kummer. Irina hielt ihre Hand, als sie den letzten Atemzug tat – und sie fühlte sich vollkommen leer, als sie ihrer Mutter sanft über das Gesicht strich und ihr für immer die Augen schloss. Ihre Eltern gehörten zu den unzähligen Opfern des Bürgerkrieges, die nicht erfasst wurden. Erfasst waren nur die rund 770.000 gefallenen Soldaten.
Es dauerte ein Jahr, bis Irina weinen konnte. Wie erstarrt ging sie nach Petrograd zurück, erzählte der Oberschwester in dem Krankenhaus, in dem sie vor ihrer Flucht aufs Land gearbeitet hatte, emotionslos, was geschehen war, ließ sich in ihre mitfühlende Umarmung ziehen und verharrte dort für Minuten. Danach nahm sie ihre Arbeit wieder auf.
Über zwei Jahre war das nun her, und langsam, ganz langsam regte sich in Irina wieder so etwas wie Leben. Immer öfter dachte sie an ihre deutschen Freunde. Johanna und Luise, denen sie damals im Krieg bei der Flucht aus Russland geholfen hatte. Und Karl, ebenfalls ein deutscher Flüchtling. Karl hatte sie wirklich geliebt. Sie hatte ihn verlassen, weil sie glaubte, in Russland gebraucht zu werden, ihrem Land, Lenin, etwas schuldig zu sein. Wie dumm war sie doch gewesen!
10. Kapitel
Überlingen, Bodensee, 23. Januar 1923
Sophie hatte Angst. Sie war mit Raphael alleine im Haus. Ihr Vater, der Schuldirektor, hielt sich noch in der Schule auf, Helene war wieder nach Konstanz gefahren, und Johanna und Sebastian hatten sie begleitet. Johanna wollte mit ihrer Mutter die Säuglingsausstattung ansehen, die sie nach der Geburt ihres Sohnes Robert im elterlichen Haus eingelagert hatte. Sophie nahm mit ihrem Sohn ein karges Abendmahl ein und schickte ihn dann ins Bett. Die ganze Zeit über wurde sie das Gefühl eines drohenden Unheils nicht los.
Bewegte sich dort im Garten nicht etwas? Waren da nicht Stimmen zu hören?
Sie ging unruhig im Haus auf und ab und knipste alle Lichter an, umklammerte das Notizbüchlein – in dem verzweifelten Versuch, die Angst zu vertreiben. Dann spähte sie vorsichtig durch die kleine Scheibe in der Haustür in den Garten hinaus. Unzählige Schatten schlichen dort herum, dessen war sie sich jetzt ganz sicher, und sie spürte, wie sich ihr die Kehle zuschnürte. Ich stelle mich schon an wie Helene!, schalt sie sich. Was ist nur mit mir los?
Sie zwang sich, zurück ins Wohnzimmer zu gehen, und setzte sich aufs Sofa.
Als sie ein Geräusch an der Tür hörte, schreckte sie hoch. Aber es war nur ihr Sohn, der dort stand.
»Raphael, was ist los?« Sie hoffte, dass er ihre Aufregung nicht bemerken, den hysterischen Klang ihrer Stimme nicht wahrnehmen würde. »Warum bist du nicht im Bett?«
»Ich konnte nicht schlafen, Mutter«, flüsterte Raphael schüchtern und schlang seine kleinen Hände fest ineinander, als wolle er sich selbst Halt geben. »Ich habe so ein komisches Gefühl … ich … ich fürchte mich.«
Sophie holte tief Luft. Ihr Sohn spürte es also auch. Oder waren es lediglich ihre eigene Angst und Unruhe, die sich auf den Jungen übertrugen?
Sie klopfte neben sich aufs Sofa. »Du musst dich nicht fürchten, mein Schatz«, sagte sie fest. »Komm her, setz dich zu mir.«
Raphael, erleichtert, dass sie ihn nicht mit scharfen Worten wieder ins Bett geschickt hatte, ging durchs Wohnzimmer und nahm neben seiner Mutter Platz.
Sophie legte ihre Arme um ihn und zog ihn an sich. Auch ihr war wohler dabei, nicht alleine zu sein.
»Es kommt dir nur komisch vor, dass all die anderen nicht da sind«, erklärte sie. »In einem Haus, in dem sonst immer so viele Menschen sind, ist es einem nun mal unheimlich, wenn man allein ist. Vor allem nachts.«
Raphael nickte und kuschelte sich tiefer in Sophies Arme. »Jetzt habe ich schon gar keine Angst mehr, Mutter«, sagte er glücklich. »Jetzt, wo ich bei dir bin.«
Wenig später war er eingeschlafen.