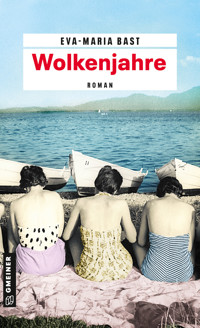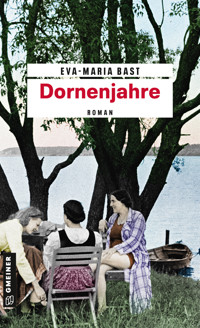Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jahrhundert-Saga
- Sprache: Deutsch
Revolutionen, Unruhen, der Vietnamkrieg, Hippies und ein Café: 1968 ist ein Jahr der Gegensätze. Während sich Karl nach seiner geglückten Flucht aus der DDR in die hübsche Revolutionärin Anni verliebt, ist Melissa am Bodensee damit beschäftigt, ihr Elternhaus in ein Café umzuwandeln. Auch Susanne in Amerika und Sophie in Paris erleben stürmische Zeiten: Die Morde an Martin Luther King und Robert Kennedy sowie die Maiunruhen lassen sie einfach nicht zur Ruhe kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva-Maria Bast
Margeritenjahre
Fünfter Teil der Jahrhundert-Saga
Zum Buch
Zeit des Umbruchs Revolutionen, Unruhen, der Vietnamkrieg, Blumenkinder, Hippies und ein Café: 1968 ist ein Jahr der Gegensätze. Während sich Karl nach seiner geglückten Flucht aus der DDR in die hübsche Revolutionärin Anni verliebt, ist Melissa am Bodensee damit beschäftigt, ihr Elternhaus in ein Café umzuwandeln. Inspiration dazu findet sie in einer Pariser Eisdiele. Ihr Gatte, der der Hippie-Bewegung nahesteht, geht der jungen Unternehmerin dabei gehörig auf die Nerven. Unterstützung bekommt sie von Karls Ziehbruder Otto: Der Architekt ist seinerseits auf der Flucht – vor seiner anspruchsvollen Ehefrau, die sich für einen Kinostar hält, und vor seiner Vergangenheit als elternloses Wolfskind, die er nie verarbeitet hat. Auch Susanne in Amerika und Sophie in Paris erleben stürmische Zeiten: Die Morde an Martin Luther King und Robert Kennedy sowie die Maiunruhen lassen sie einfach nicht zur Ruhe kommen.
Eva-Maria Bast wurde 1978 in München geboren, arbeitet seit 1996 als Journalistin und ist Leiterin der »Bast Medien GmbH«. Für ihre Arbeit wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt Eva-Maria Bast dreimal den »Oscar« der Zeitungsbranche, den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seit 2016 ist Eva-Maria Bast Dozentin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Sie lebt mit ihrer Familie in Überlingen am Bodensee und in Würzburg.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Oscar Poss
ISBN 978-3-8392-6638-0
Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt der fünfte Band meiner Mondjahre-Jahrhundertsaga. Viel hat sich seit Teil 1, der im Ersten Weltkrieg spielt, getan und nicht alle von Ihnen werden die ersten vier Bände kennen. Deshalb habe ich für Sie eine Zusammenfassung geschrieben, die Sie am Ende des Buches finden.
Herzlichst, Ihre
Eva-Maria Bast
1967 – 1968
1. Kapitel
Ost-Berlin, Anfang November 1967
Kalt kroch der Nebel über den frostigen Herbstboden, eine weiße wabernde Masse, die ihre Klauen nach ihnen ausstreckte, dachte Karl unbehaglich und schauderte leicht. Im grellen Licht der Scheinwerfer, die die Mauer anstrahlten, wurde der Nebel zu einer weißen Wand, einer zweiten Mauer. Die Kalaschnikow in seiner Hand wog schwer, die Uniform war ihm am Hals wieder einmal zu eng, und er hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.
»Heute Abend geht uns einer ins Netz, dit hab ich im Urin«, sagte Martin, der mit ihm an der Grenze entlang patrouillierte, und rieb sich die Hände. »Dann kommt die hier endlich mal zum Einsatz.« Er hob seine Waffe an und grinste breit. Karl verzog angewidert den Mund. Menschen wie Martin waren es, die ihn immer mehr an dem Staat zweifeln ließen, dem er hier diente. Dabei war er so stolz gewesen, im vergangenen Jahr seine Ausbildung im Herrenhaus der Stintenburg abgeschlossen zu haben und nun als Berufsunteroffizier im Einsatz zu sein. Endlich konnte er dazu beitragen, seine Heimat vor dem Klassenfeind zu schützen, das Land, das ihn, seinen Bruder Heinz und seine Ziehgeschwister mit offenen Armen aufgenommen hatte, nachdem seine beiden Ziehmütter Irina und Annemarie mit ihnen aus Ostpreußens Wäldern geflohen waren. Seine Ausrüstung, Doppelbewaffnung mit Maschinenpistole und Pistole und die kleine Harke zum Verwischen von Spuren, trug er mit Stolz.
Dass die Grenzen geschützt werden mussten, das war für Karl in dem Moment klar gewesen, als Otto, sein großes Idol, sein Bruder – wenn auch nicht sein leiblicher – sein Halt und seine Stütze, vor sechs Jahren, kurz nach dem Bau der Mauer, aus dem Fenster eines Hauses an der Zonengrenze in den Westen gesprungen war und ihn allein zurückgelassen hatte. Nun gut, gestand er sich inzwischen ein, allein war er ja nicht gewesen, da waren noch Irina und Annemarie und all seine Ziehgeschwister. Aber dennoch hatte er sich im Stich gelassen gefühlt, und die Wut, die er auf seinen Bruder empfunden hatte, war lähmend gewesen. Zumal im Anschluss an Ottos Flucht eine unangenehme Zeit begonnen hatte. Annemarie war für mehrere Monate verschwunden und vollkommen gebrochen wiedergekehrt. Irina hatte sich auf diffuse Weise verändert.
Ja, es war eine schwere Zeit gewesen, in der Karl das Gefühl gehabt hatte, jegliche zuvor mühsam errungene Stabilität verloren zu haben.
Seine Berufswahl hatte ihm diese Beständigkeit und diese Sicherheit zurückgegeben. Doch je besser er das System von innen kennenlernte, desto mehr missfiel es ihm. Vor allem, weil er es tagtäglich mit Menschen wie diesem Martin aushalten musste.
Der Hund schlug an und riss ihn aus seinen düsteren Gedanken. Im nächsten Moment begann das Tier, Witterung aufzunehmen, stob in Richtung Westen davon und zog den verdutzten Karl hinter sich her.
»Hab ich’s doch gesagt«, freute sich Martin und setzte sich keuchend in Bewegung. »Komm.«
Sie befanden sich in dem Bereich zwischen den beiden Grenzzäunen, rechts von ihnen verlief das »Spargelbrett«, ein Feld mit riesigen Nägeln, und der Signalzaun, der im Wachturm Alarm auslöste, sobald diesen jemand berührte.
Karl schluckte. Um seinen Kopf fühlte er ein eisernes Band, das sich immer mehr zuzog, ein Phänomen, das er von seiner Kindheit an kannte und das stets bevorstehendes Unheil ankündigte. »Wenn es wirklich ernst ist, sind die Kollegen ohnehin gleich da«, sagte er schwach.
Sein Kamerad warf ihm einen finsteren Blick zu. »Na und? Aber wir sind jetzt vor Ort und müssen handeln.«
Der Hund bellte laut, und Martins Lampe leuchtete hell durch die Nacht, brachte jedoch keine weite Sicht: Wie durch die Scheinwerfer wurde der Nebel auch durch die Lampe viel undurchdringlicher.
Karl fühlte sich immer unbehaglicher. Was, wenn Martin recht hatte und sie heute Abend wirklich jemanden bei der Republikflucht erwischen würden? Republikflucht war nicht richtig, daran gab es keinen Zweifel. Man musste die Menschen daran hindern. Doch Karl hatte das Gefühl, dass Martin von den falschen Motiven getrieben wurde, und sprach ein stummes Gebet, dass sie in dieser Nacht nicht fündig werden würden. Doch Gott erhörte ihn nicht.
Der Nebel lichtete sich und gab den Blick auf drei Gestalten frei, die versuchten, die Grenze zu überqueren. Die vordere war etwas größer, die anderen beiden deutlich kleiner.
»Stehenbleiben!«, brüllte Martin, doch die größere Gestalt machte keine Anstalten, dem Befehl Folge zu leisten. Martin hob seine Waffe und zielte.
»Mutti!«, gellte ein Schrei durch die Nacht.
»Nicht!«, brüllte Karl im selben Moment. Doch sein Ruf ging im lauten Knall des Schusses unter.
Die Welt stand still. Sie wollte sich einfach nicht weiter drehen. Entsetzt starrte Karl auf die gespenstische Szenerie. Eine junge Frau lag auf der Wiese nahe der Grenze. Aus ihrem Bauch quollen Unmengen von Blut, ihr starrer Blick richtete sich gen Himmel. Auf ihre Brust hatte sich ein etwa siebenjähriges Mädchen geworfen und schluchzte erbärmlich. »Mutti! Mutti!«
Daneben ein anderes Kind, etwa fünf Jahre alt. Es weinte nicht, es zeigte keine Regung. Es starrte einfach nur vor sich hin. Eine andere Szene drang aus den Tiefen von Karls Seele hervor, ein Bild, das er bisher noch nie gesehen hatte, von dem er aber wusste, dass es zu seinem Leben gehörte. Ein Keller. Eine schreiende Frau. Männer, die sie quälten, so lange, bis sie nicht mehr schrie. Ein Junge, der über ihrer Brust lag. Weinend. Ein anderer Junge, der daneben stand und das einfach nicht begreifen konnte. Und dann das nächste Bild: Er, der kleinere der beiden Jungen, auf dem Arm des großen, der ihn kilometerweit durch vereiste Wälder trug. Tagelang.
Ein trockenes Schluchzen entrang sich Karls Kehle, und er starrte Martin entsetzt an. »Was hast du getan?«
»Was die Frau verdient hat«, bellte sein Kamerad, der keine Anstalten machte, sich um die Kinder zu kümmern. »Ich mache jetzt Meldung. Und dann stellen wir mal die Personalien fest.«
Karl übergab sich in den nächsten Busch.
2. Kapitel
Überlingen, Bodensee, November 1967
Johanna lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes, während sie still und Hand in Hand am Ufer entlang gingen. Sie liebte diese Novemberstimmung, mochte es, wenn der Nebel die Horizontlinie verwischte. Dann sah es stets so aus, als ginge der See direkt in den Himmel über und wolle niemals enden.
»Ich kann gar nicht verstehen, dass so viele Leute immer behaupten, das Leben am See führe im November zu Depressionen«, sagte sie. »Nie kann man so schön spazierengehen wie jetzt – und dann nach Hause ins Warme zurückkehren.«
Sebastian gab ihr einen Kuss auf die winterkühle Wange.
»Das geht mir ganz genau so«, bestätigte er. »Und auch, wenn wir beide einen großen Teil unseres Lebens am Bodensee verbracht haben, so kann ich mich doch nicht daran erinnern, dass er auch nur ein einziges Mal gleich ausgesehen hat wie an einem anderen Tag. Er hat immer ein anderes Gesicht. Immer wieder aufs Neue.«
»Lass uns ein wenig zum Ufer hinabgehen«, bat Johanna. Hand in Hand verließen sie den Weg und schlenderten über einen schmalen Wiesenstreifen direkt an die Wasserkante, wo der See leise über die grauen Kieselsteine schwappte und sie an den Stellen, an denen er sie traf, dunkler färbte.
Sie bückte sich, um einen der Steine aufzuheben, und betrachtete ihn mit einem versonnenen Lächeln.
»Wenn ich daran denke, wie oft wir hier schon gestanden haben – mit wie vielen Kindern, mit wie vielen Generationen, und Steine ins Wasser geworfen haben. Einen nach dem anderen. Plopp, plopp, plopp. In Krieg und Frieden, in tiefstem Leid und größter Freude. Und wie oft habe ich an diesem Ufer gesessen und dem See mein Herz ausgeschüttet.«
»Und allzu oft auch wegen mir.«
Sebastian trat hinter sie und schlang die Arme um seine Frau. »Kaum zu glauben, dass wir uns nun schon über 50 Jahre lieben. Was haben wir alles erlebt – Kriege, Revolutionen, Epidemien und … und den Verlust unserer Tochter Susanne.«
Johanna nickte und warf den Stein mit einer weit ausholenden Geste ins Wasser. »Der hier ist für sie«, sagte sie leise. »Wie oft bin ich auch mit ihr an diesem Ufer gewesen und habe Steine geworfen, als sie noch ein kleines Mädchen war. Sie hat das geliebt. Manchmal haben wir auch Steintürme gebaut. Wer es schaffte, den höchsten Turm zu errichten, hatte gewonnen. Und nächsten Herbst würde sie ihren 50. Geburtstag feiern.«
Er nickte. »Sie fehlt mir ebenfalls schrecklich, auch nach all den Jahren«, sagte er. »Es stimmt eben nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt. Die Wunde, die der Verlust Susannes uns zugefügt hat, ist eine, die niemals heilt.«
Auch er hob einen Stein auf, warf ihn ins Wasser und betrachtete gedankenverloren die Ringe, die sich durch den Aufprall über die Oberfläche ausbreiteten. »Immerhin durften wir ihre Tochter großziehen. Melissa.« Dann fragte er: »Hältst du es eigentlich immer noch für richtig, dass wir ihr nie gesagt haben, dass wir eigentlich ihre Großeltern sind?«
Johanna antwortete nicht sofort. »Das habe ich mich oft gefragt«, erwiderte sie schließlich nachdenklich. »Aber irgendwann war dann der Moment verpasst. Es ihr jetzt zu sagen, nach all den Jahren, würde sie nur durcheinander bringen.«
»Da hast du recht«, sagte er.
»Dennoch bin ich dafür, etwas zu verändern – auch und gerade in Bezug auf Melissa.«
Er sah sie fragend an.
»Nun, ich habe das Gefühl, dass sie mit ihrem Andreas alles andere als glücklich ist. Und ich kann das verstehen.«
»Ich auch.« Mit einem ärgerlichen Knurren kickte Sebastian nach den Kieselsteinen zu seinen Füßen, eine für den älteren, distinguiert wirkenden Herrn ganz und gar untypische und unpassende Geste.
»Jede Generation hat ihre ganz eigenen Themen und Ansätze, aber diese ständige Meditiererei geht mir auf die Nerven, ebenso wie dieses Gesinge. Und er sollte sich endlich einmal die Haare schneiden lassen.«
»Das sehe ich ganz genau so«, bekräftigte Johanna. »Und Melissa auch. Seit er sich dem Studium der Philosophie verschrieben hat, kommt sie ganz alleine für ihrer beider Lebensunterhalt auf. Er ist nie da, sondern ständig auf irgendwelchen Sit-Ins und Meditationen, er hilft ihr nicht …«
»Du hast ja recht mit allem, was du sagst«, stimmte Sebastian seiner Frau zu. »Aber es ist ihr Leben, und da sollten wir uns nicht einmischen, wenn sie uns nicht ausdrücklich darum bittet.«
»Ich will mich ja gar nicht einmischen, zumindest nicht in dem Sinne«, versicherte Johanna rasch, holte tief Luft und ergänzte dann: »Was hältst du davon, wenn wir ihr unser Haus überschreiben, das Alte Schulhaus? Sie könnte dort ein eigenes Café eröffnen. Ich weiß, dass sie schon lange davon träumt.«
Verblüfft sah Sebastian sie an. »Ein Café eröffnen? In unserem Haus? Aber wo sollen wir dann wohnen?«
Johanna winkte ab. »Das Haus ist groß genug«, sagte sie. »Genau genommen, ist es viel zu groß für uns. Und zu langweilig. Nun haben wir endlich Zeit, Sebastian, Zeit, um zu reisen. Wir sind dazu noch jung genug.«
»Du möchtest reisen?«, fragte er erstaunt.
Sie nickte. »So gern würde ich Sophie in Paris besuchen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und außerdem wünschen wir uns doch, seit wir jung sind, den Turm zu einer Wohnung auszubauen. Du weißt, wie sehr ich diesen Ort liebe und wie herrlich der Seeblick von dort oben ist. Wenn wir es jetzt nicht tun, tun wir es nie mehr.«
Er sah sie nachdenklich an. »Du hast recht. Den Turm auszubauen, ist ein Plan, den wir schon seit Jahrzehnten vor uns herschieben. Dort und in der weiten Welt mit dir meinen Lebensabend zu verbringen – vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Wenn Melissa will.«
Johanna legte ihm die Arme um den Hals. »Du bist einfach der Beste, Sebastian Bigall«, sagte sie und gab ihm einen Kuss auf den Mund. »Ich liebe dich – nach 50 gemeinsamen Ehejahren mehr denn je.«
*
Melissa wollte. Und wie sie wollte. Als Johanna ihr den Vorschlag am Abend unterbreitete – wie jeden Mittwoch aßen Vater, Mutter und Tochter gemeinsam, Andreas blieb den traditionellen Familienmahlzeiten seit längerer Zeit fern –, strahlte die junge Frau über das ganze Gesicht und fiel Johanna um den Hals, wozu sie sich weit über den liebevoll gedeckten Tisch beugen musste. »Was für eine wunderbare Idee, Mutti!«, rief sie. »Ich träume schon so lange davon, ein eigenes Café zu eröffnen. Zumal es mit Andreas immer schwieriger wird. Ich passe einfach nicht mehr in seine Welt.«
Johanna sah ihre Tochter mitleidig an. »So schlimm?«
Melissa nickte. »Aber lass uns jetzt nicht von ihm sprechen, das verdirbt mir nur die Laune. Wie habt ihr euch das vorgestellt, Vati und du?«
»Wir würden dir das ganze Haus überschreiben und in die Dachgeschosswohnung im Turm ziehen«, erläuterte Sebastian. »Wir sind ja noch jung und gehen davon aus, die Treppen problemlos noch eine Weile nehmen zu können. Die Dachgeschosswohnung ist groß genug für uns beide und hat den schönsten Seeblick.«
»Du könntest das Wohnzimmer zum Café umbauen und im Frühjahr und Sommer auch im Garten bedienen«, überlegte Johanna. »Die Küche müsstest du natürlich für deine Bedürfnisse modernisieren.«
Melissa nickte begeistert. »Die Idee gefällt mir immer besser, am liebsten würde ich gleich morgen beginnen.« Dann runzelte sie besorgt die Stirn. »Ich hoffe nur, dass meine Ersparnisse ausreichen, um alles einzurichten.«
»Die Bank gibt dir bestimmt einen Kredit«, war sich Johanna sicher. »Vati und ich können dir leider nicht viel helfen. Vatis Pension ist zwar nicht schlecht, aber wir würden gerne auch auf Reisen gehen und müssen ja noch die Dachgeschosswohnung ausbauen.«
»Ich möchte gar nicht, dass ihr mir helft«, beteuerte Melissa. »Ich will das alleine schaffen. Und ihr gebt mir mit dem Haus ja schon mehr als genug.«
»Und stehen dir natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite«, versicherte Johanna.
»Dann werde ich gleich morgen einen Termin bei der Bank ausmachen«, freute sich Melissa. »Ärgerlicherweise werde ich Andreas mitnehmen müssen, er muss ja zustimmen. Und ob er mit seinen langen Haaren und seiner eigentümlichen Kleidung so einen guten Eindruck auf die Herren von der Bank macht?«
»Dafür wird der Eindruck, denn du machst, umso besser sein«, sprach Johanna ihrer Tochter Mut zu. »Du wirst das wunderbar machen. Ich bin jetzt schon stolz auf dich.«
3. Kapitel
West-Berlin, November 1967
Seufzend lehnte Otto sich auf seinem Bürostuhl zurück und ließ seinen Blick durch das große Bürofenster über die Stadt gleiten. Es war ihm gut ergangen, seit er vor sechs Jahren die spektakuläre Flucht aus dem Fenster an der Zonengrenze gewagt hatte, fand er. Er hatte seine Eltern wieder gefunden, von denen er als kleiner Junge, als die Russen kamen, getrennt worden war, woraufhin er allein durch die Wälder streunte, bis Irina und Annemarie ihn aufsammelten und, ebenso wie andere Wolfskinder, in einer Schicksalsfamilie großzogen. Wie sehr er sie alle vermisste, seine Geschwister, die drüben geblieben waren, aber auch Irina und insbesondere Annemarie, die ihm all die Jahre eine so liebevolle Ziehmutter gewesen war. Wenn er ehrlich war, hatte sie ihm näher gestanden, als er das von seiner leiblichen Mutter jemals behaupten konnte. Was angesichts der langen Trennung vermutlich auch kein Wunder war. Zumal das, was er in jenen Jahren erlebt hatte, sein Wesen verändert und ihn zu dem gemacht hatte, der er heute war.
Dennoch konnte er sich nicht beklagen. Seine Eltern lasen ihm, dem Wiedergefundenen, dem Heimgekehrten, jeden noch so kleinen Wunsch von den Augen ab, und als er sich selbstständig machte und aus der großbürgerlichen Villa in Zehlendorf auszog, hatte ihm der Vater ganz selbstverständlich zwei Etagen in einem wunderschönen Jugendstilhaus am Ku’damm gekauft. Parkettböden, hohe Decken, Flügeltüren. In der unteren der beiden Wohnungen hatte er sein Architekturbüro eingerichtet, im Stockwerk darüber wohnte er. Mit Helga. Seinem Fluch und seinem Segen. Wobei sie sich in letzter Zeit eher als Fluch denn als Segen erwies. Er hatte Helga vor drei Jahren in der Eierschale kennengelernt, einem traditionsreichen Jazzklub, 1952 gegründet von Hawe Schneider, dem Posaunisten der Spree City Stompers. Seit 1956 war die Eierschale in Dahlem ansässig, wo sie im 350 Quadratmeter großen Keller des Hauses Breitenbachplatz 8 zum angesagtesten Jazzklub West-Berlins mutierte. Ella Fitzgerald hatte sich im Anschluss an ein Konzert noch zu einem Gig überreden lassen, und Helga hatte plötzlich neben ihm gestanden – und ihn um den Verstand gebracht, mit ihren veilchenblauen Augen, ihrem Schmollmund und ihrem beachtlichen Dekolleté, mit dem sie ihrem Gegenüber einen großzügigen Einblick in ihre weiblichen Vorzüge gewährte. Seit jener Nacht war keine mehr ohne sie vergangen. Helga hatte von ihm, seinem Leben, seinem Fühlen und seinem Denken Besitz ergriffen. Und vor allem hatte sie alle Macht über seine Triebe. Noch immer erregte ihn der bloße Gedanke an sie, doch zunehmend stellte er fest, dass ihm das nicht mehr ausreichte. Helga war durch ihre oberflächliche Art eine willkommene Ablenkung von den ersten schweren Jahren seines Lebens im Westen gewesen. Mit ihr kam man gar nicht auf die Idee zu hinterfragen, zu reflektieren, mit ihr ging es einfach nur darum, das Leben zu genießen. Das tat ihm gut. Es war wie eine Heilung von all seinen Wunden.
Helga war Schauspielerin, wenn auch keine sonderlich erfolgreiche und talentierte. Sie selbst hielt sich allerdings für den Nabel der Welt, vor allem, seit sie in dem Film Zur Sache, Schätzchen, der bald Premiere feiern sollte, Seite an Seite mit Uschi Glas vor der Kamera stand. Seither sprach Helga vor aller Welt von der bekannten Schauspielerin, als sei diese ihre beste Freundin. Otto vermutete jedoch, dass Uschi Glas die Existenz seiner Frau noch nicht einmal wahrgenommen hatte, zumindest hatte der Star Helga stets ignoriert, wenn Otto sie vom Set abholte, und bei ihnen zu Hause hatte er die berühmte Schauspielerin auch noch nie gesehen.
Otto hatte längst erkannt, dass seine Frau zwar bildschön war und sicherlich als zierendes Beiwerk taugte, ihm aber, außer im Bett, nicht viel bieten konnte, und das ödete ihn zunehmend an. Zumal sie immer anspruchsvoller wurde. Ein Filmstar, so argumentierte sie, könne nicht in Billigklamotten rumlaufen. Für Helga war das Beste gerade gut genug – Gucci, Prada, Chanel – und da ihre Gage als Nebendarstellerin nicht sonderlich hoch war, musste Otto wieder und wieder seinen Geldbeutel zücken.
Was ihn nicht störte, denn Otto war ein so wohlhabender wie großzügiger Mann, Geld interessierte ihn nicht, das Einzige, was er sich leistete, war dann und wann ein Gemälde. Otto war ein begeisterter Kunstsammler, zu seinen Lieblingen zählten Andy Warhol, Salvador Dalí und Allen Jones, die Stühle in seinem Büro waren von dem dänischen Architekten und Designer Verner Panton.
Als ausgesprochen nervtötend empfand er aber die Tendenz seiner Frau, mit nichts zufrieden zu sein, immer noch mehr zu fordern und noch mehr zu wollen. Denn je mehr sie jammerte, desto mehr stand ihm seine eigene, leidvolle und entbehrungsreiche Kindheit vor Augen.
Und genau deshalb hatte er überhaupt keine Lust, jetzt, wo die Geschäfte unten auf dem Ku’damm langsam schlossen, ebenfalls Feierabend zu machen und einen Stock höher zu gehen. Doch es half nichts, sie würde mit dem Abendessen warten, seit der Film abgedreht war, gefiel Helga sich in der Rolle der liebenden Hausfrau, und sie hatte leider auch das Kochen für sich entdeckt. Eine Kunst, die sie keineswegs beherrschte. Doch Helga erwartete überschwängliches Lob für ihre Mahlzeiten, und wenn sie dieses Lob nicht bekam oder er nicht mit Appetit zugriff, füllten sich ihre blauen Kulleraugen mit Tränen und ihre Unterlippe begann auf faszinierend dramatische Weise zu beben. Mit einem erneuten Seufzer schob Otto die Papiere auf seinem Schreibtisch zusammen und fügte sich in sein Schicksal.
Helga erwartete ihn. Aber nicht, wie er befürchtet hatte, mit dem Abendessen, sondern direkt hinter der Wohnungstür im Negligee. Er hatte die Tür noch nicht hinter sich geschlossen, als sie begann, ihn gierig zu küssen. »Ich habe schon sehnsüchtig auf dich gewartet«, hauchte sie an seinen Lippen und rieb ihren Körper aufreizend an seinem. »Wenn du nicht bald gekommen wärst …«
Er stöhnte leise auf und zog seine Frau an sich. Vielleicht erwartete er zu viel, dachte er. Was machte es schon, wenn er mit ihr keine tieferen Gedanken teilen konnte. Und war es schlimm, dass sie für sich nur das Beste wollte? Er hatte genug Geld und sie einen Luxuskörper, mit dem sie ihn immer wieder um den Verstand brachte.
Er spürte ihre Hand in seinem Schritt und schloss die Augen. Sekunden später hob er sie auf seine Arme, presste sie an die Wand und nahm sie noch im Flur.
Er war ihr einfach verfallen. Und er würde es für immer bleiben.
Doch so berauschend ihre Begrüßung gewesen war, so ernüchternd war der Rest des Abends. Das Essen, das sie leider doch zubereitet und im Ofen warm gehalten hatte, schmeckte noch schlimmer als befürchtet, fad und lasch, und als er lustlos darin herumstocherte, schob sie schmollend die Unterlippe vor. »Es schmeckt dir nicht«, sagte sie vorwurfsvoll, und prompt standen in ihren großen, blauen Augen die von ihm schon erwarteten Tränen. »Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben. Vielleicht, wenn wir endlich eine Köchin …«
»Nein«, sagte Otto, »keine Köchin.«
»Warum nicht? Du bist ein Sohn aus gutem Hause, und wir leben völlig unter Stand. Gerade mal ein Hausmädchen haben wir. Das ist übrigens auch eines Filmstars nicht angemessen. Alle meine Kollegen …«
Otto schluckte den Hinweis herunter, dass seine Frau mitnichten mit einer Uschi Glas zu vergleichen war, und sagte stattdessen so sanft er konnte: »Meine Liebe, dir fehlt jeglicher Bezug zur Realität. Uns geht es hervorragend.«
Vor allem im Vergleich zu dem Leben, das ich früher hatte, dachte er bei sich. Nie hatte er sich nach seiner Flucht in den Westen und zu seinen Eltern an die vielen Dienstboten gewöhnen können.
Helga seufzte. »Du willst mich einfach nicht verstehen«, sagte sie leise. »Wenn du mir doch wenigstens endlich ein Kind …«
»Nein«, sagte Otto scharf, »Das haben wir doch nun wirklich schon mehrfach besprochen.«
Nun brach Helga in lautes Schluchzen aus. »Ich verstehe einfach nicht, weshalb du mir diesen Wunsch verwehrst«, sagte sie weinend. »Und warum du immer so wütend wirst, wenn ich davon anfange.«
»Weil du es einfach nicht begreifen kannst und willst.« Otto spürte wieder diese große unkontrollierte Wut in sich aufsteigen, die immer von ihm Besitz ergriff, wenn sie mit diesem Thema anfing. Denn dann kamen die Bilder wieder hoch. Er sah sich selbst, ein kleiner Junge noch, einsam am Bahnhof stehend, die Hand nach seiner Mutter ausstreckend, die im abfahrenden Zug saß und nicht herauskam. Dann das nächste Bild: Zwei kleine Jungen, ein und vier Jahre alt, die einsam durch den Wald irrten. Seine Ziehbrüder. Und dann: Männer, Folter, Erpressungen, Einsamkeit, Kälte und unendliches Leid. Und schließlich sah er die Bilder aus Vietnam, die tagtäglich um die Welt gingen. Wieder litten Kinder. Sie waren immer die Schwächsten. Kindheit bedeutete Leid. Und deshalb durfte er kein Kind in die Welt setzen. Nicht, wenn er nicht sicher war, dass er sein Kind vor allem Leid dieser Welt beschützen konnte.
Aber all das wusste Helga nicht, weil er es ihr nicht erzählt hatte. Es war ihm klar, dass das unfair war, und dass er ihr eine Erklärung schuldete. Otto holte tief Luft.
»Ich …«, setzte er an, doch dann dachte er beim Blick in ihre großen blauen Augen, die ihn ängstlich und zugleich hoffnungsvoll anstarrten, dass sie es ohnehin nicht begreifen würde.
»Ach vergiss es einfach«, sagte er, wandte sich zur Tür und stürmte hinaus. Helga blieb weinend im Esszimmer zurück.
4. Kapitel
Überlingen, November 1967
»Es tut mir leid, aber wir brauchen noch die Unterschrift Ihres Mannes.« Die Bankangestellte lächelte Melissa bedauernd an. Dann beugte sie sich vertraulich über den Schreibtisch und sagte: »Glauben Sie mir, ich finde diese Vorschriften auch vollkommen überflüssig. Als seien wir Frauen nicht allein in der Lage zu denken und zu handeln. Und Ihre Idee, ein Café zu eröffnen, ist großartig. Aber ich kann den Kreditantrag ohne die Unterschrift Ihres Mannes nicht bearbeiten.«
»Ich weiß«, seufzte Melissa und sah nervös auf die Uhr. »Ich habe auch alles mit meinem Mann besprochen. Er hat mir versichert, pünktlich zu sein.«
Doch inzwischen warteten sie seit fast einer halben Stunde und es war nicht mehr zu leugnen, dass er sie versetzt hatte. Wieder einmal.
»Dürfte ich den Kreditantrag mitnehmen?«, bat sie die nette Bankangestellte, die etwa in ihrem Alter war. »Dann kann er zu Hause unterschreiben.«
Die junge Frau, eine zierliche Blondine mit hüftlangen Haaren, die auf den hübschen Namen Nanette Rosenfein hörte, zögerte. »Nun, eigentlich …«, begann sie, lächelte dann aber, »Sie müssen es ja nicht an die große Glocke hängen.« Nanette Rosenfein schob die Unterlagen über den Schreibtisch in Melissas Richtung, die die Papiere sorgsam in ihrer Tasche verstaute. »Vielen Dank. Ich erledige das umgehend. Und wenn mein Café dann eröffnet hat, haben Sie mindestens ein Stück Kuchen bei mir gut.«
Die Bankangestellte lächelte. »Ich freue mich darauf.«
Der Weg nach Hause war nicht weit und Melissa bedauerte, dass er nicht am See entlangführte. Ein Spaziergang am Ufer hätte ihr gut getan – der See hatte schon immer eine beruhigende Wirkung auf sie gehabt. Und sich zu beruhigen, das wäre jetzt dringend angezeigt. Denn obwohl sie am Vorabend sehr ernst mit Andreas gesprochen und ihm mehrfach eingeschärft hatte, wie wichtig es sei, pünktlich zu erscheinen – und zwar im Anzug und nicht in seinen Batikkleidern, und wenn schon mit langen Haaren, dann doch zumindest mit gekämmten und außerdem gewaschen und nicht bekifft –, hatte sie doch insgeheim befürchtet, dass er sie versetzen würde. Und genau das war nun geschehen. Sie eilte die Münstertreppe hinauf, ging durch den schmalen Durchgang links des Gotteshauses und war schon an ihrer Altstadtwohnung angekommen. Was waren sie damals stolz gewesen, als sie sie bekommen hatten, wie liebevoll hatten sie sie renoviert. Und jetzt …
Schon im Treppenhaus schlug Melissa der süßliche Geruch von Marihuana entgegen. Verärgert schloss sie die Wohnungstür auf. Erst vor zwei Tagen hatte Andreas ihr nach einem Streit versprochen, dass in ihrer gemeinsamen Wohnung nicht mehr gekifft werden würde.
Den Streit hätte sie sich sparen können, wie sie nach dem Betreten feststellte – in ihrer Wohnung ging es schlimmer zu als je zuvor: Blaue Rauchschwaden tauchten das Wohnzimmer in einen süßlichen Nebel, auf dem Sofa lümmelte mit halb geschlossenen Augen ihr Mann und summte die aus dem Lautsprecher dröhnende Melodie zu »If you’re going to San Francisco« mit, derweil sich neben ihm ein Pärchen, das Melissa nicht kannte, wild und leidenschaftlich küsste und offenbar gedachte, in Kürze zur Paarung überzugehen. Hinter Andreas saß eine Frau mit langen Rastas und spärlich bedecktem Busen und massierte seine Schultern, auf dem Boden campierten zwei Männer mit Oberlippenbärtchen und teilten sich eine Flasche Bier.
Melissa hustete, ging zum Fenster und riss es auf, wobei sie über auf dem Boden verstreute Kleider und leere Chipstüten stieg. Keiner schien ihr Beachtung zu schenken.
»If you’re going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair.
If you’re going to San Francisco
You’re gonna meet some gentle people there«, klang es unverdrossen aus dem Lautsprecher.
Nachdem sie das Fenster geöffnet hatte, bahnte sich Melissa einen Weg zur Stereoanlage und stellte die Musik ab. Andreas öffnete die Augen und sah sie verzückt lächelnd an, die Rothaarige unterbrach ihre Nackenmassage, der Blick der am Boden hockenden Schnauzbärte glitt lustvoll über ihre Beine. Einzig das Liebespaar auf dem Sofa ließ sich nicht stören. Der Mann hatte inzwischen die Brust der Frau enthüllt und ließ ihr eine intensive Massage zukommen, was diese zu verzückten spitzen Schreien veranlasste.
»Wer ist die denn?«, fragte die Schultermasseurin.
»Meine Frau«, sagte Andreas und breitete die Arme nach Melissa aus. »Komm zu mir, mein Engel.«
»Ich muss dich sprechen«, erwiderte sie knapp.
»Das hat doch Zeit bis später«, nuschelte Andreas und hielt ihr auffordernd seinen Joint hin. »Leg dich lieber in meinen Schoß. Du wirkst so angespannt. Lorelei massiert dir sicherlich auch die Schultern.«
»Danke«, sagte Melissa knapp. »Ich verzichte.«
»Die ist aber schlecht drauf«, murrte Lorelei. »Ist die immer so zickig?«
Melissa spürte, dass sich ihre angestaute Wut nicht mehr zurückhalten ließ.
»Ja, die ist immer so zickig«, fauchte sie. »Und deswegen wirft die euch jetzt auch alle hinaus. Verlasst sofort meine Wohnung.«
Sie hatte ihre Stimme derart erhoben, dass sogar das Paar auf dem Sofa voneinander abließ und sie erstaunt ansah.
»Na hör mal«, protestierte Andreas, »das ist auch meine Wohnung.«
»Die wir von meinem Geld bezahlen«, erwiderte Melissa schneidend. »Denn du hast ja beschlossen, erst einmal nicht zu arbeiten, sondern zu studieren und dich dabei selbst zu finden.«
»Dennoch ist es auch meine Wohnung«, beharrte Andreas. »Und das sind meine Freunde.«
»Das ist mir, offen gestanden, herzlich egal«, sagte Melissa scharf. »Und selbst wenn es mir nicht egal wäre, so muss ich doch gestehen, dass ich, selbst wenn es auch meine Freunde wären, und zwar die besten, kein Bedürfnis hätte, ihnen beim – Geschlechtsakt zuzusehen.«
Lorelei lachte schrill auf. »Geschlechtsakt«, wiederholte sie spöttisch. »Die ist ja nicht nur zickig, sondern auch prüde. Das ist Sex, Schätzchen.«
»Hinaus! Augenblicklich!«
»Ist ja schon gut«, murrte Lorelei und räumte ihren Platz hinter Andreas, während sich das Pärchen mit provozierend langsamen Bewegungen wieder anzog und die beiden Bärtigen sich taumelnd vom Boden erhoben.
Unter Mitleidsbekundungen in Andreas’ Richtung, weil der ja so eine furchtbare Gattin habe, trollten sie sich in Richtung Tür.
Drinnen fauchte Melissa Andreas wütend an. »Was fällt dir eigentlich ein?«
Er sah sie mit leerem Blick an. Unendlich traurig. »Warum musst du meine Freunde so behandeln? Warum musst du mich so behandeln? So – verächtlich?«
»Das fragst du mich ernsthaft?« Melissa war fassungslos.
»Ja«, erwiderte er, »ich verstehe es nicht.« Mit einem Mal wirkte er wieder nüchterner. »Überall auf der Welt herrscht Krieg, die Bilder aus Vietnam sind kaum zu ertragen. Was spricht dagegen, all dem Hass eine Welle der Liebe und des Friedens entgegenzusetzen?«
»Dagegen spricht überhaupt nichts«, sagte Melissa und schloss das Fenster. Zwar hing der Geruch von Marihuana noch immer in der Luft, aber es war November und damit zu kalt, um länger als nur ein paar Minuten zu lüften.
Sie setzte sich wieder neben ihn auf das Sofa. »Und ich finde die Blumenkinderbewegung deshalb ja auch im Ansatz gut. Ich meine nur, dass du – dass viele – sie falsch interpretieren. Hass und Krieg Liebe entgegenzusetzen, ist ja richtig, aber das heißt doch nicht, dass zwei Wildfremde auf meinem Sofa miteinander schlafen müssen.«
»Sie haben nicht miteinander geschlafen.«
»Nein, aber es hätte nicht mehr viel gefehlt«, hielt Melissa dagegen.
»Und außerdem: Wenn man Frieden und die Dinge ordnen will, braucht man einen klaren Kopf. Das geht aber nicht, wenn man ständig dieses Zeug, oder schlimmer noch, LSD, konsumiert.«
Andreas seufzte und streckte wieder die Hand nach ihr aus. »Lass uns nicht streiten«, sagte er. »Ich hasse es, mit dir zu streiten. Wir haben uns doch früher so gut verstanden. Und wir haben uns gegenseitig an unseren Träumen teilhaben lassen.«
»Und du bist auf dem besten Weg, mir meinen Traum zu zerstören«, erwiderte sie ungehalten.
Er sah sie erschrocken an: »Wie das?«
»Wir waren für heute verabredet, erinnerst du dich?«, fragte sie, nun wieder ganz ruhig.
Seine Augen weiteten sich. »Der Banktermin«, sagte er leise.
Sie nickte. »Ganz genau. Der Banktermin. Wir haben eine halbe Stunde auf dich gewartet.«
»Das tut mir so leid!«, rief er bekümmert. »Ich habe das ganz …«
»… vergessen. Das habe ich gemerkt.« Melissa stand auf und ging zu ihrer Tasche. »Aber offen gestanden war es besser, nicht zu kommen als in diesem Zustand. Die Bankberaterin hat mir freundlicherweise den Kreditantrag mitgegeben. Du musst nur noch unterschreiben.«
5. Kapitel
Ost-Berlin, November 1967
Seit Otto über die Zonengrenze geflohen war, waren sich Karl und Heinz noch näher gekommen. Die beiden Brüder hatten sich, wie auch ihre Ziehgeschwister, nach und nach aus dem großen Haus, in dem sie gemeinsam mit Irina und Annemarie gelebt hatten, verabschiedet und waren in eigene Wohnungen gezogen. Karl und Heinz waren zusammengeblieben. Sie hatten Glück gehabt und eine Ausbauwohnung bekommen, die sie gemeinsam liebevoll renoviert hatten, und sie waren auch dann noch zusammen geblieben, als Heinz bei der SED Karriere machte und seine Sekretärin, die blonde Irene, eine überzeugte Sozialistin, deren Haar immer an Ort und Stelle saß bis auf die letzte Strähne, heiratete. Inzwischen hatte er es zum Oberstleutnant im Ministerium für Nationale Verteidigung gebracht.
Zu dritt hatten sie fortan in dem schmucken Haus mit dem adretten Vorgarten gelebt, in das sie nach der Hochzeit umgezogen waren, und Karl hatte das Gefühl von Sicherheit und Ordnung genossen, das das Zusammenleben mit den beiden ihm gab. Und so war ein erster Impuls nach dem schrecklichen Erlebnis an der Grenze auch gewesen, nach Hause zu flüchten, zu Heinz und zu Irene, um den beiden zu erzählen, was er erlebt und was das für Erinnerungen in ihm wach gerufen hatte. Ja, der Gedanke an zu Hause hielt ihn aufrecht, als er taumelnd den Rückweg antrat. Doch als er seine Hand an die Gartentür legte und sie gerade öffnen wollte, zögerte er. Durch das Fenster sah er die beiden miteinander am Tisch sitzen und das Abendessen einnehmen. Sie speisten im Schein der Lampe und unterhielten sich gepflegt. Wie aus dem Lehrbuch für ein perfektes Ehepaar, dachte Karl und verspürte mit einem Mal eine tiefe Abneigung gegen seinen Bruder und dessen Frau. Wie konnten sie hier sitzen, in ihrer häuslichen Glückseligkeit, während da draußen zwei Kinder allein durch die Nacht irrten? Wieder? Und wie konnte Heinz auch noch ein hohes Tier in diesem verbrecherischen System sein? Er wusste, dass er ihnen unrecht tat, zumal er ja selbst seinem Beruf als Grenzpolizist regelrecht entgegengefiebert hatte, aber er konnte einfach nicht anders. Konnte jetzt nicht zu ihnen gehen, konnte ihnen seinen Schmerz und seine Verzweiflung nicht zeigen, nicht in diese heile Welt einbrechen, die ihm in letzter Zeit so viel Sicherheit und Schutz geboten hatte, ihm auf einmal aber heuchlerisch und falsch vorkam.
Leise drückte er die Klinke der Gartentür nun doch hinunter, kramte seinen Schlüssel hervor und schloss behutsam die Tür auf. Er würde gleich zu Bett gehen.
*
Noch bevor Karl am nächsten Morgen die Augen aufschlug, wusste er, dass am Vortag etwas Schreckliches geschehen war. Und dann kam die Erinnerung mit voller Wucht zurück. Die tote Frau im Gras. Die beiden Mädchen. Ihre Blicke. Entsetzt keuchte er auf, es fiel ihm schwer, aus dem Bett zu kommen. Seine Beine gaben nach, und er wusste nicht, ob das daran lag, dass er gestern Abend nichts gegessen hatte, oder ob es die Erinnerung war, die sich nun auch physisch auswirkte.
Von unten drang der Geruch frischen Kaffees und gebratener Eier herauf, und augenblicklich begann Karls Magen zu knurren. Sobald er etwas gegessen hatte, würde es ihm sicher besser gehen. Er unternahm einen erneuten Anlauf aufzustehen und sich anzuziehen, und diesmal gelang es einigermaßen.
»Guten Morgen, Karl!«, begrüßte seine Schwägerin ihn herzlich. »Wir haben dich gestern Abend vermisst. Ist alles in Ordnung? Du bist etwas blass! Möchtest du ein Rührei?«
Normalerweise mochte Karl die zwar überkorrekte, aber doch fürsorgliche Art seiner Schwägerin, und er war überzeugt, dass nicht nur er, sondern auch Heinz in ihr etwas von der Mutter suchten, die sie gar zu früh verloren hatten. Heute jedoch fand er sie nur enervierend.
»Nein«, brummte er, ohne sich für ihr Angebot zu bedanken. Denn obwohl ihn der Geruch des Rühreis aus dem Bett getrieben hatte, drehte sich ihm nun beim Gedanken, selbiges zu verspeisen, der Magen herum. »Ein Butterbrötchen reicht mir.«
Karl sah nicht, dass Heinz und Irene einen besorgten Blick wechselten und seine Schwägerin kurz darauf das Zimmer verließ – wohl in der Absicht, den Brüdern die Gelegenheit für ein Gespräch unter vier Augen zu geben.
Heinz setzte sich seinem Bruder gegenüber an den Tisch. »Was ist mit dir?«, kam er direkt zur Sache.
Karl schluckte hart, griff nach seinem Brötchen und schmierte Butter darauf. Es wollte ihm nicht gelingen. Der Butterbrocken blieb am Messer kleben und riss ein Loch in die Schmolle.
»Verdammt«, rief er nach einigen vergeblichen Versuchen und warf Brötchen und Messer von sich. Beides landete klirrend auf dem Teller.
»Gib her.«
Seelenruhig griff Heinz nach dem Brötchen seines Bruders und strich Butter darauf. »Marmelade?«
Karl schüttelte den Kopf, und als Heinz ihm das Brötchen entgegenschob, griff er danach und schlang es hinunter, als hinge sein Leben davon ab.
Heinz sah ihm dabei zu und wiederholte erst, als sein Bruder aufgegessen hatte, seine Frage: »Was ist geschehen?«
»Gestern Abend«, brachte Karl mühevoll hervor. »Ich hatte Dienst. Und jetzt … sie ist tot!«
»Wer ist tot?«, fragte Heinz irritiert.
»Die … die Mutter. Und die beiden Kinder sind nun ganz allein.«
»Von wem redest du denn, um Himmels willen?« Heinz griff über den Tisch nach der Hand seines Bruders und sah ihn eindringlich an. »Bitte reiß dich zusammen und konzentrier dich.«
Karl holte einmal tief Luft, die er sodann mit einem zischenden Geräusch wieder ausstieß. Er strich sich übers Gesicht, als könne er so die Bilder vertreiben, die ihn quälten, und sagte dann, gefasster nun, fast nüchtern: »Eine Frau wollte den antifaschistischen Schutzwall durchbrechen. Sie ließ sich auch durch Rufe des Kameraden, der mit mir zum Dienst eingeteilt war, nicht davon abhalten. Der Genosse hat von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht und sie vor den Augen ihrer Kinder erschossen.«
»Wie bedauerlich«, sagte Heinz. »Habt ihr die Frau denn nicht gewarnt?«
»Doch, natürlich.«
»Und?«
»Nun, sie … sie hat die Warnung ignoriert.«
Heinz zuckte die Schultern. »Dann habt ihr alles richtig gemacht. Mach dir keine Vorwürfe. Diese Frau hat versucht, Republikflucht zu begehen und dabei ihre Kinder in Gefahr gebracht. Sie hat eure Warnungen ignoriert. Wie ich das sehe, konntet ihr gar nicht anders handeln.«
Karl schluckte hart. Dann hatte sein Gefühl vom Vorabend, dass sein Bruder nicht begreifen würde, um was es ihm ging, ihn also nicht getrogen.
»Aber es geht hier gar nicht um mich«, sagte er. »Es geht mir um die beiden Kinder. Was wird denn nun aus ihnen? Sie haben mich an uns beide erinnert, wie wir damals …«
»Das ist lange her«, unterbrach ihn sein Bruder barsch, und zum ersten Mal fiel Karl auf, dass sie eigentlich nie über ihre unglückliche Kindheit gesprochen hatten. Und Heinz schien das auch weiterhin nicht vorzuhaben.
Eindringlich sah er seinen Bruder an. »Für die beiden Kinder ist es besser so«, sagte er dann.
»Besser so?«, fragte Karl tonlos. »Wenn man ihre Mutter vor ihren Augen ermordet, ist das besser so?«
Heinz’ Blick wurde mit einem Mal ganz kalt. »Was redest du denn für einen Unsinn?«, zischte er. »Und wie kommst du überhaupt auf Mord? Die Frau hat versucht, den antifaschistischen Schutzwall zu durchdringen. Selbst wenn dein Kollege nicht geschossen hätte, hätte man ihr die Kinder wegnehmen müssen. Wie sollte sie die Kinder denn so zu sozialistischen Persönlichkeiten erziehen?«
»Sie haben ja hoffentlich noch einen Vater«, klammerte sich Karl an einen letzten Rest Hoffnung.
Heinz schnaubte. »Du glaubst doch nicht, dass man die Kinder zu ihrem Vater lässt«, empörte er sich und sah den Jüngeren kopfschüttelnd an. »Also manchmal frage ich mich wirklich, in welcher Welt du eigentlich lebst und was du in all den Jahren gelernt hast. Der Vater wird entweder schon im Westen sein oder von den Plänen seiner Frau gewusst haben. Die Kinder können auf keinen Fall wieder zu ihm, und das weißt du sehr wohl.«
»Ja«, sagte Karl voller Grauen vor dem System, an das er geglaubt hatte, und vor seinem Bruder, der ihm mit einem Mal furchtbar kalt und unmenschlich vorkam. Sein einziger Wunsch war daher, das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden und seinen Bruder nicht mehr sehen zu müssen. »Natürlich. Sie werden in ein Heim kommen und dann in eine Pflegefamilie. So wie wir damals.«
»Und wir haben es auch gut getroffen. Aus uns ist doch was geworden«, sagte Heinz tröstend. »Nun gut, dann muss ich auch mal losmachen.«
Er erhob sich und hieb seinem Bruder zum Abschied nochmals auf die Schulter.
»Halt die Ohren steif. Und lass dich nicht unterkriegen. Um unser Land vor dem Klassenfeind zu schützen, müssen wir eben manchmal zu unbequemen Mitteln greifen.«
Sprach’s und war zur Tür hinaus.
Unbequeme Mittel. Karl sah ihm fassungslos nach, während vor seinem inneren Auge zwei kleine Mädchen einsam durch die finstere Nacht marschierten. Dann vergrub er das Gesicht in den Händen. Was hatte er nur all die Jahre über getan! Mit einem Mal schämte er sich entsetzlich. Ja, es hatte ihm Sicherheit gegeben, Teil dieses Systems zu sein. Dazuzugehören. Auch die Mauer hatte er gut gefunden. Es hatte ihm Sicherheit gegeben, dass sie vor dem Klassenfeind schützte. Und es schien ihm richtig, all das zu verteidigen und sein Land zu schützen, damit nicht wieder ein Krieg ausbrach. Und nun … nun stellte er fest, dass er Menschen das Gleiche antat, wie seinerzeit ihm angetan worden war.
6. Kapitel
Überlingen, Bodensee, Mitte Dezember 1967
Melissa war völlig übermüdet. Ihr Dienst in der Bäckerei Löhle hatte bereits um 4 Uhr morgens angefangen, und da Andreas erst um 2 Uhr vollkommen unter Drogen und sturzbetrunken von einem seiner Blumenkindertreffen zurückgekehrt war, hatte sie keine zwei Stunden Schlaf bekommen. Sie konnte nicht einschlafen, solange er noch unterwegs war. Weil sie sich darüber ärgerte, dass er sich aus dem normalen Leben verabschiedete und ihr wie selbstverständlich alles überließ: sich um die Wohnung zu kümmern, einzukaufen und das Geld zu verdienen. Der Zorn nahm ihr den Schlaf. Der Zorn und das Bewusstsein, dass sie ohnehin aufwachen würde, wenn er käme, und dann nicht mehr einschlafen könnte.
Die Arbeit in der Bäckerei, die sie sonst so gerne verrichtete – es machte ihr einfach nach wie vor große Freude, die prächtigsten Torten herzustellen und zu verzieren – war ihr heute nur schwer von der Hand gegangen, und selbst ihre Tagträume, wie sie herrliche Kreationen für ihr eigenes Café herstellen und vielleicht sogar feine Pralinen entwerfen würde, konnten sie nicht trösten.
Das lag aber nicht nur an Andreas und ihrem Schlafmangel, sondern auch an der Bank. Obwohl alles anfangs so gut ausgesehen hatte und Andreas ja auch gleich pflichtschuldig seine Unterschrift abgegeben hatte, passierte nun nichts mehr. Wieder und wieder hatte sie bei der Sparkasse nachgefragt, und das freundliche Fräulein Rosenfein erklärte immer wieder aufs Neue, sich um die Angelegenheit mit hoher Priorität zu kümmern, aber am Ende musste Melissa nur wieder weitere Unterlagen einreichen – und dann begann das Warten von Neuem. Sie wollte aber nicht mehr länger warten. Sie wollte loslegen, damit ihr Café im Frühjahr, wenn die Touristen kamen, fertig war. Denn wenn die Bank ihr den Kredit endlich gab, würde es ohnehin noch einige Zeit dauern, bis sie alles beantragt und bestellt hatte. Melissa wollte, dass es ein ganz besonderes Café mit einem ganz eigenen und unverwechselbaren Charme werden würde, und da brauchte sie Zeit, um alles zusammenzusuchen.
Als das Alte Schulhaus in all seiner Jugendstilpracht, mit seinen Erkerchen, Türmchen und Giebeln vor ihr auftauchte – inmitten des winterlichen Gartens und direkt am Stadtpark gelegen –, seufzte sie. Wie schön wäre es, wenn dort im Garten munter plaudernde Menschen säßen, ihren Kuchen genössen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen ließen. Stattdessen lag das Haus vollkommen verwaist da – zumal ihre Eltern Johannas großem Wunsch, endlich zu reisen, sehr schnell nachgekommen waren.
Plötzlich nahm sie eine Bewegung im Garten wahr. Kurz darauf trat ein hochgewachsener, schlanker Mann mit grünen Augen durch den Rosenbogen, der die Einfahrt mit dem Garten verband und über den sich ab Mai die prachtvollsten Blüten in verschwenderischer Pracht ergießen würden. Melissa sah ihn erstaunt an: »Kann ich Ihnen helfen?«
»Das hoffe ich doch«, sagte der Mann und grinste. »Ich bin auf der Suche nach Johanna Bigall. Mein Name ist Otto Meinhöfen, ich komme aus Berlin.«
Melissa runzelte die Stirn. »Meine Mutter ist nicht da«, bedauerte sie.
»Oh.« Der Große schien aufrichtig enttäuscht. »Nun, ich würde lieber persönlich … wann kommt sie denn wieder?«
»Das kann ein paar Monate dauern, befürchte ich. Meine Eltern befinden sich auf einer größeren Reise.«
»Na dann«, erwiderte Otto und strich sich durch die Haare, »dann kann man wohl nichts machen.«
»Wollen Sie mir denn nicht sagen, worum es geht?«, fragte Melissa. »Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Und Sie werden ja kaum heute wieder nach Berlin zurückfahren?«
Otto grinste. »Das wäre in der Tat etwas weit«, bestätigte er.
Melissa erwiderte sein Lächeln. »Haben Sie Hunger? Ich für meinen Teil bin furchtbar hungrig – ich bin seit 4 Uhr morgens auf den Beinen, habe aber noch keinen Bissen zu mir genommen.«
»Seit 4 Uhr morgens?«, rief Otto erstaunt. »Warum, in aller Welt, steht jemand so früh auf?«
Melissa musste lachen. »Das ist für mich leider nichts Ungewöhnliches«, sagte sie. »Ich bin Konditormeisterin.«
»Ach so«, er nickte verstehend.
Aus irgendeinem Grund hatte sie das Gefühl, diesem Fremden aus Berlin alles erzählen zu müssen. Das Gespräch mit ihm verlief so leicht und fast automatisch. Sie kramte den Schlüssel aus der Handtasche und schloss die Tür auf. »Bitte kommen Sie herein.«
Otto betrat hinter ihr das Gebäude und sah sich staunend um. »Was für ein Haus!«, rief er begeistert. »Es ist einfach ein Traum.«
Melissa lächelte. »Sie haben recht«, sagte sie. »Weil ich hier aufgewachsen bin, weiß ich seine Schönheit gar nicht mehr richtig zu schätzen. Aber es ist schon so: Die Leute bleiben immer wieder bewundernd vor dem Haus stehen.«
»Darf ich mich einmal umsehen?«, fragte Otto, und es klang beinahe schüchtern. »Sie müssen wissen, ich bin Architekt, und alte Häuser sind meine Leidenschaft.«
»Aber sicher. Nach dem Essen, wenn Sie einverstanden sind. Und nachdem Sie mir erzählt haben, was Sie hierherführt und warum Sie meine Mutter suchen.«
»Sie können so gut kochen, wie das Haus schön ist«, lobte Otto, nachdem sie die Mahlzeit beendet hatten, und dachte kurz an Helga, die diese Kunst überhaupt nicht beherrschte und deren Gegenwart er immer weniger ertrug, weshalb er sich nach ihrem letzten Streit mit dem Vorwand, einen Kongress in der Schweiz besuchen zu wollen, für einige Tage verabschiedet hatte, um endlich das zu tun, was er schon so lange vorhatte: auf den Spuren der Vergangenheit wandeln. Irinas Spuren. Allerdings hatte er erwartet, eine Dame Ende 60 anzutreffen. Dass stattdessen ihre Tochter vor ihm stehen und ihn derart in ihren Bann ziehen würde, hatte er nicht erwartet. Melissa Schmidt hatte etwas an sich, das ihn tief in seinem Innern berührte. Sie war längst nicht so aufregend und schön wie seine Frau, aber sie strahlte eine Klarheit, Entschlossenheit und Lebensfreude aus, die ihn regelrecht verzauberte. Obendrein schien sie blitzgescheit zu sein und einen Sinn für Humor zu haben. Und kochen konnte sie obendrein!
Jetzt sah er zu seiner Begeisterung, dass sie angesichts seines Kompliments errötete.
»Nun, wirklich großartig ist es nicht, ich hatte ja keine frischen Sachen, sondern musste mich an den Vorräten meiner Mutter bedienen«, sagte sie. »Aber ich wollte Ihnen etwas für diese Region Typisches vorsetzen.«
Melissa hatte ihrem Gast Maultaschen in der Brühe mit geschmälzten Zwiebeln und Kartoffelsalat serviert.
»Eigentlich hätte es ein Felchen geben müssen, aber leider habe ich zufällig kein fangfrisches im Haus.«
Er lächelte. »Ich habe schon lang nicht mehr so gut gegessen«, versicherte er erneut.
»Wären Sie ein halbes Jahr später gekommen, hätte ich Ihnen noch einen Kuchen zum Nachtisch anbieten können.«
Er sah sie fragend an.
»Meine Eltern haben mir das Haus überschrieben«, erklärte sie. »Wie Sie ja schon wissen, bin ich Konditorin. Ich will hier ein Café eröffnen.«
»Eine wunderbare Idee«, sagte Otto und sah sie unverwandt an. »Das Ambiente ist einfach großartig, und wenn Sie so wunderbar backen wie Sie kochen, dann wird das hervorragend laufen.«
»Wenn es denn irgendwann läuft.« Melissa starrte betrübt vor sich hin. »Ich wollte eigentlich schon im Frühjahr eröffnen.«
»Bis dahin ist doch noch Zeit. Woran hakt es denn?«, fragte Otto.
»An der Bank. Es sah anfangs alles ganz gut aus, sie wollten mich unterstützen, fanden, das Haus an sich stelle eine große Sicherheit dar, und das sei alles kein Problem.«
»Und dann?«
Sie seufzte wieder. »Seither warte ich. Ich habe wirklich eine nette und bemühte Bankberaterin, die auf meiner Seite steht, aber die scheitert ständig an irgendwelchen Auflagen von irgendwelchen Sachbearbeitern im Hintergrund.«
»Es tut mir leid.« Otto zupfte gedankenverloren eine verwelkte Blume aus dem Strauß auf dem Tisch und blickte Melissa tief in die Augen, als er sagte: »Aber ich weiß, Sie werden das schaffen.«
Melissas Herz begann wild zu schlagen. Von diesem Mann ging ein Zauber aus, den sie schon vom ersten Moment an wahrgenommen, aber entschlossen zur Seite gedrängt hatte. Unbewusst griff sie nach der Blume, wobei sich ihre Hände leicht berührten, und es durchfuhr Melissa wie ein Schlag. Als hätte sie sich verbrannt, zog sie die Hand ruckartig zurück, die Blume fiel zwischen ihnen auf den Tisch.