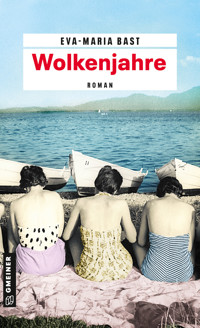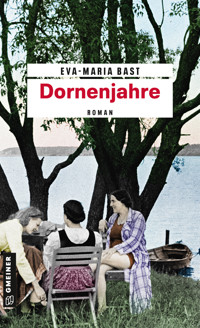9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie war die Sonne von Paris, vom Dunkel verfolgt – In ihrem Roman beleuchtet Eva-Maria Bast die berühmt-berüchtigte Spionin Mata Hari, eine der schillerndsten Figuren ihrer Zeit, in neuem Licht. Paris, 1905. Margaretha Geertruida Zelle steht vor dem Nichts: ohne Mann, ohne Geld, ohne ihre geliebten Kinder. Alles, was ihr geblieben ist, ist ihre Schönheit – und ihr Hang zur Hochstapelei. Sie tanzt in den Salons der High Society, verkauft sich spärlich bekleidet als geheimnisvolle Exotin, zieht die Leute mit der Mischung aus Erotik und Eleganz in ihren Bann. Der Plan geht auf: Margaretha wird zum Mythos, zur Ikone, die mächtigen Männer der Welt liegen ihr zu Füßen. Und die Kunstfigur Mata Hari wird geboren, die »aufgehende Sonne« am Pariser Himmel. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten … Die Journalistin Eva-Maria Bast ist Verlegerin, Autorin sowie Chefredakteurin der Zeitschrift Women's History – Frauen in der Geschichte. Für ihre Arbeiten erhielt sie bereits dreimal den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
ww.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die aufgehende Sonne von Paris« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com und Historic Images / Alamy Stock Photo; Kolorierung Motiv »Mata Hari« von Olga Shirnina
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Java 1899
Teil 1
1904–1905
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Teil 2
1906–1907
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Teil 3
1909–1912
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Epilog
Danksagung
Spuren der Realität
Quellen und Literatur
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Prolog
Java 1899
Ich möchte so gern mit euch spazieren gehen.« Der kleine Junge schob seine fieberheißen Händchen in die seiner bekümmerten Eltern, die seit seiner schweren Erkrankung Tag und Nacht an seinem Bett weilten.
Margaretha MacLeod drückte die Hand ihres Sohnes ganz vorsichtig, öffnete den Mund, um etwas zu sagen, ihm zu versichern, dass ein Spaziergang durch Javas bunte Blütenwelt genau das sei, wonach ihr ebenfalls der Sinn stand. Doch da sackte der Kopf des Kleinen zur Seite. Margaretha schrie erschrocken auf und wandte sich Hilfe suchend zu dem Arzt um, der etwas abseits gestanden hatte, um den Moment nicht zu zerstören. Sofort eilte Dr. Smith herbei, untersuchte den Jungen und erklärte mit bekümmerter Miene: »Er hat das Bewusstsein verloren.«
Margaretha schluchzte auf und presste sich erschrocken die Hand vor den Mund. »Nein.«
»Das ist alles deine Schuld!« Die Worte, die ihr Mann John ihr entgegenschleuderte, waren wie Peitschenhiebe.
Margaretha starrte ihn nur stumm an. Reichte es nicht, dass er sie schlug, betrog, beschimpfte und misshandelte? Konnte er sich nicht wenigstens in einem Moment wie diesem zurückhalten? Absurderweise unterstellte er ihr stets, ihn zu betrügen, dabei war er es, der sein Bett jede Nacht mit einem der Dienstmädchen teilte. Alle sollten sie ihm zu Willen sein.
Margaretha sandte ihm einen hasserfüllten Blick, beschloss dann aber, nicht näher auf seine Unterstellungen einzugehen. Sie wollte ihre Kraft lieber ihrem Sohn geben, damit er gesunden konnte. So wie seine Schwester Jeanne-Louise, genannt Non, die im Nebenzimmer lag und inzwischen zumindest wieder auf dem Weg der Besserung war.
»Was können wir tun?«, fragte sie den Militärarzt.
»Im Augenblick nicht viel«, antwortete der Mann bedauernd. »Bleiben Sie einfach bei ihm, und halten Sie seine Hände. Das wird ihm Kraft geben.«
Margaretha nickte.
»Ich sehe nach Ihrer Tochter und bin gleich wieder bei Ihnen«, fuhr Dr. Smith fort. In der Tür drehte er sich noch einmal um und sagte: »Eins noch. Versuchen Sie, Auseinandersetzungen vor dem Kleinen unbedingt zu vermeiden. Auch wenn er nicht bei Bewusstsein ist, könnte er das mitbekommen, und er sollte sich unter keinen Umständen aufregen. Das wäre fatal.«
»Natürlich«, versicherte Margaretha und warf ihrem Mann einen warnenden Blick zu, den dieser finster erwiderte.
Dann nahm sie Normans Hand wieder in die ihre und betrachtete liebevoll das schweißnasse Gesichtchen. In welcher Hölle war sie nur gelandet! Ihre Kinder waren vergiftet worden, ihr Mann hatte sich als eifersüchtiger und gewalttätiger Alkoholiker erwiesen, und wenn sie inzwischen auch etwas mehr in Niederländisch-Ostindien angekommen war und vor allem die Tänze und Bräuche der javanischen Frauen sie zu faszinieren begannen, war sie doch einsam, so fern von der Heimat. Dabei hatte alles so romantisch begonnen! Nachdem ihr Vater pleitegegangen war, hatte Margaretha Gertrudia Zelle nach einem Mann Ausschau gehalten, der in der Lage wäre, sie zu versorgen, und diesen Mann in dem zwanzig Jahre älteren John Rudolf MacLeod, der seinerseits per Zeitungsannonce nach einer Frau gesucht hatte, gefunden. Groß und stattlich war er gewesen, er hatte ihr gefallen in seiner Uniform, und was er ihr erzählte von dem fernen Niederländisch-Ostindien, in das er als Offizier der Kolonialtruppen bald reisen und sie mitnehmen würde, hatte paradiesisch geklungen. Sorgenfrei würden sie dort leben können, an langen Sandstränden unter Kokospalmen entspannen. Und Margaretha hatte sich nur zu gerne fortgeträumt. Dass er die Wahrheit sagte, wusste sie auch deshalb, weil überall in der Stadt Plakate hingen, die ein Leben in den Kolonien anpriesen und auf denen ebendas abgebildet war, was John ihr beschrieb: das Paradies.
Vor etwas mehr als zwei Jahren waren sie dann mit Norman an Bord des Linienschiffs SS Prinses Amalia gegangen. Ihrem Jungen, der jetzt so hilflos vor ihr lag. Sie schluckte, und während sie wieder sein liebes Gesichtchen betrachtete, verloren sich ihre Gedanken erneut.
Wie aufgeregt sie gewesen war! Leuchtend und verheißungsvoll lag die Zukunft vor ihr, und wenn John auch ohne Zweifel manchmal etwas einsilbig war, so war er doch ausgesprochen aufregend. In seiner Uniform fand sie ihn sehr attraktiv, im Bett verstanden sie sich hervorragend. Dem gemeinsamen Sohn war er ein zärtlicher und liebevoller Vater. Doch dann hatte sich das Blatt gewendet: Nach einem kurzen Aufenthalt in Batavia hatten sie die erste Zeit in Ambarawa verbracht, einem winzigen Dorf mitten im Dschungel. Margaretha hatte sich in dem winzigen Holzhaus furchtbar unwohl gefühlt. Nur eine weitere andere weiße Frau gab es in der Garnison, und die war schrecklich langweilig. Die Einheimischen, die sie sich in Holland so aufregend und exotisch vorgestellt hatte, waren ihr einfach nur fremd und unheimlich. Zu allem Überfluss war sie wieder schwanger und hatte grässliche Angst davor, mitten in diesem Urwald entbinden zu müssen. Doch dann hatte sich das Blatt noch einmal zu ihren Gunsten gewendet – zumindest kurz. John war nach Tumpang in der Nähe von Malang versetzt worden. Hier ging es zivilisierter zu, sie lebten in einem schmucken Haus im Kolonialstil, es gab Pferde, auf denen sie reiten konnte, und auf den Rücken der Rösser fühlte sie sich endlich wieder frei. Auch die Garnison war deutlich größer als die letzte, die Offiziere warfen ihr bewundernde Blicke zu, sie war jung, schön und fühlte sich ausgesprochen begehrt. Am 2. Mai kam ein entzückendes Mädchen zur Welt, und Margarethas Leben hätte eigentlich perfekt sein können, wenn John sich nicht immer merkwürdiger verhalten hätte. Damals begann seine Alkoholsucht – und seine Affären. Gleichzeitig hatte er sie aber immer wieder des Betrugs beschuldigt, und als sie bei einer Theateraufführung anlässlich der Krönung der niederländischen Königin Wilhelmina die Hauptrolle gespielt hatte und bejubelt worden war und ein Offizier sie anschließend zum Tanzen aufforderte, machte John ihr in aller Öffentlichkeit eine Szene und erhob in jener Nacht das erste Mal die Hand gegen sie.
Unter gesenkten Lidern musterte sie verstohlen den Mann, der auf der anderen Seite des Bettes saß und seinen Sohn ansah. Voller Verzweiflung war dieses vom Alkohol rot geäderte, sonst so zornige Gesicht nun. Dass er ihr die Schuld am Zustand ihrer Kinder gab, war absurd, denn die Gerüchte, die in Medan an der Ostküste Sumatras, wohin John vor einem Jahr versetzt worden war, kursierten, gaben ihm zumindest allesamt eine Mitschuld. Die eine Variante besagte, ein Eingeborener, der von John geschlagen worden war, habe die Kinder vergiftet. Die Leute erzählten sich aber auch, es sei die Amme gewesen, mit der ihr Ehemann ein Verhältnis hatte. Um bei ihr freie Bahn zu haben, habe er ihren Mann verhaften lassen, und sie habe sich auf diese Weise gerächt. In der dritten Version war deren eifersüchtiger Ehemann der Giftmischer.
Was für ein Verrat.
Oder hatte John am Ende doch recht? »Du hast die Kinder vernachlässigt«, hatte er ihr vorgeworfen. Und tatsächlich hatte sie die beiden nach ihrer Ankunft in Medan nur zu gern in die Obhut der Amme gegeben, die sie ja noch nicht einmal kannte, und hatte sich mit ausgebreiteten Armen ins Stadtleben gestürzt. Denn Medan pulsierte, im Gegensatz zu dem Ort, an dem sie zuvor gelebt hatten. Es gab Elektrizität, Häuser mit mehreren Stockwerken, in deren untersten Etagen sich kleine tokos befanden, Ladengeschäfte, in denen man nach Herzenslust einkaufen konnte, und reich verzierte Kutschen, auf denen sich feine Damen durch die Stadt ziehen ließen. Margaretha war ausgehungert nach Zivilisation und ein wenig Luxus gewesen und hatte endlose Einkaufstouren unternommen – misstrauisch beäugt von den anderen Frauen der Garnison, die fanden, sie benehme sich wie eine Königin. Aber ihr Kaufrausch war doch nur ein Ventil für die Respektlosigkeit, mit der John sie behandelte!
Dennoch, erkannte sie jetzt, es war ein Fehler gewesen. Sie hätte bei ihren Kindern sein müssen. Sie nicht einer Wildfremden überlassen, die sie nun …
Margaretha beugte sich über ihren schlafenden Sohn, um ihn ganz sacht auf die schweißnasse Stirn zu küssen. Verzeih mir, mein Schatz, sagte sie, nur in ihren Gedanken, damit John sie nicht hören konnte. Bitte verzeih mir. Ich werde dich nie wieder im Stich lassen. Bitte, bitte verlass mich nicht.
Doch ihr stummes Flehen half nichts. Minuten später erschlaffte die kleine Kinderhand in der ihren. Norman war von ihnen gegangen.
*
Zwischen ihr und ihrem Schmerz lag ein Schleier. Margaretha wusste: Würde jemand diesen Schleier fortziehen, würde sie sterben. Die Schmerzen würden sie umbringen. Sie wusste nicht, ob sie dankbar für diesen Schleier sein sollte oder nicht, denn auch wenn er sie in gewisser Weise schützte, so lähmte er sie andererseits auch. Sie reagierte nicht, als John sie in seiner endlosen Trauer um seinen Sohn anschrie, sie aß nichts, sprach nicht, trank nur dann und wann einen Schluck Wasser. Sie weigerte sich, das Sterbebett ihres kleinen Jungen zu verlassen, und selbst als sie ihn irgendwann fortbrachten, gegen ihren Willen, begehrte sie nicht auf. Der Schleier verhinderte Reaktionen, so wie er Schmerz verhinderte.
Als sie ihn fortgebracht hatten, in einem winzigen, weißen Sarg, da wankte sie hinüber ins Nachbarzimmer, wo ihre Tochter noch immer in ihrem Krankenbett lag – auch wenn sie sich auf dem Weg der Besserung befand. Obgleich sie kleiner und zarter war als ihr großer Bruder, hatte die Einjährige den Giftanschlag überstanden. Stundenlang saß Margaretha stumm an ihrem Bett, hielt ihre Hand und fasste den Entschluss, ihre Tochter nie zu verlassen, immer bei ihr zu sein. Ihr Leben in ihren Dienst zu stellen und ununterbrochen auf sie aufzupassen. Was auch kommen möge.
Am Tag vor der Beerdigung polterte John herein, der in seinem Kummer um seinen Sohn umso mehr zum Alkohol griff. Er packte seine Frau am Arm, riss sie grob vom Krankenbett ihrer Tochter weg und warf sie buchstäblich zur Tür hinaus, um ihr dann zu folgen. Doch er tat noch etwas viel Schlimmeres, er zerriss den Schleier, der über Margarethas Schmerz gelegen hatte. »Wenn die Pest mich doch nur von dir befreien würde, damit ich wieder glücklich werden könnte, Griet«, spie er sie an, und die Spucketröpfchen flogen aus seinem Mund und landeten auf ihrem Gesicht. Sie wischte sie nicht fort. »Es ist mir unmöglich, dich, du … du … du Dirne, weiter um mich zu haben. Meinen Sohn hast du auf dem Gewissen. Meine kleine Non wirst du nicht auch noch bekommen. Ich werde alles tun, um dich mir vom Halse zu schaffen.«
Es dauerte eine Weile, bis Margaretha, nun ihres schützenden Schleiers beraubt, das alles begriff. Während John vor ihr tobte, brach in ihrem Innern alles über sie herein. Ihre Welt stürzte in sich zusammen. Sie realisierte – alles. Sie hatte ihren Sohn verloren.
John tobte weiter. Margaretha sah ihn voller Abscheu an. »Lass mich durch«, sagte sie schließlich, taub vor Schmerz. Sie versuchte, an ihm vorbei in das Krankenzimmer zu gelangen, doch er schob sie nur fort wie eine lästige Fliege. Wieder probierte sie es. Verzweifelt. Sie musste doch zu ihrer kleinen Non, sie hatte es doch versprochen!
»Du hältst dich von ihr fern, Griet!«, brüllte ihr Mann, packte sie bei den Oberarmen und schleuderte sie mit aller Kraft gegen die Wand. Und dann war da nur noch Schwärze.
*
Noch bevor Margaretha die Augen aufschlug, wusste sie, dass etwas Schreckliches geschehen war. Und dann kam die Erinnerung zurück. Der Schmerz fuhr wie ein bohrender Pfeil durch ihren Körper. Ihr Blick fiel auf die Betten neben ihr, in denen andere Frauen lagen. Sie waren verletzt, so wie John auch sie verletzt hatte. Sie war offensichtlich im Militärkrankenhaus und damit bei ihrer Tochter, Non. Hastig setzte sie sich auf und stöhnte gleich darauf vor Schmerz. Ihr tat jeder Knochen weh, John hatte sie wieder einmal übel zugerichtet. Dieser Bastard!
Sie quälte sich zur Tür und in den Gang hinaus. Sogleich eilte ihr eine Schwester entgegen. »Mevrouw MacLeod«, rief sie erschrocken. »Sie sollten noch liegenbleiben. Sie stehen noch immer schwer unter Schock! Und Sie haben Verletzungen davongetragen. Gestern sind Sie in Ihrem Kummer einfach gegen die Tür gelaufen und haben das Bewusstsein verloren!«
Margaretha musste ein bitteres Lachen unterdrücken. Gegen die Tür gelaufen! Es sah John ähnlich, dass er diese Ausrede erfunden hatte, nachdem er sie derart brutal niedergeschlagen hatte. Ihr Mann übernahm nie die Verantwortung für seine Taten, auch nicht hinsichtlich des Todes von Norman, ihrem kleinen Jungen.
»Ich muss zu meiner Tochter«, stieß sie hervor, doch die Krankenschwester schüttelte bedauernd den Kopf. »Ihr Mann hat Ihre Tochter gestern mit nach Hause genommen«, sagte sie. »Sie ist wieder so weit genesen.«
»Was?« Entsetzt starrte Margaretha die besorgte Schwester an. »Dann gehe ich zu ihr.«
»Aber Sie können doch nicht …«, setzte die Schwester an, doch Margaretha hieß sie schweigen. »Doch, ich kann«, sagte sie selbstbewusster, als sie sich fühlte. »Und ich muss.«
*
Nachdem der schützende Schleier zerrissen war, gab es nur eine einzige Möglichkeit für Margaretha zu überleben. Sie floh. Sie floh aus ihrem lieblosen, tristen, kalten Leben in eine buntere, farbenfrohere, liebevollere Welt. Java bot dafür die perfekte Kulisse. Zum Glück musste John bald nach der Beerdigung wieder zu seiner Arbeit zurückkehren, und Margaretha, die ihrem Mann inzwischen abgrundtiefen Hass entgegenbrachte, konnte ihren Tag gestalten, wie sie es wollte. Und wenn die Sitten und Gewohnheiten der Einheimischen sie in all ihrer Fremdheit anfangs auch eingeschüchtert, ja fast abgestoßen hatten, so ließ sie sich nun regelrecht von ihnen verzaubern. Ihr war, als nehme diese exotische, duftende Welt sie in ihre Arme, um sie zu trösten. Stundenlang ging sie mit Non durch die Straßen, ihre Finger strichen über die gewebten Sarongs, sie bewunderte die Farben der Gewürze und sog den Duft von Jasminblüten tief, ganz tief in sich ein. Und dann erlebte sie eine Offenbarung: Als sie eines Tages wieder einmal in Banjoe Biroe unterwegs war, vernahm sie mit einem Mal betörende Musik. Trommeln waren da und Flöten, außerdem noch einige weitere Instrumente, die sie nicht zuordnen konnte. Derartige Musik hatte sie schon öfter gehört, sie bisher aber immer abgelehnt. Nun wurde sie regelrecht in ihren Bann gezogen. Sie folgte den Klängen und sah auf einer kleinen Steinbühne zwei Frauen tanzen. Schlangenartig bewegten sich ihre Körper, die in halb durchsichtige Sarongs gewickelt waren. Sie schienen mit der Musik zu verschmelzen. In ihren Gesichtern sah Margaretha die völlige Hingabe. Ob das ging? Den Schmerz einfach aus sich herauszutanzen?
Begeistert sah sie zu, die kleine Non auf ihrem Arm war inzwischen eingeschlafen. Da die sprachbegabte Margaretha relativ gut Javanisch beherrschte, verstand sie, um was es ging: Sie wohnte der Vorstellung des mythischen Hindu-Epos Ramayana bei. Ihre Augen folgten den anmutigen Bewegungen der Bajaderen, und während sie ihnen zusah, war sie eine von ihnen, aufgehoben und geborgen in dieser duftenden, bunten Welt voller Sonnenschein.
Wie in Trance taumelte sie nach der Vorstellung durch die Straßen.
Dann ging sie in den kleinen toko, in dem sie zuvor die Sarongs bewundert hatte, kaufte einen ganzen Armvoll und ließ sich den ersten von einer strahlenden Javanerin, die sich vor Begeisterung über die Tatsache, dass eine Weiße die landestypische Kleidung tragen wollte, kaum halten konnte, anlegen. Nur die kleine Non wollte Margaretha ihr nicht anvertrauen, und so musste die Frau den Sarong wickeln, während sie ihre Tochter auf dem Arm hielt. Sie würde sie nie wieder in fremde Obhut geben.
Am Straßenrand kaufte sie auf dem Weg nach Hause noch eine Jasminblütenkette und steckte sich die duftenden weißen Sterne in ihr Haar. Sie ging barfuß und hatte das Gefühl, dass der Boden dieses Landes ihr durch diese Berührung Kraft gab. Die Wärme strahlte durch ihre Fußsohlen nach oben, als sei sie nun von einer Sonne durchdrungen, die die innere Kälte, unter der sie so lange gelitten hatte, verglühen ließ. Nun verstand sie, warum die Hindus und die Buddhisten ihre Tempel stets mit bloßen Füßen betraten.
Als sie nach Hause kam, sah John ihr fassungslos entgegen. »Das schlägt doch dem Fass den Boden aus!«, schrie er. »Willst du mich noch mehr blamieren, Griet? Kleidest dich wie eine Ureinwohnerin. Na ja, siehst ja auch ohnehin so aus.«
Doch Margaretha lächelte nur und ging, ohne ein Wort zu sagen, an ihm vorbei, nach oben in ihr Zimmer. Sie schloss die Tür von innen ab, legte ihr schlafendes Töchterlein in seine Wiege, setzte sich an ihren zierlichen Sekretär, zog einen Bogen Papier heraus und begann einen Brief zu schreiben – an ihre alte Freundin Ybeltje im heimischen Leeuwarden.
Liebe Ybeltje,
Java ist ein sehr romantisches und mythisches Land. Es ist ein Land unendlicher Möglichkeiten, und ich tauche immer tiefer in die Sitten und Gebräuche ein. Ich bin in Jasminblüten gehüllt und in die Geheimnisse der Götter eingeweiht worden. Ich bin nun eine javanische Tempeltänzerin, Ybeltje, kannst Du Dir das vorstellen!
Von ihrer Trauer um den kleinen Norman schrieb sie kein Wort, auch nicht von ihrem brutalen Ehemann. Sie war der Realität entflohen und hatte einen Weg gefunden, ihrem verzweifelten Leben zu entkommen. Margaretha McLeod, von ihrem Ehemann Griet genannt, gab es nicht mehr. Sie war eine andere geworden: Mata Hari.
Teil 1
1904–1905
1. Kapitel
Die Landschaft vor dem Zugfenster huschte vorbei. Dorf um Dorf, Baum um Baum. Margaretha sah hinaus, folgte den dahinfliegenden Welten mit ihren Augen. Sie war auf dem Weg nach Paris. Paris! Die Stadt der Liebe und des Lichts, die Stadt der Träume! In Paris, so hoffte sie, könnte sie das sein, was sie einmal gewesen war, bevor das Leben ihr so übel mitgespielt hatte. Die schöne Margaretha, genannt M’Greet, der die Welt zu Füßen lag. Sie gehörte in Samt und Seide gehüllt, ihr Hals, ihre Hände und Arme sollten von den herrlichsten Juwelen geschmückt werden.
Zwar war ihr erster Besuch in Paris vor einem Jahr ausgesprochen erfolglos verlaufen, und sie war ziemlich geknickt wieder zurückgekehrt, aber Aufgeben war noch nie eine Option gewesen, deshalb versuchte sie es nun erneut. Wie sie es anstellen sollte, ihre Reise diesmal erfolgreicher enden zu lassen, wusste sie allerdings noch nicht. Sie hatte keinen Centime in der Tasche. Aber sie hatte Fantasie. Und sie hatte ihre Schönheit.
Margaretha war derart in Gedanken versunken gewesen, dass sie gar nicht bemerkt hatte, wie sich die Szenerie draußen veränderte. Vor den Fenstern zogen nun graue Vorstadthäuser vorbei, groß waren sie und prachtvoll, und es wurden immer mehr, je näher sie dem Gare de l’Est und damit der Innenstadt kamen.
Mit quietschenden Bremsen fuhr der Zug schließlich in den Bahnhof ein. Margaretha erhob sich von ihrer Bank in der Holzklasse. Obwohl sie mehr als zwölf Stunden unterwegs gewesen war, hatte sie nicht wahrgenommen, wie unbequem ihr Platz eigentlich gewesen war. In ihren Träumen hatte sie sich ausgemalt, sie reise im komfortabel ausgestatteten Privatabteil eines reichen Geliebten.
Doch nun war sie in Paris angekommen. Und in der Realität. »Mademoiselle, Sie müssen aussteigen«, sagte der Schaffner, und Margaretha schenkte ihm einen tiefen Blick aus ihren dunklen Augen, der seine Wirkung nicht verfehlte. Der junge Schaffner schmolz regelrecht dahin. Wie sie das alle taten. Wenn John auch der reinste Teufel gewesen war und sie verflucht hatte: Die meisten Männer waren ihr verfallen. Margaretha hatte eine Menge Macht über sie. Und die würde sie zu nutzen wissen, damit ihr Traum wahr würde.
»Da … darf ich Ihnen mit dem Gepäck helfen?«, fragte der Schaffner diensteifrig.
»Ich habe keines«, ließ Margaretha ihn wissen. »Ich gedenke, mich in Paris vollkommen neu einzukleiden. Ich habe eine Erbschaft gemacht, müssen Sie wissen. Nur leider muss ich persönlich erscheinen, um an das Geld zu kommen. Deshalb bin ich auch mit der Holzklasse gereist.«
»Eine Erbschaft«, staunte der junge Mann und lief feuerrot an.
»Ja«, bekräftigte Margaretha. »Endlich habe ich auch das Geld, das meinem Stand angemessen ist. Ich bin nämlich eine javanische Prinzessin.«
Nun war es vollkommen um den Schaffner geschehen. »Kö … Kö … Königliche Hoheit«, stammelte er und verneigte sich.
Die junge Frau lächelte huldvoll. »Das nächste Mal«, verkündete sie, »das nächste Mal reise ich nicht mehr in der Holzklasse.«
»Si … si … sicher nicht, Königliche Hoheit.«
Unter Verbeugungen begleitete der vollkommen überforderte Schaffner Margaretha zur Tür und verneigte sich noch einmal, als sie dem Zug entstieg.
Margaretha hatte den jungen Mann schon wieder vergessen, als sie ihren Fuß auf die oberste der drei Tritte setzte und hinabstieg. Sekunden später berührte sie wieder einmal Pariser Boden. Sie atmete erwartungsfroh tief ein – und gleich darauf hastig wieder aus. Diese Großstadt roch nicht so, wie sie es sich erträumt hatte, um ehrlich zu sein, stank sie sogar ziemlich. Nach Urin, nach Benzin und noch etwas anderem, das sie nicht einordnen konnte. Aber war da nicht auch der Duft nach Jasminblüten? Und kroch nicht der Geruch frisch gekochten Kaffees in ihre Nase? Darauf musste sie sich konzentrieren und die negativen Aspekte einfach ignorieren. So hatte sie das schon immer gehandhabt und war dabei ausgesprochen erfolgreich gewesen. Und das Gebäude, in dem sie sich befand, war auf jeden Fall ausgesprochen prächtig.
Beeindruckt sah Margaretha zu den mächtigen Glasdächern hinauf, während sie weiter in Richtung Ausgang schritt.
»Attention!«, rief eine scharfe Stimme, doch es war zu spät. Nach oben blickend hatte Margaretha übersehen, wo sie hinging, und war mit einem Mann zusammengestoßen, der offenbar einen großen Stapel Papiere bei sich hatte. Durch den Zusammenstoß waren sie ihm entglitten und breiteten sich nun auf dem Bahnsteig aus. »Merde«, fluchte der Mann und schickte einen ganzen Schwall auf Französisch hinterher, den Margaretha nicht verstehen konnte, der aber nicht sonderlich freundlich klang.
»Pardon«, sagte sie hastig und ging in die Knie, um dem Mann beim Aufsammeln zu helfen.
Der hob den Kopf, um ihr einen verärgerten Blick zuzuwerfen, stutzte dann aber, und seine Augen leuchteten auf. Margaretha registrierte es zufrieden. Wie oft hatte sie diesen Ausdruck in Männeraugen schon gesehen. Das war etwas, worauf sie sich verlassen konnte. Sie bedachte ihr Gegenüber mit einem tiefen Blick und einem sinnlichen Lächeln, als sie sagte: »Ich bin untröstlich, Monsieur. Ich war so mit meinen Sorgen beschäftigt, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, wohin ich meine Schritte wende.«
Während sie sprach, half sie ihm, die Papiere einzusammeln, und gewährte ihm damit einen Einblick in ihr Dekolleté, das durch den Schnitt ihres Reisekleides geschickt betont wurde. Es verfehlte seine Wirkung nicht.
»Aber, Mademoiselle«, sagte er. »Sie haben Kummer? Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Ach«, seufzte Margaretha, »ich möchte Sie nicht mit meinen Sorgen belasten.«
»Ich bitte Sie«, sagte der Mann. »Ich helfe wirklich gern.«
»Ach«, seufzte Margaretha abermals, während sie sich langsam erhob und ihn dabei aus dem Augenwinkel musterte. Seine Kleidung war ausgesprochen exquisit, wirkte sehr kostspielig, und er war, wie sie sich eingestehen musste, äußerst attraktiv. Vermutlich war er ein Geschäftsmann, worauf auch die Aktentasche, die aus allen Nähten zu platzen schien, und die zahlreichen Papiere in seiner Hand hindeuteten. Der Mann hatte sich inzwischen ebenfalls erhoben und sah sie aus unfassbar blauen Augen eindringlich an.
Sie schenkte ihm ihrerseits einen tiefen Blick. »Stellen Sie sich vor, ich bin ausgeraubt worden!«
»Nein!«, rief der Mann. »Das ist ja schrecklich.«
Sie nickte. »Mein Gepäck ist weg. All meine Kleider und auch all mein Geld, ganz zu schweigen von meinem Schmuck. Nun stehe ich hier, vollkommen mittellos.«
»Aber das ist ja entsetzlich!«, empörte sich der Mann. »Haben Sie Anzeige erstattet?«
Sie schüttelte den Kopf. »Dazu hatte ich noch keine Gelegenheit. Ich weiß auch gar nicht, wo die Polizei ist, ich war noch nie in Paris. Und die beiden Herren, die Zeugen des Diebstahls wurden, meinten, dass es wohl aussichtslos sei. Zumal wir nicht sicher sind, wann genau das Gepäck abhandengekommen ist. Es muss sich irgendwann auf der Fahrt ereignet haben. Als ich aussteigen wollte, waren meine Koffer nicht mehr da.«
»Wie entsetzlich«, wiederholte der Mann. »Da kommen Sie zum ersten Mal in die Stadt der Liebe und dann werden Sie ausgeraubt. Wenn Sie erlauben, würde ich das gern wiedergutmachen.«
»Sie?«, entgegnete Margaretha mit gekonntem Augenaufschlag. »Aber Sie können doch gar nichts dafür.«
»Nun ja«, erwiderte der Mann. »Indem ich in Sie hineingerannt bin, habe ich mich ja in gewissem Sinne mitschuldig gemacht.«
Margaretha schenkte ihm erneut ein tiefes Lächeln. Sie wussten sehr wohl beide, dass sie es war, die den Zusammenstoß verursacht hatte.
»Da kann ich Sie doch hier nicht einfach so stehen lassen. Ich muss noch die Unterlagen bei der Bank abgeben«, sagte er und deutete auf den Stapel Papiere. Dann fuhr er fort: »Meine Kutsche steht draußen, und wenn Sie erlauben, würde ich Sie gern in eine angemessene Unterkunft bringen, sobald ich meine Angelegenheiten erledigt habe. Sie sind selbstverständlich mein Gast.«
Margaretha sah ihn gespielt verlegen an. »Ich stehe tief in Ihrer Schuld.«
Der Geschäftsmann, Margaretha schätzte ihn auf Mitte dreißig, lächelte. »Bei Ihrer Schönheit, wenn Sie erlauben, würde Sie wahrscheinlich jeder Mann nur allzu gern aus einer Notlage befreien.«
»Sie schmeicheln – und sind ein wahrer Gentleman.«
Der Mann schlug sich leicht gegen die Stirn. »Wenn ich das wäre, hätte ich nicht jede Etikette vergessen und mich Ihnen schon längst vorgestellt. Bitte verzeihen Sie meine Unachtsamkeit. Ihre Schönheit hat mich ganz durcheinandergebracht.« Er legte die rechte Hand an seinen Hut, um ihn zu lüften, verneigte sich leicht und sagte: »Gestatten: Louis Castagnole.«
»Sehr erfreut, Monsieur Castagnole«, erwiderte Margaretha lächelnd. »Ich bin Lady Margaretha MacLeod.«
»Angenehm.« Mit einer erneuten Verneigung küsste er ihre Hand.
Margaretha lächelte zufrieden. Das Glück war ihr hold. Endlich einmal. Faszinierend, welche Macht Geschichten hatten. Manchmal glaubte sie sogar selbst, was sie da so alles erzählte.
»Sie hätten sich keinen besseren Zeitpunkt für Ihren ersten Besuch in unserer Stadt aussuchen können«, sagte Louis Castagnole, als sie ihm gegenüber in der Kutsche Platz genommen hatte. Geschickt fädelte der Kutscher das Gefährt in den überbordenden Pariser Stadtverkehr ein. Es herrschte ein ungeheurer Lärm, und der Benzingeruch, den Margaretha schon beim Aussteigen aus dem Zug wahrgenommen hatte, war hier ungleich stärker, drang erbarmungslos durch die dünnen Kutschenwände. Dennoch ließ sie fasziniert ihre Blicke schweifen.
»Ich möchte unbedingt den Eiffelturm sehen«, sagte Margaretha aufgeregt.
»Mit Vergnügen. Wenn Sie erlauben, zeige ich Ihnen gerne die Stadt, nachdem ich Sie in Ihre Unterkunft gebracht und Sie sich ein wenig erfrischt haben.«
»Das wäre wundervoll.«
In diesem Moment hielt die Kutsche vor der Banque de Paris et des Pays-Bas, die in einem feudalen Gebäude in der Rue de Rougemont ihren Firmensitz hatte. »Es wird nicht lange dauern.« Ein angedeutetes Lächeln, dann war er aus der Kutsche gestiegen und kurz darauf im Bankhaus verschwunden.
Margaretha ließ sich tief in das Polster der Kutsche sinken, und während sie ihre Blicke über das feudale Bankhaus schweifen ließ, dachte sie, dass ihre Ankunft in der Stadt des Lichts nicht besser hätte verlaufen können. Doch auch wenn sie darüber hätte jubeln mögen: Wirkliche Freude wollte sich nicht einstellen, zu schwer wog immer noch der Schmerz, nach Norman nun auch ihre Tochter Non verloren zu haben. Zwar erfreute sich die Kleine bester Gesundheit, doch als sie sich schließlich von ihrem Gatten trennte – nach vielen schlechten Tagen, noch schlechteren Wochen und Monaten, nahm er ihr das Teuerste, was sie hatte. Ihre Tochter. Jeanne-Louise, zärtlich Non genannt. Selbst Briefe und Pakete, die sie an Non sandte, schickte er ungeöffnet wieder zurück. Sie hatte gekämpft wie eine Löwin, jedoch feststellen müssen, dass eine Frau im Vergleich zu einem Mann offenbar wenig Rechte besaß. Auch deswegen war sie nach Paris gekommen. Weil sie hoffte, hier, in der Stadt des Lichts, ihrer inneren Dunkelheit entfliehen zu können.
Sie schrak aus ihren trüben Gedanken hoch, als sich die Kutschentür öffnete und Louis Castagnole zurückkehrte. »Wie unaufmerksam von mir«, nahm er das Gespräch wieder auf.
Margaretha sah ihn fragend an. »Was ist unaufmerksam?«
»Sie müssen furchtbar hungrig sein. Darf ich Ihnen im Hotel etwas auf Ihr Zimmer bringen lassen und Sie heute Abend zu einem Diner einladen?«
»Sehr gerne, Monsieur Castagnole«, antwortete Margaretha, die erst jetzt bemerkte, dass sie tatsächlich großen Hunger verspürte.
»Sehr schön.«
2. Kapitel
Das Hôtel du Louvre erwies sich als prächtiger Jugendstilbau und war, wie Margaretha rasch feststellen konnte, mehr als standesgemäß. Obendrein ließ das Personal keinen Zweifel daran, dass ihr Begleiter bekannt und äußerst gern gesehen war.
Mit einer kleinen Verbeugung überreichte der Portier ihm den Schlüssel zu ihrem Zimmer. »Dürfen wir uns um Ihr Gepäck kümmern?«
Er sah sich suchend um.
Castagnole schüttelte bedauernd den Kopf. »Stellen Sie sich vor, Lady MacLeod wurde ausgeraubt. In der Bahn!«
»Wie schrecklich«, rief der Mann, doch Margaretha bemerkte, dass sich ein Hauch von Misstrauen in seine Augen schlich. Als lang gedienter Portier kannte er vermutlich jede Menge Geschichten, wahre und unwahre, und besaß einen siebten Sinn hinsichtlich der Unterscheidung derselben. Doch es war nur ein Moment gewesen, gleich darauf hatte sich der Portier wieder im Griff.
»Kann ich ansonsten noch etwas für Sie tun?«
»Sehr gerne, würden Sie bitte für mich und meine Begleitung für heute Abend einen Tisch im Café de Flore reservieren?«
»Selbstverständlich.«
»Werte Lady MacLeod«, wandte sich Louis Castagnole an Margaretha, während sie sich zu den Aufzügen begaben, »Sie sind sicherlich erschöpft von der anstrengenden Anreise nach Paris und der Aufregung um den Diebstahl Ihres Gepäcks.«
Als sie nickte, fuhr er fort: »Ich begleite Sie zu Ihrem Zimmer und lasse Ihnen wie versprochen eine kleine Stärkung bringen. Ich hätte aber noch eine Frage.«
»Jede.« Sie strahlte ihn an.
Während der Fahrstuhl unter der Regie eines etwa vierzehnjährigen Knaben in Livree, der vor Stolz um seine wichtige Aufgabe zu platzen schien, nach oben glitt, sagte Castagnole: »Da Ihnen ja Ihr gesamtes Gepäck geraubt wurde … dürfte ich Ihnen eine Auswahl an Kleidern auf Ihr Zimmer schicken lassen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich vor unserem Diner, auf das ich mich im Übrigen sehr freue, aus Ihren Reisekleidern befreien möchten.«
Margaretha bedachte ihn erneut mit ihrem reizendsten Lächeln.
»Sie scheinen Gedanken lesen zu können. Ich hatte mich schon gefragt, wie ich es bewerkstelligen sollte, heute Abend in angemessener Kleidung zu erscheinen.«
»Dann wird es mir eine Freude sein, dafür zu sorgen.«
Inzwischen waren sie in der Beletage, in der sich die besten Zimmer befanden, angekommen, und Margaretha wandte sich ihm zu. »Ich danke Ihnen sehr. Für alles.«
»Darf ich Sie um halb acht Uhr in der Hotelhalle erwarten?«
»Es wird mir eine Freude sein«, versicherte sie. Und sie meinte es auch so. Wer hätte vor ein paar Stunden gedacht, dass die Dinge sich so glücklich fügen würden! Endlich war da wieder jemand, der für sie sorgte. Endlich war sie wieder die kleine Prinzessin, die ihr Vater immer so verwöhnt hatte! Adam Zelle, der wohlhabende Hutmacher und Spekulant, hatte vier Kinder gehabt, aber sie, Margaretha, war stets sein kleiner Liebling gewesen. Er hatte sie verwöhnt, wann immer er nur konnte. Sogar eine kleine Kutsche, die von zwei weißen Ziegen gezogen wurde, hatte er ihr geschenkt! Was hatten die anderen Mädchen gestaunt und sie bewundert, als sie so durch das holländische Leeuwarden gefahren war. Allein, das war lange her. Ihre Mutter war inzwischen gestorben, das Geschäft des Vaters bankrott und Margaretha durch die Hölle gegangen. Doch nun schien sich alles wieder zum Guten zu wenden. Endlich!
Louis Castagnole hatte Wort gehalten und ihr sowohl köstliche kleine Speisen als auch eine große Auswahl exquisiter und ohne Zweifel sehr kostspieliger Kleider auf ihr Zimmer bringen lassen.
Margaretha, die schon gar zu lange ihrer Lust nach schöner Garderobe nicht mehr hatte frönen können, hielt sich, nach einem ausgiebigen Schaumbad in einer beinahe unverschämt großen Wanne, ein Kleid um das andere vor und hatte Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Louis Castagnole verfügte wirklich über einen ausgezeichneten Geschmack! Und ihre Kleidergröße hatte er mit schmeichelhafter Genauigkeit erraten.
Schließlich entschied sie sich für eine jadegrüne Robe mit tiefem Rückenausschnitt und steckte ihr langes dunkles Haar im Nacken zu einem losen Knoten zusammen. Dazu die tropfenförmigen Perlenohrringe, die der Vater ihr einst geschenkt hatte, der einzige Schmuck, den sie noch besaß, und sie war, wie sie fand, perfekt angezogen. Auf dem Weg nach unten bewunderte sie die luxuriöse Ausstattung des Hotels, schlenderte durch die Eingangshalle, blickte durch das Glasdach in den Abendhimmel. Die ersten Sterne funkelten ihr schon entgegen und spiegelten sich im Wasser des mit Blumen geschmückten Springbrunnens.
Auch die blauen Augen Castagnoles funkelten, als er seine schöne Begleitung erblickte.
*
Es war ein zauberhafter Abend gewesen. Louis Castagnole hatte die Erwartungen, die er zweifelsohne in ihr geweckt hatte, nicht enttäuscht. Sein Benehmen war formvollendet, das Abendessen vorzüglich, und je länger es dauerte, desto mehr hatte die Atmosphäre zwischen ihnen zu knistern begonnen. Hier eine flüchtige Berührung, dort ein tiefer Blick und am Ende des Abends das Geständnis: »Ich habe mich in Sie verliebt, Margaretha. Als wir auf dem Bahnsteig buchstäblich ineinandergerannt sind – das war Magie. Das war Schicksal.«
Sie musste sich keiner Lüge bedienen, als sie flüsterte: »Ja. Ja, das geht mir auch so.«
Zwar hatte sie sich nach der schmerzlichen Erfahrung mit John geschworen, nie wieder einen Mann in ihr Herz zu lassen, aber das Herz musste man vielleicht auch gar nicht öffnen, um das himmlische Prickeln zu genießen, das er in ihr erzeugte, und die Vorzüge, die er ihr in finanzieller Hinsicht zu bieten hatte, waren auch nicht zu verachten.
Louis Castagnole versank in einem innigen Handkuss, und nach dem Dessert gingen sie Arm in Arm zum Ausgang, wo bereits der Kutscher auf sie wartete und diensteifrig von seinem Bock sprang, um ihnen die Tür zu öffnen. Und sie gleich darauf wieder zu schließen.
Während die Pferde sich in Bewegung setzten, zog Louis Castagnole Margaretha MacLeod in seine Arme, um sie leidenschaftlich zu küssen.
Als die Kutsche vor dem Hotel hielt, begleitete Louis, ganz Gentleman, sie noch zu ihrer Zimmertür. Voller Verlangen sah er sie an, um sie sodann erneut zärtlich zu küssen. »Ich danke dir für einen zauberhaften Abend«, flüsterte er. »Morgen früh bin ich pünktlich um neun Uhr zur Stelle.«
Doch sie schüttelte den Kopf. »Bitte. Komm mit hinein. Ich möchte dich jetzt nicht loslassen.«
»Bist du sicher?«
»Ja.« Zum einen war da die Leidenschaft, zum anderen wollte sie in ihrer ersten Nacht in Paris nicht allein sein. Er würde ihr helfen, die bösen Geister zu vertreiben.
»Das lasse ich mir nicht zweimal sagen«, murmelte er und nahm ihr den Schlüssel aus der Hand.
3. Kapitel
In der Avenue Nicolas II hielt die Kutsche an. Nach einer leidenschaftlichen Nacht und einem petit-déjeuner im Bett hatten sie sich auf die von Margaretha herbeigesehnte und von Louis versprochene Stadtrundfahrt begeben. Ganz Gentleman, half er ihr aus der Kutsche.
»Das ist ja gigantisch«, staunte Margaretha, als sie das mächtige Gebäude erblickte, vor dem die Kutsche gehalten hatte.
»In der Tat, das ist es«, freute sich Louis über ihre Begeisterung. »Das ist das Grand Palais.«
»Wie lang ist es?«
»Stolze zweihundertvierzig Meter lang und vierundvierzig Meter hoch! Zusammen mit dem Petit Palais«, er deutete auf ein weiteres Gebäude, das dem ersten gegenüberlag, »war es Teil der Pariser Weltausstellung von 1900.«
»Die Weltausstellung!« Margaretha war wie elektrisiert. Im fernen Java hatte sie damals jeden Schnipsel verschlungen, den sie über die Pariser Weltausstellung hatte ergattern können. Dieser Fortschritt! Wie schnell die Welt sich weiterdrehte, während sie mitten im Dschungel festsaß, neben einem bösen, brutalen Mann, hatte sie damals gedacht. Und nun war sie hier. Es schien ihr ein gutes Omen zu sein, dass Louis sie, obwohl sie ihm mit keinem Wort von ihrer Begeisterung für die Weltausstellung erzählt hatte, zuerst hierhergebracht hatte.
»Warst du schon einmal drin?«, fragte sie, während sie sich bei ihm unterhakte und das Gefühl genoss, neben diesem offenbar sehr reichen, charmanten und gut aussehenden Mann an einem Ort zu stehen, auf den vor vier Jahren die ganze Welt geblickt hatte. Die Welt hatte doch so viel mehr zu bieten als Dschungel und Einsamkeit!
»Ja, sogar während der Weltausstellung«, sagte Louis nun. »Und ich bin auch mit dem rollenden Gehsteig gefahren.«
»Davon habe ich gelesen, aber vorstellen konnte ich mir das überhaupt nicht.«
»Es war wunderbar«, rief Louis, und Margaretha, die ihn schon in der vergangenen Nacht als ausgesprochen leidenschaftlich erlebt hatte, stellte fest, dass er diese Leidenschaft offenbar nicht nur im Bett zu empfinden imstande war. Seine Begeisterung gefiel ihr, steckte an, wirkte so jung und unbeschwert und half ihr, das Dunkel in ihrem Herzen zu verdrängen. Nur zu gern ließ sie sich darauf ein.
»Eine Fahrt kostete fünfzig Centimes, und man konnte dann in rund zwanzig Minuten einen Rundgang absolvieren. Dabei konnte man zwischen zwei Rollsteigen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten wählen«, erzählte er, während sie die Avenue Nicolas II entlangschlenderten.
»Und was hat dich auf der Weltausstellung am meisten beeindruckt?«, fragte Margaretha. »War es die Rolltreppe?«
Louis dachte angestrengt nach und entgegnete dann: »Das ist wirklich schwer zu sagen. Es gab so vieles, was ungemein faszinierend und neuartig war. Wenn ich mich unbedingt entscheiden müsste, würde ich vielleicht den Palast der Elektrizität wählen.«
»Erzähl mir mehr.«
»Gern.« Er hob ihre Hand an seinen Mund, um sie zu küssen, und fuhr dann in seiner Schilderung fort: »Der Palast lag am Ende vom Garten des Marsfeldes. Er hatte weder Eingang noch eine Fassade, sondern war wie ein Fächer geformt und befand sich oberhalb der Springbrunnen und Wasserspiele. Neben vielen anderen Statuen stand dort unter anderem die Elektrizitäts-Fee aufrecht in einem Wagen, der von Pegasus und einem Drachen gezogen wurde. Sobald die Dämmerung hereinbrach, wurde die Fee derart beleuchtet, dass man dachte, es wäre ein riesiges Feuerwerk.«
Lächelnd blieb er stehen, drehte ihr Gesicht zu sich und sah ihr zärtlich in die Augen. »Das würde übrigens auch zu dir passen, Elektrizitäts-Fee. Besonders, wenn ich an die letzte Nacht denke.«
Sie erwiderte seinen Blick, und auch dieses Mal verfehlte er seine Wirkung nicht.
*
Die nächsten Tage vergingen wie im Flug, Margaretha und Louis erkundeten gemeinsam Paris und liebten sich nach opulenten Abendessen leidenschaftlich und hingebungsvoll. Heute jedoch musste Louis, der, wie er Margaretha inzwischen berichtet hatte, ein bedeutender Weinhändler war, tagsüber zu einer Besprechung in die Banque de Paris et des Pays-Bas.
»Ich werde dich vermissen, mein Engel«, sagte er, als er sie am Morgen leidenschaftlich küsste. »Bitte vertreib dir die Zeit, und besorge dir neue Garderobe und Geschmeide. Lass es dann auch auf meine Kosten anschreiben und ins Hotel bringen.«
»Aber das kann ich doch nicht annehmen, mein Liebling!«, widersprach Margaretha.
»Aber sicher kannst du«, sagte er. »Du tust mir damit sogar einen Gefallen.« Er band sich die Schuhe zu und stand dann auf. »Ich habe genug Geld auf der Bank. Ich habe es im Überfluss, und ich brauche es nicht. Es ist mir ein großes Vergnügen, die Frau meiner Träume zu verwöhnen. Bitte kauf dir alles, was dein Herz begehrt.«
»Wenn du dir wirklich sicher bist.«
»Und wie sicher ich mir bin. Ich bin gespannt, was du mir nach meiner Rückkehr heute Abend präsentierst.«
*
Trotz Louis’ Aufforderung, sie solle kaufen, was das Herz begehrt, war Margaretha anfangs durchaus noch etwas zögerlich, als sie durch die Galeries Lafayette schlenderte, und ließ zunächst nur kleine Dinge zurücklegen. Schließlich kam Louis nicht nur für ihr Hotelzimmer auf, sondern erfüllte ihr auch ansonsten nahezu jeden Wunsch. Als sie aber die Pelze sah, die sich herrlich weich und in beinah unverschämter Fülle aneinanderreihten, war es um sie geschehen. Wie sehr hatte sie sich schon immer einen solchen gewünscht, und Louis hatte sie ja regelrecht aufgefordert, alles, aber wirklich alles anzuschaffen, was sie sich wünschte. Ohnehin war es ausgesprochen kühl im herbstlichen Paris, bald würde der Winter hereinbrechen, und sie bräuchte etwas, das sie warm hielt. Louis hätte bestimmt nichts dagegen. Zwar war ein Pelz ohne Frage ungleich teurer als ein Wintermantel, aber hatte er nicht gesagt, er habe mehr Geld, als er je ausgeben könne? Und ein Pelz würde ihm, da war sie sich sicher, auch ausgesprochen gut gefallen!
Kaum hatte die Verkäuferin sie aufgefordert, ihn doch zumindest einmal probeweise zu tragen, wusste sie, dass sie ihn unbedingt haben musste. Damit war der Damm gebrochen. Und von dem Moment an gab es kein Halten mehr.
Als der Page am späten Nachmittag an ihrer Tür klopfte und die Pakete ins Zimmer schob, die soeben von den Galeries Lafayette geliefert worden waren, bekam sie dann dennoch ein schlechtes Gewissen. Ein Paket reihte sich ans andere. Hatte sie es doch übertrieben? Was, wenn Louis böse auf sie werden würde? Doch ihre Angst war vollkommen unbegründet, wie sich zeigte, als Louis, der inzwischen offiziell in ihrer Suite eingezogen war, am Abend zurückkam. Eher amüsiert als verärgert betrachtete er all ihre Anschaffungen und bestand darauf, dass sie ihm ein Kleid nach dem anderen vorführte. Und der Pelz fand besonderen Gefallen. Erleichtert ließ sich Margaretha in seine Arme ziehen und voller Inbrunst küssen.
4. Kapitel
Das darf doch nicht wahr sein«, brüllte Louis aus dem Salon ihrer Suite. Margaretha, die gerade im Badezimmer damit beschäftigt gewesen war, ihre Morgentoilette zu erledigen, eilte erschrocken herbei. Sie fand ihren Liebsten mit zornesrotem Gesicht im Raum stehen, ein Telegramm in der Hand.
»Aber was ist denn geschehen?«
»Ach, man kann nicht einmal ein paar Tage nach Paris fahren, ohne dass sie einem die Existenz aufs Spiel setzen«, schnaubte er.
»Möchtest du mir davon erzählen?«, fragte sie zaghaft, doch Louis reagierte gar nicht auf sie, schimpfte nur weiter vor sich hin. Er schien sich selbst immer mehr hochzuschaukeln. Plötzlich stieß er einen lauten Schrei aus, griff nach einem Glas in Kristallschliff, das auf der Bar bereitstand, und schleuderte es mit Wucht gegen die Wand. Margaretha keuchte entsetzt auf. Sie kannte diesen überbordenden Zorn. Und sie wusste, wo er enden konnte. John war anfangs schließlich ausgesprochen charmant und großzügig gewesen – selbst wenn er mit seiner eher einsilbigen Art in keiner Weise mit Louis mithalten konnte –, und auch mit ihm hatte sie im Bett wahre Leidenschaft erlebt. Dann, als er sich ihrer sicher sein konnte, hatte er sich nach und nach zu dem wütenden, aggressiven Mann entwickelt, vor dem sie solche Angst hatte. Was, wenn sie dieses Schicksal ebenfalls mit Louis erwartete, der da stand und immer weiter schimpfte, bis sie schließlich ins Badezimmer floh. Floh, vor ihm und ihren Erinnerungen. Doch die Flucht vor der Vergangenheit gelang ihr nicht. Die dunklen, düsteren Bilder holten sie ein. Da war John, der wutentbrannt nach Hause stürmte, weil er in der Stadt gehört hatte, dass sie mit einem anderen Mann geflirtet habe. John, wie er sie mit Fragen bombardiert und ihre Antworten nicht hatte hören wollen. Wie er sich in seinen Zorn hineingesteigert hatte, bis er ihr das erste Mal ins Gesicht schlug. Fassungslos hatte sie ihren Mann angestarrt. Doch statt erschrocken über seine Tat zu sein, hatte er nur erneut ausgeholt und vollkommen besinnungslos auf sie eingeschlagen. In der Erinnerung hielt sie schützend die Arme über ihren Kopf, es war ihr, als spürte sie erneut jeden Schlag, die Erniedrigung, die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit.
Schluchzend ließ sie sich auf den Boden sinken und kauerte sich zusammen wie ein Kind.
Es dauerte eine Weile, bis das Klopfen in ihr Bewusstsein drang. Sie hob lauschend den Kopf und hörte nun auch Louis’ Stimme.
»Margaretha, Schatz, mach doch bitte die Tür auf.«
Zitternd erhob sie sich, wischte sich die Tränen vom Gesicht und drehte den Schlüssel herum.
Zögernd öffnete Louis die Tür und erschrak offenbar, als er sie derart aufgelöst vor sich stehen sah. Hilflos sah er sie an. »Ich habe dich erschreckt mit meinem Zorn, nicht wahr?«
Sie schluckte. »Ja.«
»Das tut mir unendlich leid«, sagte er. »Wenn ich etwas nicht wollte, dann das. Es ist nur … einer meiner Mitarbeiter hat einen schlimmen Fehler gemacht, der dazu führen könnte, dass mein gesamtes Unternehmen in Gefahr ist.«
Natürlich, dachte Margaretha. Es gab immer einen Grund, immer eine Ausrede.
»Ich muss dich morgen noch mal allein lassen und mich um diese Sache kümmern.« Er nahm ihre Hand. »Es tut mir so leid. Das alles.«
»Schon gut«, sagte Margaretha und schob sich an ihm vorbei. Wenn sie ehrlich war, war sie froh, den Tag morgen allein verbringen zu können.
»Ich bin müde«, sagte sie. »Ich möchte mich ein wenig hinlegen.«
Hilflos sah er ihr nach, und sie war dankbar, dass er ihr nicht folgte.
*
Irgendwann war er zu ihr gekommen, hatte sie zaghaft in die Arme genommen, doch sie hatte sich schlafend gestellt, ebenso wie am nächsten Morgen, als er sich für den Tag fertig machte. Erst als er das Zimmer verlassen hatte, sprang sie auf, kleidete sich an und ging nach nebenan in den Salon, an dem er am Abend zuvor das Glas gegen die Wand geschleudert hatte. Keine Spur war mehr davon zu sehen, die Scherben waren ordentlich aufgekehrt worden. Auf dem Tisch fand sie einen Briefumschlag, auf dem ihr Name stand. Bevor sie ihn öffnete, wusste sie, was darin stand. Er würde sich noch einmal entschuldigen und ihr versichern, das werde nie wieder geschehen. John hatte das auch immer getan. Anfangs zumindest. Doch seine Wut war jedes Mal zurückgekehrt, sie war nicht zu bezähmen.
Nachdenklich überflog sie die Zeilen, die enthielten, was sie erwartet hatte. Tat sie ihm unrecht? Schließlich hatte seine Wut sich nicht gegen sie gerichtet. Und sie war sicherlich in dieser Hinsicht besonders empfindlich, traumatisiert von ihren Erlebnissen mit John. Aber war es nicht unwichtig, gegen wen oder was sich eine Wut richtete? Irgendwann würde Louis sich über sie ärgern. Das ließ sich gar nicht vermeiden. Würde er dann das Glas nach ihr statt nach der Wand werfen? Würde er sie schlagen? Vergewaltigen? War sie wahnsinnig, wenn sie das glaubte? Oder nur realistisch?
Nach dem Frühstück unternahm Margaretha einen langen Spaziergang an der Seine, und sie merkte, wie gut es ihr tat, ihre Gedanken fließen zu lassen. Sie schritt weit aus, und das brachte ihr Klarheit. Sie würde ihm noch eine Chance geben. Aber sie würde auf der Hut sein. Und sich nie so weit von ihm abhängig machen, dass sie nicht jederzeit gehen konnte. Das bedeutete auch, dass sie sich Gedanken darüber machen musste, wie es in Paris ohne ihn weitergehen könnte. Weiter ging sie und immer weiter, bis sie schließlich vor einem lang gestreckten Gebäude angekommen war. »Reitschule«, stand dort in großen Lettern zu lesen. Margaretha lächelte. Eine Reitschule, dachte sie. Reitschulen brauchten Reitlehrer. Sie liebte Pferde, und nicht nur ein Mann hatte ihr versichert, dass sie in der Lage sei, zu reiten wie eine junge Göttin. Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Vielleicht läge hier ihre Zukunft.
*
Sie hatten sich ausgesprochen, doch die Leichtigkeit, der Zauber der ersten Tage kehrte nicht zurück. Immerhin genossen sie beide die körperliche Nähe, vielleicht, so hoffte sie, würden sie dieserart ihre innere Distanz überwinden können. Und auch ansonsten gab Louis sich alle erdenkliche Mühe, seine Liebste zu überraschen. Für den heutigen Sonntag hatte er einen Ausflug zum Eiffelturm geplant, und als sie auf die Aufzüge zugingen, da war Margaretha tatsächlich für einen Moment glücklich und beinahe in der Lage, ihre innere Distanziertheit zu vergessen. Bewundernd legte sie den Kopf in den Nacken und sah hinauf. Endlich wurde ihr Traum wahr!
Im Aufzug zog Louis sie in seine Arme, und sie ließ es geschehen. »Glücklich?«, fragte er dicht an ihrem Ohr.
»Ja«, sagte sie, während sie nach oben entschwebten.
»Dann wirst du gleich noch viel glücklicher sein«, prophezeite er ihr. »Wir werden nämlich auf dem Eiffelturm zu Abend essen. Ich habe einen Tisch reservieren lassen.«
»Oh, Louis!« Sie küsste ihn strahlend. »Das ist einfach wunderbar.«
»Dann hast du mir meinen Wutausbruch also verziehen?«
Sie zögerte nur einen Moment. Sie konnte ihm ja schlecht ihre Vorgeschichte und all ihre Überlegungen offenbaren. Sie hatte ihm verziehen, aber auch beschlossen, eine gewisse Grenze mit ihm niemals zu überschreiten. Aber das musste er ja nicht wissen.
Insofern gab sie ihm noch einen Kuss und sagte: »Ja. Ja, das habe ich.«
Der Aufzug hielt auf der ersten Plattform, und sie stiegen aus.
»Was für ein Ausblick«, staunte Margaretha und schmiegte sich in seine Arme. Beinah überrascht stellte sie fest, dass es sich gut anfühlte und sie sich sogar geborgen fühlte.
»Ich kann mich auch nie sattsehen«, versicherte er, während sie auf das Grand Palais blickten. »Weißt du, dass Gustave Eiffel bei der Eröffnung in Begleitung des Ministerpräsidenten am 31. März 1889 um Punkt 13:30 Uhr mit dem Aufstieg auf den Eiffelturm begann?«
Margaretha schüttelte den Kopf, »Ich weiß nur, dass es wohl genau 1792 Stufen bis zur Spitze sein sollen und dass Eiffel diese Zahl bewusst gewählt hatte.«
Ende der Leseprobe