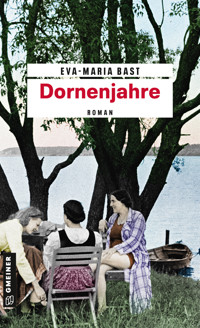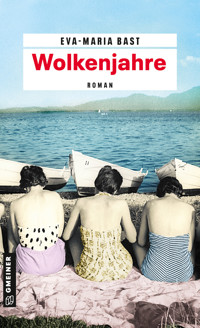
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jahrhundert-Saga
- Sprache: Deutsch
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, Johanna, Sophie und Luise klauben die Scherben ihrer Leben zusammen. Luise glaubt, Kriegswitwe zu sein und heiratet erneut, eine Entscheidung, die sie Jahre später das Leben kosten wird. Johanna gibt die Suche nach ihrer verlorenen Tochter nicht auf. Eine Suche, die sie an den Rand ihrer Kräfte führt. Und Sophie braucht lange, um den Verlust ihres Mannes zu verkraften. Dann begegnet ihr eine neue Liebe - in sehr überraschender Form …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva-Maria Bast
Wolkenjahre
Vierter Teil der Jahrhundert-Saga
Zum Buch
Drei starke Frauen »Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die Welt liegt in Trümmern. Luise, Johanna und Sophie sammeln mit vereinten Kräften die Scherben ihrer Leben auf. Da Luises Mann nicht aus dem Krieg zurückkehrt und sie sich neu verliebt, lässt sie ihren Gatten nach langem Zögern für tot erklären – und ausgerechnet da kehrt Roman zurück und stürzt alle in ein großes Chaos. Sophie in Frankreich braucht lange, um wieder in der Realität anzukommen und den Verlust ihres Mannes zu verkraften. Manon, die im Krieg ebenfalls Schlimmes erleiden musste, steht ihr zur Seite, und Sophie bemerkt, dass sie mehr für die Freundin zu empfinden beginnt. Johanna kämpft am Bodensee um den Wiederaufbau ihrer Firma und um ihre Tochter, die im Zweiten Weltkrieg verschwunden ist. Eine Suche, die sie an den Rand der Verzweiflung bringt – und deren Ende bis in die nächste Generation und in die Gegenwart führt. Und dann ist da noch Irina, die Russin, die gemeinsam mit ihrer Freundin Annemarie Waisenkinder aus den Wäldern rettet – und in der DDR für das persönliche Glück ihrer Schützlinge kämpft.«
Eva-Maria Bast wurde 1978 in München geboren, arbeitet seit 1996 als Journalistin und ist Leiterin der »Bast Medien GmbH«. Für ihre Arbeit wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt Eva-Maria Bast dreimal den »Oscar« der Zeitungsbranche, den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seit 2016 ist Eva-Maria Bast Dozentin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Sie lebt mit ihrer Familie in Überlingen am Bodensee und in Würzburg.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Oscar Poss
ISBN 978-3-8392-5706-7
Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen werden die ersten drei Teile der Mondjahre-Saga bereits kennen. Für diejenigen, die Band 1, 2 und 3 nicht gelesen haben, habe ich hier eine kurze Zusammenfassung geschrieben. Auch wenn jeder Band in sich abgeschlossen ist, sind manche Handlungsstränge doch besser zu verstehen, wenn man weiß, was sich bisher ereignet hat.
Herzlichst, Ihre Eva-Maria Bast
Was bisher geschah
Band 1 – Mondjahre
Deutsches Reich 1914: Johanna Gerstett ist voller Idealismus, mutig und ein wenig unkonventionell. Sie hat Lust auf das Leben, will die Welt erobern. Und sie ist zum ersten Mal verliebt – in den Studenten Sebastian Bigall. Auch ihre Tante Sophie, die nur wenige Jahre älter ist als Johanna, hat ihr Herz verloren: an Pierre Didier, einen französischen Journalisten, der über den weltweit Aufsehen erregenden Ferdinand Graf Zeppelin recherchiert. Sowohl Sophie als auch Johanna interessieren sich – für die damalige Zeit ungehörigerweise – für Politik. Und so sind sie beunruhigt über die Aufrüstung der europäischen Staaten und beobachten besorgt die Wolken, die am Horizont aufziehen. Als der österreichische Thronfolger in Sarajevo erschossen wird, erleben Johanna und Sophie die Wirren der Tage des Kriegsausbruches mit, die Hamsterkäufe, die Jagd nach Gold, die Kriegsbegeisterung einerseits und andererseits die Angst. Als sich die Fronten zwischen Deutschland und Frankreich verhärten, verlässt Sophies Geliebter das Land – vor seiner Abreise verloben sich die beiden und schlafen miteinander, ein verzweifelter Akt. Sophie wird schwanger, schwanger vom Feind.
Auch Sebastian und Johannas junger Onkel Siegfried müssen in den Krieg ziehen. Siegfried ist beim Kampf um Neidenburg in Ostpreußen dabei und verliebt sich in Luise, bei deren Familie er einquartiert ist. Als die Russen vorrücken, ziehen sich die deutschen Truppen aus Neidenburg zurück – und Siegfried beschwört Luise, mit ihm zu kommen. Aber sie muss auf ihre Eltern warten, die dann jedoch grausam ermordet werden. Schier besinnungslos vor Schmerz, Wut und Hass erlebt Luise die Tage, in denen Neidenburg in russischer Hand ist.
Sophie macht derweil im Lazarett an der Westfront schreckliche Erfahrungen und wird schließlich, als ihre Schwangerschaft nicht mehr zu verbergen ist, entlassen. Siegfried und Luise haben sich inzwischen wiedergefunden und planen ihre Hochzeit in Memel. Während der Vorbereitungen werden Johanna und Luise von den Russen gefangen genommen. Siegfried sieht die beiden Frauen in der Gewalt der feindlichen Soldaten und wird beim Versuch, seine Verlobte und seine Nichte zu retten, vor ihren Augen niedergeschossen. Luise bricht im Zug, der sie nach Russland bringen soll, völlig zusammen. Sie weiß nicht, ob er getötet wurde. Doch Siegfried überlebt – stürzt aber in eine tiefe Krise, weil er ein Bein verliert und sich nur noch wie ein halber Mann fühlt. Johanna und Luise landen in einem russischen Gefangenenlager. Johanna soll dem dort arbeitenden Arzt assistieren – und hat eines Tages ihre große Liebe, den als vermisst geltenden Sebastian, vor sich auf dem OP-Tisch. Gerade als die beiden Wiedersehen feiern, werden Johanna und Luise als Schwestern nach Petrograd an ein Krankenhaus beordert. Sebastian und sein Freund Karl flüchten aus dem Lager und reisen den Frauen hinterher. Während in Petrograds Straßen die Revolution tobt, spürt Sebastian Luise und Johanna auf. Gemeinsam mit Karl und der jungen russischen Krankenschwester Irina fliehen sie, Irina und Karl verlieben sich ineinander. Derweil trauert Pierre im feindlichen Frankreich immer noch seiner Sophie nach. Doch seine Mutter versucht, ihn zu verkuppeln. Schließlich heiratet Pierre eine andere, sein Herz gehört aber nach wie vor Sophie.
Sebastian und Karl müssen an die Front zurück. Bei einem Angriff wird Karl vor Sebastians Augen von einer Granate getötet. Sebastian verliert den Verstand. Es dauert lange, bis man den zutiefst Verstörten findet. Als der Kaiser abdankt und die Straßen in Deutschland der Revolution gehören, bringt Johanna ihre Tochter Susanne zur Welt. Und Sebastian findet langsam ins Leben zurück.
*
Band 2 – Kornblumenjahre
1923: Auf dem Höhepunkt der Inflation kämpft Johanna in Überlingen am Bodensee darum, ihre Familie satt zu bekommen. Derweil marschieren im Ruhrgebiet Franzosen als Besatzer ein. Luise und ihr Mann Siegfried erleben die Besetzung mit, Siegfried schließt sich einer Untergrundbewegung an, die nur ein Ziel hat: die Franzosen zu vertreiben und zu besiegen. Am Bodensee verrät Sophies Schwester Helene ausgerechnet der größten Klatschtante der Stadt deren Geheimnis: Sophies Sohn ist Halbfranzose. Auf Sophie wird ein Anschlag verübt und sie flieht ins Ruhrgebiet zu Luise, die sie bei sich versteckt. Als Sophies Bruder Siegfried davon erfährt, ist er außer sich vor Zorn. Auch wenn Sophie seine Schwester ist, will er sie auf keinen Fall bei sich aufnehmen, denn sie hat das Schlimmste getan, was der Widerständler sich vorstellen kann: sich mit einem Franzosen eingelassen, von dem sie obendrein auch noch ein Kind bekommen hat! Siegfried ist es höchst peinlich, einen Neffen zu haben, der einen Franzosen zum Vater hat, er fürchtet um seinen guten Ruf bei seinen Leuten. Denn seit er im Untergrund ist, genießt er endlich wieder Ansehen. Sein Selbstbewusstsein ist zusammengebrochen, als er im Krieg ein Bein verlor. Siegfried droht, Sophie zu verraten, es kommt zum Streit. Und Luise, außer sich vor Angst um ihre Schwägerin und ihren Neffen und völlig verzweifelt darüber, was aus dem Mann, den sie einmal geliebt hat, geworden ist, erschlägt ihn im Affekt. Mit Sophies Hilfe gelingt es ihr, die Tat zu vertuschen, der Verdacht fällt auf die französischen Besatzer. Aufgeklärt wird der Mord nie.
Johannas Schwester Marlene ist inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsen, hungrig auf das Leben, hungrig nach der Liebe. Doch sie gerät an den Falschen: Marlene verliebt sich in einen Angehörigen der NSDAP und erlebt nicht nur den Hitlerputsch mit, sondern auch, wie dieser ihren Geliebten immer aggressiver macht, bis er sie schließlich vergewaltigt.
In Überlingen am Bodensee ist Johanna immer unzufriedener mit ihrem Leben und ihrer Ehe. Sie hat das Gefühl, dass sie sich ganz alleine für die Familie aufreibt und dafür kämpft, ihre Kinder satt zu bekommen, während ihr Mann Sebastian, der Pfarrer, immer nur die Gemeinde im Kopf hat. Johanna rebelliert. Sie schneidet sich die Haare und die Kleider ab, trägt den Garçonne-Look und verliebt sich obendrein in den Juden Matthias Thannberg, den neuen Schulleiter, der die Nachfolge ihres verstorbenen Großvaters antrat. Eine denkbar schwierige Situation, denn Matthias Thannberg ist verheiratet und Johanna landet im totalen Gefühlschaos.
*
Band 3 – Dornenjahre
Die Lösung des großen Familiengeheimnisses führt tief in die Vergangenheit: in das Deutschland des Dritten Reichs, eine Zeit voller Wirren und Leid. Sophie Didier, die bei ihrem Mann Pierre in Frankreich lebt, schließt sich der Résistance an und wird zur Widerstandskämpferin. Als die Deutschen Paris besetzen, druckt das Ehepaar gemeinsam mit einer Gruppe von Mitstreitern in seinem Keller Flugblätter gegen Adolf Hitler, kurz darauf fliehen Sophie und Pierre nach Südfrankreich und kämpfen aus dem Untergrund weiterhin gegen Nazideutschland. Ausgerechnet während des Massakers von Tulle halten sich Pierre und Sophie dort auf, Sophie muss zusehen, wie ein Mann nach dem anderen an den Balkonen erhängt wird. Pierre ist nicht darunter, wird von den Nazis aber verschleppt und kehrt nie wieder. Sophie rettet Manon, eine junge Französin, die einen Deutschen geliebt hat, und versteckt sich mit ihr in den Wäldern. Doch zieht sie sich vollkommen in sich selbst zurück.
Luise hat gerade das im Ersten Weltkrieg zerstörte Gut ihrer Eltern in Ostpreußen wiederaufgebaut, als sie aufgrund ihrer Liebe zu einem polnischen Zwangsarbeiter verhaftet wird. Nach der Geburt des gemeinsamen Kindes wird Luise ins Konzentrationslager Ravensbrück verschleppt, ein Sonderlager für Frauen, die sich mit dem Feind eingelassen haben. Dort wird sie gefoltert und muss zusehen, wie eine Frau vor ihren Augen von Hunden zerfleischt wird, die die Nazi-Aufseherinnen auf sie gehetzt haben. Nach ihrer Freilassung muss sie erneut alles zurücklassen, um mit ihrem Kind vor den Russen zu fliehen. Über das Schicksal ihres Geliebten bleibt sie lange im Ungewissen.
Und Johanna profitiert als Firmenchefin von den Nazis, verliebt sich aber wieder in ihren Exgatten Sebastian, der im Untergrund gegen Hitlers Regime kämpft. Um ihre Tochter Susanne zu retten, die einen Juden liebt und dadurch in Gefahr gerät, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung: Susanne ist schwanger von ihrem Freund, Johanna versteckt ihre Tochter und täuscht selbst eine Schwangerschaft vor – niemand soll wissen, dass das Kind Halbjude ist, sie will es vor den Nationalsozialisten schützen. Als das Kind, Melissa, geboren ist, macht sich Susanne auf die Suche nach ihrem Geliebten und lässt das Kind bei Johanna zurück – ohnehin glaubt ja jeder, sie sei die Mutter. In diesem Glauben wächst auch Melissa auf. Johannas niederträchtige Schwester Franziska ist die einzige, die weiß, wo Susanne sich nach dem Krieg aufhält. Aus Hass gegenüber den beiden Frauen fälscht sie ein amtliches Schreiben an Susanne, in dem sie mitteilt, Melissa und ihre Eltern seien bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Außer sich vor Schmerz kehrt Susanne nicht mehr nach Deutschland zurück. Franziska hat ihr Ziel erreicht.
*
Gegenwartsebene:
Durch alle drei Bände hindurch zieht sich ein zweiter Handlungsstrang, der in der Gegenwart spielt. Zita, eine junge Frau aus Stuttgart, ersteigert bei eBay ein winziges altes Notizbüchlein in einem Deckel aus Silber, das an einem Band um den Hals getragen werden kann. Als sie das Büchlein in der Hand hält, entdeckt sie, dass sich darin einige lose Seiten mit Notizen befinden. Gebannt entziffert sie die verblassten Aufschriebe, die offensichtlich aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs stammen. Was sie dort liest, fasziniert sie so sehr und ist so rätselhaft, dass sie beschließt, sich auf Spurensuche zu begeben. Ihre Suche führt sie an den Bodensee nach Überlingen, wo die Nachfahren einer jener Frauen leben, die ins Notizbüchlein schrieben: die Nachfahren von Johanna. Zu jener Zeit ahnt Zita noch nicht, dass der Fund des Notizbüchleins ihr Leben komplett verändern soll: Sie verliebt sich in Philippe, den Urenkel Sophies, den die Spuren der Vergangenheit ebenfalls nach Überlingen führen. Und sie entgeht knapp einem Mordanschlag, den Franziska, Johannas kleine Schwester, die inzwischen hochbetagt ist, auf sie verübt. Der Grund: Sie fühlt sich durch Zita und das Notizbüchlein bedroht, denn Franziska hat etwas zu verbergen … Gemeinsam mit Johannas Nachfahrinnen Mia und Melissa begibt Zita sich auf die Suche nach der Wahrheit, bei der auch Philippe, die Journalistin Alexandra Tuleit und der Polizist Ole Strobehn mithelfen, nach und nach die Fäden entwirren und Johannas totgeglaubte Tochter Susanne ausfindig machen.
Teil 1 1949–1952
1. Kapitel
Litauen, Februar 1949
Das kleine Mädchen weinte nicht, als der Mann sich an ihm verging. Es war lange schon tot, im Innern tot, gestorben wegen all den Gräueltaten, die es in seinem kurzen Leben bereits hatte erdulden müssen. Wann genau dieser Tod eingetreten war, konnte sie nicht sagen. Vielleicht in jenem Winter 1945, als sie ihren kleinen Bruder in einem Pappkarton bestatten mussten und den Körper des Säuglings tief in das garstige Grab aus Eis und Schnee hinabsenkten. Er war doch noch so klein und so schutzlos. Das Mädchen hatte das Bedürfnis gehabt, dem winzigen Jungen wenigstens etwas Wärme zu geben, hatte ihre Jacke ausgezogen und sie über ihn gebreitet. Dafür hatte sie eine Ohrfeige ihrer Mutter kassiert. »Willst du auch noch sterben?«, hatte sie mit einer Stimme, die unnatürlich hoch war und sich überschlug, gefragt und das Mädchen gezwungen, die Jacke wieder anzuziehen.
War sie in diesem Moment innerlich erstarrt? Oder als ihre dreijährige Schwester den Hungertod starb, während sie sie in den Armen hielt? Irgendwann hatte Sibylle einfach nicht mehr geatmet.
Oder war das Ende mit den Russen gekommen, als sie ihre Mutter vergewaltigten, während sie in der Tür stand und entsetzt zusah und hörte, wie die Mutter um Hilfe rief und nach ihr, dem einzigen ihrer Kinder, das ihr noch geblieben war? Bis ihr Schreien irgendwann verstummte, für immer?
Vielleicht war der Tod auch irgendwann in den Wäldern eingetreten, als sie einsam durch das Land zog und mit den bloßen Händen das Fleisch aus verendeten Tieren riss, um es sich in den Mund zu stopfen. Alles, alles, um nur dem Hunger zu entkommen! Hatte die Einsamkeit sie erschlagen und getötet, nachts, in den riesigen Wäldern, als in der Stille die Erinnerungsbilder auf sie einstürmten und der Lärm in ihrem Innern übergroß wurde, sodass sie sich die Ohren zuhielt und schrie und schrie und schrie?
Wie lange sie so durch die Wälder zog – Lisabeth wusste es nicht. Sie baute sich einen Unterschlupf aus Blättern und Ästen, aus Tannenzapfen bastelte sie Puppen, die setzte sie in eine Ecke der Hütte und sprach mit ihnen, als handle es sich um Menschen. Tagsüber streunte sie herum, immer auf der Suche nach etwas Essbarem. Es gab zahlreiche Bauernhäuser hier, viele Bewohner jagten sie fort, andere waren großzügiger und gaben ihr etwas zu essen. Eine Scheibe Brot. Und, wenn sie ganz viel Glück hatte, ein Stück Käse.
Inzwischen hatte sie auch herausgefunden, in welche Ställe sie sich schleichen konnte, um heimlich eine Kuh zu melken. Was für ein Glück, dass die Mutter ihr das noch beigebracht hatte! Ach, die Mutter. Die Mutter, die Mutter. Sibylle. Und Siegbert, ihr winzig kleiner Bruder.
Vor einem halben Jahr hatte Lisabeth Glück gehabt. Eine litauische Familie hatte sie bei sich aufgenommen, ihr zu essen gegeben, die Kinder sollte sie dafür hüten und auf dem Feld mitarbeiten. Doch dann hatten sie sie wieder fortgeschickt. Zu gefährlich sei es, sie zu behalten, hatte die Bäuerin ihr noch erklärt und ihr zum Abschied zart über die Wange gestrichen. Die Russen erlaubten es nicht, und wenn man sie erwischte, dann gnade ihnen Gott.
Also war Lisabeth wieder gegangen. Die nächste Etappe auf ihrem langen, einsamen Weg. Sie stahl, um satt zu werden, und nachts suchte sie unter Brücken Schutz vor der Kälte. Aber Schutz vor bösen Menschen konnte die Brücke nicht bieten. Bösen Menschen wie diesem Mann, der nun über ihr stöhnte und ächzte, während er sein hartes Glied in sie stieß. Lisabeth starrte in den Himmel. Sie spürte nichts. Auch dann nicht, als der Mann plötzlich über ihr zusammenbrach, mit weit aufgerissenen Augen. Blut sickerte von seiner Stirn, auf der sich plötzlich ein Loch bildete.
Irina kniete neben Lisabeth nieder. »Kleines Mädchen«, flüsterte sie, »kleines Mädchen.« Lisabeth starrte sie an. Ohnehin konnte sie sich nicht rühren, der Mann, der auf ihr lag, erdrückte sie schier mit seinem Gewicht. In der Hand der Frau sah sie die Waffe, die noch ein klein wenig rauchte. Sie sah das wilde schwarze Haar, den entschlossenen Blick und sie dachte, dass diese Frau sie wohl gerettet hatte. Aber wieder spürte sie nichts. »Ich befreie dich von ihm«, sagte Irina. Sie packte den Mann unter den Achseln, drehte ihn um und zog ihn in Richtung des Flusses, über den die Brücke führte. »Geh nicht weg, ich bin gleich wieder da.«
Lisabeth reagierte nicht, sie starrte in den Himmel, an dem kein Stern zu sehen war. Die Sterne haben sich versteckt, dachte Lisabeth, vielleicht, weil sie sich schämen, weil sie nicht sehen wollen, was auf Erden geschieht. Die Sterne, das sind doch alle, die gegangen sind. Mama. Die Geschwister.
Irina ließ den Mann los, sein blutender Kopf krachte mit einem harten Geräusch auf den Boden. Die Russin achtete nicht darauf. »Bitte versprich mir, nicht fortzugehen«, bat sie das Mädchen eindringlich. »Ich helfe dir. Du bist nicht allein, weißt du? Es gibt viele Kinder wie dich, die herumirren und nichts zu essen haben. Ich helfe euch zusammen mit meiner Freundin Annemarie. Sie ist nur durch einen glücklichen Zufall noch am Leben. Weil sie so froh ist, dass ihre beiden Kinder nun keine Waisen sind, hilft sie mir. Wir kümmern uns um dich. Versprich mir, dass du nicht wegläufst, während ich tue, was ich tun muss.«
Lisabeth starrte sie aus großen, dunklen Augen an. Dann nickte sie stumm. Irina lächelte ihr zu, packte den Mann wieder unter den Schultern und zerrte ihn weiter. Die Wut, die sie verspürte, gab ihr Kraft.
Die Wut trieb sie an, seit Jahren schon. Seit sie in jenem kalten Winter neben ihrem toten Iwan erwacht war und klagte, dass Gott nicht die Gnade hatte, sie ebenfalls aus diesem grausamen Leben zu reißen. Dass er sie nicht einfach erlöste. Dass er sie nicht gehen ließ, sie nicht zu sich nahm. Irina hatte beschlossen, sich zu rächen. Iwan zu rächen und alle, die sie ihr genommen hatten. Anfangs war ihr Hass gegen die Deutschen gerichtet und sie hatte einen nach dem anderen erschossen. Irina war zu einer jener russischen Scharfschützinnen geworden, die unzählige deutsche Männer gnadenlos töteten. Dann war sie nach Königsberg gekommen. Aus den Kellern hörte sie die Schreie der Frauen, die von den Russen, Irinas Landsleuten, vergewaltigt wurden. Irinas Hass wandelte sich. Er richtete sich nicht mehr gegen eine Nation, sondern gegen das Böse. Sie wurde zu einer Retterin der Verfolgten und der Gepeinigten und zögerte dabei nicht, selbst Gewalt anzuwenden.
So hatte sie auch Annemarie kennengelernt. Sie kam dazu, als die zweifache Mutter in ihrem Keller von Russen vergewaltigt wurde, wobei ihre beiden Kinder zusehen mussten. Bis Irina, die Scharfschützin, gekommen war und ihre Landsleute verjagt hatte. Anfangs hatte Annemarie furchtbare Angst vor Irina gehabt, schließlich war diese als Russin auch ein »Feind«. Doch dann hatte die vollkommen traumatisierte Deutsche begriffen, dass Irina ihr nichts tun würde. Die beiden Frauen waren in diesem eisigen ostpreußischen Keller Freundinnen geworden, geeint in dem verzweifelten Wunsch, all den armen, einsamen Kindern zu helfen. Annemarie war paralysiert von der Vorstellung, dass sie, ihre beiden Kinder mutterseelenallein zurücklassend, aus dem Leben geschieden wäre, wenn Irina nicht gekommen wäre und sie gerettet hätte.
»Wenn ich wirklich hätte sterben müssen, dann hätte ich mir gewünscht, dass da jemand ist, der sich um sie kümmert, sich ihrer annimmt, für sie sorgt. Sie … liebt«, sagte sie eines Abends leise zu Irina. »Und da draußen sind so viele kleine, einsame, arme Kinder, die frieren vor Kälte und Kummer. Wir müssen uns dieser Kinder annehmen, Irina. Diese armen, kleinen Würmchen können doch am wenigsten für all das Leid und für das Unrecht, das auf dieser Welt geschieht. Die Eltern hat man ihnen genommen, die Heimat … es ist unsere Aufgabe, ihnen all unsere Liebe zu schenken.«
Irina nickte. »Ja«, sagte sie. »Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Die Kinder zu retten.«
Diese Aufgabe war den beiden Frauen zur Passion geworden. Lange schon hatten sie Königsberg, von den Russen in »Kaliningrad«umbenannt, verlassen und waren über die Grenze nach Litauen gegangen. Sie hatten herausgefunden, dass dorthin die meisten Waisenkinder flohen.
»Der Plan ist folgender«, sagte Irina. »Litauen steht unter sowjetischer Besatzung und es wird nicht lange dauern, bis sich dort immer mehr Russen ansiedeln. Es wird für mich nicht schwer sein, dort ein Haus zu finden, in dem wir leben können. Und in Litauen können wir auch die meisten Kinder einsammeln und ihnen helfen. Ich habe gehört, dass viele dorthin gehen.«
»So einfach wird es nicht sein«, widersprach Annemarie, »bis auf dich sind wir alle Deutsche. Sie werden uns nicht so einfach dulden.«
Irina nickte: »Du hast recht. Dann werden wir, sobald es geht, versuchen nach Deutschland zu gelangen. Vielleicht in die sowjetische Besatzungszone, da ist es einfacher für mich. Aber erst einmal müssen wir hier all die Kinder einsammeln.«
Nachdem Irina den Fremden in den Fluss geworfen hatte, ging sie zu Lisabeth zurück. Das Mädchen in seinen zerrissenen Kleidern zitterte vor Kälte, Hunger und Einsamkeit. Sie hatte die Arme um die Knie geschlungen und den Kopf darin vergraben. Wie ein kleines, schutzloses Tier. Irina zog es das Herz zusammen. Sie strich ihr sacht über das verlauste und verfilzte Haar.
»Es ist gut«, flüsterte sie, »ich bringe dich in Sicherheit. Kannst du aufstehen?«
Lisabeth nickte. Irina beobachtete besorgt die Bewegungen der Kleinen, die sie auf elf bis 13 Jahre schätzte. Sie wollte das Mädchen nicht untersuchen, um es nicht noch mehr zu verängstigen, erkannte aber mit einem Blick das Blut zwischen seinen Beinen und sah an der leicht zusammengekrümmten Haltung des Mädchens, dass es Schmerzen hatte.
Irina nahm ihre Hand. Ablenkung wäre nun vermutlich das Beste. Ablenkung und Zuneigung, Zuwendung. Trost. »Wie heißt du?«, fragte sie sanft.
»Lisabeth«, flüsterte das Mädchen.
»Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe, Lisabeth«, erwiderte Irina, »ich habe dich nämlich gesucht.«
Lisabeth warf ihr einen erstaunten Blick zu. Irina musste lächeln. Die Kleine verstand offenbar nicht, warum sie, Irina, nach ihr gesucht hatte, wo sie sie doch gar nicht kannte.
»Nicht nach dir speziell«, konkretisierte sie. »Aber ich weiß, dass hier draußen Kinder sind, die meine Hilfe brauchen. Viele Kinder.«
2. Kapitel
Paris, Frankreich, Februar 1949
Manon wollte nicht zurück in das Dorf ihrer Kindheit. Nicht zurück dorthin, wo man sie aus ihrem Haus gezerrt und an den Pranger gestellt hatte, bis Sophie kam und sie rettete. Nicht zurück dorthin, wo man ihr die Haare geschoren und sie bespuckt hatte. Nicht zurück, nur nicht zurück.
»Nimm mich mit«, hatte sie Sophie gebeten, als die beiden sich aus den Kriegstrümmern erhoben und wie schlafwandlerisch zurück ins Leben wankten. »Nimm mich mit zu dir. Ich kann nicht dorthin zurück.« Sophie hatte sie aus ihren großen blauen Augen angesehen. Und auch wenn Manon dort, in dem Blick der Freundin, immer noch eine große Leere sah und das Gefühl hatte, dieses Blau führe in eine Unendlichkeit, die haltlos war, so hatte ihr diesmal doch der Atem gestockt, denn sie sah nun noch mehr in diesem Blau. Sie sah zum ersten Mal nicht ausschließlich Leere, sondern sie sah Inhalte, Fragen, Antworten. Das Blau füllte sich mit Leben.
»Sophie«, sagte sie leise, »liebe Güte, Sophie, du kommst zurück!«
In Sophies Gesicht zuckte es, ihre Miene verschloss sich wieder, vor das Blau ihrer Augen legte sich ein Schatten.
Du Närrin, schalt sich Manon. Du hast sie überfordert. Du hättest sanfter und vorsichtiger auf sie zugehen sollen.
Um Sophie, aber auch sich selbst, über diesen Moment hinwegzuhelfen, redete sie einfach weiter. »Ich will nicht zurück, Sophie. Kannst du mich mitnehmen, wohin auch immer du gehen magst?«
Sophie nickte langsam und nachdenklich.
Drei Jahre war das jetzt her und Sophie sprach immer noch nicht. Wie so viele Menschen im Nachkriegseuropa hatte das Grauen sie sprachlos gemacht.
Gemeinsam mit Manon war sie zurückgekehrt nach Paris in das große Haus, in dem sie vor dem Krieg mit ihrer Familie ein glückliches Leben geführt hatte. Manon, die eher aus ärmlichen Verhältnissen kam, staunte angesichts all der Pracht. Das riesige, reichverzierte Haus hatte wenige Kriegsschäden davongetragen, nur der Stuck war hier und da etwas abgebröckelt. Ansonsten aber erstreckte es sich groß und prachtvoll hinter dem schmalen Vorgarten.
Da Sophie mehr oder weniger teilnahmslos durch die Räume schritt und keine Anstalten machte, ihr alles zu zeigen, hatte Manon sich auf eigene Faust auf den Weg gemacht. Staunend war sie von Zimmer zu Zimmer gezogen, sie betrachtete die Antiquitäten und strich mit den Fingern über das edle Porzellan.
Vor allem aber folgte sie Sophie wie ein Schatten, sprach mit ihr und versuchte, dieser zerbrechlichen und zerbrochenen Frau so viel Normalität zurückzugeben wie möglich. Sie kochte, putzte, kaufte ein, und sorgte dafür, dass Sophie regelmäßig aß. Und sie kümmerte sich darum, Geld herbeizuschaffen. Sie fragte Sophie, ob diese ihr erlaube, Dinge aus dem Familienbesitz gegen Nahrung einzutauschen, diese stimmte wortlos, nur mit einem Nicken, zu.
Es kehrte so etwas wie Normalität ein. Irgendwann hörte Manon auch auf, die Freundin dazu zu bewegen, aus dem Haus zu gehen. Sie ahnte die Gründe für deren Weigerung. Sophie, so dachte sie, scheute die Feindschaft der Nachbarn. Außerdem wollte sie das Haus nicht verlassen, falls eines Tages jemand käme, der ihr wichtig war.
Aus den Unterlagen und Fotoalben, die Manon mit Sophies Erlaubnis studiert hatte, schloss sie, dass diese einen Mann hatte, der Pierre hieß. Und sie wusste, dass Sophie sehnsüchtig auf ihn wartete. Aber Pierre kam nicht. Stattdessen kam Raphael nach Hause, Sophies Sohn, der in den letzten Kriegstagen noch in Gefangenschaft geraten war. Und mit seinem Kommen änderte sich alles.
3. Kapitel
Litauen, März 1949
Es war zwei Uhr morgens, als Irina mit Lisabeth auf dem verfallenen und verlassenen Bauernhof ankam, den Annemarie und sie auf ihren langen Wanderungen durch die Wälder entdeckt hatten. Eine Woche lang hatten sie damals in einem Versteck nahe des Hofes ausgeharrt, nachdem sie jedoch nie eine Menschenseele gesehen hatten, waren sie, mutig geworden, eingezogen. Wohl wissend, wie unsicher dieses Versteck war. »Was, wenn jemand kommt, dem dieser Bauernhof gehört?«, hatte Annemarie ängstlich gemurmelt.
»Dann wäre derjenige jetzt hier«, argumentierte Irina. »Wenn, dann hat er Deutschen gehört, die fliehen mussten. Und wenn die zurückkommen und dich hier finden – was ausgesprochen unwahrscheinlich ist – haben wir auch kein Problem.« Annemarie nickte nachdenklich. Die Annahme, der Hof habe einmal Deutschen gehört, bestätigte sich, denn in den Regalen standen zahlreiche deutsche Bücher und in den Schubladen lagen Briefe in deutscher Sprache. Wichtige Briefe. Briefe von der Front. Von einem Mann namens Uwe.
Als Irina nun mit Lisabeth auf das Haus zukam, erwartete Annemarie sie schon in der Tür. Sie stellte keine Fragen, sagte nur »Willkommen« zu dem Mädchen. Und: »Du hast bestimmt Hunger.« Lisabeth nickte stumm, Annemarie führte sie in die Küche und gab ihr ein verhältnismäßig großes Stück Brot, das die Kleine gierig herunterschlang.
»Du musst langsam machen«, mahnte Annemarie sanft. »Sonst bekommst du Bauchmerzen. Du hast sicherlich schon lange nichts mehr gegessen?«
Lisabeth nickte wieder, mit vollem Mund diesmal, bemühte sich tapfer, etwas langsamer zu essen und scheiterte. Die beiden Frauen lächelten sich an. In diesem Moment waren sie einfach nur glücklich. Wieder ein kleines Menschenkind, das sie gerettet hatten und dem sie die Chance auf eine Zukunft geben wollten.
»Wir haben noch einen Neuzugang«, sagte Annemarie leise und sofort schossen ihr Tränen in die Augen. »Oder besser: zwei.«
Irina sah sie fragend an.
Annemarie presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Irina verstand. Ihre Freundin rang um Fassung und wollte vor Lisabeth nicht weinen. Die beiden Frauen versuchten, den Kindern so viel Rückhalt und Normalität wie möglich zu geben.
Irina brannte aber darauf, alles über die »Neuzugänge« zu erfahren, und da sie ohnehin fand, dass Lisabeth ins Bett gehörte, sagte sie: »Du bist bestimmt müde.«
Das Mädchen nickte stumm.
»Na komm, ich bringe dich ins Bett.«
Sie stieg vor Lisabeth die knarrende Treppe in den ersten Stock hinauf, in dem es viele Betten und viele dicke Decken gab, die Schutz vor der Kälte boten. Die Familie, die hier einmal gewohnt hatte, war offenbar groß gewesen. »Deine Geschwister« – sie wählte das Wort ganz bewusst – »schlafen alle schon«, sagte sie. »Morgen wirst du sie kennenlernen.«
Lisabeth nickte ernst.
Irina dachte, dass man das Mädchen dringend waschen und ihr die vollkommen verfilzten und verlausten Haare schneiden musste. Aber jetzt sollte die Kleine erstmal schlafen. Sie zog dem vor Müdigkeit halb ohnmächtigen Mädchen ein sauberes Nachthemd an, das zusammengelegt in einem Schrank lag, und fragte sich, was wohl aus dem Kind geworden war, dem es einst gehört hatte. Dann legte sie Lisabeth ins Bett und deckte sie zu. Sie durfte nur morgen nicht vergessen, Annemarie zu sagen, dass sie die Bettwäsche auskochen und die Kleine entlausen musste. In einer derart großen Familie und unter so schwierigen hygienischen Umständen waren solche Dinge von außerordentlicher Bedeutung.
Sekunden später war Lisabeth eingeschlafen.
Irina setzte einen Stoffbären neben sie.
Im Flur stieß sie fast mit Annemarie zusammen. »Willst du schon ins Bett gehen? Ich wollte gerade zu dir in die Küche kommen«, sagte Irina. »Ich bin doch gespannt auf unsere Neuzugänge.«
Da kullerten die Tränen über Annemaries Wangen.
»Was ist denn los?«, fragte Irina erschrocken und nahm die Freundin in ihre Arme.
»Komm mit«, erwiderte Annemarie mit bebender Stimme und zog Irina hinter sich in ihr Schlafzimmer. Die beiden Frauen hatten die Räume gleich rechts und links am Treppenaufgang gewählt, die Zimmer der Kinder befanden sich dahinter. So würden sie immer mitbekommen, wenn jemand die Treppe hinauf- oder hinunterstieg, denn sie schliefen stets mit offenen Türen.
Verwundert folgte Irina der Freundin, die eine Petroleumlampe in der Hand hielt, in deren Schlafzimmer. In ihrem Bett lag etwas. Etwas sehr Kleines. Zwei sehr kleine Menschen, die hier zusammengekauert schliefen und ihre kleinen Ärmchen umeinandergeschlungen hatten, als wollten sie sich auch im Schlaf vergewissern, dass der andere sie nicht verließ.
Ein kleiner Junge, höchstens vier Jahre alt, und ein noch kleinerer Junge, der, wenn überhaupt, gerade mal ein Jahr alt war.
»Sie standen heute einfach vor der Tür«, sagte Annemarie. »Der Größere hat den Kleineren getragen. Kannst du dir das vorstellen? Diese winzig kleinen Menschen sind mutterseelenallein durch die Kälte geirrt, ich will nicht wissen, wie lange«, schluchzte sie.
»Jetzt haben sie ja uns«, sagte Irina, während auch ihr angesichts dieser Kinder Tränen übers Gesicht liefen. »Und bei Gott, ich schwöre, ich werde alles tun, um ihnen ein glückliches Leben zu schenken.«
4. Kapitel
Überlingen, Bodensee, März 1949
»Ich möchte zurück«, sagte Luise, als sie neben Johanna unter dem Kirschbaum im Garten des Alten Schulhauses saß. »Zurück nach Ostpreußen. Gerade jetzt, wo hier bald alles in Blüte steht, sehne ich mich nach den Blumen meiner Heimat. Und nach dem riesigen, blauen Kornblumenfeld hinter dem Haus, wo im Sommer die Blumen blühen. Erinnerst du dich daran?«
Johanna lächelte. »Natürlich erinnere ich mich an das Kornblumenfeld«, erwiderte sie. »Wie viele glückliche Stunden haben wir dort erlebt.« Dann wurde sie ernst: »Aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist, Luise. Neidenburg heißt jetzt Nidzica und ist polnisch. Und was man so hört, sind die Deutschen dort nicht unbedingt willkommen. Was man verstehen kann. Du weißt ja von deinem Roman, wie grausam sie zu den Polen waren.«
Roman war Luises Mann, sie hatte ihn kennengelernt, als er als Zwangsarbeiter auf ihren Hof gekommen war, nachdem die Nazis seine polnische Familie ermordet und ihn verschleppt hatten. Die beiden hatten sich nach einer Weile ineinander verliebt und sich damit in große Gefahr gebracht.
Auch Neidenburg war bei Kriegsende von der Roten Armee überrollt worden, Luise war eilends mit ihrem Sohn und ihrer Freundin geflohen, Roman kämpfte, zwangsverpflichtet von den Deutschen, an der Front.
Nach Kriegsende war Neidenburg zusammen mit der südlichen Hälfte Ostpreußens unter polnische Verwaltung gestellt und zahlreiche polnische Zivilisten dort angesiedelt worden. Neidenburg hieß zunächst Nidbork und dann Nidzica. Deutsche, die noch nicht geflohen waren, wurden weitgehend vertrieben. Im August 1945 lebten 23.478 neu zugezogene Polen und 7.514 zurückgebliebene Deutsche im ehemaligen Neidenburg.
»Ja, ich weiß«, sagte Luise nun. »Aber dadurch, dass Roman Pole ist, hat er – und damit auch ich – ein Anrecht darauf, zurückzukehren.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein wirklich glückliches Leben wird«, mahnte Johanna sanft. »Man weiß dort ja, dass du Deutsche bist, und entsprechend wird man dich behandeln. Außerdem …«, sie zögerte, sagte dann aber: »Außerdem ist Roman noch gar nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Du … Luise, du weißt nicht, ob er je wiederkehren wird.«
Ein Schatten flog über Luises Gesicht. »Er wird wiederkommen«, sagte sie und es klang fast trotzig. »Und dann werden wir gemeinsam zurückkehren. Und wenn die Nachbarn feindlich sind, dann stört mich das auch nicht.« Sie holte tief Luft, ehe sie fortfuhr: »Ich habe schon so viel erlebt, da kann mich ein kleiner Nachbarschaftsstreit nicht mehr schrecken.«
Über die Männer etwas herauszufinden, die in russischer Gefangenschaft saßen, war gar nicht so einfach. Die Sowjetunion missachtete nämlich die Vereinbarungen der Genfer Konvention, in der die Behandlung von Kriegsgefangenen geregelt war, und gab keine Informationen über ihre Lagerinsassen an Deutschland weiter. Deshalb befragte der Deutsche Suchdienst alle Frontheimkehrer eingehend nach ihren Erfahrungen, zeigte ihnen Fotos von Vermissten und fragte sie nach den Namen ihrer Mitgefangenen, meistens kannten die Heimkehrer aber lediglich den Vornamen ihrer Lagerkameraden. Allein: Roman hatten sie noch nicht gefunden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er gefallen war, wurde von Tag zu Tag größer.
»Bleib noch bei mir, Luise, ich bitte dich«, sagte Johanna nun flehend und Luise blickte erschrocken auf. Sie konnte sich nicht erinnern, dass die Freundin je um etwas gebeten hatte. Johanna war immer die Starke gewesen, die, die für andere da war. Die nichts umzuhauen schien. Und nun diese Bitte. Und vor allem: Die Verlorenheit in ihrer Stimme.
»Was ist denn los?«, fragte sie, stand auf, setzte sich neben Johanna auf die Bank und legte den Arm um sie. »Ist es wegen Susanne?«
Johanna nickte und fing an zu weinen. »Auch«, sagte sie. »Es ist wegen Susanne, wegen Sebastian und wegen Melissa.«
Susanne war Johannas Tochter. Luise wusste, dass sie im Zweiten Weltkrieg nach Frankreich geflohen war – gemeinsam mit ihrem jüdischen Freund Leopold. Und dass Johanna seither nichts mehr von Susanne gehört hatte, obwohl sie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatte, um sie zu finden.
»Susanne wird wiederkommen«, sagte Luise.
»Nein«, widersprach Johanna. »Nein, das glaube ich nicht. Ich habe heute Nacht beschlossen, die Suche nach Susanne zu beenden. Und das solltest du auch tun. Diese endlose Suche, dieses endlose Warten, es zermürbt so.«
Johanna, der starken, mutigen Johanna liefen die Tränen über die Wangen.
Luise zog sie enger an sich.
Lange weinte Johanna in ihren Armen, dann löste sie sich von der Freundin und sah ihr ins Gesicht: »Auch du solltest nicht mehr warten, Luise. Du schmiedest Zukunftspläne, als sei es selbstverständlich und sicher, dass Roman zurückkehren wird. Aber der Krieg ist seit fast vier Jahren zu Ende. Die Chance, dass er wiederkommt, ist inzwischen sehr, sehr gering.«
Luise schluckte. Sie hatte den Impuls, aufzuspringen und fortzugehen. Johanna anzuschreien, was sie sich einbilde, so herzlos zu sein, und dass man einen Menschen doch nicht so einfach aus seinem Leben streichen könne. Aber ein Blick in deren verzweifeltes Gesicht machte ihr klar, dass sie besser schweigen sollte. Und tief in ihrem Innern wusste sie, dass Johanna recht hatte. Nur: Wirklich eingestehen konnte sie sich das nicht, es wäre zu schmerzhaft. Insofern war es ein großes Stück Ablenkung vom eigenen Schmerz, als sie fragte: »Du hast gesagt, du bist nicht nur wegen Susanne traurig, sondern auch wegen Sebastian und Melissa. Warum?«
»Die Frage mit Sebastian ist einfach zu beantworten«, sagte Johanna. »Wie du weißt, hatten wir es nicht immer leicht miteinander und für mich war es ein Problem, dass ich immer die Starke in unserer Beziehung sein musste.«
»Ja«, nickte Luise. »Auch wenn du schon immer eine modern denkende Frau warst, bist du in gewisser Weise schrecklich traditionell und konservativ. Du willst einen Mann haben, auf den du stolz sein und zu dem du aufblicken kannst. Der dich in seinen starken Armen beschützt. Das weiß ich schon lange.«
Johanna nickte. »Das habe ich bereits erkannt und Sebastian hat sich sehr verändert. Wir hatten wirklich gute Jahre miteinander und ich finde es großartig, dass er nun in die Politik gegangen ist und an der zukünftigen deutschen Verfassung mitarbeitet. Sie holte Luft. »Aber ich bin unglaublich einsam, Luise, er ist so viel fort und ich vermisse ihn sehr. Auch deshalb bitte ich dich, noch etwas zu bleiben.«
Luise sah sie nachdenklich an. Plötzlich war ihr klar, was Johannas Problem war. Zum ersten Mal, seit sie eine sehr junge Frau gewesen war, musste Johanna nicht kämpfen. Weder um Nahrung für ihre Familie noch um das Überleben in einem russischen Gefangenenlager. Und wenn man sein ganzes Leben nur gekämpft hatte, dann fiel man in so einem Moment in ein tiefes Loch. Vor allem, wenn man einsam war und nichts an der Situation ändern konnte. In diesem Moment stand Luises Entschluss fest: Johanna hatte so viel für sie getan, sie durfte und würde sie jetzt nicht verlassen. Ob sie nun früher oder einige Zeit später nach Ostpreußen zurückkehren würde – was für eine Rolle spielte das schon!
»Du hast doch aber deine Firma«, sagte sie beschwichtigend, »und Melissa.«
»In der Firma sitzt meine Schwester Franziska, dieser Parasit«, bemerkte Johanna angewidert. »Mir wird schlecht, wenn ich sie sehe.«
Luise grinste. »Das, meine Liebe, kann ich sehr gut verstehen.«
»Und Melissa – Melissa, meiner Tochter, muss ich irgendwann die Wahrheit sagen.«
»Was für eine Wahrheit?«, frage Luise alarmiert. Was ist denn mit Melissa?«
Johanna sah sie nachdenklich an. Dann schüttelte sie den Kopf.
5. Kapitel
64 Jahre später
Überlingen, Bodensee, August 2013
»Bist du müde, Mu… Mutter?«, fragte Melissa. Sie brachte das Wort nur stockend hervor. Trotz aller Befangenheit und aller Scheu hatte sie sofort, gleich im ersten Moment, als sie ihrer wahren Mutter gegenübergestanden hatte, eine so große Nähe gespürt, dass es ihr beinah den Atem verschlug. Und das, obwohl sie diese Frau noch nie in ihrem Leben gesehen hatte – oder zumindest nicht bewusst, denn als sie ganz klein gewesen war, hatte Susanne ja noch an ihrem Bettchen gestanden und auf sie herabgeblickt. Dann war sie gegangen, um Melissas Vater zu suchen, der, von den Nazis verfolgt, nach Frankreich gefahren war. Und nie mehr wiedergekehrt. Oder zumindest für eine ganz lange Zeit nicht, denn später war Susanne Gast in Melissas Pension gewesen, hatte sich aber nicht zu erkennen gegeben.
Melissa dachte voller Bitterkeit an Franziska, ihre kürzlich verstorbene Tante – nein, es war ja ihre Großtante, wie sie jetzt wusste. Aus Hass, Missgunst und Neid gegenüber ihrer Schwester Johanna hatte sie ein doppeltes Spiel gespielt und damit viel Leid über sie alle gebracht. Erst auf dem Totenbett hatte sie ihr, Melissa, gestanden, was sie getan hatte, erst dann konnte die Suche nach Susanne beginnen.
Doch nun hatten sie sich wiedergefunden – und waren dabei, die Puzzleteile ihrer Leben zusammenzusetzen. Es gab noch viele ungeklärte Fragen, vieles, worauf sie dringend eine Antwort finden wollten.
»Bist du müde, Mutter?«, fragte sie nun wieder und strich der alten Dame sanft über die Wange.
Susanne nickte. »Müde und glücklich«, sagte sie. »Wie schön, Mutter genannt zu werden. Das… das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Natürlich hat es noch nie jemand zu mir gesagt.«
Mia, ihre Enkelin, schlang von hinten die Arme um sie und gab ihr einen Kuss auf die faltige Wange. Sie spürte die Innigkeit, aber auch die Befangenheit zwischen den beiden und wollte ihnen aus dieser Situation heraushelfen.
»Und Großmutter hat sicherlich auch noch niemand zu dir gesagt«, vermutete Mia. »Ist es dir denn recht, wenn wir dich so nennen, oder sollen wir dich Maman und Grand-Mère nennen, weil du ja jetzt in Frankreich lebst?«
Susanne wandte den Kopf und strich der Enkelin lächelnd über die Wange. »Lustig, dass du das sagst«, erwiderte sie. »Denn als Melissa Mutter zu mir sagte und du Großmutter, habe ich mich genau das gefragt. Ich fühle mich lange schon als Französin, also würde das in der Tat besser passen. Aber ich glaube, dass ich mich nur deshalb wie eine Französin gefühlt habe und davor wie eine Amerikanerin, weil ich meine deutsche Identität verloren hatte. Ich habe Deutschland gehasst.« Als sie den Kopf hob, bemerkte sie, dass alle anderen Gespräche am Tisch im Garten des Alten Schulhauses verstummt waren, alle sahen sie an. Sie erwiderte den Blick eines jeden. Den Blick von Philippe, Sophies Urenkel, und dessen Freundin Zita, die durch den Fund des alten, silbernen Notizbuches alles erst ins Rollen gebracht hatte. Den von Alexandra, der Überlinger Journalistin und ihres Freundes Ole, dem Polizisten, der Franziska kurz vor ihrem Tod verhaftet hatte. Und schließlich den von Mia und Melissa. Ihrer Enkelin und ihrer Tochter. Sie alle waren unter dem alten Kirschbaum zusammengekommen, um sie mit einer großen Kaffeetafel zu empfangen.
»Wisst ihr«, begann sie, »wisst ihr, es bedeutet mir viel, dass ihr mich alle willkommen heißt. Dass ihr die Kaffeetafel zu meiner Ankunft ausgerechnet hier unter diesem Kirschbaum gedeckt habt. Der Kirschbaum hat in unserer Familie immer eine wichtige Rolle gespielt. So viele wichtige Gespräche haben in seinem Schatten stattgefunden, so viele eifrige Kinder haben Kirschen gesammelt, während der Inflation und Hungersnot zur Zeit der Weimarer Republik hat er uns wirklich gute Dienste erwiesen. Im Krieg natürlich auch. Und hier habe ich deinen Vater zum ersten Mal geküsst. Deinen Vater, den du nie gesehen hast«, wandte sie sich mit feuchten Augen an Melissa.
»Ja, ich habe mich nicht als Deutsche gefühlt«, fuhr sie fort. »Aus verschiedenen Gründen, vor allem aber, weil ich Deutschland gehasst habe. Es hat mir alles genommen. Und gleichzeitig habe ich mich so nach meiner verlorenen Heimat gesehnt.«
Die Menschen am Tisch schwiegen und lauschten gebannt den Worten der alten Dame.
»Ja, ich habe Deutschland gehasst«, wiederholte sie. »Deutschland hat Leopold – deinem Vater – seine ganze Familie genommen, Melissa. Deine Großeltern und deine Tante sind im Konzentrationslager ermordet worden.«
Melissa schluckte, Mia atmete scharf ein. Bis vor Kurzem wussten sie ja nicht einmal, dass jüdisches Blut in ihren Adern floss. Und nun erfuhren sie, dass ihre Vorfahren zu den Opfern des Holocaust gehörten.
»Und auch mir hatte Deutschland alles genommen – das dachte ich zumindest«, sagte Susanne. »Durch die Bomben waren alle gestorben, die ich liebte. Mutter, Vater und du, Melissa. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das alles eine hässliche Intrige war. Man kann ja nicht ahnen, dass ein Mensch so etwas tut.«
Ihre Stimme war ganz leise geworden, als sie sprach, und die Menschen am Tisch mussten sich konzentrieren, um sie zu verstehen, aber sie lauschten ohnehin mit angehaltenem Atem. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können.
»Insofern ist es wirklich eine gute Frage, ob ich Mutter oder Maman, Großmutter oder Grand-Mère genannt werden möchte. Und dennoch ist die Antwort schon klar.« Die alte Dame wandte sich an ihre Tochter. »Natürlich möchte ich von dir Mutter genannt werden. Wenn es dir nichts ausmacht …«, sagte sie schüchtern, »wenn es dir nichts ausmacht, sogar Mama. Das ist noch ein bisschen persönlicher.«
Melissa lächelte und schluckte.
Susanne nahm ihre Hand.
»Mama ist das erste Wort, das Kinder sprechen können – oder eines der ersten Worte. Und nun ist es sozusagen das Wort, das mich wieder in meine deutsche Heimat zurückholt. Es ist der Anfang einer Versöhnung mit diesem Land.«
Melissa nahm ihre Mutter in die Arme, beide konnten ihre Tränen nun nicht länger zurückhalten. Sie konnten nicht glauben, wie sehr die Geschichte und eifersüchtige Intrigen ihre persönlichen Lebenswege gelenkt hatten und dass sie nun über all das gesiegt hatten und sich schließlich und endlich in den Armen hielten.
6. Kapitel
64 Jahre zuvor
Litauen, April 1949
Irina staunte, wie schnell sich eine Art Alltag auf dem verlassenen Bauernhof in Litauen entwickelte. Es war fast wie in einer richtigen Familie, in der sie den Part des Vaters eingenommen hatte. Morgens nach dem Frühstück ging sie aus dem Haus, auf der Suche nach Nahrung und vor allem nach weiteren verlassenen Kindern. Zum Glück fand sie nicht weit von dem Hof entfernt Arbeit auf einem Bauernhof, auf dem sie zwar hart schuften musste, aber neben dem Lohn auch noch ab und an Lebensmittel geschenkt bekam – und immer wieder Gelegenheit hatte, etwas mitgehen zu lassen. Hier ein Ei, dort ein bisschen Korn. Ein schlechtes Gewissen hatte Irina nicht, schließlich stahl sie nicht, um selbst satt zu werden, sondern um die Kleinsten der Kleinen, die Ärmsten der Armen, die Unschuldigsten der Unschuldigen nicht verhungern zu lassen.
Der Bauer, für den sie arbeitete, betraute sie auch mit der Auslieferung an verschiedene Lebensmittelgeschäfte. In vielen Häusern, die sie besuchte, und auch auf dem Hof sah sie Kinder, von denen sie wusste, dass sie Wolfskinder waren. Sie hatten den gleichen verlorenen Blick wie jene, derer sich Irina und Annemarie annahmen, viele von ihnen hatten geschorenes Haar, weil es keinen anderen Weg gab, sie von ihren verlausten, verfilzten Haaren zu befreien. Bei manchen Kindern sah Irina auch immer noch den vom Hunger aufgedunsenen Bauch, der in den Wochen und Monaten nach Kriegsende bei so vielen Menschen zu sehen gewesen war. Wenn Irina einen solchen Bauch sah, tauchte vor ihrem inneren Auge noch ein anderes Bild auf. Von Menschen, darunter auch Kindern, die sich mit Messern auf tote Pferdeleiber stürzten, das Fleisch herausrissen und sich in den Mund stopften. Irina schüttelte sich und schob das Bild rasch fort.
Die Kinder, die sie auf den Höfen sah, sprachen nicht oder nur sehr gebrochen litauisch, und wenn sie sprachen oder wenn sich jemand ihnen näherte, beobachtete Irina ein nervöses Flackern im Blick derer, die sie aufgenommen hatten. Es war den Litauern verboten, diesen Kindern zu helfen, wer sich widersetzte, dem drohten harte Strafen bis hin zur Ausweisung oder zur Deportation nach Sibirien. Viele Litauer gingen das Risiko trotzdem ein, zumindest eine Zeit lang, bevor sie die Kinder wieder fortschickten, weil die Lage zu bedrohlich wurde.
Und es gab so viele Menschen, die Hilfe brauchten! 5.000 Wolfskinder – wie man die einsamen Kinder, die wie Wölfe in den Wäldern hausten, nannte – versuchten, jenseits der Memel zu überleben.
Abends kehrte Irina heim, immer ein wenig besorgt, ob während ihrer Abwesenheit ein Russe gekommen war und Annemarie und die Kinder vertrieben oder Schlimmeres getan hatte. Wenn einer käme, dann hätte nur sie die anderen schützen können, denn ihr, Irina, würden sie nichts tun. Am liebsten wäre sie den ganzen Tag zu Hause geblieben, um auf ihre Lieben aufzupassen.
Aber sie hatte keine andere Wahl, als tagsüber unterwegs zu sein, um Geld und etwas Lebensmittel heimzubringen. Und irgendwie hielt Gott auch seine schützende Hand über den Hof. Niemand krümmte den Kindern und Annemarie ein Haar. Dann und wann schallte inzwischen sogar fröhliches Kinderlachen durch das Haus, Annemarie war den ganzen Tag damit beschäftigt, Wäsche zu waschen, Essen zu kochen und die Kinder zu unterrichten. Es war ihr wichtig, dass sie etwas lernten und dass sie die deutsche Sprache nicht vergaßen, im Gegensatz zu den vielen anderen einsamen Kindern, die in litauischen Familien aufgenommen wurden. Denn aus Angst vor den Russen verboten sie ihnen, Deutsch zu sprechen und verlangten auch von ihnen, ihren deutschen Namen abzulegen, womit ihren Eltern, so sie noch lebten, freilich auf ewig die Chance genommen war, sie zu finden.
Tagsüber war alles gut, aber die Nächte waren schlimm. Sowohl Annemarie als auch Irina waren stets die halbe Nacht auf den Beinen, um Tränen zu trocknen und zitternde kleine Körper in den Armen zu halten, wenn die Kinder des Nachts von den Gespenstern der Vergangenheit heimgesucht wurden.
7. Kapitel
Paris, Frankreich, April 1949
Der Mann, der vor der Tür stand, war groß, schlank und sah Sophie auf eine unheimliche Weise ähnlich. Vor allem aber strahlte er eine schier überbordende Vitalität aus – das war es, was sein Auftreten besonders prägte.
Das Lächeln auf seinen Lippen erstarrte, als Manon ihm öffnete.
Er hatte erwartet, dass seine Mutter oder sein Vater vor ihm stehen würden und hatte sich diesen Moment so oft ausgemalt. Ihr Gesicht, wenn sie begriffen. Das Gefühl ihrer Umarmung.
Stattdessen stand nun eine wildfremde Frau vor ihm und starrte ihn an. In Raphaels Kopf überschlugen sich die Gedanken. Das konnte in diesen Tagen nichts Gutes bedeuten. Es konnte nur heißen, dass seine Eltern … umgekommen waren. Dass sie nicht mehr lebten und ihr Haus jetzt einer anderen Familie gehörte.
Wortlos starrten sie sich an. Er gefangen in seiner Verblüffung und seiner Angst, sie fassungslos, weil dieser Mann aussah wie Sophie.
»Wer sind Sie?«, brachte er schließlich hervor.
Und sie sagte nur: »Manon«, als seien damit alle Fragen beantwortet.
Wieder schwiegen sie eine Weile, dann nickte er und sagte: »Manon.« Und nach weiterem Schweigen: »Sagen Sie, Manon, wie lange leben Sie hier schon?«
»Zwei Jahre«, erwiderte Manon.
»Zwei Jahre«, wiederholte der Mann und fragte: »Kannten Sie die Familie, die vorher hier lebte?«
In Manons Kopf herrschte Verwirrung. Vorher? Wie meinte er das? Soviel sie wusste, befand sich das Haus schon von jeher im Besitz der Familie? Daher schüttelte sie nur langsam den Kopf.
Raphael sackte in sich zusammen, sagte leise: »Dann entschuldigen Sie bitte die Störung«, und machte auf dem Absatz kehrt.
In diesem Moment begriff Manon. Während ihr sofort klar gewesen war, dass es sich bei dem Mann um ein Familienmitglied Sophies handeln musste, hatte er sie ja noch nie zuvor gesehen und musste daher annehmen, dass seine Familie nicht mehr hier lebte. Der junge Mann hatte sicherlich gedacht, sie sei die neue Hausherrin und seine Familie … Sie rannte ihm nach und rief: »So warten Sie doch.«
Raphael drehte sich um, einen Schimmer Hoffnung in den Augen. »Wissen Sie vielleicht doch, wo ich die Familie finden kann? Oder was aus ihr wurde?«
»Wenn sie die Familie Didier meinen, die lebt hier immer noch. Ich bin nur eine Freundin. Bitte entschuldigen Sie, ich habe überhaupt nicht begriffen.«
Raphaels Gesicht begann zu leuchten, er fiel der überraschten Manon glückstrahlend um den Hals. »Sind sie da?«, fragte er, »meine Eltern? Pierre und Sophie?«
Manon schluckte. Sie wusste so wenig von Sophies Familie, da diese ja nicht sprach. Aber sie hatte sich nach und nach die Geschichte zusammengereimt. Im Keller hatte sie Flugblätter der Résistance gefunden. Sie hatte Familienfotos gesehen.
»Sophie ist da«, sagte sie leise. »Sophie ist immer da. Pierre … ist Ihr Vater, nicht wahr?«
»Ja«, sagte Raphael verblüfft und gleichermaßen besorgt – und auch ein wenig misstrauisch. Wenn sie eine Freundin der Familie war, wieso wusste sie dann nicht, dass Pierre sein Vater war?
»Gehen Sie noch nicht hinein«, bat Manon, als Raphael sich auf den Weg zur Tür machte. »Ich muss Ihnen erst erzählen, was mit Ihrer Familie geschehen ist – sofern ich das weiß.«