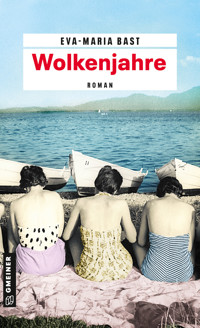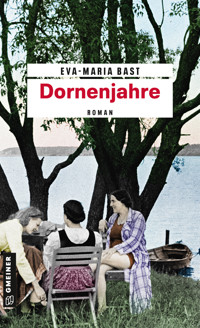Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jahrhundert-Saga
- Sprache: Deutsch
Deutsches Reich 1914. Johanna, Sophie und Luise sind drei mutige, starke und schöne junge Frauen, die Zukunft liegt verheißungsvoll vor ihnen. Doch dann bricht der Krieg aus und sie lernen das Leben von seiner finstersten Seite kennen. Sophie erwartet ein Kind von einem Franzosen, der jetzt Feind ist, Luise und Johanna geraten in russische Gefangenschaft. Der Krieg verlangt ihnen alles ab. Aber er macht sie auch stärker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Eva-Maria Bast
Mondjahre
Ein historischer Roman vom Bodensee
Zum Buch
Kriegswirren Deutsches Reich 1914. Johanna, Sophie und Luise sind drei mutige, starke und schöne junge Frauen, die Zukunft liegt verheißungsvoll vor ihnen. Doch dann bricht der Krieg aus und sie lernen das Leben von seiner finstersten Seite kennen. Sophie erwartet ein Kind von einem Franzosen, der jetzt Feind ist. Luise muss den Einmarsch der Russen in ihrer Heimatstadt miterleben und gleichzeitig den Tod ihrer Eltern, die von feindlichen Truppen ermordet werden, verarbeiten. Halt gibt ihr Siegfried, Johannas Onkel, der in der Schlacht um Neidenburg kämpft und sich in die junge Luise verliebt. Im Jahr darauf geraten Johanna und Luise in russische Gefangenschaft. Luise muss zusehen, wie Siegfried beim Versuch, sie zu befreien, niedergeschossen wird. Mit der Fahrt nach Russland beginnt die Fahrt ins Ungewisse. Hat Siegfried die Schüsse überlebt? Wird sie ihn wiedersehen? Und dann geraten die beiden Frauen in die Wirren der Revolution.
Eva-Maria Bast, Jahrgang 1978, ist Journalistin, Autorin und Geschäftsführerin der »Bast Medien GmbH«. Sie erfand und schrieb die bekannte Buchreihe »Geheimnisse der Heimat«, die inzwischen deutschlandweit vorliegt. 2012 begann sie, sich auch der Belletristik zu widmen. Nach zwei Krimis, die beim Gmeiner-Verlag erschienen sind, legt sie nun den vierten Teil ihrer »Mondjahre-Reihe« vor. Eva-Maria Bast erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen für ihre Arbeit und ist seit Juni 2015 Gastdozentin an der Hochschule der Medien Stuttgart. 2016 brachte sie mit »Women’s History« das erste Magazin über Frauen in der Geschichte heraus. Es erscheint vierteljährlich. Eva-Maria Bast lebt mit ihrer Familie am Bodensee.
www.bast-medien.de und www.womens-history.de
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Wolkenjahre (2018)
Dornenjahre (2016)
Kornblumenjahre (2015)
Mondjahre (2014)
Tulpentanz (2013)
Vergissmichnicht (2012)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © GettyImages
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN978-3-8392-4384-8
Widmung
Für meine Großmutter Annelene Preuß, deren Leben mich zu diesem Buch inspiriert hat, und die an dem Tag starb, an dem ich es fertig geschrieben hatte.
1. Kapitel
Friedrichshafen, Bodensee, 20. Juni 1914
Der Regen setzte plötzlich und unerwartet ein. Er troff aus dem düsteren Sommerhimmel, der wenige Minuten zuvor noch leuchtend blau gewesen war, durchdrang Sophies Kleider und legte sich mit eisigen Fingern auf ihre Haut, als wolle er durch sie hindurchfließen, sie durchdringen, sie in seinen Besitz bringen. Sie keuchte erschrocken und suchte Schutz in einer Nische, die sich als Eingang zu einer dunklen Spelunke erwies, in die sie unter normalen Umständen nie einen Fuß gesetzt hätte – schon gar nicht alleine. Die Nische bot nicht lange Schutz, denn der Regen wurde heftiger und Sophie floh nach drinnen, wo staubige Dunkelheit sie umfing. Kaum ein Lichtstrahl drang hier herein, als wolle das Licht diesen trostlosen Ort nicht sehen und wende feige und beschämt seinen Blick ab.
Es roch nach Schweiß, Alkohol, Zigaretten und auch ein wenig nach Resignation und Verzweiflung. Sie strömte aus den Augen der greisen Männer, die dort am Tisch saßen, den Blick trüb auf die Platte gerichtet, als hätten sie nie anderswo hingeblickt. Vor einem Bier, das aussah, als hätte es immer schon immer dort gestanden, in dieser dunklen Spelunke, auf der schäbigen, zerkratzten Tischplatte, vor den alten Augen, die so trüb blickten.
Sophie schwankte beim Beobachten der Männer zwischen Mitgefühl, Ekel und Faszination, als sie wahrnahm, dass sich der Raum plötzlich veränderte.
Er schien größer, mit einem Mal. Weiter. Der staubige, traurige Grundton war dem köstlichen Duft nach Ferne gewichen. Es roch nach Fremde, nach Versprechen, Hoffnung und Verlangen.
Sie blickte auf und sah einen Mann in der Tür stehen. Schlank und muskulös. Lässig und elegant. Sein Blick irrlichterte im Raum umher, ging auf die gleiche Reise wie zuvor der ihre, traf ihren Blick, verhakte sich in ihm, hielt sich daran fest. Welcher Ausdruck in seinen Augen lag, konnte Sophie nicht deuten, dazu war es zu dunkel und er zu weit weg. Aber sie wusste, ohne ihn anzusehen, wie sein Blick sich anfühlte. Spürte, wie er sich durch ihren Körper wand, sich ausbreitete, Finger bildete, die nach ihr griffen, Worte formte, die sie liebkosten.
Der Mann an der Tür nickte kurz, was keiner bemerkte, niemand außer Sophie hatte sein Erscheinen wahrgenommen. Die alten Männer betrachteten immer noch die Maserung der Tischplatte. Und der Wirt, ein verhärmter und lebloser alter Mann mit wächserner Haut und ebensolchem Haar, hinterließ mit seinem schmutzigen Lappen eine Dreckspur in der feinen, silbrigen Staubdecke des Tresens.
Der junge Mann löste sich aus dem Türrahmen und kam auf Sophie zu.
Drei Stunden später war der Regen in der heißen, durstigen Erde versunken. Pierre, so hieß der Fremde, und Sophie hatten drei Schnäpse getrunken, in dieser Bar, die wie eine andere Welt war. Sie hatten sich viel zu sagen gehabt dort drinnen, wie alte Freunde, die einander nach langen Jahren wiedersehen.
Sie beschlossen, spazieren zu gehen. Und dann setzten sie sich am Seeufer still nebeneinander auf eine Parkbank, die sie zuvor von den Spuren des Regens befreit hatten.
»Das ist einer dieser Momente, an die man kurz vor seinem Tod noch mal denkt«, sagte Pierre versonnen.
Ja, dachte Sophie und fröstelte plötzlich. Obwohl sie Pierres Nähe unendlich genoss, sie mit jeder Faser ihres Körpers in sich aufsog, stieg dunkles Unbehagen in ihr empor – ein Unbehagen, das sie nicht benennen, nicht greifen konnte. Vielleicht war es die Vorahnung, dass die Welt, die außerhalb dieses kleinen, geschützten Augenblicks lag, wenig später völlig aus den Fugen geraten sollte. Ihr Magen zog sich zusammen. Verflogen war der Zauber des Moments, die Angst griff polypenartig ins Jetzt. Sie tastete mit der linken Hand Halt suchend nach dem kleinen, silbernen Notizbuch, das sie, seit sie es im Kaufhaus Morath in Überlingen erstanden hatte, immer an einem Band um den Hals trug, und dem sie ihre intimsten Gedanken anvertraute. Und mit der Rechten griff sie nach Pierres fremder, vertrauter Hand.
2. Kapitel
99 Jahre später
Stuttgart, Baden-Württemberg, August 2013
Worte fielen auf Papier. Sie formten sich zu Sätzen, bildeten Aussagen, wurden nach und nach zu einer Geschichte. Das Papier, auf das sie flossen, war hässlich. Der Stift, mit dem Zita sie schrieb, auch. Die grauen, linierten Blätter wurden am oberen Rand von einer dünnen Metallspirale gehalten, der Stift war ein einfacher Plastikkugelschreiber, dessen Mine schmierte und Schlieren zwischen den Worten bildete.
Zita hielt inne und legte den Kugelschreiber mit einer langsamen Bewegung auf die Tischplatte. Es schmerzte sie, die Worte mittels solch hässlicher Instrumente niederzuschreiben. Worte mussten, das wusste sie, achtsam behandelt werden. Wer Worte hat, ist mächtig. Mit dieser Macht galt es, gewissenhaft umzugehen. Worte können nicht nur schön sein und lyrisch, sie können auch verletzen, kränken, ja, sogar vernichten. Hilde Domin kam ihr in den Sinn und ihr Gedicht »Unaufhaltsam«, das mit den Worten endet: »Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. Nicht das Wort. Am Ende ist das Wort. Immer am Ende das Wort.«
Mit einer raschen Bewegung zog sie ihr iPad aus der Tasche. Nicht, um auf ihm weiterzuschreiben, konnte doch das Schreiben auf dem technischen Gerät das Gefühl des Schreibens mit der Hand nie ersetzen und waren es doch ganz andere Worte, die hervorquollen, wenn sie einen Stift in der Hand hatte, als wenn sie tippte.
Nein, Zita, die Schriftstellerin und Studentin der Literatur und der Geschichte, hatte anderes im Sinn: Sie strich sich ihre schweren, dunklen Haare hinter die Ohren, wählte sich ins World Wide Web ein, öffnete die Startseite von eBay, klickte auf Antiquitäten und Kunst und tippte »Notizbuch« in die Suchmaske.
Das Foto, das Sekunden später auf dem Bildschirm erschien, zog Zita in seinen Bann. Ein Verkäufer bot ein wunderschönes Notizbuch aus Silber an. Seine Oberfläche war ziseliert, an der Seite befand sich ein kleiner, silberner, ebenfalls ziselierter Stift, der durch an der Vorder- und Rückseite des Büchleins befestigte Laschen gesteckt wurde und damit gleichzeitig einen Verschluss bildete. Man konnte lose Blätter zwischen Buchdeckel und Buchrücken klemmen. Das kleine Kunstwerk stamme aus der Zeit des Jugendstils, schrieb der Verkäufer, und Zita wusste, dass sie es haben musste. Sie begriff nicht, warum ihr Herz so hart gegen die Brust schlug, als sie das erste Gebot abgab. Sie hatte eigentlich nie zu den Frauen gehört, die angesichts eines Gegenstands, den sie sich wünschen, in Hysterie verfallen. Erst später, als die Geschichte um das Büchlein ihren Lauf nahm und sich die Leben so vieler Menschen dadurch veränderten, sollte sie dieses harte Schlagen ihres Herzens rückwirkend als eine Art Vorahnung begreifen.
Der Verkäufer hatte noch weitere Bilder ins Netz gestellt, und als Zita sie anklickte, sah sie zu ihrem Entzücken, dass sich in dem Notizbuch noch ein alter, vergilbter, mit sehr verblasster Tinte beschriebener Block befand. Die Bildansicht ließ sich nicht vergrößern, auch dann nicht, als sie versuchte, das iPad auszutricksen. Es hielt stur und eckig an der Größe fest, die irgend jemand ihm vorgegeben hatte.
Vier Besucher hatten bereits auf das Büchlein geboten, das Angebot endete in 59 Minuten. Hastig tippte sie eine Zahl ein und klickte auf »bieten«.
Ein dickes rotes Kreuz spie sie drohend an. »Sie wurden von einem anderen Bieter überboten«, höhnte die Schrift. »Bitte geben Sie ein höheres Gebot ein.« Zita tat, wie ihr geheißen, wurde wieder überboten, spielte das Spiel noch viele weitere Male, kämpfte einen harten Kampf mit einer, die »antikmami« hieß, und blendete die Welt, in der sie sich befand, ein Café in der Stuttgarter Innenstadt, völlig aus. Nur zweimal nahm sie am Rande ihres Bewusstseins die Wirtin wahr, die sie streng fragte, ob sie noch etwas wünsche, was sie stets bejahte und durch »einen Kaffee bitte« ergänzte, den die Wirtin ihr gleich darauf neben das iPad knallte. Und dann ging, und ihr Lächeln hinter sich herschleifte.
In stummer Verbissenheit rang Zita mit »antikmami« um das Büchlein, bis Ebay ihr zum erfolgreichen Kauf gratulierte und die Zahlungsinformationen schickte. Zita verließ eilends das Café und hastete zu ihrer Bank, zum Nachtschalter, um die Überweisung von 300 Euro sofort vorzunehmen – die Onlineüberweisung vom iPad aus hatte nicht geklappt – konnte sie es doch kaum erwarten, die Kostbarkeit in Händen zu halten.
Das Päckchen war winzig klein und der Verkäufer hatte die Pappe mit mehreren Schichten dickem, braunen Klebeband umwickelt. Zita zerrte heftig an den glänzenden Bändern, die dieser Ungeduld erfolgreich ihre Zähigkeit entgegensetzten, nicht nachgaben, sich nicht lösten, bis sie schließlich kapitulierte, in ihr Büro ging, eine Schere holte, und das Klebeband aufschnitt.
Während sie die glitzernden Klebestreifen sorgsam entfernte, schämte sie sich mit einem Mal ihrer Ungeduld. Sie schien ihr ein unwürdiger Empfang für dieses lang erwartete Büchlein. Jetzt schnitt sie Klebebänder und Pappe vorsichtig auseinander und barg das darin liegende, in Zeitungspapier eingewickelte Büchlein wie einen Schatz in den Händen.
Aus seinen Hüllen befreit, lag es vor ihr. Es war genau so, wie sie es sich ausgemalt hatte, und nicht größer als ihre Handfläche. Am oberen Rand des Büchleins befand sich eine Öse, und Zita stellte sich vor, wie seine ehemalige Besitzerin – aus der Femininität des Stückes schloss sie, dass es einmal einer Frau gehört haben musste – es um den Hals getragen hatte. Vielleicht an einem hellblauen Seidenband? Oder an einer dicken, silbernen Kette? Zita konnte die Frau vor sich sehen – es war wie eine Vision. In ihrer Vorstellung war sie dunkelblond, hatte ein madonnenhaftes Gesicht, grünblaue Augen und trug die Haare am Hinterkopf aufgesteckt. Ihr Kleid war unter dem Mieder weit und fiel bis zum Boden hinab und in ihren Ohrläppchen steckten hellblaue Gemmen-Ohrringe.
Auf der Rückseite des Büchleins waren ein See und Berge eingraviert. Ganz schwach war auch die Schrift zu lesen. »Überlingen am Bodensee.« Ein Reiseandenken?
Andächtig klappte Zita das Büchlein auf, dazu musste sie zuvor den Stift herausziehen. Ein Meisterwerk der Kunst, dachte sie und ließ ihre Finger langsam und zärtlich über die Hülle wandern, als liebkose und erforsche sie das Gesicht eines noch fremden Geliebten.
Vor den beschriebenen Blättern klemmte, im Deckel befestigt, ein vergilbtes und augenscheinlich aus einer Zeitung herausgerissenes Bild von einem Mann mit dunklen Haaren. Es war offensichtlich, dass das Bild sehr alt war. Der Mann blickte gerade, klar und entschlossen in die Kamera. Zita betrachtete es nachdenklich, berührte es vorsichtig und blätterte dann weiter.
Die Notizblätter, die sich im Büchlein befanden, waren vergilbt, die hellblaue, verschnörkelte Schrift verblasst, sie ließ sich nicht leicht entziffern, zumal es sich um altdeutsche Schrift – oder war es Sütterlin? – handelte. Zita trat näher ans Fenster ihres Wohnzimmers, um besser sehen zu können. Die herrliche Aussicht auf Stuttgart nahm sie nicht wahr. Langsam gewöhnte sie sich an das Schriftbild, sie las mit angehaltenem Atem, verschlang die Worte, die eine andere Jahrzehnte zuvor geschrieben hatte, voller Verzweiflung, wie es schien, und voll tiefer, reiner Liebe.
Die Tinte war verwischt, als habe die Schreiberin beim Lesen geweint. Auch die Schrift war zitterig. Es war ein Gedicht von Bertolt Brecht:
Morgens und abends zu lesen:
Der, den ich liebe
hat mir gesagt,
dass er mich braucht.
Darum gebe ich auf mich acht,
sehe auf meinen Weg und
fürchte von jedem Regentropfen,
dass er mich erschlagen könnte.
Bertolt Brecht
Mit angehaltenem Atem blätterte Zita weiter.
Rußland, Petrograd, Mai 1917
Es wird Zeit zu gehen, wir sind in Gefahr. Eine Taube vor dem Fenster. Sie kündet von einer Freiheit, die es vielleicht nie mehr für uns geben wird. Gejagte sind wir, Verfolgte. Selbst der Stift in meiner Hand, mein einziger Vertrauter, fühlt sich kalt an. Sie zwingen uns hineinzugehen, mitten ins Dunkel. Aber etwas müßen wir mitnehmen, denn der Weg ist gefährlich. Einen Zettel, auf dem ein Wort steht: Licht. Und eine Empfindung, die wir nicht vergessen dürfen: Liebe.
Zita starrte nachdenklich auf Stuttgarts Lichter hinunter. Petrograd. Das war der russische Name für St. Petersburg. Im März 1917 hatte Russland unter den Feuern der Revolution buchstäblich in Flammen gestanden. Ob der Eintrag zwei Monate später mit der Februarrevolution zusammenhing? Was aber tat eine Deutsche mitten im Ersten Weltkrieg in St. Petersburg? Wenn die Schreiberin eine Russin gewesen wäre, dann hätte sie doch sicherlich nicht in Sütterlin und in deutscher Sprache geschrieben. Ob sie eine Kommunistin war, die sich den Bolschewiki angeschlossen hatte? Zita glaubte es nicht. Alles, was die andere schrieb, klang nicht kämpferisch – eher so, als sei sie tieftraurig und verzweifelt.
Nachdenklich blätternd betrachtete sie das nächste Blatt im Block. Es war eindeutig von einer anderen Person, denn die Schrift war nicht so kantig wie die der ersten Schreiberin, sondern weicher und runder. Auf dem Papier stand:
Ich erwarte ein Kind!
Baum des Lebens
gewachsen
aus der reinen Substanz
des Herzens.
Wie soll es leben
in dieser Welt der Kälte?
Und auf dem nächsten Blatt, in der gleichen Schrift:
Altes Schulhaus, Überlingen, Deutsches Reich, 1939
Franziska! Wach auf! Erkenne Dich! Erschrick vor Dir und beginne, den anderen, nämlich Deinen Weg zu suchen. Das ist nicht Dein Weg, den Du zu gehen im Begriff bist. Es ist ein schrecklicher, dunkler Weg, der Dich verschlingen wird. Der uns alle verschlingen wird. Komm zurück, ich flehe Dich an!
Zita atmete tief ein. Sie wollte, nein, sie musste dieser Geschichte auf den Grund gehen. Altes Schulhaus Überlingen. Das war ein Anhaltspunkt. Hastig gab sie die Angaben im Internet ein. Google fand zahlreiche Einträge. Das Alte Schulhaus war ein kleines Hotel inmitten eines reizenden Rosengartens. Einem plötzlichen Impuls folgend suchte Zita auf dem zerrissenen Packpapier nach dem Absender. Das Päckchen war in Überlingen aufgegeben worden. Von einer Sophie Didier. Sie verglich die Adresse des Alten Schulhauses im Internet mit dem Absender. Die Adressen stimmten überein.
Kurzentschlossen buchte Zita ein elektronisches Ticket und packte ihren Koffer. Da sie Semesterferien und auch keinen Ferienjob hatte, war sie frei. Und diese Freiheit würde sie nutzen. Jetzt sofort.
3. Kapitel
99 Jahre zuvor
Konstanz, Bodensee, 28. Juni 1914
Zu Hause wartete Helene. Seine schwangere, schutzbedürftige und stets auch ein wenig wehleidige Helene. Etwas in ihrem Wesen führte dazu, dass Justus sich ständig um sie sorgte, wenn er nicht bei ihr war. Diese Sorge hatte ihn verändert, seit er sie vor 20 Jahren geheiratet hatte. Sie hatte ihm die Unruhe in die Adern getrieben, ihn zu einem dauernd Gehetzten gemacht, der immer nur eines wollte: nach Hause, um zu sehen, ob es ihr gut ging, ob sie ein Leiden hatte, ob sie etwas brauchte. Auch heute war er ein Getriebener. Er zog seine goldene Taschenuhr hervor und seine fahrigen Finger brauchten drei Anläufe, bis sie den Deckel zu öffnen vermochten. Es war spät, zu spät, man hatte ihn nicht gehen lassen wollen. Konstanz war voller Touristen, es war Hochsaison und alle wollten sie bedient werden, alle hatten eine Frage an ihn, der im Inselhotel die feinen Stoffe seiner Firma anpries. Er hatte ein ambivalentes Verhältnis zu ihnen, wie Schmeißfliegen fielen sie jeden Sommer ein, setzten sich auf die Stadt, vereinnahmten sie, von der Schweiz her kommend, verdunkelten ihr schillerndes Bild durch ihre Masse. Und doch liebte er sie, weil er sie lieben musste. Sie ernährten ihn, sie sicherten seiner Firma das Einkommen und seiner Familie das luxuriöse Leben im erlesenen Kreise der Konstanzer Elite – man nannte seinen Namen in einem Atemzug mit dem anderer Fabrikanten, wie dem Planen- und Zelthersteller Stromeyer, der Stoffdruckerei Herosé und der mechanischen Weberei Straehl. Und auch der neue Bürgermeister Dietrich, ein fähiger Mann, wie Justus fand, verkehrte in ihren Kreisen. Während die Damen sich dann und wann zu Kränzchen verabredeten und jüngst sogar gemeinsam einen Ausflug nach Schloss Arenenberg unternommen hatten – Helene war ganz aufgeregt gewesen – trafen sich die Herren regelmäßig im Barbarossa, um über die Weltgeschichte zu sprechen. Diese Herrentreffen waren Justus heilig, und er dachte gerade daran, dass dieser Dietrich wirklich etwas zu sagen hatte, als ein Auto unmittelbar neben ihm bremste. Justus zuckte zusammen. Automobile waren Fremdkörper in der Stadt, sie veränderten ihr Bild, ihren Klang, ihre Geschwindigkeit.
»Haben Sie schon gehört?«, brüllte der Fahrer, ein elegant gekleideter Herr, den Justus nicht kannte. Das Gesicht unter seinem weißen, modernen Hut war rot vor Begeisterung. »Es gibt vielleicht Krieg! Der österreichische Thronfolger und seine Frau sind in Sarajevo ermordet worden!«
Justus erblasste. Im Keller seines Bewusstseins formte sich ein Gedanke, aber er war zu schwach, um an die Oberfläche zu gelangen. So stiegen nur die kleinen Bläschen einer Ahnung empor, bitter, giftig, Unheil kündend. Sie lähmten ihn, als beginne ihr Gift schon zu wirken und breite sich langsam und schleichend in seinem Körper aus.
Lang schon hatte der Fahrer ihn verlassen, war davongefahren, um die Botschaft weiter in der Stadt zu verbreiten, als Justus immer noch versuchte, die Schatten, die sich zwischen ihn und die Welt gelegt hatten, wegzublinzeln. Es gelang ihm nicht, und so waren seine Bewegungen langsam, schwer und traumhaft, als er kehrt machte und zur Konstanzer Marktstätte ging. Der Platz war voller Menschen. Sie riefen aufgeregt durcheinander, aneinandergepresst, weil nicht genug Platz für alle vorhanden war. Ein Polizist versuchte, einen Anschlag anzubringen, und wurde von den Menschenmassen fast erdrückt. Sie alle wollten die Worte lesen, in sich einsaugen, was dort stand, es schriftlich sehen, eine Bestätigung dafür bekommen, dass es ernst war, dass es stimmte, was gesagt wurde. Der Anschlag war die Papier gewordene Bestätigung, dass sich etwas ändern würde. Dass da etwas Ungeheures geschehen war. Etwas, das die Welt verändern würde. Es gelang Justus nicht, sich bis zu dem Anschlag vorzuarbeiten, zu dicht gedrängt standen die Menschen. Doch er erfuhr auch so alles, was dort stand, denn die Nachrichten wurden rasch in die hinteren Reihen und von dort aus weiter in die Stadt hinausgetragen.
»Es war das zweite Attentat auf Franz Ferdinand!«, rief ein junger Mann und zerrte sich vor Aufregung seinen weißen Hut mit dem schwarzen Band vom Kopf. »Gleich bei ihrer Ankunft am Bahnhof soll eine Bombe gezündet worden sein, die das Thronfolgerpaar aber verfehlte. Dafür wurden andere verletzt.«
»Der Attentäter soll ein serbischer Extremist gewesen sein!«
»Der Kaiser ist schon unterrichtet. Er ist bereits auf dem Weg nach Berlin!«
»Österreich-Ungarn wird sich das nicht bieten lassen, und sie sind unsere Bündnispartner!«
»Das wird Krieg geben!«, schrie einer.
Die allgemeine Welle der Erregung prallte hart gegen Justus’ Betäubtheit und riss ihn grob in die Realität der lauten Töne und der grellen Farben. Hastig und mit Gedanken im Kopf, die sich zu überschlagen begannen, verließ er den Platz. In zwei Wochen sollte sein drittes Kind geboren werden und die ganze Welt schien kopfzustehen! Er versuchte sich einzureden, dass sie übertrieben, dass sie die Sache aufbauschten, die Leute auf dem Platz. Aber es gelang ihm nicht, denn in gewisser Weise hatten sie recht. Wenn Österreich einen Vergeltungsschlag üben würde, dann hinge Deutschland mit drin.
Wahrscheinlich müsste ich jetzt patriotische Gefühle bekommen!, dachte Justus. Aber wenn es Krieg gibt, dann werde ich als Reserveoffizier einberufen und muss Helene mit dem neugeborenen Kind, der fünfjährigen Marlene und unserer heiratsfähigen Johanna in der Stadt allein lassen. Sie wird das nicht schaffen, sie wird verzweifeln, sie wird … er zwang sich, seine Gedanken zu unterbrechen. Noch war ja kein Krieg und es konnte durchaus sein, dass es auch keinen geben würde. Dass die Welt jetzt brodelte, das war nur zu verständlich, aber vielleicht beruhigte es sich ja wieder.
Inzwischen war er vor seiner Haustür angelangt – ein Mann in Aufruhr, der sich aber wieder so weit gefangen hatte, dass er ruhig und gelassen wirkte. Aufrecht vom Scheitel bis zur Sohle, seiner Frau ein hervorragender Beschützer, seinem Land ein braver Bürger.
In der Tür kam ihm Sophie, seine Schwägerin, entgegengelaufen und er dachte wieder einmal, wie schön sie war, wie ihre Augen funkelten, wie viel Lebenslust aus ihnen strahlte. »Gut, dass du kommst!«, rief sie erleichtert. »Helene geht es gar nicht gut.«
Seine preußisch-aufrechte Haltung fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – das Sachen waren, die eigentlich nur die Frauen etwas angingen, fühlte er sich in diesen Dingen so unbedarft und unsicher. »Kommt das Kind etwa schon heute?«, fragte er hastig und rückte sich seine Nickelbrille zurecht. »Habt ihr eine Hebamme gerufen?«
Sophie schüttelte den Kopf und legte ihrem Schwager ihre schmale Rechte auf den Arm. »Inzwischen geht es ihr schon besser, sie schläft jetzt. Und kurz bevor sie eingeschlafen ist, sagte sie noch, dass sie nun doch das Gefühl habe, dass das Kind sich noch etwas Zeit ließe und dass sie wohl nur ein wenig nervös gewesen sei.«
»Sie hat es also gespürt«, murmelte Justus. »Ich habe es schon befürchtet. Sie ist so empfindlich und noch dazu schwanger, da musste die allgemeine Stimmung auf sie übergehen und sie beunruhigen. Vielleicht hat sie es auch irgendwie erfahren.«
Sophie horchte auf, erschrocken über seinen Ton. Erst jetzt bemerkte sie, wie blass ihr Schwager war, wie blass er schon gewesen war, als er zur Tür hereinkam, bevor er wusste, dass es Helene nicht gut ging. »Was? Was hat sie gespürt?«
Justus sah sie an. Er wusste, dass er ohne Bedenken mit ihr über alles sprechen konnte, denn sie war nicht so leicht aus der Fassung zu bringen und überdies politisch sehr interessiert. Sophie entsprach so gar nicht seinem Frauenbild. Sie ordnete sich nicht unter, bildete sich ein eigenes Urteil und tat der Umwelt die Ergebnisse ihrer Gedanken auch kund. Das befremdete ihn. Und gleichermaßen faszinierte es ihn. Er hatte es schon längst aufgegeben, sie in diesen Dingen zu ignorieren und sie daran zu erinnern, dass sie eine Frau war und dass diese Themen nichts für sie waren.
»Das dauert wohl etwas länger, dir das zu berichten«, sagte er also. »Es ist gut, dass Helene gerade schläft, sie soll sich nicht zusätzlich aufregen. Ich will noch mal nach ihr sehen. Geh doch schon mal ins Wohnzimmer, ich komme gleich.«
Als er wiederkam, saß Sophie wartend auf dem Sofa, ihre unruhigen Finger fuhren über die samtenen Lehnen der Sessel, verfingen sich in ihren Haaren und spielten nervös mit der Strähne, die sich aus der Hochsteckfrisur gelöst hatte. Sie hob den Blick und sah ihm erwartungsvoll entgegen. »Nun sag schon«, drängte sie ihren Schwager. »Was ist geschehen?«
Justus ließ sich ihr gegenüber auf das kleine Sofa sinken, holte tief Luft und sah ihr direkt in die Augen. »Der österreichische Thronfolger ist in Sarajevo ermordet worden«, sagte er ohne Umschweife.
Sophie ließ die Hände sinken. Hilflos lagen sie nun da, auf ihrem Schoß, wie zwei Fremdkörper, die nicht zu ihr gehörten, nicht Teil von ihr waren. Mit starrem Blick sah sie auf den gemusterten Teppich, während es hinter ihrer Stirn zu arbeiten begann und Justus’ Worte wie durch einen dichten Nebelschleier zu ihr drangen. Sie hörte, dass er sagte, die Frau des Thronfolgers sei auch tot. Dass sie die Schüsse zunächst überlebt hatte und dann auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben war. Während sich diese Informationen gewissermaßen von außen in ihren Kopf bohrten, stieg zeitgleich die Ahnung in ihr auf, was das für sie und Pierre und für ihr junges Glück bedeuten konnte. Es war das gleiche Gefühl, das sie an jenem Abend gehabt hatte, als sie sich zum ersten Mal gesehen hatten, in der dunklen Spelunke am Eck. Jener Nacht, die alles verändert hatte. Seither lebte Sophie in einer Wolke der Sinnlichkeit. Sie nahm die Welt und ihren Körper ganz anders wahr – und zugleich stritten die Geister in ihr, die Lehre ihrer Mutter, die Lehre der Schicklichkeit war tief in ihr verankert, die Welt der Liebe war für sie bisher eine verschlossene gewesen – ohnehin hatte sie gelernt, dass Liebe eher etwas Langweiliges ist, dazu da, von der Sicherheit des Elternhauses in den sicheren Schoß eines Ehemanns zu wechseln. Und das, was man tun muss, um Kinder zu bekommen, schien eher etwas Peinliches und Unangenehmes zu sein.
Das dachte sie, bis sie Pierre kennenlernte. Und auch wenn sie ihm bisher nicht mehr als einen Kuss genehmigt hatte, so labte sie sich doch an jener schweren Süße, die jeder ihrer Begegnungen innewohnte und die voller Versprechen und Verlangen war. Es war ein seltsamer, aber sehr belebender Kampf, den die wilhelminische Erziehung mit der eben erwachenden Sinnlichkeit der jungen Frau kämpfte.
Sie hob den Kopf und sah Justus an. »Sie befürchten, dass es Krieg geben wird«, sagte der gerade.
Das war das Wort, das Sophie endgültig aus ihrer Betäubung riss, jegliche Hoffnung zerschmetterte, ihr klar vor Augen führte, was das zu bedeuten hatte. Krieg. Sie würde Pierre verlieren.
Justus sah sie besorgt an. »Soll ich dir ein Glas Wasser besorgen?«, fragte er hilflos. Er hatte schon oft gehört, dass Helene einer der anderen Damen der Gesellschaft ein Glas Wasser anbot, wenn diese unpässlich zu sein schien. Also hielt er es auch jetzt für angebracht.
Doch seine Schwägerin blitzte ihn wütend an. »Wasser! Es gibt momentan Wichtigeres als Wasser!«, zischte sie.
Justus’ Miene verhärtete sich und er setzte dazu an, sich zu erheben. So sehr er seine Schwägerin schätzte – so durfte sie nicht mit ihm sprechen. Das durfte niemand.
»Entschuldige«, sagte Sophie da auch schon, erschrocken über ihre eigene Heftigkeit. »Ich wollte dich nicht anfahren. Ich bin nur derart erschüttert, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann.«
»Ist schon gut, ich verstehe dich ja.« Justus ließ sich wieder in den Stuhl zurückfallen.
»Meinst du denn, dass es Krieg geben wird?«
»Ich weiß es nicht. Auf den Straßen schreien die Menschen begeistert davon. Sie sagen, dass Österreich sich das nicht bieten lassen wird und dass sie Serbien den Krieg erklären werden.«
»Und dann hängt Deutschland mit drin, wegen des Bündnisses«, stellte Sophie fest.
Justus nickte und rückte seine Nickelbrille zurecht wie immer, wenn er nervös oder verunsichert war. »Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass Österreich unbedingt mit einem Krieg reagieren wird. Ich denke, es kommt ganz darauf an, wie Serbien sich jetzt verhält.«
»Wir müssen es Helene sagen«, meinte Sophie leise, »und auch Johanna.«
»Ich weiß.« Justus’ Stimme war rau. »Aber wenn das Kind doch heute noch zur Welt kommen sollte, dann wäre es das Beste, es Helene erst nach der Entbindung zu sagen.«
»Da hast du recht«, stimmte Sophie ihm zu, froh, dass sie nun gefordert war, ihre Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, froh, einen Moment Gnadenfrist bekommen zu haben und nicht darüber nachdenken zu müssen, was mit Pierre und ihr geschehen würde. »Aber vorhin hielt sie es für unwahrscheinlich, dass das Kind heute noch kommt. Und dann müssen wir es ihr heute sagen, denn sonst erfährt sie es von anderswo und das ist noch schlimmer.«
»Ich sehe noch einmal nach ihr.« Justus stützte seine schlanken Finger auf der Armlehne ab, erhob sich und verließ das Zimmer. Sophie sah ihm nach und wunderte sich wieder einmal darüber, wie gerade und aufrecht Justus stets durch das Leben ging. Als hätte er einen Stock verschluckt.
Mit Justus war alles, was sie hätte ablenken können, aus dem Zimmer verschwunden. Sophie blieb alleine zurück, grübelte und versuchte sich selbst Mut zuzusprechen. Doch sie konnte die kalte Angst, die ihr Herz in Besitz genommen hatte, nicht vertreiben. Sie war ein Widerhall jener dunklen Ahnung, die sie an ihrem ersten Abend mit Pierre ergriffen hatte.
*
Wenn Johanna ging, glich sie einem Engel. Ihre Füße berührten den Boden immer nur flüchtig, als streife sie die Erde lediglich, um sie zu segnen. Ihr schlanker Körper gestreckt, die Augenbrauen leicht gewölbt, ihr Gesicht madonnenhaft, blickte sie fragend in die Welt, ihr Blick, ihr grüner Blick traf den seinen und Sebastian fühlte sich an das weiche Moos eines Waldbodens erinnert. Wieder einmal. Heute aber waren ihre Augen dunkler, wie nasses Moos, ihr Atem ging stoßweise, auf ihren Wangen brannte ein fiebriges Rot, als sie bei ihm anlangte, seine Hände ergriff und die Worte sprach, die an diesem Tag aus den Mündern so vieler quollen. Ob er es schon gehört habe. Ob er es schon erfahren habe, schon wisse: dass der österreichische Thronfolger ermordet worden sei. Und ob er das auch so schlimm finde wie alle anderen. Ob er ihr nicht bestätigen könne, dass es bedeutungslos sei.
Sebastian blickte in ihre grünglühenden Augen, in dieses schöne Gesicht, das nach dem Leben gierte, und obwohl er nur vier Jahre älter war als sie, fühlte er sich, als liege ein ganzes Jahrhundert zwischen ihnen. Ein bleiernes, lähmendes Jahrhundert, ein todbringendes. Schwer war die Bewegung, als er seinen Kopf schüttelte und sagte: »Ich habe schon lange so eine Ahnung gehabt.«
Johanna sandte ihm einen verwirrten Blick zu. »Wieso? Dass Franz Ferdinand ermordet werden würde, konntest du doch wirklich nicht wissen.«
»Das meine ich auch nicht.« Sebastian zog sie neben sich auf die weiße Bank, die, im Schutze einer mächtigen deutschen Eiche, am Ufer stand. Er blickte auf den See, der ihm immer Heimat gewesen war. Aber auch der See war unberechenbar und gefährlich, erst drei Tage zuvor hatte er sich in ein Ungeheuer verwandelt und drei Fischer in den Tod gerissen, darunter auch einen, der eine achtköpfige Familie hatte. Johannas Hand hielt er noch immer in der seinen und spielte mit ihren Fingern, als er sagte: »Ich habe das Gefühl, dass all die Menschen um mich herum, ob nun meine Kommilitonen oder mein Bruder, die Eintönigkeit ihres Lebens langsam satthaben und sich nach etwas Neuem sehnen. Ein Krieg käme ihnen da gerade recht. Und von einem Freund, dessen Vater bei der Regierung arbeitet, weiß ich, dass der Kaiser und der Reichskanzler schon lange daran gedacht haben, Russland anzugreifen.«
Johanna wurde blass und die Augen unter den hochgewölbten, schmalen Augenbrauen wirkten zu groß für ihr Gesicht. Moosteiche. »Wieso sollten sie das tun?«
Sebastian wandte den Kopf, blickte sie von der Seite an und strich ihr zärtlich eine dunkle Haarlocke hinter das Ohr. »Es wäre ein Präventivschlag. Die Russen rüsten schon seit Langem auf, und in den entsprechenden Kreisen befürchtet man, dass sie uns angreifen werden, sobald sie fertig sind.«
Johanna blickte auf ihre ineinander verschlungenen Finger, die zwischen ihnen auf der hölzernen Bank lagen. »Und da wollen sie ihnen zuvorkommen«, sagte sie mit leiser, ärgerlicher Stimme. »Aus einem bloßen Verdacht heraus. Aber wenn sie es schon so lange überlegt haben, warum haben sie es dann noch nicht getan?«
»Na, weil doch Russland mit Frankreich und England verbündet ist. Und Frankreich hat ein Interesse daran, Elsass-Lothringen zurückzugewinnen. Deutschland müsste dann an zwei Fronten kämpfen. Aber wie gesagt, das weiß ich alles nur aus zweiter Hand. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich stimmt.«
»Schön und gut«, sagte Johanna. »Aber was hat das alles mit der Ermordung des Thronfolgers zu tun? Das ist doch zunächst mal eine Sache zwischen Österreich-Ungarn und Serbien.«
»Nicht für Russland. Russland sieht sich als Beschützer aller slawischen Völker und versucht schon lange seinen Einfluss auf dem Balkan auszudehnen«, erklärte Sebastian. »Österreich-Ungarn hingegen ist mit uns verbündet, und wenn sie Serbien angreifen, dann hängen wir mit drin.«
»Meine Güte, wie verworren das alles ist.« Johanna schüttelte langsam den Kopf. »Und ich dachte, ich würde mich ein wenig in der Politik auskennen.«
Sebastian lächelte. Es war ohnehin mehr als ungewöhnlich, dass eine junge Frau sich für Politik interessierte. Johanna und ihre Tante Sophie waren da große Ausnahmen.
»Das heißt, im Ernstfall wären wir auch mit Frankreich im Krieg?«, fragte Johanna.
»Ich denke, ja.«
Johanna stöhnte.
»Warum erschüttert ausgerechnet das dich so sehr?«, fragte Sebastian erstaunt.
»Wegen Sophie. Ihr Freund ist Franzose. Er ist gerade drüben in Friedrichshafen, um über Zeppelin zu schreiben. Er ist Journalist. Und Sophie ist so glücklich.«
Sie ließ Sebastians Hand los und rieb sich die bloßen Arme. Plötzlich war ihr bitterkalt. Eine Gänsehaut kroch über ihre Gliedmaßen, als Vorbote dessen, was kommen würde.
Sebastian legte den Arm um sie und zog sie an sich. Sie lehnte in einer unendlich vertrauten Geste den Kopf an seine Schulter.
4. Kapitel
Friedrichshafen, Bodensee, 29. Juni 1914
Sophie rannte. Es war ein gutes Stück Wegs vom Hafen bis zum Kurgarten-Hotel, in dem Pierre residierte, um für das Blatt in seiner Heimatstadt Paris über Graf Zeppelin im Allgemeinen und die Tatsache, dass der Flugzeugbau Friedrichshafen neuerdings touristische Rundflüge über den Bodensee anbot, im Besonderen zu schreiben. Immer sonntags, mittwochs und samstags zwischen zwei und drei Uhr konnte man nun im Zeppelin über Friedrichshafen fliegen. Pierre wollte nicht nur über den Grafen, der im Hotel eine Suite bewohnte, schreiben, sondern auch über einen gewissen Theodor Kober, der wohl einst Ingenieur bei Zeppelin gewesen war und sich dann mit der Flugzeugbau GmbH selbstständig machte. »Ich nehme dich mit auf den Flug, ma chère«, hatte Pierre Sophie bei ihrem letzten Treffen mit leuchtenden Augen versprochen. »Die Zeitung bezahlt’s. Und Essen und Trinken kann man an Bord des Luftschiffs auch. Der Küchenchef des Kurgarten-Hotels fliegt mit.«
Die Straßen waren schmutzig und ihr knöchellanges Kleid saugte am Saum den Staub auf. Einige Locken hatten sich aus der Hochsteckfrisur gelöst und fielen ihr auf den Rücken. Aber all das war ihr egal. Sie musste zu Pierre. Atemlos stand sie schließlich vor dem Hotelgebäude. Sie drückte die schwere Eichentür auf, raffte ihr Kleid, ignorierte das vehemente Räuspern des Concierge, lief in Windeseile die Treppen hinauf und klopfte im ersten Stock an seine Türe.
Sekunden später stand Pierre vor ihr.
»Sophie.« Rasch blickte er nach links und rechts, denn er wollte sie nicht noch mehr kompromittieren, als sie das ohnehin selbst schon getan hatte, indem sie zu ihm auf sein Zimmer gekommen war. Am Ende des Gangs standen zwei Zimmermädchen, tuschelten und starrten mit unverhohlener Neugier zu ihnen herüber. »Komm«, sagte er und drängte sich an ihr vorbei auf den Flur. »Ich lade dich zu einem Kaffee ein.«
Im Treppenhaus, unbeobachtet, zog er sie an sich und küsste sie sanft auf den Mund. »Wie schön, dass du gekommen bist.«
Sophie machte sich los. »Ich muss mit dir reden.«
Pierres Miene wurde ernst. »Ich kann mir schon denken, worüber. Komm.«
Unten setzten sie sich auf die Sonnenterrasse des Hotels und bestellten Kaffee für Pierre und eine Limonade für Sophie. »Es geht um die Ermordung des Thronfolgers, nicht wahr?«
Sophie nickte. »Ich mache mir schreckliche Sorgen!«
Pierre nahm ihre Hand. »Die Situation ist durchaus ernst«, begann er, »aber du solltest dir nicht allzu viele Gedanken machen. Oft verläuft sich so etwas.«
»Meinst du wirklich?«
Pierre nickte.
»Ich würde dir so gerne glauben. Aber ich habe Angst, dass das der Auslöser sein könnte. Europa ist ein Pulverfass, alle rüsten schon seit Langem auf.«
Pierre küsste Sophies Hand und sah ihr dabei in die Augen. »Bitte, Sophie«, sagte er leise. »Wir haben so wenig Zeit miteinander. Lass uns die, die uns bleibt, nicht mit schwarzen Gedanken vergeuden.
»Ach Pierre«, erwiderte Sophie. »Ich kann nicht anders. Ich muss einfach mit dir darüber sprechen, für Zärtlichkeiten habe ich jetzt wenig übrig.« Sie entzog ihm ihre Hand und blickte ihn so unglücklich an, dass es ihn ins Herz schnitt.
»Was, wenn ich recht habe, was, wenn unsere beiden Länder sich zerstreiten? Was wenn … wenn es Krieg gibt. Was wird dann aus uns? Ich möchte dich nicht verlieren!« Eine Träne rann ihr übers Gesicht.
Bestürzt sprang Pierre auf, umrundete den Tisch und ging neben Sophie in die Hocke. »Sophie, warum sollten sie sich streiten? Momentan ist das eine Sache zwischen Österreich-Ungarn und Serbien. Mit uns hat das noch gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Frankreich und Deutschland sind meiner Meinung nach gleichermaßen erschüttert über das Attentat.«
Sophie beruhigte sich etwas. »Wahrscheinlich hast du recht. Es ist nur, dass ich mir eben Sorgen mache, es könnte sich etwas Größeres daraus entwickeln, jeder könnte sich plötzlich an alte Rechnungen erinnern, die er mit einem anderen Land noch zu begleichen hat.«
»Sophie, bitte, lass uns nicht mehr darüber reden. Ich glaube nicht, dass du recht hast, aber wenn doch, dann müssen wir das Glück, das uns noch bleibt, genießen.«
Er sah sie an und wusste, dass jetzt der Moment gekommen war. Der Moment, der über sein ganzes weiteres Leben entscheiden würde. Sein Herz begann heftig zu schlagen, als er Sophies Hände in die seinen nahm und leise fragte: »Sophie … Sophie, willst du … willst du meine Frau werden?«
5. Kapitel
Konstanz, Bodensee, 12. Juli 1914
Johannas Mutter Helene nahm die Nachricht von der Ermordung des Thronfolgers weit ruhiger auf als erwartet. Sie litt zwar sehr unter dem Gedanken, dass Justus als Reserveoffizier im Falle eines Krieges sehr wahrscheinlich eingezogen würde, aber noch weigerte sie sich zu glauben, dass es wirklich dazu kommen könnte. Und genau zwei Wochen nach dem Attentat brachte sie ihre Tochter Franziska zur Welt.
Es war keine schwere, aber auch keine besonders leichte Geburt. Helene erwachte in der Nacht um zwei Uhr und wusste mit untrüglicher Sicherheit, dass das Kind kommen würde. Leise stand sie auf, schlich in Sophies Zimmer und berührte ihre Schwester sanft an der Schulter. »Sophie, das Kind kommt.«
Sophie schreckte hoch. »Bist du sicher?«
»Ich weiß es«, sagte Helene nervös. »Oh Gott, Sophie, ich habe solche Angst.«
Sophie sprang aus dem Bett. »Hast du Justus schon Bescheid gesagt?«
»Nein, ich wollte erst dich wecken. Bitte hole schnell die Hebamme im Nachbarhaus. Oder fürchtest du dich, jetzt, mitten in der Nacht? Ich weiß, es schickt sich nicht …«
»Blödsinn«, unterbrach Sophie sie rau. »In einem solchen Fall kommt es doch wirklich nicht darauf an, was sich schickt oder nicht. Versuch dich auszuruhen, du wirst deine Kraft noch brauchen.«
Damit verließ sie das Zimmer. Helene folgte ihr. Sie hatte gerade ihre Schlafzimmertür erreicht, als sie einen brennenden, stechenden Schmerz spürte. Es schien ihr, als legte sich eine eiserne Klammer um ihren Unterleib. Keuchend sank sie zu Boden und krümmte sich zusammen.
Justus schreckte hoch. »Helene?«
»Ich bin hier«, stöhnte sie. Die Wehe war vorbei, aber sie stand nicht wieder vom Boden auf. »Das Kind kommt.«
Mit einem Satz war Justus bei ihr. »Ich hole die Hebamme.«
»Nicht nötig, Sophie ist schon unterwegs.«
»Mitten in der Nacht?«
»Die Hebamme wohnt doch gleich nebenan.«
Justus schluckte. Ganz wohl war ihm nicht bei der Sache, aber er konnte wohl nichts mehr daran ändern. »Dann werden sie ja gleich kommen«, sagte er hilflos, während er seiner Frau aufhalf. Er war befangen, fühlte sich unwohl, wäre am liebsten geflohen. Aber er wusste, dass er bei seiner Frau ausharren musste. Umso erleichterter war er, als Sophie kurz darauf mit der Hebamme ins Zimmer kam, die ihn und Sophie resolut aus dem Zimmer schickte.
Besser ging es ihm deshalb nicht. Bis in die Stube hinein hörte er Helenes Schreie, und es machte ihn rasend, ihr nicht helfen zu können. Das war doch die ureigenste Aufgabe eines Mannes: allen Schmerz, alle Pein und alle Sorgen von seiner Frau fernzuhalten!
Mit einem Mal tauchte Johanna auf. Sie trug ein langes, spitzenbesetztes Nachthemd, und die dunklen Haare hingen ihr lose auf die Schultern. »Was ist denn los?«, fragte sie verschlafen.
Justus antwortete nicht.
»Helene bekommt ihr Baby«, sagte Sophie.
»Du solltest wieder zu Bett gehen«, murmelte Justus halbherzig in Johannas Richtung.
Die tat, als habe sie ihn nicht gehört, und ließ sich neben Sophie auf dem Sofa nieder. Justus beachtete sie nicht weiter. Er war zu sehr damit beschäftigt, ängstlich auf die aus dem Zimmer kommenden Geräusche zu lauschen. Auch Johanna und Sophie waren mucksmäuschenstill und horchten angestrengt.
Für einige Zeit war nur die leise Stimme der Hebamme zu hören.
Schließlich wurde es hektischer, Helene schrie noch mehr, die Hebamme spornte sie an. Dann war es still.
Johanna spielte nervös mit dem Ärmel ihres Nachthemdes. Was bedeutete das denn nun? Auch wenn sie es sich nicht anmerken ließ, so waren ihr die Schmerzensschreie ihrer Mutter doch durch und durch gegangen. Und nun diese plötzliche Stille! War sie … mein Gott – was, wenn sie tot war?
Plötzlich durchbrach ein spitzer, empörter Schrei die Stille und erlöste die angespannt Lauschenden aus ihrer Erstarrung. Es war der erste Schrei eines neugeborenen Menschen.
Justus sprang auf und stürzte aus dem Zimmer. Vor seiner Schlafzimmertür hielt er einen Moment inne und holte tief Luft. Dann klopfte er.
»Sie können jetzt hereinkommen«, rief die Hebamme.
Er öffnete vorsichtig die Tür.
Johanna war inzwischen in den Flur geeilt und versuchte einen Blick ins Zimmer zu erhaschen, bevor die Tür sich wieder schloss. Aber sie hatte zu spät reagiert. Sie konnte nichts mehr erkennen. Bedrückt ging sie zum Sofa zurück und ließ sich neben Sophie nieder.
Die spürte, was in Johanna vorging, und legte ihr die Hand auf die Schulter.
»Hoffentlich geht es Mutter gut«, murmelte Johanna.
»Sicher tut es das«, versicherte Sophie beruhigend.
»Aber man hat nichts mehr von ihr gehört nachdem sie … nachdem sie so entsetzlich geschrien hat.«
»Wenn ihr etwas geschehen wäre, dann hätte die Hebamme schon längst nach einem Arzt geschickt. Du kannst wirklich beruhigt sein.«
Wenig später wurde Johanna von ihren Sorgen erlöst, denn die Tür ging auf, und Justus bat sie und Sophie hinein. Johannas Beine fühlten sich ganz weich an, als sie hinter ihrem Vater das Zimmer betrat.
Helene saß aufrecht im Bett, blass und geschwächt zwar, aber freudestrahlend. In ihrem Arm hielt sie ein winzig kleines Mädchen.
Sie streckte die Hand nach Johanna aus. »Du hast eine kleine Schwester«, flüsterte sie, »sie heißt Franziska.«
Widerstrebend nahm Johanna die Hand ihrer Mutter. Irgendwie hatte sie eine gewisse Scheu, sie zu berühren, nachdem sie sie so hatte schreien hören. Rasch versuchte sie abzulenken. »Darf ich Franziska einmal auf den Arm nehmen?«, fragte sie.
Helene zögerte.
»Bitte.«
»Nun gut. Aber sei vorsichtig.«
Johanna nahm der Mutter das Kind aus den Armen und blickte es staunend an. Wie klein sie war. Und wie hilflos.
Schenk ihr ein friedvolles Leben, betete sie innerlich. Und lass sie zu einem guten Menschen werden.
Doch beide Wünsche sollten sich nicht erfüllen.
6. Kapitel
Konstanz, Bodensee, 23. Juli 1914
Johanna scherte sich nicht um die Beschimpfungen, als sie sich rücksichtslos durch die Menschenmenge und bis zum Zeitungsstand vorkämpfte, um ein Exemplar zu ergattern. Sie warf einen Blick auf die Schlagzeile, fand bestätigt, was die Menschen sich auf den Straßen zuschrien, und rannte so schnell sie konnte nach Hause. Einen Monat war die Ermordung Franz Ferdinands nun schon her und keiner hatte mehr an einen Krieg geglaubt. Sophie und Pierre hatten das Aufgebot bestellt und Johanna sich in eine friedvolle Zukunft mit Sebastian geträumt. Und nun war alles wieder ins Wanken geraten!
Johanna eilte durch die bekieste Auffahrt und flog die Treppen zum Haus ihrer Eltern hinauf. Sie hatte erwartet, sie im Wohnzimmer zu finden, aber die gute Stube war leer, das einzige Geräusch war die laut tickende Wanduhr. Johannas Elternhaus glich einem kleinen Schloss. Ihr Vater hatte sich der Baufreudigkeit der letzten Jahre angeschlossen und es errichtet. Und auch wenn es noch relativ neu war, so kam es Johanna doch vor, als handle es sich um einen sehr alten Familienbesitz und als stünde das Haus schon seit Jahrhunderten dort an seinem Platz am Ufer. Es hatte zum See hin einen kleinen Erker, in dem ein winziger Sekretär stand. Und das Treppenhaus verlief in einem entzückenden kleinen Turm. Der Garten befand sich auf der geschützten Rückseite des Hauses.
Johanna machte kehrt und rannte nach draußen. Sie fand ihre Familie unter dem großen Nussbaum, der den hinteren Teil des Gartens beschattete. Justus, Helene und Sophie saßen am Tisch bei Kaffee und Kuchen, Marlene hockte auf der Wiese und flocht ein Blumenkränzchen und die kleine Franziska schlief unter einem weißen, leichten Spitzendeckchen in ihrem Kinderwagen. Unvermittelt packte Johanna die Wut, als sie ihre Familie so friedlich am Tisch sitzen sah. Wie konnten sie Kaffee trinken, während draußen die Welt unterging?
Sie achtete nicht auf das mahnende »Johanna!«, das ihre Mutter ihr zuzischte, als sie ohne ein Wort des Grußes auf den Tisch zustürmte und mit blitzenden Augen die Zeitung mitten auf die schön gedeckte Tafel warf. Eine Ecke des Blattes landete in einem hübschen Schälchen mit Rosenmuster in der schneeweißen Sahne. Sophie richtete sich alarmiert auf und wollte nach der Zeitung greifen, doch Justus war schneller.
»Du hattest recht, Vater«, rief Johanna atemlos, während Justus stirnrunzelnd die Zeitung aufschlug und Helene, die aufgeregt mit ihrer Serviette versuchte die Sahneflecken von dem Papier zu entfernen, wegscheuchte wie eine lästige Fliege. »Die Ruhe war nur trügerisch. Österreich-Ungarn hat Serbien ein scheinbar unerfüllbares Ultimatum gestellt, und alle Welt ist empört«, fuhr Johanna fort.
Justus rückte seine Brille zurecht und begann zu lesen. Beklommenes Schweigen machte sich am Tisch breit. Helene starrte ihren Mann an – beleidigt, weil er sie so grob zurückwies, sie, die es doch nur gut gemeint hatte. Zugleich aber war sie auch verängstigt: Er richtete darüber, ob das ernst zu nehmen war oder nicht, ob ihre Welt zerbrechen oder in dieser Form bestehen bleiben würde. Auch Johanna und Sophie beobachteten Justus wie gebannt. Nur die beiden Kinder bekamen von all dem nichts mit. Marlene sang ein Lied und auch das machte Johanna aggressiv. »Sei doch endlich ruhig«, zischte sie ihre Schwester an.
»Johanna, es reicht«, sagte Helene scharf. Johanna presste die Lippen aufeinander. Ihre Mutter begriff mal wieder nichts. Sie vergrub sich in ihrer Welt aus Spitzen, schneeweißer Sahne und Rüschen und schob alles andere weit fort.
Justus hatte den Artikel zu Ende gelesen, faltete die Zeitung zusammen und legte sie auf den Tisch. »Ich habe es gewusst«, sagte er ruhig. »Auf irgendeine Weise musste Österreich ja reagieren. Ich habe befürchtet, dass es diese sein würde.«
Helene, die gerade eine der zerbrechlichen Tassen zum Mund geführt hatte, stellte sie ruckartig wieder ab. Kaffee schwappte über den zarten Rand und in die Untertasse. Ängstlich sah sie ihren Mann an: »Und was bedeutet das denn nun?« Ihre Stimme war schrill.
»Es bedeutet erst mal gar nichts, Mutter«, antwortete Johanna statt des Vaters und hoffte, dass sie nicht allzu gereizt klang. Sie machte Anstalten, ebenfalls am Kaffeetisch Platz zu nehmen, und sagte: »Ich fürchte, dass eine Mobilmachung der russischen Armee bevorsteht.«
»Woher weißt du das?«, fragte Helene streng.
»Habe ich unterwegs aufgeschnappt«, gab Johanna schnippisch zurück und wandte sich an ihren Vater. »Was meinst du, wird es zum Krieg kommen?«
Justus zuckte die Achseln. »Ich weiß es nicht«, sagte er mit einem Seitenblick auf Helene.
Johannas moosgrüne Augen saugten sich am Gesicht ihres Vaters fest. »Und was würde ein Krieg für uns bedeuten?«, fragte sie eindringlich.
Justus erhob sich und ging zu der kleinen Marlene, die immer noch unter dem Baum saß und Blumenkränzchen flocht. Die Aufregung der Erwachsenen hatte sie nicht beeindrucken können. In einer beinahe verzweifelten Geste nahm Justus seine Tochter auf den Arm und drückte sie an sich. So, als könne er sie damit vor allem schützen, was noch kommen mochte. Dann nahm er, mit Marlene auf dem Arm, wieder Platz. Das Mädchen schmiegte sich an ihn und verbarg sein Gesichtchen in seiner Halsbeuge. Es war verwirrt und glücklich zugleich. Zuneigungsbekundungen gab es von dem eher strengen Vater doch recht selten. Sie waren aufregend wie eine Karussellfahrt, die man herbeisehnte und vor der man sich zugleich fürchtete, weil sie einem fremd war.
»Wahrscheinlich würde es zwei Fronten geben, eine zu Russland und eine zu Frankreich«, antwortete Justus, als er wieder saß. Sophie sprang auf und brachte dabei die ganze Kaffeetafel ins Wanken, was ihr einen leisen, panischen Aufschrei von Helene bescherte. »Wieso denn zu Frankreich?«, rief Sophie wild. »Malt doch nicht immer so schwarz!« Sie warf ihre Serviette auf den Teller und rannte ins Haus.
Justus sah ihr erstaunt nach: »Was hat sie denn, sie ist doch sonst nicht so.«
»Pierre ist Franzose«, erwiderte Johanna, »hast du das vergessen?« Sie stand ebenfalls auf. »Ich gehe mal nach ihr sehen.«
7. Kapitel
Ein Gut in der Nähe von Neidenburg, Ostpreußen, 27. Juli 1914
Luise ließ ihren Blick über das weite Gut ihrer Großmutter schweifen. Sie hatte es immer als einen Ort empfunden, der ihr Schutz bot, ihr Heimat war. Wenn sie hier war, fühlte sie sich sicher. Doch in dieses Gefühl der Sicherheit mischte sich zunehmend ein unbestimmtes Gefühl der Angst. Die Kriegsangst hatte sie alle im Griff, Fred, ihr Vater, der als Zollinspektor arbeitete, brachte jeden Tag beängstigendere Neuigkeiten heim. Die Grenzwachen auf der russischen Seite trügen nun neue Uniformen und bekämen neue Munition, sie seien für den Krieg gekleidet, erzählte er mit bleichem Gesicht und großen, geweiteten Augen. Luises Mutter Augusta war ständig in Sorge um den Vater. Und je näher man der russischen Grenze kam, desto öfter sah man Soldaten, die hohe Leitern an Häuser lehnten, um über die Dächer hinweg mit ihren Fernrohren zu beobachten, was sich jenseits der Grenze tat. Auch Luises Blick flog beunruhigt immer öfter in die Richtung, in der Russland lag. Sie musste sich eingestehen, dass sie sich in der Wohnung der Eltern in Neidenburg, die sie nie gemocht hatte, weil sie dem Vergleich mit dem Haus der Großmutter nicht standhielt, inzwischen wesentlich wohler fühlte als auf dem großelterlichen Gut. Schlicht und einfach deshalb, weil das Gut näher an der Grenze lag als Neidenburg.
Sie zuckte zusammen, als es an ihrer Zimmertüre klopfte. Es war noch immer ihr Zimmer, obwohl sie schon seit zehn Jahren mit den Eltern in der Stadt lebte. Doch die Großmutter hatte es so gelassen, wie es immer gewesen war. Mit den Spitzenkissen auf dem Bett und den vielen kleinen Püppchen auf dem Regal. »Du sollst hier immer ein Zuhause haben«, hatte die alte Dame gesagt und ihr mit ihren faltigen Händen über die Wange gestrichen. Diese vertraute, alte Haut auf ihrer, gepaart mit dem Duft, der von ihrer Großmutter ausging – sie roch nach Lavendel und frischer Wäsche – verstärkte das Gefühl, zuhause zu sein.
Luise seufzte. War es das noch? Ein Zuhause, obwohl es keine Sicherheit mehr bot? Sie erhob sich, um zu öffnen und blickte in das vertraute Gesicht von Olga, dem russischen Dienstmädchen, in dem seit zwei Wochen die Angst wohnte, eine Angst, die sich der Gesichtszüge der jungen Frau von Tag zu Tag mehr bemächtigte. Olga war vielleicht fünf Jahre älter als Luise, und die beiden hatten sich immer gut verstanden. Sie sahen sich in die Augen. Luise mochte die lebhafte, kleine, runde Russin, die ihre farblosen Haare zu einem strengen Knoten im Nacken band, was die Rundheit ihres stets von Fett und Schweiß glänzenden Gesichts noch betonte. Schon manches Mal hatte Luise bei Olga in der Küche gesessen, Plätzchen genascht und die Ältere kichernd über die Liebe ausgefragt. Olga hatte ihr einige Dinge über Männer beigebracht, Dinge, die sie ihre Mutter nie hätte fragen können. »Ach, Olga«, sagte sie nun sanft und nahm die Bedienstete in den Arm.
Lange standen sie so. Olga weinte, Luises Schulter wurde nass von ihren Tränen. Endlich löste sich Olga von ihrer Freundin.
»Ich …«, begann sie und es gelang ihr vor Verlegenheit, Scham und Furcht nicht, Luise anzusehen, also blickte sie zu Boden, als sie sagte: »Ich habe gekündigt.«
Rückblickend würde das für Luise immer der Moment sein, an dem das Grauen begann. An dem die bis dahin deutlich vorhandene aber doch subtile Angst einer rasenden Furcht wich. An dem sie wusste, dass es schlimm werden würde, ganz schlimm.
Und als sie Olga nun zum Abschied in die Augen blickte, fragte sie sich, ob sie sich je wiedersehen würden. »Egal, ob es Krieg gibt oder nicht, wir werden uns immer lieb haben, Olga, ja? Wir werden immer Freunde sein und keine Feinde.«
Olga, der die Tränen jetzt in Sturzbächen über die Wangen liefen, nickte vehement und sagte in ihrem gebrochenen Deutsch: »Ich werden dich nie vergessen.« Dabei presste sie beide Hände an ihr Herz.
Luise sah ihr durchs Zimmerfenster nach, als Olga mit ihrem kleinen Koffer in Richtung der russischen Grenze ging. Gerade noch rechtzeitig. Vier Tage später sollte es an allen Grenzübergängen ein heilloses Durcheinander geben, denn dann wollte auch der Letzte in seine Heimat zurück. Tausende Russen drängten aus dem Deutschen Reich nach Hause und umgekehrt. Und als die Russen zeitweise die Grenzübergänge sperrten, stieg die Hysterie derer, die nicht in ihrem vermeintlich sicheren Heimatland waren, in einer flirrenden Wolke zum Himmel und braute sich dort droben drohend und Unheil verkündend zusammen. Doch da hatte Olga lang schon die Grenze passiert und war auf dem Weg ins Landesinnere, wo ihre Heimat war.
8. Kapitel
Überlingen, Bodensee, 28. Juli 1914
Der alte Schuldirektor war ein großer, schwerer Mann mit erstaunlich feinen und humorvollen Gesichtszügen und tausend Lachfältchen um die Augen.
Er war Schuldirektor aus Tradition, schon sein Vater und sein Großvater waren Direktoren oder Lehrer an den hiesigen Schulen gewesen. Besonders stolz war Friedrich auf seinen Vorfahren Johann Rautter, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts an der Lateinschule unterrichtet und maßgeblich zur Einführung des Humanismus beigetragen hatte. Einen anderen Beruf als den eines Schuldirektors oder einen anderen Ort zum Leben als Überlingen konnte sich Friedrich Seiler nicht vorstellen. Zumal er nicht nur den Beruf, sondern auch das Haus seiner Väter geerbt hatte, eines der schönsten Häuser in Überlingen, wie er fand. Es stand im Westen der Stadt, nur wenige Meter entfernt von der Stelle, an der Alois Seubert, der Mann, der die Eisenbahn nach Überlingen gebracht hatte, seine prachtvolle Villa errichtet hatte.
Das Haus der Seilers, das die Überlinger Altes Schulhaus nannten, stand näher an der neuen, von Sipplingen kommenden Straße. Vor fast siebzig Jahren war sie gebaut worden, und dafür hatte man die Heidenhöhlen zerstört, in denen der Vater des alten Schuldirektors als Kind so gerne gespielt hatte. Von der Straße zweigte eine bekieste Auffahrt ab, das Gelände war von hohen Hecken umgeben und durch ein eisernes Tor zu verschließen. Man konnte sich, fand der alte Schuldirektor, hier durchaus sehr wohl fühlen.
Friedrich Seiler seufzte und strich sich müde über das Gesicht. Es bereitete ihm großen Kummer, dass die Ära der Seiler’schen Schuldirektoren mit ihm zu Ende gehen würde, denn keiner seiner Söhne zeigte Interesse daran, diesen Beruf auszuüben. Beide waren sie Ingenieure geworden, Heinrich, sein Ältester, arbeitete bei Zeppelin in Friedrichshafen, Siegfried in Berlin.
Es war, als zerschnitte man ein Band, an dem die Familie seit Jahrhunderten webte, als fälle man eine stolze alte Eiche, die, allen Ereignissen zum Trotz, stets unbeirrt weiter gewachsen war, ihre mächtigen Zweige gen Himmel reckend. Allen Ereignissen zum Trotz! Der alte Schuldirektor runzelte besorgt die Stirn, als er auf das Extrablatt des Seeboten blickte, das vor ihm auf seinem Schreibtisch lag. »Nun haben sie es also doch geschafft«, brummte er vor sich hin.
»Was sagst du, mein Lieber?« Amalia, seine Frau, kam herein und setzte sich auf das zierliche Sofa, das die Wand neben Friedrich Seilers Schreibtisch schmückte.
»Ich sagte: Nun haben sie es also doch noch geschafft! Österreich-Ungarn hat Serbien den Krieg erklärt.«
Amalias Brust entrang sich ein leiser Schrei. Rasch schlug sie die Hand vor den Mund und sah ihren Mann erschrocken an. »Aber Serbien hat Österreich doch eine weitgehend positive Antwort auf das Ultimatum gegeben. Positiver als ich erwartet hätte!«
»In allen Punkten haben sie nicht nachgegeben. Serbien und Österreich haben schon vor drei Tagen mobil gemacht. Und Deutschland hat sogar zur sofortigen Kriegserklärung gedrängt. Das weiß ich aus einer sicheren Quelle.«
»Davon wusste ich ja gar nichts, warum hast du mir das nicht erzählt?«, rief Amalia aufgeregt.
»Ich wollte dich nicht beunruhigen, meine Liebe«, sagte der Schuldirektor. »Es hätte ja sein können, dass sich doch alles wieder beruhigt. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird nicht so schlimm sein und hier draußen sind wir doch recht geschützt vor allem Unheil.«
»Aber wenn du fort musst!«
»Ich werde nicht fort müssen, ich werde gebraucht. Außerdem bin ich zu alt.«
»Aber die Buben!«
Friedrich schluckte. Die Nachricht bereitete ihm mehr Sorgen, als er zugeben mochte. »Die werden wohl gehen müssen«, stimmte er mit rauer Stimme zu. »Wenn es überhaupt so weit kommt. Noch steckt das Reich nicht mit drin.«
»Natürlich steckt es mit drin!«, rief Amalia. »Bis über beide Ohren! Es hat nur noch nicht den Krieg erklärt, aber das wird es bald tun. Und wenn es so weit kommt, sollte ich wohl eine stolze Mutter sein, die glücklich ihren tapferen Söhnen nachsieht, wenn sie in den Krieg ziehen, um für ihr Vaterland zu kämpfen.« Amalia hatte Tränen in den Augen.
»Aber, meine Liebe!«, rief der Schuldirektor bestürzt, erhob sich schwer von seinem Schreibtischstuhl und setzte sich neben seine Gattin auf das Sofa, für das er viel zu groß wirkte. Hilflos legte er ihr den Arm um die Schulter. Er war derartige Gefühlsausbrüche von seiner sonst so ausgeglichenen Gemahlin nicht gewöhnt. Amalia kam ihm immer vor wie einer der Kapitäne, die ihre Schiffe sicher über den Bodensee steuerten. Aufrecht und stolz ging seine kleine Frau durch das Leben, hatte für alle ihre Kinder ein liebes Wort und ein offenes Ohr. Und für ihren Mann sowieso. Unerschütterlich war sie, sie hatte für alles eine Lösung und verzweifelt hatte er sie noch nie erlebt. »Und Helene? Und Sophie? Und die Kinder?«, wütete Amalia weiter. »Sollen die etwa ganz alleine drüben in Konstanz bleiben? Justus als Reserveoffizier wird sicher auch in den Krieg ziehen. Noch einer mit stolzgeschwellter Brust, dem ich nachblicken kann! Ach, und die arme Sophie, aus ihrer Hochzeit wird nun vielleicht gar nichts …«
»Wir holen sie selbstverständlich alle zu uns«, beteuerte Friedrich, froh, etwas sagen zu können, was sie beruhigte. »Und Justus muss vielleicht gar nicht in den Krieg. Seine Textilfirma gilt sicherlich als kriegswichtig – er wird Uniformen produzieren.«
Dieser Gedanke schien Amalia etwas zu beruhigen. »Verzeih, dass ich so die Kontrolle über mich verloren habe«, bat sie, »aber ich habe solche Angst.«
»Schon gut«, sagte Friedrich beruhigend und nahm sie in die Arme. »Schon gut.«
9. Kapitel
Konstanz, Bodensee, 31. Juli 1914
Justus hatte sich Arbeit mit nach Hause genommen. Auch wenn er in der Firma eigentlich unentbehrlich war – in diesen Tagen des Umbruchs wollte er so viel wie möglich in der Nähe von Helene und seinen Töchtern sein. Doch wirklich konzentrieren konnte er sich nicht. Immer wieder schweifte sein Blick zum See hinaus und in Richtung Stadt. Dort sollte er jetzt eigentlich sein. Er konnte seine Familie nicht durch seine bloße Anwesenheit schützen, er musste mehr tun. Entschlossen schob er die Unterlagen zur Seite und stand auf.
»Wohin gehst du?«, fragte Helene, die hinter ihm im Wohnzimmer gesessen und an einer Stickerei gearbeitet hatte.
»Zur Bank. Ich will sehen, dass ich unsere Banknoten in Gold eintausche. Gold ist wertstabil.«
Sie ließ ihre Handarbeit in den Schoß sinken und sah ihren Mann mit großen Augen an. »Hältst du das wirklich für notwendig?«