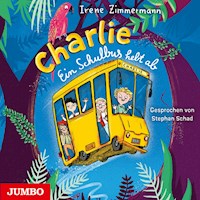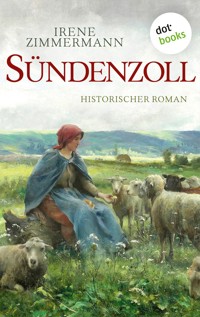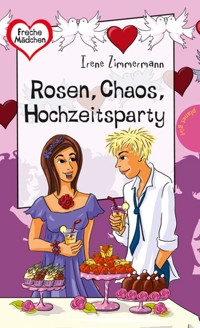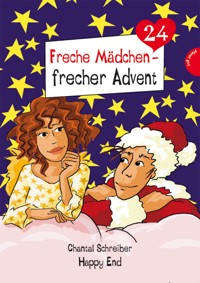5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
In tiefster Not erstrahlt das Licht der Hoffnung … Der historische Roman »Kranzgeld« von Irene Zimmermann jetzt als eBook bei dotbooks. Oberschwaben im späten 19. Jahrhundert. Hochschwanger flieht die junge Magd Marie vom Gsellhuberhof und versucht verzweifelt, sich im See zu ertränken – denn ihr Geliebter Josef, der Hofbesitzer, soll an diesem Tag die reiche Fanny heiraten. Im letzten Moment wird Marie vom Tagelöhner Sebastian gerettet, der in einer kleinen Hütte im Wald lebt. Leidenschaftlich schwört der herzensgute Mann, dass er sich um sie und ihre neugeborene Tochter kümmern wird. Kann Marie es wagen, dem Leben noch eine Chance zu geben? Wie Anna Wimschneider gibt Irene Zimmermann auf meisterhafte Weise einen Einblick in ein hartes bäuerliches Leben. Jetzt als eBook kaufen und genießen: der historische Roman »Kranzgeld« von Irene Zimmermann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
Über dieses Buch:
Oberschwaben im späten 19. Jahrhundert. Hochschwanger flieht die junge Magd Marie vom Gsellhuberhof und versucht verzweifelt, sich im See zu ertränken – denn ihr Geliebter Josef, der Hofbesitzer, soll an diesem Tag die reiche Fanny heiraten. Im letzten Moment wird Marie vom Tagelöhner Sebastian gerettet, der in einer kleinen Hütte im Wald lebt. Leidenschaftlich schwört der herzensgute Mann, dass er sich um sie und ihre neugeborene Tochter kümmern wird. Kann Marie es wagen, dem Leben noch eine Chance zu geben?
Wie Anna Wimschneider gibt Irene Zimmermann auf meisterhafte Weise einen Einblick in ein hartes bäuerliches Leben.
Über die Autorin:
Irene Zimmermann wurde in Ravensburg geboren, studierte Germanistik und Politikwissenschaften in Freiburg und arbeitete als Lehrerin. Besonders bekannt ist die SPIEGEL-Bestsellerautorin für ihre Kinder- und Jugendbücher. Viele ihrer Bücher wurden übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Irene Zimmermann außerdem den Roman »Wer braucht ein Ziel, um anzukommen?«.
***
eBook-Neuausgabe September 2021
Copyright © der Originalausgabe 2015 Silberburg-Verlag GmbH, Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Vewendung eines Gemäldes von Julien Dupré »La Recolte Des Foins«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-577-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Kranzgeld« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Irene Zimmermann
Kranzgeld
Historischer Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Kein Windhauch, nichts. Nur ein makellos blauer Frühlingshimmel, der sich über dem Land wölbte, in einem Blau, das Marie so durchdringend erschien wie selten zuvor; lediglich ein aufmerksamer Beobachter hätte in den wenigen Quellwolken, die sich fern am Horizont gebildet hatten, das drohende Gewitter erahnt. Der jungen Frau bereitete es Mühe, den Blick zu wenden; wieder und wieder schaute sie nach draußen, auf blühende Apfelbäume, sah den Lerchen nach, die voller Lebenslust über die Felder flatterten, und konnte sich erst losreißen, als sie schlurfende Schritte im Obergeschoss hörte und kurz darauf die heisere Stimme von Ellis auf dem Flur, ob die Pasteten denn endlich fertig seien, sie wisse doch, dass die Hochzeitsgäste in Kürze …
»Ja, ja, gleich«, murmelte Marie und lauschte noch einen Augenblick lang angestrengt, bevor sie das Küchenfenster endgültig schloss. Vom Dorf herauf glaubte sie Musik zu hören. Walzerklänge vielleicht, wie Josef sie damals gesummt hatte, als er ihr die neuesten Tanzschritte aus der Stadt zeigte. Er hatte behutsam ihre Taille umfasst, im Obstgarten, als sie Kirschen pflückte, an jenem Sommertag, an dem der Himmel von ebenso tiefem Blau gewesen war wie jetzt, und sie zum ersten Mal geküsst. Damals … Marie lächelte bitter, während sie eine Pastete neben die andere auf das Blech setzte.
»Die Glocken!«, verkündete Ellis, die jetzt in die Küche trat und das Fenster sofort weit aufriss. Sie lehnte sich nach draußen und kniff die Augen zusammen, als könnte sie so bis nach Aulendorf hinunterschauen. »Hörst du’s? Beim Herrgott, jetzt sind sie Mann und Frau.«
Plötzlich fröstelnd, schloss sie das Fenster wieder, bekreuzigte sich und wandte sich Marie zu, die unter Ellis’ missbilligendem Blick hastig ihren schweren Zopf feststeckte, der sich wie so oft gelöst hatte, das Blech aufnahm und es nach draußen trug. Dort wartete der kleine Leopold bereits ungeduldig darauf, es in die Bäckerei zu bringen. Er kam aus dem Ort, war ein kluges Kind. Aber er sollte besser die Schule besuchen, wie oft hatte Marie ihm das schon gesagt. Doch fast jeden Tag sah sie ihn auf dem Hof herumlungern, immer auf der Suche nach Arbeit, mit der er sich ein paar Pfennige verdienen konnte.
»Beeil dich, es pressiert!«, sagte Marie und drückte dem mageren Buben ein Geldstück in die Hand.
Sonst hatte er das Geld immer erst bekommen, wenn er die Pasteten, gebacken und herrlich duftend, wieder zurückbrachte. Aber an diesem Tag galten die üblichen Regeln nicht – und mit diesem Tag würde ohnehin alles anders werden. Marie griff ein zweites Mal in ihre Schürzentasche und holte ein weiteres Geldstück heraus. Voller Erstaunen sah Leopold sie an, ließ dann aber auch diese Münze sofort in seiner Hosentasche verschwinden.
»Gib gut auf dich acht!«, mahnte Marie und widerstand der Versuchung, ihm über den kurzgeschorenen Kopf zu streichen, ihm ins Ohr zu flüstern, dass er nicht traurig sein solle, dass es so alles seine Richtigkeit habe. Stattdessen sagte sie: »Los, auf was wartest du noch?«, und es klang härter, als sie es gewollt hatte.
Leopold runzelte die Stirn, vielleicht hatte sein älterer Bruder ja doch recht mit der Behauptung, kein Mensch könne die Weiber verstehen. Aber dann marschierte er los, das riesige Blech mit beiden Händen umklammert. Am Kuhstall wich er geschickt Hilde, der neuen Magd, aus, drehte sich nochmals um, rief, er werde sich auch ganz bestimmt beeilen!
Aber Marie hatte sich bereits umgewandt und ging wortlos ins Haus zurück. Das Sprechen fiel ihr schwer, was nicht allein von den Schmerzen kam, die immer stärker wurden. Nur mit großer Anstrengung schaffte sie die steile Treppe nach oben in die Mägdekammer. Dort tauschte sie ihre dunkelblaue Schürze, die vom Mehl eingestäubt war, gegen ihre einzige weiße aus, die sauber und frisch geplättet auf dem Bett lag, das sie sich mit Ellis teilte.
Schwerfällig kniete Marie sich nieder und holte unter dem Bett das kunstvoll gearbeitete Holzkästchen hervor, das Josef ihr in schöneren Tagen geschenkt hatte. Kaum merklich zitterten ihre Hände, als sie den Deckel aufklappte und ein sorgfältig zusammengefaltetes Blatt Papier herausnahm, das sie mit einem Seufzer in ihre Schürzentasche steckte. Mühsam zog sie sich dann am Bett hoch. An der Tür warf sie einen letzten Blick in die dunkle Kammer zurück, die in den vergangenen Jahren ihr Zuhause gewesen war.
Währenddessen, auf drei Kutschen verteilt, kam die kleine Hochzeitsgesellschaft näher. Im Landauer Josef Gsellhuber, ein großer, schlanker Mann in der Hochzeitstracht, die dunklen Haare nicht mehr wild und lockig wie noch am gestrigen Nachmittag, sondern zurückgekämmt und in der Mitte gescheitelt, mit teurer Pomade gebändigt. Neben ihm Fanny, seit wenigen Minuten die junge Gsellhuberin, mit irrlichternden Augen, ihrer neuen Rolle als Gutsherrin noch unsicher.
Als die Kutsche auf den Weg einbog, der durch den Wald zum Hof führte, sah es einen Moment lang so aus, als wolle Fanny nach Josefs Hand greifen, aber seine versteinerte Miene ließ die junge Frau dann nur eine ungefähre Bewegung durch die Luft machen.
Ihre Mutter, die schwer atmend gegenübersaß, warf ihr einen unwilligen Blick zu, der zu sagen schien: Dumme Gans, lass das, du hast doch das Ziel erreicht! Ihr neues Besuchskleid aus dunkelbraunem Wollmusselin spannte über ihrem gewaltigen Busen, an den sie ihr Gebetbuch gepresst hielt, als könne das ihre Kurzatmigkeit lindern.
»Wenn dein Vater diesen Tag noch erlebt hätte«, stieß sie jetzt hervor, um das lastende Schweigen in der Kutsche zu unterbrechen, und schloss, als keine Antwort kam, beleidigt die Augen.
Seit ihrem verschreckten Ja vor dem Traualtar hatte Fanny kein einziges Wort mehr gesagt. Ihr war übel vor Aufregung, den ganzen Morgen schon, und durch das Gerumpel über die Feldwege und die schlechte Luft in der Kutsche wurde es immer schlimmer. Die Mutter hatte trotz des schönen Wetters darauf bestanden, während der Fahrt das Verdeck des Landauers geschlossen zu halten, denn Zugluft galt ihr als Quelle allen körperlichen Unwohlseins. Fanny seufzte, um im nächsten Moment entsetzt aufzuschreien.
Das Gefährt war auf einmal ins Schlingern geraten, und vorn auf dem Bock brüllte der Fessler Lorenz, den der Gsellhuber ab und zu als Mietkutscher beschäftigte, obwohl er gern ein Glas zu viel trank, unflätige Schimpfwörter. Die Pferde wieherten auf, und ruckartig kam der Wagen schließlich zum Stehen. Der Pfarrer, der bislang reglos neben Fannys Mutter gesessen hatte, tätschelte beruhigend deren Hand, sah dabei zum Gsellhuber hinüber, Ungeduld und Unverständnis im Blick. Schließlich machte er kopfschüttelnd Anstalten, auszusteigen, um nachzuschauen, was vorgefallen war. Er hatte bereits die Hand an der Tür, da erwachte Josef endlich aus seiner Erstarrung. Er murmelte etwas, öffnete den Schlag und steckte den Kopf hinaus, woraufhin das Fluchen auf dem Kutschbock augenblicklich verstummte.
»Eine Verrückte!«, ereiferte Lorenz sich. »Rennt mir vor die Gäule, als sei der Teufel hinter ihrer Seele her!« Bei diesen Worten bekreuzigte er sich, knallte heftig mit der Peitsche, und die Pferde preschten los, die Anhöhe zum Gutshof hinauf, einem stattlichen Gebäude mit tief herabgezogenem Walmdach und dunkelgrünen Fensterläden. Von fern war leises Donnergrollen zu hören.
»Ja, ja, der Schnaps bringt viel Unheil«, murmelte nach einer Weile die Alte in der Kutsche. »Da sieht einer leicht Gespenster.«
Der Pfarrer nickte zustimmend, aber ein Gespräch ergab sich daraus auch nicht.
Marie blickte dem Gefährt nach, bis der Staub sich legte. Ihr Puls raste, doch gleichzeitig war sie erleichtert.
Vor Jahren war die junge Magd vom Peterhof durch eine Chaise zu Tode gekommen, ein tragischer Unfall – aber ob es wirklich ein Unfall gewesen war, das wusste niemand so genau. Genüsslich hatte Ellis davon berichtet, während sie mit geübten Bewegungen den Teig für den Hefezopf ausrollte, die Füllung darauf verstrich und dabei wieder und wieder jede grausige Einzelheit beschrieb.
»Ich danke dir, Herrgott, dass du mich davor bewahrt hast«, flüsterte Marie und war einen Moment lang fast glücklich, dass sie sich nicht vor den Wagen geworfen hatte. Es war nur ein flüchtiger Gedanke gewesen. Sie sah sich um. Womöglich würden ja noch weitere Kutschen folgen, und, wer weiß, vielleicht würde jemand sie erkennen in ihrem Zustand, womöglich sogar anhalten, fragen, was los sei. Ihr blieb also nichts anderes übrig, als abseits des Weges zu gehen, so schwer ihr das auch fiel. Denn die Schmerzen waren stärker geworden. Es würde nicht mehr lange dauern, das ahnte sie.
Als sie an einem Feldkreuz vorbeikam, fiel ihr ein, dass sie nicht einmal mehr das Grab der Mutter besucht hatte. Wer würde sich in Zukunft darum kümmern? Der Vater bestimmt nicht. Ihn hatte sie vor Jahren zum letzten Mal gesehen, damals, bei der Beerdigung der Mutter. Schon drei Monate später hatte er wieder geheiratet und Marie als Magd weggegeben. Zwei Frauen im Haus tun nicht gut, hatte er gesagt, als er ihr die Tür wies.
Marie stieß ein wildes Stöhnen aus, vor Schmerz und vor Wut. Sie keuchte, als sie den Abhang zum See hinunterstolperte, zerkratzte sich die bloßen Arme im Himbeergestrüpp, spürte es kaum, hatte schließlich nur noch den einen wirren Gedanken, es zu schaffen, bevor es zu spät war.
»Heilige Mutter Gottes, verzeih mir«, wiederholte sie immer wieder.
Als sie ihr Ziel erreichte, war das Wetter umgeschlagen. Der See lag in Erwartung des Gewitters dunkel und drohend da, schwer lastete der Himmel über allem, sogar der Gesang der Vögel war verstummt. Marie stand am Ufer, griff in ihre Schürzentasche, holte das Blatt heraus, betrachtete lange das Porträt, fuhr mit den Fingern zärtlich über die Worte, die am unteren rechten Rand standen: Auf ewig dein Josef. Sie lächelte wehmütig, während sie die Kohlezeichnung einer Opfergabe gleich aus ihren Fingern gleiten ließ. Das Papier würde sich vollsaugen und langsam nach unten sinken, auf den Grund des Sees, dorthin, von wo es keine Wiederkehr mehr gab. Alles würde vergehen, alles.
Marie bückte sich unter Schmerzen und packte so viele Steine, wie sie nur zu finden und zu fassen vermochte, in ihre Schürzentaschen. Mühsam richtete sie sich wieder auf, hielt ihr Gesicht in die letzten Sonnenstrahlen, die vom Westen her zwischen dem Wolkengebirge hervordrangen, zwang sich, die Augen weit geöffnet zu lassen, um den See, den Wald, den Himmel, das Leben, alles, aber auch alles, noch ein letztes Mal in sich aufzunehmen, nur noch ein allerletztes Mal.
Ein lautes Schlagen im Schilf ließ sie zusammenfahren; aber es waren nur Stockenten, die aufflogen. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, löste ihren Zopf, vergrub die Hände in ihrem langen dunklen Haar, wie Josef es so oft gemacht hatte, glaubte sogar seine sanfte Stimme zu hören, strich sich dann behutsam über den Hals, über die Brust, über den Bauch, den sie zum ersten Mal seit Monaten nicht eng geschnürt hatte, umfasste beinah zärtlich ihren schweren Leib, während sie langsam ins Wasser ging. Nach wenigen Schritten aber hielt sie inne.
Badeten nicht die Buben des Dorfes hier an warmen Sommertagen? Und keinem hatte das Wasser je weiter als bis zur Brust gereicht. Ich muss mich ins Schilf legen, dachte sie verzweifelt, den Kopf unter Wasser halten. Die nächste Wehe kam so heftig, dass Marie kaum noch atmen konnte. Sie krümmte sich, ließ sich ins Wasser sinken, kroch auf allen vieren weiter, spürte, wie das Wasser in Mund und Nase drang. Ein letztes Mal noch wollte sie an Josef denken, doch da verlor sie schon das Bewusstsein.
In der Stube des Gsellhuberhofes war festlich gedeckt, für sieben Personen. Nur eine kleine Hochzeitsgesellschaft, denn die alte Bäuerin war noch kein Jahr tot, und dem Altbauern wollte man eine größere Festlichkeit nicht zumuten; auch war er nicht mehr recht bei Sinnen.
So schien es jedenfalls, wenn man auf die hagere Gestalt hinuntersah, die in der viel zu weiten Sonntagstracht zusammengekauert in dem Lehnstuhl saß, die Augen starr auf den Fußboden gerichtet, die Hände unter der Jacke versteckt, so als hätten sie etwas zu verbergen. Lediglich wenn der Alte sich unbeobachtet wähnte, konnte man erkennen, dass ihm nichts entging – so wie jetzt, als alle zum Hochzeitspaar hinüberschauten, das an der Kopfseite des Tisches aufgestanden war, während der Pfarrer einen endlos langen lateinischen Segensspruch ausbrachte, auf besondere Bitte von Fannys Mutter, die eine nicht unerhebliche Spende für das neue Altarbild in Aussicht gestellt hatte.
Der Blick des alten Gsellhubers hob sich langsam, wanderte von Josef, der dastand und eine Miene machte, als gehöre er gar nicht hierher, weiter zur Braut, die verlegen ihre Hände knetete. Ihr weißer Schleier hatte sich verschoben, eine blonde Locke ringelte sich an ihrem Hals und ließ sie noch jünger aussehen als ihre siebzehn Jahre. Ein halbes Kind zwar, aber recht hübsch doch, dachte der Alte und ließ einen schnalzenden Laut hören, so dass die Hochzeitsgesellschaft erschrocken zusammenfuhr.
»Ja, Herrgott noch mal«, brummte er daraufhin, scharrte mit den Füßen, die in frisch polierten Schnallenschuhen steckten, und wedelte schließlich unwillig mit der Hand. Macht weiter!, hieß das.
Der Pfarrer fuhr fort, aus seinem Gebetbuch vorzulesen, während der Alte weiter ungeniert die Braut musterte. Josef hatte wahrlich keinen Grund, sich zu beklagen. Fanny brachte Geld mit, viel Geld, und sie hatte breite Hüften – mehr brauchte es nicht. Und einen Sohn zu gebären, einen Stammhalter, wie es sich gehörte, das würde sie ebenfalls schaffen, immerhin hatte das auch die Altbäuerin geleistet. Das Taufkleid, seit über hundert Jahren im Besitz der Familie, vielfach geflickt und immer wieder mit neuen Borten verziert, wartete nur darauf, wieder aus dem Kasten geholt zu werden.
»Eine sehr private Feier«, hörte er Jakobe spitz sagen. Sie war Josefs Patin und extra aus der Stadt angereist, »ein weiter Weg«, wie sie nicht müde wurde zu betonen, denn sie hatte sich angesichts ihrer Mühen mehr Feierlichkeiten versprochen und vielleicht auch einen Heiratskandidaten für ihre älteste Tochter, die aber wegen ihres nässenden Hautleidens doch nicht mitgekommen war. Gott sei Dank, dachte Jakobe, es hätte sich ja auch nicht gelohnt. Missmutig starrte sie auf den Kaffeefleck auf dem Tischtuch, verdrehte die Augen. Sie saß zur Rechten des Apothekers, dessen Magen schon mehrmals vernehmlich geknurrt hatte. »Zu einem ordentlichen Fest scheint’s in diesem Haus wohl nicht mehr zu reichen«, setzte sie nach und schob, immer noch kopfschüttelnd, ihre neue Radhaube zurecht.
»Gib endlich Ruhe! Hochwürden spricht!«, zischte der Alte, und angriffslustig richtete er sich in seinem Lehnstuhl auf. Jakobe lief eine ungesunde Röte übers Gesicht, und er war sich sicher, dass sie dem Schlag näher war als er. Doch wenn sie erst wüsste, welche Mitgift Fanny in die Ehe einbrachte, würde sie vor Neid vermutlich schon auf der Stelle tot umfallen.
Und während der Pfarrer redete und redete, alle Heiligen samt der Ortsheiligen der näheren Umgebung anrief und um Gottes Segen für das junge Paar bat, erging der Altbauer sich bereits in kühnen Zukunftsplänen. Den Hof würde er umbauen lassen, alles war bereits bis ins Kleinste bedacht, die Zeichnungen aber waren noch sorgfältig versteckt vor allzu neugierigen Blicken. Mit dem Vertreter von Lanz aus Mannheim, der in letzter Zeit noch häufiger als früher auf dem Hof aufgetaucht war, hatte er über die Bestellung einer Dreschmaschine mitsamt Lokomobile gesprochen. Nein, nicht nur gesprochen, verbesserte er sich, er hatte bereits bestellt. Und dann würde er den Rössle Kilian überreden, endlich sein Flurstück zu verkaufen, ein paar weitere hatte er auch schon im Auge. Nicht zu vergessen die Restsumme, die der Moserbauer ihm noch schuldete. Ertragreich würde das alles sein, sehr ertragreich, und wenn dann noch der Stammhalter käme … Zufrieden schmunzelte er vor sich hin und schlummerte ein.
Fanny war das nicht entgangen, und sie musste sich ein Kichern verkneifen, als sie den Alten so sah, wie er da reglos im Stuhl hing, den Mund halb offen, aus dem in regelmäßigen Abständen leise Schnarchlaute drangen.
Jetzt, da sie sich nicht mehr von ihm beobachtet fühlte, konnte sie sich endlich umschauen in ihrem neuen Zuhause. Neugierig wanderte ihr Blick durch die niedrige Stube, durch deren Fenster nur wenig Tageslicht drang, von der schweren Nussbaumanrichte zu der Chaiselongue mit beigefarbenem Damastbezug, ein Möbelstück, das so gar nicht hierherpasste, das Josef aber, wie sie vermutete, bestimmt ihr zuliebe angeschafft hatte, darüber das schwere hölzerne Kruzifix, das bedrohlich schief hing, weiter zum Klavier, das sie in die Ehe eingebracht hatte.
Fanny schluckte. Sie erinnerte sich, als sei es gerade eben gewesen. Ein dunkler Winterabend daheim, sie am Klavier, lustlos, wie so häufig, die Mutter daneben mit einer Stickerei beschäftigt, das Dienstmädchen an der Tür, mit einem Knicks den Besucher anmeldend. Errötend war Fanny aufgesprungen, aber Josef hatte beim Eintreten nur gelächelt, ihr nicht einmal die Hand gereicht, stattdessen unsicher den schwarzen Schaufelhut in den Händen gedreht und schließlich gemeint: »Spiel weiter.« Sie hatte sich wieder gesetzt, widerwillig, denn sie wusste, sie hatte kein Gefühl für die Musik. Für einen Augenblick hatte sie überlegt, ob sie besser aufstehen und nach Noten suchen sollte, aber dann, weil ihre Mutter im Hintergrund ärgerlich zischte, spielte sie einfach weiter, die Lippen zusammengepresst, mit vielen falschen Tönen, die ihr zum Ärger der Mutter fortwährend unterliefen, während Josef mit eingefrorenem Lächeln danebenstand. Schließlich, nachdem Fanny endlich aufgehört hatte zu spielen, machte er ihr den erhofften Heiratsantrag.
Der Pfarrer hatte inzwischen seine Fürbitten beendet, setzte sich, legte die Stola beiseite, griff nach dem leinernen Mundtuch – Fanny hatte sechsunddreißig Stück davon in die Ehe gebracht, denn ihre Mutter hatte bis vor wenigen Tagen noch auf eine große Hochzeitsgesellschaft gehofft -, da war aus dem Flur ein Poltern zu hören, gefolgt von einem spitzen Schrei. Alle Blicke richteten sich auf Fanny. Sie war von nun an die Hausfrau, sie musste sich um das gesamte Hauswesen kümmern, alles wissen, was vor sich ging. Das hatte ihr die Mutter in den letzten Wochen oft genug eingebläut.
»Geh schon!«, fauchte Wilhelmine Dietterle erbost in ihre Richtung, um kurz darauf wieder lächelnd in die Runde zu nicken. »Ja, ja, aller Anfang ist schwer«, meinte sie entschuldigend und lauschte, während ihre Tochter zur Tür hinaushuschte.
Im Flur konnte Fanny nur mit Mühe erkennen, was passiert war: ein Backblech auf dem Boden, überall Pasteten verstreut, Ellis, die einen schmächtigen sommersprossigen Buben am Ohr hielt, Hilde und eine weitere Magd, die dastanden, die Arme verschränkt, und neugierig darauf warteten, was wohl als Nächstes geschehen würde.
Fanny schlug das Herz bis zum Hals, als sie Ellis fragend ansah. »Was ist …?«
»Das Blech hat er fallenlassen, der Depp«, verkündete die Magd, packte Leopold an den Schultern und schüttelte ihn bei jedem einzelnen Wort.
Fanny biss sich auf die Unterlippe. Sie musste etwas tun, nur hatte sie nicht die geringste Ahnung, was von ihr erwartet wurde. Den Buben bestrafen? Ein Machtwort sprechen? Schließlich bückte sie sich, hob eine der Pasteten auf, betrachtete sie von allen Seiten, als würde ihr dadurch eine Lösung einfallen. Wieder sah sie Ellis an, aber die war immer noch damit beschäftigt, ihre Wut an Leopold auszulassen. Er heulte, auch dann noch, als sie ihn endlich losließ.
»Aber mit Marie muss etwas passiert sein«, schluchzte er. »Warum ist sie sonst auf einmal nicht mehr da?« Mit verheulten Augen musterte er Fanny und sein Kindergesicht wurde plötzlich hart. »Du bringst Unglück«, stieß er hervor, »großes Unglück!«
Ellis versetzte ihm einen heftigen Stoß. »Verschwinde«, knurrte sie. »Du kommst mir nie wieder auf den Hof, du dummer Kerl, du!« Sie drehte sich um und warf Fanny einen Blick zu, den diese nicht deuten konnte.
Doch immerhin war ihr wieder etwas von dem eingefallen, was ihre Mutter ihr immer wieder eingeschärft hatte. Du musst alles wissen, was auf dem Hof vor sich geht, alles, alles, alles. »Halt, bleib!«, rief sie, als der Junge schon fast an der Haustür war. »Ich will wissen, was passiert ist. Und ihr …«, bei diesen Worten blickte sie die Mägde, die zu tuscheln begonnen hatten, streng an und wies mit einer Kopfbewegung in Richtung Küche, »ihr macht euch wieder an die Arbeit.«
Die dicke Ellis setzte sich in Bewegung, brummelnd, nicht ohne vorher noch einige der Pasteten aufgehoben und in ihre Schürze gepackt zu haben, und die beiden anderen Frauen folgten ihr unwillig, während Fanny langsam auf Leopold zuging, der furchtsam zurückwich. Verschüchtert wischte er sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht, zog hörbar die Nase hoch, und Fanny brach unwillkürlich in Lachen aus. Mit einem Mal fiel die ganze Anspannung des Tages in ihr zusammen. Da stand sie, in ihrem teuren isabellfarbenen Seidenkleid, dessen Saum aber bereits eingerissen war, hielt sich die Hände vor den Mund und lachte und lachte, während Leopold sie entsetzt anstarrte.
Die Stubentür öffnete sich, und genauso plötzlich, wie Fanny zu lachen begonnen hatte, verstummte sie. Ihre Mutter stand in der Tür, füllte mit ihrer massigen Figur nahezu den Türrahmen aus, herrschte sie an: »Sei still! Was soll das?« Dann erst nahm sie Leopold wahr, der voller Furcht mit der Wand zu verschmelzen schien. Sie winkte ihn zu sich heran. »Komm nur her, Bub, niemand will dir etwas tun«, sagte sie, wobei sie nach jedem Wort tief Luft holen musste.
Leopold wäre am liebsten aus dem Haus gestürmt, aber weil nun auch schon wieder Ellis, die um nichts in der Welt das Spektakel versäumen wollte, das sich anzubahnen schien, aus der Küche kam und ihm den Weg abschnitt, blieb ihm nichts anderes übrig, er musste stehen bleiben.
»Nun, Kleiner, was ist denn geschehen?«, fragte die Alte.
Sie lächelte Leopold zu und machte Fanny Zeichen, um Himmels willen endlich Haltung zu bewahren. Wie sie schon wieder dastand, mit hängenden Schultern! Aber darum konnte man sich später kümmern, jetzt galt es erst herauszufinden, was hier vorgefallen war.
»Nun, Kleiner?«, wiederholte sie und fasste Leopold am Kinn. »Du kannst mir alles sagen.«
»Marie ist verschwunden«, brach es schluchzend aus ihm heraus.
Nie mehr würde sie ihn in den Arm nehmen, ihm mit einem Lächeln einen Wecken zustecken. Oft hatte sie sonntags nach der Kirche mit ihm zusammen gesungen, ihm Geschichten erzählt von Rittern und Seefahrern. Was jetzt passiert war, hatte er immer befürchtet, immer geahnt, was unzählige Albträume bereits vorweggenommen hatten. Marie war verschwunden. Und er wusste ganz genau, niemals mehr würde sie zurückkommen.
An der Tür gab es plötzlich eine Bewegung. Wilhelmine Dietterle wurde grob beiseitegeschoben. Aufgebracht drehte sie sich um, wollte schon laut losschimpfen, da sah sie, dass es ihr Schwiegersohn war.
»Was sagst du da? Marie ist verschwunden?«, rief er. »Was weißt du? Sag, schnell!«
Leopold, der spürte, dass hier jemand war, der ihn verstand, nickte eifrig. »Vorhin hat sie mir noch das Geld für die Pasteten gegeben!«, rief er aufgeregt. »Und mehr als sonst!« Erschrocken hielt er sich die Hand vor den Mund. Der dicken Alten traute er ohne Weiteres zu, dass sie das Geld zurückfordern würde.
Aus der Stube wurden Stimmen laut. Die Patin beklagte sich darüber, dass es mit dem Essen so lange dauern würde, und sie habe schon fröhlichere Hochzeiten erlebt, mit Musik und Tanz und …
»Ihr geht wieder in die Stube zurück!«, wies der Bauer Fanny und die Schwiegermutter an. »Von mir aus, schenkt Schnaps aus.« Die Alte wollte protestieren, aber Josef drückte sie einfach durch die Tür. »Du auch!«, herrschte er Fanny an. »Was stehst du hier so herum?«
Es klang grob, denn voller Herzensangst konnte er nicht mehr an sich halten, dachte nur noch panisch an Marie, an den verstörten Blick in ihren dunklen Augen, als er ihr von den Plänen seines Vaters, von der bevorstehenden Hochzeit erzählt hatte.
Fanny senkte eingeschüchtert den Kopf. Das Myrtenkränzchen auf ihrem Schleier hatte sich gelöst, hing halb herunter. Sie schob es hoch und schlängelte sich an ihrem Mann vorbei. Neugierige Blicke folgten ihr, nur der Altbauer schlief immer noch, als sie sich mit einem gezwungenen Lächeln wieder an ihren Platz setzte. Ihre Mutter hatte die große Schnapsflasche von der Anrichte genommen und goss freigiebig ein.
»Diese Hochzeit steht unter keinem guten Stern«, orakelte Jakobe mit einem Seitenblick auf die Braut und leerte ihr Glas in einem Zug.
Theres Fimpel – die Fimpelin, wie sie nur genannt wurde – trat vor die Tür ihrer Kate. Prüfend hielt sie die Hand in die Höhe; sie hatte sich nicht getäuscht, es regnete noch, wenn auch nur noch ganz fein.
Dabei hatte der Tag so schön begonnen. Aber nach einem Mittag mit blauem Himmel wie schon lange nicht mehr waren die ersten Gewitterwolken aufgezogen, eine schwarze Front hatte sich gebildet, und bald danach zuckten auch schon die ersten Blitze. Die Fimpelin hatte sich in eine Ecke der Kate gekauert, ein Stoßgebet nach dem anderen gemurmelt – und siehe da, die heilige Barbara hatte ein Einsehen und das Unwetter verzog sich gegen Abend.
Die Fimpelin wollte schon wieder zurück ins Haus, da hörte sie einen Laut. Sie blieb stehen und lauschte angestrengt. Seitdem ihre Augen immer schlechter wurden, verließ sie sich mehr auf ihr Gehör, aber dieses Geräusch konnte sie beim besten Willen nicht einordnen.
»Bastl? … Bist du’s?«, rief sie leise.
Lauter zu rufen traute sie sich nicht. Zwar war das Häuschen im Wald weit abgelegen, für Unkundige kaum zu finden, aber man wusste nie, ob nicht womöglich der Offiziant aus dem Ort hier herumschlich. Das letzte Mal hatte er ihren Bastl mit ein paar Hasen und einem Wildschwein erwischt; fast wäre es zur Anzeige gekommen, aber da hatte sich der Gendarm dann doch einsichtig gezeigt und sich mit dem Wildschwein zufriedengegeben. Die Fimpelin seufzte tief. Sie allerdings hatte hinterher den Ärger mit der Frau des Apothekers gehabt, die das Wild für die Jubiläumsfeier eingeplant hatte.
»Bastl?«, rief sie nochmals in die Dunkelheit, dieses Mal aber lauter. »Bastl?«
Ein Keuchen als Antwort, und sie spürte, wie jemand sie an der Schulter fasste.
»Ich bin’s, Mutter«, hörte sie die vertraute Stimme sagen.
Noch bevor die Alte protestieren konnte, hatte Sebastian sie ins Haus gezogen und eilig Kerzen angezündet, fünf Stück, eine richtige Festtagsbeleuchtung. Als ob plötzlich der Reichtum bei uns ausgebrochen sei, dachte sie.
»Die Frau vom Bürgermeister hat zwei Hasen bestellt, und dann will sie auch wieder ein Wildschwein«, murmelte die Fimpelin, der das Verhalten ihres Sohnes zunehmend unheimlicher wurde. »Und der Herr Pfarrer wünscht Rebhühner auf den nächsten Sonntag. Die letzten waren so zart, dass er sie …«
»Hab nix!«
»Aber der Herr Pfarrer …«
»Fast hätten sie mich erwischt!«, stieß er hervor. »Ich hab die Fallen liegen lassen müssen und die Hasen auch, bin selbst gerannt wie einer, hab mich ins Schilf gerettet und da …«
»Jesusmaria!«, unterbrach die Fimpelin ihn und faltete die Hände. »Bub, ich sag dir doch, sei endlich vorsichtig. Das nächste Mal sperren sie dich ein, und was wird dann aus mir alter Frau?«
»Hör auf zu jammern! Hilf mir lieber, das Weib muss es warm haben!«
»Weib? … Welches Weib? … Sag! Was hast du wieder angestellt?« Ihre Stimme überschlug sich.
Ihr Bastl war zwar ein guter Junge, der Einzige, der ihr von den sieben Kindern geblieben war, aber es gab Zeiten, da fürchtete sie sich auch ein wenig vor ihm und vor dem, was er tat. Manchmal glaubte sie, dass der Krieg an allem schuld war, er hatte nicht nur Bastls Gesicht entstellt, sondern womöglich auch seinen Geist.
»Jetzt sag doch!«
Aber Sebastian achtete nicht auf sie. Er hatte das dicke Federbett aufgeschüttelt, sorgsam eine Decke darübergebreitet und richtete sich auf. »Ich hol sie jetzt herein. Und du, mach Wasser heiß.«
»Wen holst du?«
Die Fimpelin spürte, wie ihre Knie zitterten, als ihr Sohn nach draußen ging. Am liebsten hätte sie gerufen: Wer es auch ist, lass sie draußen, das nimmt kein gutes Ende, das spüre ich! Aber weil Sebastian seinen eigenen Kopf hatte und sich immer durchsetzte, egal, wie heftig sie auch zeterte und alle Heiligen beschwor, so schwieg sie auch dieses Mal und stand einfach nur da, den Hals nach vorn gereckt, die Augen zusammengekniffen, bis ihr Sohn wieder eintrat.
»Ist sie tot?«, fragte sie nach dem ersten Schrecken.
»Mutter, du glaubst doch nicht etwa …?«
Ein drohender Unterton in seiner Stimme ließ sie einen Schritt zurückweichen, und sie beeilte sich zu versichern: »Aber nein, was denkst du denn, Bastl.«
Ihr fiel der Vogel Johann ein, auch er ein Häuslerkind, auch er aus dem Krieg zurück, so wie ihr Sohn versehrt an Leib und Seele. Wegen Menschenraub und Notzucht angeblich hatten sie ihn vor Jahren zu schwerem Zuchthaus verurteilt, man munkelte, dass er dort verrückt geworden sei, aber Genaues wusste niemand, und das war vielleicht auch besser so.
Die Fimpelin warf Bastl einen prüfenden Blick zu. Verrückt wirkte er nun eigentlich nicht, wenigstens nicht verrückter als sonst, befand sie, wie er da im flackernden Kerzenlicht vor der Bettstatt kniete, die Hand der jungen Frau nahm, die dort lag, in nassen Kleidern, das lange schwarze Haar strähnig, die Augen geschlossen, bleich wie der Tod. Ein langgezogenes Stöhnen war auf einmal von ihr zu hören. Und die Fimpelin atmete auf vor Erleichterung. Wie hatte sie nur auf den Gedanken kommen können, Bastl hätte ihr auch nur ein Haar gekrümmt.
Doch als sie näher trat, stockte ihr der Atem. Erst jetzt erkannte sie, dass das junge Ding kurz vor der Niederkunft stand.
Unter die Vogelstimmen, die diesen herrlichen Frühlingstag begrüßten, mischte sich das Weinen eines Neugeborenen, ein Wimmern, das erst aufhörte, als die Fimpelin das Kind auf Maries Bauch legte. Sie hob den Kopf ein wenig, um dieses ihr so fremde und doch so vertraute kleine Wesen zu betrachten.
Immer noch war ihr Gesicht schweißüberströmt, gezeichnet von den Strapazen der vergangenen Stunden. Aber sie war nicht ohnmächtig geworden wie zuvor im Schilf. Sie hatte zwar geschrien, sich in den Wehen aufgebäumt, hatte aber auch willenlos die Anweisungen der Fimpelin befolgt, die sich an die vielen eigenen Geburten erinnerte, zehn an der Zahl, wenn man die Totgeburten mitrechnete. Marie hatte gepresst, als sie schon glaubte, nicht mehr zu können.
Jetzt, mit dem Kind auf dem Bauch und einem glückseligen Gefühl tiefer Zufriedenheit, nahm sie zum ersten Mal ihre Umgebung wahr. Sie schaute zur Tür, welche die alte Frau weit geöffnet hatte, und ihr schien es, als wären mit dem gleißenden Sonnenlicht alle Schrecknisse der Nacht vergessen.
Sebastian beugte sich währenddessen über eine Holzkiste, kramte lange darin herum und trat schließlich ans Bett, ein wollenes Tuch in der Hand, mit dem er das Kind fürsorglich zudeckte. Marie sah ihm schweigend zu, bis er sich abwandte und sich verstohlen über die Augen wischte.
Als er sich ins Licht drehte, schrie sie entsetzt auf.
Kapitel 2
»Es tut mir so leid«, beteuerte Marie immer wieder, während die Fimpelin mit düsterem Blick dasaß und Kartoffeln schälte. »Ich wollte ihn nicht kränken.«
»Hast du aber«, knurrte sie. »Und jetzt ist er fort.«
Wenn es ganz schlimm kam – und es würde schlimm kommen, das spürte sie -, würde es Tage dauern, bis Sebastian wieder auftauchte. Und sie hatte in der Zwischenzeit den Ärger; Ärger mit den Kunden, die vergeblich auf ihr Wild warteten, und nicht zuletzt mit dem ungebetenen Gast in ihrer Bettstatt.
»Du hast Bastl sehr weh getan«, stieß sie hervor, »das hat er nicht verdient!«
Eine Welle von Schuldbewusstsein überflutete Marie. Diese Menschen waren so gut zu ihr gewesen – und wie hatte sie es ihnen vergolten? Inzwischen hatte die Fimpelin ihr auch erzählt, was geschehen war. Bastl habe sie am See gefunden, im Schilf, halb ertrunken bereits, da habe er sie bis hierher geschleppt, obwohl er selbst in größter Gefahr gewesen sei, und dass das bei einer Selbstmörderin nun gewiss keine Christenpflicht sei. Kilometerweit habe er sie getragen, sie und das ungeborene Kind, ewig könne sie ihm dankbar sein, dass sie nicht der Todsünde anheimgefallen sei, denn an ein zufälliges Ertrinken glaube sie ja wohl nicht einmal selbst.
Marie hatte pausenlos genickt. Ja, die Frau hatte so recht. Ja, es wäre eine Todsünde gewesen. Und ja, Marie wollte auch auf ewig dankbar sein. Sie blickte auf das rosige Wesen, das an ihrer Brust lag und schmatzende Geräusche von sich gab.
Die Fimpelin schälte noch einige Kartoffeln mehr – sie war zwar aufgebracht, aber sie wusste auch, dass stillende Mütter Kraft brauchten –, und wenn die Vorsehung diese Frau mit dem Kind schon in ihr Haus geschickt hatte, so wäre sie die Letzte, die etwas dagegen unternehmen könnte. Sie brummelte missmutig vor sich hin, während sie den Topf mit der Brennsuppe aufs Feuer schob. Ein Geräusch an der Tür ließ sie zusammenzucken. Es war Sebastian, mit drei Rebhühnern und einem Hasen.
»Hier! Bring’s zur Kundschaft!«, wies er seine Mutter an.
Marie hatte die Augen niedergeschlagen. Noch immer schämte sie sich, aber gleichzeitig hatte sie auch Angst vor diesem Gesicht, dessen rechte Seite durch wulstige Narben entsetzlich entstellt war. Schweigen herrschte in der Kate, während die Fimpelin das Wild in ihre Kiepe legte und nach ihrem Umhang griff. Wortlos schlurfte sie nach draußen.
Marie betrachtete die winzigen Finger ihres Kindes, versuchte sanft, die Faust, die es gemacht hatte, zu öffnen, da fiel ein Schatten auf das Bett.
»Wie wirst du sie nennen?«, fragte Sebastian.
»Weiß nicht«, erwiderte sie tonlos.
»Wir werden schon einen Namen finden.«
Er lachte, und sie erinnerte sich an ein Gespräch mit Josef. Das wird sich finden, natürlich wird sich das finden, hatte er gesagt, als sie ihm panisch vor Angst schließlich die Schwangerschaft gestand. Und Marie hatte sich von seiner plötzlichen Zuversicht, seinem Gottvertrauen anstecken lassen, und Josef hatte sie in seine Arme genommen und gelacht vor Freude. Vor fünf Monaten war das gewesen, und seither, so bildete Marie sich ein, hatte niemand mehr in ihrer Gegenwart so glücklich gelacht.
»Josef …«, brach es mit einem Mal schluchzend aus ihr heraus.
»Josefa!«, fiel er ihr ins Wort. »Ich werde sie auf den Namen Josefa taufen!«
Mit Tränen in den Augen sah sie zu ihm hoch. »Du willst sie taufen? Aber die heilige Kirche …«
Sebastian lachte erneut, jetzt aber spöttisch. »Glaubst du wirklich, irgendein Pfarrer kommt zu uns heraus und tauft den armen Tropf da?« Er machte eine verächtliche Handbewegung. »Wo sind denn die Pfaffen, wenn die Not am größten ist? Wo? Sag!«
Er tauchte die Hand in den Zuber neben dem Herd, ließ vorsichtig ein paar Wassertropfen auf die Stirn der Kleinen fallen und sprach feierlich: »Hiermit taufe ich dich auf den Namen Josefa. Du sollst ein glücklicheres Leben haben, jetzt und in Ewigkeit. Amen!«
Erst als Sebastian längst wieder verschwunden war – vermutlich hackte er draußen Holz, den Geräuschen nach zu urteilen – und Marie aus einem unruhigen Schlummer hochschreckte, fiel ihr ein, dass sie sich überhaupt nicht mehr vor seinem zerschossenen Gesicht geängstigt hatte.
Nach dem Essen zerstreute sich die Hochzeitsgesellschaft rasch; nicht einmal der Schnaps, der mehr als reichlich ausgeschenkt worden war, hatte es geschafft, die Stimmung zu heben.
Und so saßen sich schließlich Fanny und ihre Mutter in der Stube allein gegenüber. Die junge Frau rührte gedankenverloren in ihrer Kaffeetasse herum – immerhin echter Mokka, wie die Patin Jakobe anerkennend zugegeben hatte, und nicht der billige Zichorienkaffee, der sonst immer ausgeschenkt wurde –, bis die Alte sie unvermittelt anfuhr: »Kind, hör sofort auf damit! Du machst mich noch ganz verrückt!«
Fanny presste die Lippen zusammen. Mit unbewegter Miene stand sie auf, ging zum Klavier, hob den Deckel und schlug ein paar Töne an. Es war verstimmt, aber sie zog den Klavierhocker heran und versuchte sich wie zum Trotz an einem Walzerpotpourri.
Bei der Hochzeit ihrer Freundin Erika im letzten Sommer war den ganzen Abend über ausgelassen getanzt worden, eine beschwingte Gesellschaft waren sie gewesen, noch gut erinnerte sie sich daran, wie unbekümmert sie sich gefühlt hatte. Josef, ein gut aussehender Mann Mitte zwanzig, war ihr Tischherr gewesen, ein Junggeselle mit ansehnlichem Besitz, zurückhaltend und angenehm im Wesen; sie war die Einzige, mit der er tanzte, und sie errötete geschmeichelt, als er sich bei ihr für den schönen Abend höflich bedankte. Doch niemals hätte sie sich vorstellen können, dass er einige Zeit später um ihre Hand anhalten würde. Je länger sie darüber nachsann, desto weniger konnte sie sich daran erinnern, sich das überhaupt je gewünscht zu haben. Ja, war es nicht sogar so gewesen, dass sie eine leise Beklemmung in seiner Gegenwart gespürt hatte, etwas Düsteres hinter seiner ruhigen Freundlichkeit? Eine leise Ahnung, dass womöglich nicht alles so war, wie es ihren Freundinnen erschien, die sie um diese Partie glühend beneideten?
Mit einem harten Akkord beendete sie ihr Klavierspiel. So jedenfalls hatte sie sich ihre Hochzeit nicht vorgestellt. Unvermittelt warf sie einen Blick zur Tür, doch es war nicht Josef, wie sie gehofft hatte, sondern Ellis, die sich mit mürrischem Gesicht vergewissern wollte, dass der Tisch auch sauber abgeräumt war. Vielleicht war es aber auch nur Neugier, ob der Bräutigam endlich zurückgekehrt war.
Die Standuhr in der Ecke schlug halb sieben, als Fannys Mutter sich ächzend von der Chaiselongue erhob. Aus ihrem Samtbeutel kramte sie einen Briefumschlag hervor, den sie mit bedeutungsschwerer Miene auf den Tisch legte. »Hier, Post für dich. Die Kommerzienrätin hat dir zur Hochzeit geschrieben.«
Fanny blickte erstaunt herüber. »Lina?«
Noch immer konnte sie sich nicht daran gewöhnen, dass ihre Schwester mit dem so viel älteren Kommerzienrat Otto Benecke verheiratet war – und vor allem, dass ihre Mutter sie nicht mehr beim Namen nannte, sondern nur noch von Frau Kommerzienrat sprach oder, wie in letzter Zeit immer häufiger, von der Kommerzienrätin.
Vermutlich hat Mutters begeisterter Monolog über die überaus einträgliche Tuchwarenfabrik ihres Schwiegersohnes in Stuttgart und seine Verdienste für das württembergische Königreich mit dazu beigetragen, dass meine Hochzeitsfeier so schnell zu Ende war, dachte Fanny bitter und starrte auf den Umschlag. An Frau Fanny Gsellhuber, geb. Dietterle, wohnhaft Gsellhuberhof stand dort und, direkt daneben, in mindestens genauso großen Buchstaben, mit genau derselben Akkuratesse, die Lina in allem, was sie in ihrem Leben anpackte, an den Tag legte: Abs. Frau Kommerzienrat Lina Benecke, z. Z. Franzensbad, Hotel Savoy.
Ihre Mutter schien plötzlich von einer merkwürdigen Unruhe ergriffen zu sein, mehrmals ging sie zum Fenster – als ob es draußen etwas zu sehen gab außer einem großen Misthaufen –, dann wieder zur Tür, bis Fanny irgendwann nervös auflachte: »Ist das nicht sonderbar, Mutter? Ich konnte nicht zu Linas Hochzeit kommen, weil ich erkrankt war, und jetzt konnte Lina nicht zu meiner kommen. Ist Lina denn krank? Weshalb ist sie überhaupt in Franzensbad?«
Aus ihren Worten sprach ehrliche Besorgnis, denn obwohl das Verhältnis zu ihrer fast zehn Jahre älteren Schwester nicht innig war, machte Fanny sich Sorgen, hauptsächlich aber wegen ihrer Mutter, denn Lina war immer deren Liebling gewesen, und einen weiteren Schicksalsschlag nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes würde sie gewiss nicht verkraften.
»Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen«, fügte Fanny nach einer Weile hinzu, weil ihre Mutter immer noch schwieg, und ergänzte dann, auf einen bloßen Verdacht hin: »Ich bin jetzt schließlich ebenfalls eine verheiratete Frau.«
»Lina wird dir schon alles geschrieben haben. Ich muss jetzt wieder heim.« In einer seltenen Gefühlsaufwallung nahm sie ihre Tochter in die Arme. »Gott behüte dich, mein liebes Kind.«
Fanny sah sie verständnislos an. So bewegt hatte sie ihre Mutter seit dem Tod des Vaters nicht mehr gesehen. Doch bevor sie nachfragen konnte, hatte die Alte bereits die Zimmertür aufgerissen und Ellis, die anscheinend draußen gelauscht hatte, angeherrscht: »Eine Kutsche! Aber schnell!«
Noch einige Minuten lang hielt Fanny den Umschlag in der Hand. Das Verhalten der Mutter beunruhigte sie – hatte es womöglich etwas mit Linas Schreiben zu tun? –, und so war sie sich unschlüssig, ob sie den Brief gleich lesen sollte oder lieber doch erst später. Schwere Schritte im Flur und die Stimme Josefs nahmen ihr die Entscheidung ab.
Rasch legte sie den Brief auf die Tasten, schloss den Klavierdeckel und fühlte sich augenblicklich seltsam befreit. Der Brief hatte Zeit, nie wieder würde sie eilfertig das tun, was Lina von ihr verlangte, denn sie waren jetzt einander ebenbürtig, auch sie war jetzt verheiratet, hatte nicht einmal eine schlechte Partie gemacht, wie die Mutter oft genug betonte. Ich bin nicht mehr Linas kleine Schwester, dachte sie, die ungeschickte, die weniger hübsche, nein, gewiss nicht, ich bin nicht mehr die dumme Gans. Ich bin jetzt eine respektable Ehefrau. Ich bin die Gsellhuberin.
Die Tür quietschte leise in den Angeln, als Ellis eintrat, ein Tablett mit Geschirr in den Händen, dahinter Josef. Fanny unterdrückte einen Entsetzensschrei, als sie sein aschfahles Gesicht sah. Wortlos musterte er den Tisch, deutete mit dem Zeigefinger auf die beiden Kopfenden, woraufhin Ellis, ebenso schweigsam, geschwind fürs Abendessen deckte.
Wenig später saßen Josef und Fanny einander gegenüber, er am einen Ende des Tisches, sie am anderen. Sie wagte es nicht, den Blick zu heben, stocherte im Aufgewärmten, das ihr Ellis hingestellt hatte, hörte in der Stille jedes einzelne Schlucken. Als sie endlich hochsah und seinen Blick suchte, stand Josef mit einem Ruck auf. Einen Moment lang blieb er noch am Tisch stehen, schien unentschlossen zu sein, dann aber verließ er mit einem knappen Nicken wortlos die Stube.
Als Fanny am frühen Sonntagmorgen den Klavierdeckel wieder öffnete, um vielleicht im Spiel Trost zu finden – niemals hätte sie gedacht, dass es jemals so weit kommen würde –, fiel ihr der Brief entgegen, an den sie schon gar nicht mehr gedacht hatte. Mit klopfendem Herzen riss sie den Umschlag auf und las:
Franzensbad im Mai 1879
Liebe Schwester. Meine herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu Deiner Vermählung. Otto und ich sind gut in Franzensbad angekommen, Professor Heidlin in Stuttgart hat es mir wärmstens empfohlen, und ich scheine nicht die Einzige zu sein, die auf die heilende Wirkung des Wassers hier vertraut. Eine Verwandte des Kommerzienrats ist inzwischen guter Hoffnung, nach dreimaligem Besuch in Franzensbad konnte sie das auch erwarten. Nun aber zum eigentlichen Grund meines Schreibens. Du wirst nun in den heiligen Stand der Ehe eintreten. Im Folgenden werde ich dir einige Verhaltensregeln nennen, an die Du Dich in Deinem eigenen Interesse halten solltest. Da ist zum Ersten die Hochzeitsnacht …
Fanny ließ den Brief sinken. Sie war kreideweiß geworden und musste würgen. Ein unsägliches Gefühl der Demütigung überfiel sie. Minutenlang noch hielt sie den eng beschriebenen Bogen in der Hand, um ihn dann in immer kleinere Fetzen zu zerreißen. Dabei weinte sie leise vor sich hin. Niemals mehr wollte sie an diese Nacht erinnert werden.
Ellis hatte sie zu Bett gebracht und – bestimmt auf Anweisung der Mutter – ihr zuvor noch die Haare gebürstet, so lange, bis die Kopfhaut schmerzte. Angeblich sollte das gut sein, den Haarwuchs anregen, die Haare glänzend machen, und Fanny war ja so bereit für alles. Sie lag im Bett, wartete, lauschte mit angehaltenem Atem, versuchte, die Geräusche in dem fremden Haus zuzuordnen. War das Ellis, die jetzt unten an der Stiege rief? Oder Hilde? Was klapperte da vor dem Fenster? Fanny setzte sich auf, das Deckbett bis zum Kinn hochgezogen, starrte in die Dunkelheit. Und wartete angespannt.
Gegen Morgen, als es kühler geworden war, wachte sie aus einem unruhigen Schlaf auf, brauchte lange, bis sie erkannte, dass sie in einem fremden Haus war. Dann, im Licht der frühen Sonne, sah sie das unbenutzte Bett neben sich. Eine Vorahnung beschlich sie, dass es auch in den kommenden Nächten leer bleiben würde. Josef hatte sich seit dem gestrigen Abendessen nicht mehr blicken lassen.
Ein aufgeregtes Wiehern im Hof holte sie in die Gegenwart zurück. Fanny ging zum Fenster. Ihre Mutter stieg aus der Berline, kam erstaunlich raschen Schrittes auf die Haustür zu, die Ellis bereits eilfertig aufhielt. Bestimmt ist der Magd inzwischen auch klar, wer das Sagen hat, dachte Fanny und trat vom Fenster zurück. Angespannt sah sie zur Tür hin, dann hörte sie Schritte auf der Treppe, Ellis’ aufgeregte Stimme und kurze Zeit später ein Poltern im Schlafzimmer über ihr. Noch rechtzeitig fiel Fanny ein, dass die Papierschnitzel nach wie vor verstreut auf dem Boden lagen; sie schob sie hastig mit dem Fuß unter die Chaiselongue, ebenso den Briefumschlag, setzte sich wieder ans Klavier und schlug ein paar Töne an. Als die Tür geöffnet wurde, rief sie ihrer Mutter betont munter entgegen: »Guten Morgen, Mama!«
Doch anstelle eines Grußes kam nur ein bestürzter Blick und die Frage: »Wo war er vergangene Nacht?«
Fanny nahm ihr den Sonnenschirm ab, schob ihr einen Stuhl hin und setzte sich wieder auf den Klavierhocker. »Ich weiß es nicht«, gestand sie schließlich.
Ihre Mutter träufelte Kölnisch Wasser auf ein Taschentuch und presste es sich aufstöhnend gegen die Stirn. »Du weißt es nicht?«, wiederholte sie entsetzt, straffte dann aber die Schultern. »Wie dem auch sei! Mach dich fertig zum Kirchgang!«
Was werden die Leute denken, wenn ich ohne Josef in die Kirche komme?, wollte Fanny fragen, doch ihre Mutter ließ sie gar nicht erst zu Wort kommen.
»Keine Widerrede! Wir fahren! Auf der Stelle! Geh nach oben, zieh dich an!«
Ellis, die vermutlich vor der Tür gestanden hatte, denn sie war sofort zur Stelle, half Fanny beim Anlegen des Korsetts. Am liebsten hätte sie darauf verzichtet, aber weil sie ihre Mutter nicht noch mehr verärgern wollte, nickte sie nur, als Ellis fragte, ob sie noch enger schnüren solle, und ob es dann so recht sei, denn bisher habe man auf dem Hof nicht geschnürt, sie habe das aber bei ihrer früheren Herrschaft gelernt, damals, als sie bei einer ehemaligen Hofsängerin in Stuttgart in Dienst gestanden habe. Auf dem Land dagegen lehne man das verrückte Schnüren ja eigentlich ab.