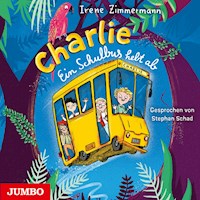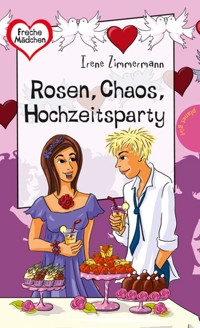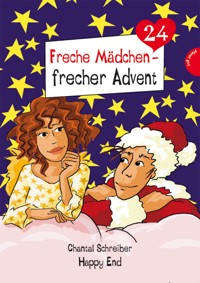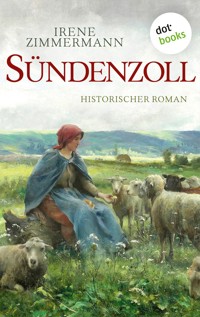
9,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wenn alte Geheimnisse ans Licht kommen ... Der historische Roman »Sündenzoll« von Irene Zimmermann jetzt als eBook bei dotbooks. Oberschwaben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Magd Marie und ihr Mann Josef, ein ehemaliger Großbauer, suchen verzweifelt nach einer neuen Anstellung. Aber warum weigert sich Josef so vehement, als Verwalter auf dem abgelegenen Schelklehof zu arbeiten? Erst als Marie schwanger wird, kann sie ihn dazu überreden – doch die Freude währt nicht lange, denn ein Geheimnis aus der Vergangenheit steht zwischen Josef und der Hofbesitzerin Emerenz und wirft dunkle Schatten auf das Glück des Ehepaars ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der dramatische Schicksalsroman »Sündenzoll« von Irene Zimmermann ist der zweite Band ihrer Oberschwaben-Saga, die Fans von Susanne Betz und Anna Wimschneider begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Ähnliche
Über dieses Buch:
Oberschwaben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Magd Marie und ihr Mann Josef, ein ehemaliger Großbauer, suchen verzweifelt nach einer neuen Anstellung. Aber warum weigert sich Josef so vehement, als Verwalter auf dem abgelegenen Schelklehof zu arbeiten? Erst als Marie schwanger wird, kann sie ihn dazu überreden – doch die Freude währt nicht lange, denn ein Geheimnis aus der Vergangenheit steht zwischen Josef und der Hofbesitzerin Emerenz und wirft dunkle Schatten auf das Glück des Ehepaars ...
Über die Autorin:
Irene Zimmermann wurde in Ravensburg geboren und studierte Germanistik und Politikwissenschaften in Freiburg. Seit Mitte der neunziger Jahre schreibt sie Kinder- und Jugendbücher, die in insgesamt vierzehn Sprachen übersetzt wurden und von denen es viele auf die SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft haben. Inzwischen hat sie sich erfolgreich historischen Romanen zugewandt, in deren Mittelpunkt bewegende Frauenschicksale stehen.
Irene Zimmermann veröffentlichte bei dotbooks bereits die historischen Romane der Oberschwaben-Saga »Kranzgeld« und »Sündenzoll«, sowie den humorvollen Roman »Wer braucht ein Ziel, um anzukommen?«
***
Originalausgabe Februar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Katrin Scheiding
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Julien Dupré »Die Schäferin«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98952-195-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Irene Zimmermann
Sündenzoll
Historischer Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Ein Schwall kalter Luft strömte durch die weit aufgerissene Tür in die Wäscherei. Marie blickte sich flüchtig um, wandte sich dann aber, als sie in der dampfigen Luft die wild gestikulierende Oberlehrerswitwe erkannte, wieder ihrer Bügelarbeit zu. Mit dem Plätteisen war sie damit beschäftigt, vorsichtig die Plisseefalten des grauseidenen Hochzeitskleides zu glätten, das jeden Moment abgeholt werden sollte.
»Am Bahnhof! … Am Bahnhof! … Aufstand der Taglöhner! … Dieses Pack! … Früher hätten die sich das nicht getraut!«
Jetzt horchte Marie doch auf. Hatte Josef nicht davon gesprochen, auch an diesem Tag wieder zum Bahnhof zu gehen? Womöglich, so hatte er beim Morgenkaffee ungewohnt zuversichtlich gemeint, würden die Entlassungen ja wieder zurückgenommen werden. Vielleicht hätte er also doch noch Aussicht auf irgendeine Arbeit bei der Eisenbahn, und wenn es auch nur wieder als Taglöhner sei.
»Eh man sich's versieht, übernimmt dieser gottlose Pöbel die Herrschaft im Land.« Die Stimme der Oberlehrerswitwe überschlug sich vor wohliger Aufregung. »Scharf geschossen wird dort! Ach, wir gehen schrecklichen Zeiten entgegen! Man traut sich heutzutage gar nicht mehr auf die Gasse! Wie gut, dass ein tüchtiger Landjäger wie unser Klotzbücher für Ordnung sorgt!«
Die letzten Worte der Oberlehrerswitwe hörte Marie schon nicht mehr. Und auch nicht das Zetern der Wäschereibesitzerin, die ihr befahl, gefälligst ihre Arbeit zu tun. Denn Marie hatte hastig ihre Schürze abgestreift, nach ihrem wollenen Umschlagtuch gegriffen und stürmte aus der Wäscherei, auf dem schnellsten Weg hinunter zum Bahnhof. Dort, auf dem Vorplatz, entdeckte sie schließlich Josef in dem Häuflein der Entlassenen.
Von Krawall konnte keine Rede sein. Schweigend standen die Männer da, ihre Gesichter aschfahl. Ihnen gegenüber in einigen Metern Abstand eine Ansammlung, Frauen und Kinder vor allem, die von Minute zu Minute anwuchs. Und zwischen den beiden Gruppen marschierte der verhasste Landjäger Klotzbücher auf und ab, ein schwerer Mann mittleren Alters mit wucherndem Backenbart und einer fleckigen Uniformjacke, die über dem dicken Bauch spannte. Seinen Revolver hielt er seitwärts auf die Männer gerichtet. Nichts war zu hören außer den schweren Tritten seiner genagelten Schuhe auf dem Kopfsteinpflaster.
»Er wartet nur auf Verstärkung. Er will alle festnehmen lassen«, flüsterte eine junge Frau Marie zu. »Wegen Aufruhr ins Zuchthaus bringen. Aber das kann er doch nicht machen? Oder?« Blassblaue Augen sahen Marie ängstlich an. Eine eiskalte Hand krallte sich um ihren Arm. »Oder? … Kann er?«
»Das kann er … nicht«, schob Marie nach einem zweiten Blick auf die junge Frau nach. Das arme Mädchen in der schäbigen grauen Jacke, dem Dialekt nach eine Ortsfremde, stand kurz vor der Niederkunft. Sie musste eine von denen sein, die auf der Suche nach Arbeit mit ihren Männern von Ort zu Ort zogen. »Nein, das kann er nicht«, wiederholte sie.
Die junge Frau lächelte sie dankbar an. »Nein, er kann sie nicht verhaften!«, rief sie plötzlich mit schriller Stimme, und als hätte die Menge nur auf ein Signal gewartet, fielen wie ein Chor alle mit ein. »Nein, er kann sie nicht verhaften! Nein, er kann sie nicht verhaften! Nein …!«
Der Landjäger hatte seine Waffe in die Höhe gerissen, ein Schuss peitschte, und so unvermittelt, wie die Rufe begonnen hatten, verstummten sie. Neben sich hörte Marie ein dumpfes Gurgeln, und es dauerte einen Augenblick, bis ihr klar wurde, dass es von der Schwangeren kam, die zu Boden gesunken war. Im selben Moment spürte sie, wie jemand sie unsanft an der Taille packte und zur Seite schob. »Hau ab, hier wird’s gefährlich«, zischte ihr der schweißüberströmte Klotzbücher direkt ins Ohr. Seine Stimme überschlug sich, als er sich wieder umdrehte und brüllte: »Ruhe und Ordnung! Das ist ein Befehl! Oder ich schieß euch alle über den Haufen!«
Tumultartige Szenen, so war es Tage später im Schwäbischen Merkur zu lesen, hätten sich auf dem sonst so friedlichen Bahnhofsvorplatz zugetragen. Eine aufsässige Menschenmenge habe gegen die Obrigkeit revoltiert, und nur der Geistesgegenwart und dem besonnenen Einschreiten des örtlichen Landjägers Egon Klotzbücher sei es zu verdanken, dass eine größere Katastrophe verhindert worden sei. Für dieses vorbildliche polizeiliche Handeln stehe ihm wahrhaft ein königlicher Orden zu.
Wie betäubt wankte Marie nach Hause. Voller Sorge stand sie dann am Fenster ihrer Kammer in der Kirchgasse, spähte stundenlang vergeblich nach draußen, wo das gleiche Treiben wie jeden Tag herrschte: Ochsengespanne, die es kaum den steilen Berg hinauf schafften, Hausfrauen, die mit einem Korb am Arm vorbeieilten, Mägde, die sich am Brunnen trafen, Kinder, die ihre kleineren Geschwister hüteten, laut stritten und sich dann wieder vertrugen, alles war wie immer. Nur Josef fehlte. Was war mit ihm geschehen? Hatte der Klotzbücher ihn verhaftet? Sollte sie sich auf die Suche nach ihm machen?
Unschlüssig ging Marie in der Kammer auf und ab. Wieder sah sie das feiste Gesicht des Landjägers vor sich, der sich so nah an sie gedrängt hatte, dass sie seinen stinkenden Atem zu riechen glaubte. Vielleicht hatten Ella und die anderen Frauen in der Wäscherei doch recht mit ihren lockeren Reden, dass nämlich der Klotzbücher ein Auge auf sie, die schöne Marie, geworfen habe. Sie selbst hatte das immer abgetan. Ach was, das habe nichts zu bedeuten, und dass der Klotzbücher die Hemden nur von ihr gebügelt haben wolle, liege nur daran, dass sie eben besonders sorgfältig bügle. Insgeheim aber war sie doch beunruhigt gewesen, bemühte sich, nicht allzu deutlich zu zeigen, wie zuwider ihr der Landjäger war. Denn ihn, das wusste jeder im Dorf, sollte man keinesfalls zum Feind haben.
Das Angelusläuten vom nahen Kirchturm war längst verklungen, als sie Josef endlich die schmale Gasse entlangkommen sah. Eigentlich hätte sie überglücklich sein müssen – er war wieder zurück, auch wenn seine Jacke zerfetzt war und er eine geschwollene Lippe hatte –, doch stattdessen schüttelte sie ein heftiger Weinkrampf. Sie beruhigte sich erst wieder, als er ihr versicherte, dass alle Männer freigelassen worden seien, es der Schwangeren wieder besser gehe und die Menge sich friedlich verlaufen habe. »Aber unsere Träume können wir endgültig begraben.« Erschöpft ließ er sich auf einen Küchenstuhl fallen und stützte die Ellbogen schwer auf den Tisch. »Die Bahn hat uns betrogen. All die schönen Versprechungen sind keinen Pfifferling mehr wert. Marie, ich sag es, wie es ist: Mit unsereinem wird es in diesem Leben nichts mehr. Und es ist allein meine Schuld. Wenn der Hof nicht durch mein Verschulden verloren gegangen wär … Ein auskömmliches Leben hätten wir und nicht so ein erbärmliches Taglöhnerdasein.«
Marie beugte sich vor und nahm seine Hand, doch sie wusste, es gab keinen Trost für ihn. Denn es war nicht nur der Verlust des Hofes, es waren auch die ständigen Demütigungen, die Josef zermürbten. Keiner der Bauern war bereit gewesen, ihn zumindest als Knecht einzustellen, und mit versteinerter Miene hatte er ihr vor einiger Zeit erzählt, dass der Moserbauer, der seinen Hof ersteigert hatte, ihm seinen alten Platz am Stammtisch im Adler verwehrt habe mit den Worten: »Gsellhuber, hast du’s immer noch nicht kapiert? Du hast keinen Hof mehr. Du bist keiner mehr von uns. Also verschwind! Lass dich bloß nicht mehr bei uns blicken!«
Doch dann, nach Wochen voller Schwermut, in der nicht einmal die Malerei half, die ihn bislang in diesen schwarzen Momenten getröstet, ja vielleicht sogar gerettet hatte, gab es plötzlich einen Lichtblick. Über den Schwiegersohn, den Mann von Agnes, der jüngeren Tochter, bekam Josef Arbeit beim Eisenbahnbau, als Tagelöhner zwar nur, aber mit der verheißungsvollen Aussicht, falls er sich dort bewährte, eines Tages angestellt zu werden. Ab diesem Zeitpunkt war er wie verwandelt gewesen und trotz der schweren Arbeit voller Tatendrang. Gut gelaunt las er Marie jeden Wunsch von den Augen ab, kaufte ihr von seinem ersten Wochenlohn sogar den teuren, mit künstlichen Blumen verzierten Florentinerhut, den sie auf dem Jahrmarkt bei einem der Händler sehnsüchtig angeschaut hatte.
Er begann auch wieder zu malen, und einmal mehr staunte sie über sein Können. In Wirklichkeit ist er ein Künstler und gar kein Bauer, dachte sie, als er ihr ein kleines Aquarell zeigte, das er in kurzer Zeit auf Papier gebracht hatte. Den Kirschgarten am Dorfrand besaßen sie zwar schon seit einer Weile nicht mehr, doch noch immer war er Josefs Lieblingsmotiv in seiner schwelgerischen weißen Blütenpracht und, mittendrin, an einen der Bäume gelehnt, Marie, eine schlanke Gestalt mit leuchtenden Augen, die dicken schwarzen Haare zu einem Zopf geflochten und kranzförmig um den Kopf gelegt. »Wie eine Krone«, hatte sie lachend gemeint, und Josef küsste sie und nannte sie seine Königin, behauptete, sie sehe immer noch aus wie das Mädle von einst. Verlegen hatte sie abgewehrt, so jung war sie schließlich nicht mehr, aber gefreut hatte sie sich dennoch darüber. Sie begannen auch wieder, Zukunftspläne zu schmieden: Wenn ihre Schulden erst abbezahlt waren – sie hatten sich Geld von Seffi, der ältesten Tochter, geliehen, die in Zürich gut verheiratet war –, wollten sie als Erstes den Kirschgarten zurückkaufen, das Symbol ihrer Liebe, wie Josef ihn bezeichnete.
Doch dann, schon Tage vor dem Aufruhr am Bahnhof, hatte es beunruhigende Anzeichen gegeben. Ein Trupp junger Vorarlberger tauchte auf, kaum den Kinderschuhen entwachsen, aber voller Kraft und Eifer, und schnell hatte das Gerücht die Runde gemacht, alle Männer, die älter als vierzig seien, würden nicht mehr gebraucht. Ihr Protest, sie seien doch fleißig und zuverlässig gewesen, außerdem habe es das Versprechen einer Anstellung gegeben, wurde vom Bahnhofsaufseher, einem schneidigen Beamten aus der Hauptstadt, mit einem kalten »Davon war nie die Rede. Verschwindet, ihr Gesindel« abgetan.
»Gesindel! Gesindel nennen sie uns! Und der Landjäger hätt uns heute am liebsten allesamt zusammengeschossen.« Wütend blickte sich Josef in der ärmlichen Kammer um. »Schau dich doch um hier. Tisch, Bett, zwei Stühle und ein Kasten … Zu mehr hat’s dem Gesindel nicht gereicht.« Er drückte Maries Hand. »Ich flehe dich an, trenn dich von mir, auch wenn es mir das Herz zerreißt. Du hast ein besseres Leben verdient, als ich es dir bieten kann. Ich bin deiner nicht wert. Ich gebe dich frei.«
»Jetzt red doch nicht so widersinnig daher«, flüsterte sie unter Tränen und schmiegte sich an ihn. »Ohne dich wär ich nur ein halber Mensch, das weißt du doch. Ich schwöre dir, nichts und niemand wird uns jemals auseinanderbringen. Und es wird wieder mit dir, glaub mir.« Zärtlich streichelte sie sein Gesicht. »Die Hauptsache ist doch, du bist nicht verhaftet. Und vielleicht gibt es ja einen Ausweg, ich hätte da vielleicht auch schon eine Idee. Du weißt, wie man einen Hof führt, du kennst dich aus mit …«
Mit einem bitteren Lachen unterbrach er sie. »Du meinst wohl, ich weiß, wie man einen Hof zugrunde richtet. So heißt das. Wie lange habe ich gebraucht, den Gsellhuberhof zu ruinieren? Nach ein paar Monaten schon war es vorbei!«
»Jetzt ist doch alles anders. Lass die Vergangenheit ruhen. Bitte! Hör mir zu! In der Wäscherei war neulich die Rede davon, dass es in der Nähe einen Hof gibt, auf dem dringend ein tüchtiger Verwalter gesucht wird. Du kannst das, Josef, ich weiß das. Und ich werde dich unterstützen. Der Schelklehof …«
»Der Schelklehof?« Mit der Faust schlug Josef auf den Tisch. »Nie und nimmer! Mit dem Schelklehof ist mir vor ein paar Tagen schon der Härle gekommen. Dass sie da draußen verzweifelt einen Verwalter suchen. Aber da will ja keiner aus dem Dorf hin. Ich könnt mich doch bewerben, hat er gemeint, ein Versuch würd ja nichts kosten. Ich hab ihm aber sofort gesagt, auf diesen Hof geh ich meiner Lebtag nicht.«
»Aber …«
»Du weißt ja nicht, wovon du redest. Komm mir nie wieder mit dem Schelklehof! Kein Wort mehr davon!«
Marie erhob sich, holte schweigend einen Kanten Schwarzbrot aus dem Kasten, schnitt ihn sorgfältig in zwei gleich große Teile und schob Josef die eine Hälfte hin, legte ihm – nach kurzem Zögern – auch noch das letzte Stück Speck dazu. Unwillig schüttelte er den Kopf. »Ich kann nichts essen, wenn du mir bös bist. Und bös bist du mir, das spür ich doch. Glaub mir, auf jeden anderen Hof würd ich gehen, ganz egal, welche Arbeit es ist, und wenn ich Schweine hüten müsst. Aber nicht auf den Schelklehof.«
Schweigend kaute sie ihr Brot, das mit einem Mal fad schmeckte, zwang sich zum nächsten Bissen, legte, als eine Welle der Übelkeit in ihr hochstieg, schließlich den Kanten zurück. Josef griff nach ihrer Hand. »Marie, glaub mir, dir würde es dort gar nicht gefallen. Der Hof liegt so abgelegen, dass man meinen könnte, auf einer einsamen Insel zu sein. Du würdest auch die Frauen aus der Wäscherei nur noch selten sehen. Glaub mir, ich habe es oft gehört, dort hält es keiner länger als nötig aus.«
»Einsam ist es dort? Das macht mir nichts aus. Wir zwei haben einander, das reicht uns doch. Du müsstest eigentlich froh sein, wenn du nicht mehr jeden Tag dem hochnäsigen Moserbauern und all den anderen begegnest. Was hält uns denn noch im Dorf?«
Ja, was hielt sie noch im Dorf? Die Menschen, die ihnen wichtig gewesen waren wie die alte Vogelin, lebten schon lange nicht mehr. Oder sie waren weggezogen, wie vor wenigen Wochen auch Agnes und Karl, ein Abschied, der Marie besonders schwergefallen war, denn ihre jüngere Tochter war ihr zunehmend zu einer Freundin geworden. Doch die beiden hatten von Josefs Onkel eine Gaststätte im Allgäu geerbt und wollten dort einen Neuanfang wagen. Überall könne man lesen, im Fremdenverkehr liege die Zukunft, hatte Agnes, eine resolute junge Frau, gesagt, aus den Städten würden mehr und mehr Sommerfrischler jedes Jahr in die Berge strömen und bestimmt einiges an Geld in einem gut geführten Gasthof liegen lassen. Kommt doch mit, hatte sie vorgeschlagen, wir finden schon ein nettes Plätzchen für euch, aber Josef hatte bloß abgewinkt, fürs Altenteil seien sie noch zu jung.
»Es heißt, der Schelklehof sei verflucht«, hörte Marie ihn jetzt sagen.
Ungläubig blickte sie ihn an, brach dann in ein leises Lachen aus. »Josef, das ist nichts anderes als Altweibergeschwätz, das meinst du doch wohl nicht ernst? Nenn mir nur einen einzigen vernünftigen Grund, weshalb du nicht auf diesen Hof willst, und ich verspreche dir, ich rede bestimmt nie wieder davon.«
Josef schien mit sich zu kämpfen. Er wollte etwas erwidern, schüttelte dann aber den Kopf, als Marie ihn fragend ansah. Eine Weile schwiegen beide, maßen einander mit Blicken. Bis Josef plötzlich aufsprang. »Dann versuch ich es eben wieder als Taglöhner!«, rief er. »Du musst dir keine Sorgen machen, wir werden schon nicht verhungern. Notfalls stell ich mich am Sonntag vor die Kirche.« Er lachte spöttisch auf. »Ein Almosen werden mir die reichen Bauern allemal noch geben, wenn ich da an der Pforte stehe mit demütig gesenktem Blick und sie an ihre Christenpflicht erinnere. Außerdem«, seine Stimme wurde wieder ernst, »wir sind genügsame Leute, was brauchen wir schon?«
»Was wir brauchen?« Maries dunkle Augen blitzten vor Zorn. »Josef, wir brauchen eine Zukunft.«
Zum ersten Mal seit langer Zeit stritten sie sich, bis sie, erschöpft und wortlos, schließlich zu Bett gingen. Erst spät in der Nacht, als sie noch immer schlaflos nebeneinanderlagen – und gleichzeitig doch so fern voneinander –, richtete Marie sich plötzlich auf. »Ich bin guter Hoffnung«, sagte sie in die Dunkelheit hinein. »Wir brauchen eine Zukunft für unser Kind.«
Am nächsten Morgen erklärte Josef ihr als Erstes mit ruhiger Stimme, er werde sich als Verwalter auf dem Schelklehof bewerben, und er hoffe, damit für sie und das Kind das Richtige zu tun.
»Natürlich ist es das Richtige!«, rief Marie erleichtert aus. Und um ihm eine Freude zu machen, legte sie seine Hand auf ihren Bauch, der flach war und noch nichts ahnen ließ von dem neuen Leben, das sie in sich trug. »Dieses Mal wird es ein Sohn. Das spüre ich.« Denn sie wusste, dass er, obwohl es keinen Hof mehr zu vererben gab, sich insgeheim einen Stammhalter wünschte, sosehr er auch seine beiden erwachsenen Töchter liebte.
»Ja, es ist ein Sohn«, sagte er ernst, und es klang, als wäre das Kind schon auf der Welt. »Ich verspreche dir, ich werde alles dafür tun, damit er eine gute Zukunft hat. Gleich nachher geh ich hinüber zum Härle.« Als er Maries erstaunten Blick sah, lächelte er verschmitzt. »Ich hab heute Nacht lang darüber nachgedacht, wie ich es am klügsten anstelle. Ich brauch jemanden, der für mich spricht. Das ist der alte Härle. Er war zusammen mit meinem Vater bei der Feuerwehr und hat immer große Stücke auf ihn gehalten. Viel wichtiger noch, er ist der Patenonkel von der Emerenz Schelkle, dem Fräulein, also hat er bestimmt Einfluss auf sie. Außerdem war es ja sein Vorschlag, dass ich mich dort bewerben soll.«
Keine zwei Stunden später kam er zurück, zu Maries freudiger Überraschung den unterschriebenen Vertrag bereits in der Hand. Den alten Härle hatte er zwar nicht angetroffen, aber seinen Enkel, was sich im Nachhinein als Glücksfall erwiesen hatte. Denn der junge, hoch aufgeschossene Mann mit runder Nickelbrille, der aus Reutlingen zu Besuch und ordentlicher Rechtsassessor war, hatte vom Großvater den Auftrag bekommen, so schnell wie möglich einen Verwalter für den Schelklehof aufzutreiben.
»Ich hab ihm freimütig gestanden, dass ich meinen Hof durch eigenes Zutun verloren habe. Aber das hat ihn überhaupt nicht interessiert«, sagte Josef verwundert. »Er meinte nur, das würde keine Rolle mehr spielen und dass ich doch bitte sofort unterschreiben soll, es pressiere nämlich sehr, weil die Stelle aus widrigen Umständen, die aber nichts mit dem Hof zu tun hätten, schon länger vakant sei. Wahrscheinlich hat er deshalb auch sofort eingewilligt, als ich darauf bestanden habe, dass du als Frau des Verwalters dort keinesfalls in Diensten stehen wirst. Und stell dir vor, als ich vor der Unterschrift auch nur kurz gezögert habe, hat er mir gleich noch ein Fahrrad versprochen. Wie gefällt dir das? Dein Josef auf einem Fahrrad! Nicht so ein altmodisches Ding wie das Dienstrad vom Klotzbücher, nein, ein neues mit Rücktrittbremse! Wer hier im Dorf hat schon so eins? Der Moser wird gewiss Augen machen.«
Übermütig hob Josef sie hoch und wirbelte sie im Kreis. Mit leuchtenden Augen redeten sie davon, wie sie an Sonntagen mit dem Fahrrad einen Ausflug machen würden, bei Sonnenschein vielleicht ein Picknick an einem Bach, den Sohn (in Josefs Vorstellung war er bereits drei oder vier Jahre alt) vorn auf dem Lenker, und Marie würde auf der Querstange sitzen, den Jungen fest umklammernd. So malten sie es sich aus in diesem glücklichen Moment. Sogar von einem Besuch im Gasthof sprachen sie, wie das sein würde, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen und sich bedienen zu lassen. »Aber hinterher muss man natürlich bezahlen«, wandte Marie ein, doch Josef winkte lachend ab. Das Geld sei gar kein Problem, als Verwalter würde man sich solch einen Luxus ab und zu leisten können.
Zu Maries großer Freude schien Josef glücklich zu sein. Endlich würde ihm etwas gelingen, und falls er doch Bedenken hatte, so sprach er nicht darüber. Lediglich in der folgenden Nacht, als er von einem Albtraum geplagt aufschreckte, einmal sogar aufschrie und wirr von einem lodernden Feuer redete, spürte Marie, dass ihn weiterhin etwas quälte, etwas, worüber er aber nicht sprechen wollte. Ihre besorgten Fragen wehrte er am nächsten Tag mit einem stummen Kopfschütteln ab und versank wieder minutenlang in seinen Grübeleien. Doch letztlich überwog die Freude.
Kapitel 2
Ein erstes zartes Morgenrot zeigte sich am Himmel, als das Paar an diesem kühlen Apriltag des Jahres 1904 aufbrach. Noch ein letztes Mal ließ Marie ihren Blick durch die Kammer in der Kirchgasse schweifen, an deren Wänden der Schimmel schwarze Spuren hinterlassen hatte, dann nickte sie Josef mit ernster Miene zu, und er schulterte das Bündel, das sie zusammengepackt hatten. Unten vor dem Haus griff er nach der Deichsel des Handkarrens, auf dem eine grob zusammengenagelte Kiste mit ihren wenigen Habseligkeiten stand. Keine Menschenseele begegnete ihnen im Dorf, nur die blinde Schuhmacherswitwe, die wer weiß wie lange schon auf den Kirchenstufen hockte und darauf wartete, vor der Frühmesse eine milde Gabe zu erhalten. Der Eisenbahnbau hatte zwar Reichtum ins Dorf gebracht, allerdings nur wenigen. Unsereins hat nicht dazugehört, dachte Marie bitter, als sie der Blinden ein Fünfpfennigstück in die Hand drückte. »Vergelt’s euch Gott«, murmelte die Frau, und Marie strich ihr behutsam über die rauen Hände. Josef und sie hatten jetzt jeden Grund, freigiebig zu sein, denn sie waren auf dem Weg in ein neues Leben, ein glücklicheres, wie sie von ganzem Herzen hoffte. Not und Verzweiflung würden der Vergangenheit angehören; vor allem aber die Angst vor dem Armenhaus, die sie in so vielen schlaflosen Nächten umgetrieben hatte.
Doch jetzt brach endlich eine andere Zeit für sie an. Denn der einsam gelegene Schelklehof, auf dem Josef als Verwalter arbeiten würde, galt als äußerst gut gestellt. Jedenfalls sagte das jeder im Dorf, der etwas davon verstand. Nicht nur äußerst fruchtbares Land, sondern auch ausgedehnte Wälder gehörten dazu, von denen der württembergische König für sehr viel Geld jüngst einige erworben hatte, nur für sein Jagdvergnügen, und man habe auch schon einiges an Damwild ausgesetzt, damit die Hatz für die hohen Herren in jedem Fall erfolgreich sei, wie man sich erzählte. Doch was die Besitzerin des Schelklehofs, Emerenz Schelkle, von allen halb ehrfürchtig, halb spöttisch »das Fräulein« genannt, mit ihrem sagenhaften Reichtum machte, wusste niemand so genau.
Auf dem Hof selbst war an diesem Morgen jedenfalls nichts davon zu sehen; entsprechend groß war Maries ungläubiges Erschrecken, als sie nach dem langen Marsch über Feldwege und Pfade, die quer durch den Wald führten, endlich ankamen. Lang gestreckt in einer Senke lag der Hof vor ihnen im Nebel, wie ein waidwundes Tier zum Sterben bereit. Das Wohnhaus, der vermutlich älteste Teil – über der Tür konnte man ins Holz geritzt die Jahreszahl 1791 entziffern –, war ein großer zweigeschossiger Fachwerkbau mit verwitterten Balken und einer morschen Sitznische neben dem Eingang. Linker Hand hatte man eine hölzerne Remise angebaut, ebenfalls mit einem Strohdach, das aber schon lange nicht mehr ausgebessert worden war, daneben eine Scheune aus Bruchsteinen, zwischen denen Unkraut wucherte, und auf der rechten Seite konnte man in dem Gebäude mit blinden Luken und abblätterndem Putz den Stall vermuten. Schräg gegenüber, als würde es nicht dazugehören, stand ein altes Backhaus mit steilem Satteldach, dessen oberes Stockwerk, über eine Außenstiege erreichbar, als Austragshäuschen dienen mochte. Daneben schloss sich ein weitläufiger, von niedrigem Gestrüpp begrenzter Kräuter- und Gemüsegarten an, dahinter, soweit das Auge reichte, knorrige Obstbäume, die wie Hilfe suchend die kahlen Äste zum grauen Himmel streckten.
Doch wo sich auf anderen Höfen Gerätschaften stapelten, Fuhrwerke herumstanden, Hühner und Gänse herumspazierten, bisweilen sich auch Schweine im Matsch suhlten und der Misthaufen dampfte, war hier der Platz mit dem gemauerten, überdachten Ziehbrunnen und dem steinernen Wassertrog daneben leer. Wie ausgestorben wirkte alles; nichts deutete darauf hin, dass irgendwo menschliches Leben war. Die schmutzig grünen Fensterläden, einige davon schief in den Angeln hängend, waren geschlossen, aus dem Kamin stieg nicht einmal die dünnste Rauchfahne auf, und Josefs lautes Rufen und sein wiederholtes Klopfen an der Tür des Wohnhauses waren vergeblich gewesen. Selbst einen Hofhund schien es nicht zu geben. Lediglich ein leichter Geruch nach Pferdemist hing in der Luft. Aber das besagte wenig, konnte doch ein Reiter erst kürzlich hier entlanggekommen sein.
Ungläubig beobachtete Marie, wie Josef, der von einem Gebäude zum anderen ging, vergeblich an den Türen rüttelte, mehrmals »Ist da wer?« rief und dann kopfschüttelnd zurückkam. Eine Welle von Übelkeit stieg in ihr auf. War womöglich alles vergeblich gewesen? All die Mühe, die es gekostet hatte, Josef, der sich anfangs mit Händen und Füßen dagegen gesträubt hatte, davon zu überzeugen, den Verwalterposten hier auf dem Schelklehof anzunehmen. Womöglich hat er ja recht gehabt mit seinen Bedenken, dachte sie in einer Aufwallung schlechten Gewissens, ich hätte ihn nicht überreden dürfen. Das haben wir jetzt davon. Doch das, was ihr bei der Arbeit in der Wäscherei zufällig zu Ohren gekommen war, hatte allzu verlockend geklungen und schien ein gütiger Fingerzeig des Himmels zu sein: Auf dem Schelklehof werde ein Verwalter gesucht, und die Besitzerin solle weit besser als jeder Bauer in der Umgebung bezahlen.
Doch als Marie jetzt daran zurückdachte, schien es ihr, als hätte die pausbackige Ella, mit der sie seit vielen Jahren so vertraut zusammengearbeitet hatte, mit einem Mal ungewöhnlich spöttisch geklungen. Mit dem langen Holzlöffel im Bottich mit der Weißwäsche des Schultheißen rührend, hatte sie Marie über die Schulter hinweg zugeraunt: »Wär das nichts für deinen Josef? Draußen auf dem Schelklehof würden die sogar einen wie ihn nehmen.«
Noch bei der Erinnerung an diese Worte krampfte sich in Marie alles zusammen. Einen wie ihn … Ein Geschwätz, als ob mein Josef ein schlechter Mensch wäre, dachte sie aufgebracht. Dabei ist er der aufrichtigste Mensch, den man sich vorstellen kann, der Mann, den ich immer geliebt habe und den ich immer lieben werde, mit all seinen Unzulänglichkeiten, die er vielleicht in den Augen der anderen haben mag. Doch danach fragt wahre Liebe nicht.
Mit warmem Blick musterte sie ihn, den groß gewachsenen Mann, der jetzt seinen grauen Filzhut abnahm, ihn gedankenverloren in den Händen drehte und dabei leise sagte: »Ich versteh das nicht. Hier scheint keine Menschenseele zu sein.«
Liebevoll strich sie ihm durch die dunklen Locken, in denen die grauen Strähnen in den letzten Monaten zahlreicher geworden waren. Trotzdem zog dieser stattliche Mann mit dem kantigen Kinn noch immer bewundernde Blicke vieler Frauen auf sich, wie sie mit leisem Stolz beim Besuch auf dem Frühjahrsmarkt bemerkt hatte, und neidvolle mancher Männer, vor allem derer mit wenig Haar. Mit gepresster Stimme sagte sie: »Es gibt wohl Menschen, die uns übelwollen.«
»Du meinst, es gibt Menschen, die mir übelwollen.« Josef drehte noch immer den Hut und schien dabei nach Worten zu suchen.
Marie schüttelte den Kopf, zwang sich dann zu einem Lächeln. Bitte, lass uns nicht wieder darüber reden, hätte sie am liebsten ausgerufen, du musst endlich vergessen, was gewesen ist. Wie oft muss ich es dir noch wiederholen: Lass die Vergangenheit ruhen, du kannst sie nicht ändern. Lass uns trotz alledem nach vorne blicken, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben … Aber es war zwecklos, ihm das zu sagen; die Verbitterung, seinen einstmals so prächtigen Gsellhuberhof durch eigenes Verschulden verloren zu haben, schwärte in Josef wie eine eiternde Wunde.
Mit der flachen Hand schlug er sich gegen die Stirn. »Ich Narr hab dem Enkel vom Härle jedes Wort geglaubt, das er da zum Besten gegeben hat. Eine Verwalterstelle! Gut bezahlt! Und ein Fahrrad! Bestimmt hockt der Alte am Stammtisch und klopft sich auf die Schenkel, wenn er die Geschichte erzählt. Wie sein Enkel, dieser lausige Rotzbub, den ehemaligen Großbauern Gsellhuber samt seiner Frau in den Wald geschickt hat, auf einen Bauernhof, der schon lange aufgelassen ist. Der Dummkopf Gsellhuber hat ja keine Ahnung, der fällt drauf rein, geschieht ihm grad recht, dass so einer seinen Hof verliert und …«
»Hör auf! Jetzt hör doch auf! Plag dich nicht, Josef! Wir finden einen Ausweg! Wir haben immer einen Ausweg gefunden!« Sie sagte das mit Nachdruck, um Josef zu besänftigen, der sich wieder einmal in eine Selbstanklage hineinsteigerte, ein Unterfangen, das so schmerzlich wie überflüssig war, denn es änderte nichts an den Tatsachen. Doch es würde einen Ausweg geben, einen naheliegenden sogar. Heimlich hatte sie Sebastian, ihrem Lebensretter vor langer Zeit, von ihrer schwierigen Lage berichtet, allerdings erst, nachdem er in mehreren Briefen eindringlich darum bat, die Wahrheit zu erfahren. Und wie schon einige Male zuvor hatte er seine Hilfe angeboten, ja fast darum gefleht, sie sollten doch endlich klug werden. Macht es wie ich damals, hatte er geschrieben, kommt nach Amerika, da liegt das große Geld auf der Straße, und ich unterstütze euch gern bei eurem Start in der neuen Welt.
Als sie Josef den Brief vorgelesen hatte (das Schreiben war gespickt mit fremden Wörtern, die sie nicht verstand und der Einfachheit halber überlas), hatte er brüsk abgelehnt. »Wir brauchen keine Hilfe von diesem Auswanderer, und wenn er noch so reich geworden ist in Amerika.« Den Namen Sebastian nahm er nicht in den Mund, obwohl er vor längerer Zeit zugegeben hatte, sehr dankbar zu sein, dass dieser Marie und Seffi damals vor dem sicheren Tod gerettet hatte.
»Es gibt keinen Ausweg mehr.« Marie schreckte aus ihren Gedanken auf. »Es gibt keinen Ausweg mehr«, wiederholte Josef eindringlich und griff nach ihren Händen. »Marie …«
Im selben Moment hörten sie vom Wohnhaus her ein leises Knarzen und blickten auf. Anscheinend wurde dort ein Schlüssel im Schloss umgedreht, denn die mächtige Eichentür öffnete sich, und ein junger Knecht, vielleicht sechzehn oder siebzehn, schmächtig und mit hochrotem Kopf, stolperte heraus, gefolgt von drei weiteren Knechten in fleckigen Arbeitshosen und Hemden. Einer von ihnen überragte sie alle, ein Blonder mit einer Augenklappe, die ihm ein verwegenes Aussehen gab. Aber auch er machte den Eindruck, als hätte ihn gerade jemand gezwungen, einen Kübel Essig auszutrinken.
»Ist doch jemand da?«, rief Josef ihnen überrascht nach. Im Laufen blickte sich der Älteste von ihnen flüchtig um, ein Grauhaariger mit wildem Vollbart und auffallend fleischiger Nase, und blieb schließlich stehen. »Ich meine, ist doch jemand im Haus?«, verbesserte Josef sich. Er war dem Mann nachgelaufen und fasste ihn am Ärmel. Der Knecht spuckte seinen Kautabak aus und blickte ihn schief an. »Wenn du die Verrückte meinst, ja freilich, die ist da. Aber ich rate dir, sei vorsichtig. Das Weib ist heute wieder des Teufels! Bestellt uns in die Stube, als hätten wir Gott weiß was verbrochen. Dann hält sie uns eine Predigt, dass wir elende Faulenzer sind. Und dass wir deshalb für die Woche auch nur den halben Lohn bekommen. In der Zeit, in der dieses Weib uns ausgeschimpft hat, wär schon das halbe Tagwerk geschafft.« Einen leisen Fluch ausstoßend, hinkte er kopfschüttelnd hinüber zum Brunnen, wo sich im Nebel, der immer dichter geworden war, mittlerweile das gesamte Gesinde versammelt hatte.
»Der Hof ist also gar nicht verlassen.« Marie war Josef nachgeeilt und atmete tief durch. »Wir haben nur Gespenster gesehen. Jetzt wird alles gut, glaub mir.«
Josef blickte sie an, aber er machte nicht den Eindruck, als habe er auch nur ein Wort von dem verstanden, was sie gesagt hatte. Kaum hörbar murmelte er etwas vor sich hin, aber als Marie nachfragte, schüttelte er abwehrend den Kopf.
Als wären sie Zaungäste eines sonderbaren Schauspiels, standen die beiden da und beobachteten, wie eine große ältere Frau mit schwarzem Kopftuch, eine Riesin fast, einen klappernden Schlüsselbund am Gürtel, in einem sonderbar aufrechten Gang von Gebäude zu Gebäude stapfte. Eines nach dem anderen schloss sie auf, woraufhin sich Knechte und Mägde verteilten, nach einer Choreografie wie von unsichtbarer Hand geführt. Gedämpfte Stimmen waren zu hören, ab und zu auch ein leises Lachen. Aus dem Kamin des Wohnhauses kräuselte sich nun der Rauch, und irgendwo im Wald, den man im Nebel nicht einmal mehr sehen, nur erahnen konnte, bellte ein Hund. Obwohl alles zu sein schien wie auf jedem anderen Hof, im Großen und Ganzen zumindest, konnte Marie ein plötzliches Schaudern nicht unterdrücken. Sie fasste Josef am Arm, wollte ihn fragen, ob er auch so empfand, doch da stand mit einem Mal die Frau mit dem schwarzen Kopftuch vor ihnen. Ihre Augenbrauen waren über der Nasenwurzel zusammengewachsen und verliehen ihrem Gesicht einen finsteren Ausdruck, der durch die herabgezogenen Mundwinkel noch verstärkt wurde. Und sie war ein wenig größer als Josef, der doch ein stattlicher Mann war.
»Der neue Verwalter?« Ohne auf eine Antwort zu warten, deutete sie mit einer knappen Kopfbewegung zum Wohnhaus hinüber und drehte sich um. Josef folgte ihr eilig, wobei er sich im Gehen nach Marie umwandte. »Warte hier auf mich!«
Eine gute Weile verging. Marie schätzte, dass es mittlerweile bestimmt schon Mittag sein musste. Oder täuschte sie sich? War es bereits viel später? Zum ersten Mal bedauerte sie, dass der Schelklehof so weit vom Dorf entfernt war, dass man nicht einmal den Glockenschlag der Kirchturmuhr hören konnte. Eine seltsame Stimmung bemächtigte sich ihrer, und für einen Moment wünschte sie sich zurück in die Sicherheit ihrer kleinen Kammer im Dorf, ein Ort, der ihr vertraut war mit all seinen Unzulänglichkeiten. Was, wenn Josefs ursprüngliche Einschätzung des Schelklehofs doch richtig war?
Sie hatte sich ihre Ankunft auf dem Hof beileibe anders vorgestellt; nicht dass sie von einer überschwänglichen Begrüßung durch die Knechte und Mägde geträumt hatte, das gewiss nicht, sie war auf dem Land aufgewachsen und kannte den Menschenschlag. Aber ein wenig Herzlichkeit, ein freundlicher Gruß hätte es schon sein dürfen, mehr war ja nicht nötig. Plötzlich stiegen ihr die Tränen hoch, und sie hatte Mühe, ein Schluchzen zu unterdrücken. Jetzt stell dich nicht so an, schimpfte sie mit sich selbst. Du hast es so gewollt, also mach das Beste daraus. Sie bückte sich, um ein Tuch zum Schnäuzen in der Kiste zu suchen, als sie das schwarze Fellbündel entdeckte, das sich unbemerkt unter dem Handwagen verkrochen hatte. Eine kleine Katze, nur wenige Wochen alt, die ängstlich maunzte, als Marie sie behutsam auf den Arm nahm. »Du musst keine Angst haben, mein Kleines«, flüsterte Marie. »Ich sorge dafür, dass dir nichts passiert.«
Als hätte das Kätzchen sie verstanden, schmiegte es sich in ihre Armbeuge, sie glaubte sogar ein leises Schnurren zu hören, und das Herz wurde ihr leicht. Dieses erste Wesen auf dem Hof, das freundlich zu ihr gewesen war, würde sie nie wieder hergeben.
Kapitel 3
»Siehst du, nun hat sich doch noch alles zum Guten gewendet.« Erleichtert blickte Marie sich um. Die Verwalterwohnung im Austragshäuschen übertraf alle ihre Erwartungen: Die Schlafkammer mit dem Fenster zum Wald war frisch gekalkt, es gab einen zweitürigen Kasten, eine Waschkommode mit Spiegelaufsatz und einer Waschschüssel aus glasiertem Steinzeug mit verblichenem Blumenmuster und einem kleinen Sprung, der aber nicht weiter störte. Daneben lag in einer Schale ein Stück Kaloderma-Seife, die teure, wie Marie feststellte, als sie daran schnupperte. An der gegenüberliegenden Wand standen zwei hölzerne Bettgestelle mit mehrteiligen Wollmatratzen und so dicken Federbetten, dass man auch die kälteste Winternacht überstehen würde, und darunter zwei frisch gewienerte Nachttöpfe, ein echter Segen, weil der einzige Abtritt hinter dem Stall war. In der etwas kleineren Stube nebenan befanden sich ein schmiedeeiserner Kochherd, ein Tisch mit Schublade, mehrere Schemel und sogar ein Kanapee, mit dunkelrotem Samt bezogen, etwas durchgesessen zwar und an den Armlehnen auch ein wenig abgeschabt. Aber es machte immer noch etwas her, wie sogar Josef zugeben musste. Und die Holzdielen in beiden Zimmern knarrten nur mäßig, kurzum, es gab jeden Grund, mit dem neuen Zuhause zufrieden zu sein.
»Ich werde uns Gardinen nähen«, überlegte Marie halblaut. »Aus einem leichten Baumwollstoff vielleicht? Obwohl der Blick aus diesem Fenster auch sehr schön ist, so direkt in den Wald hinein. Aber andererseits wirken die hohen Bäume auch ein wenig finster. Gardinen machen es bestimmt viel heimeliger. Das Fenster zum Hof braucht keine. Ich werde dort stehen und beobachten, was unten vor sich geht.« Sie lachte vergnügt. »Ich weiß schon jetzt, wir werden hier glücklich sein.«
Immer noch hielt sie das Kätzchen auf dem Arm, das noch namenlos war, denn ein passender Name war ihr bislang nicht eingefallen. Josefs Vorschlag, es einfach Kätzle zu nennen, das könne sogar er sich merken (dabei lachte er spitzbübisch), hatte sie mit einem empörten Ausruf zurückgewiesen. Nein, es müsse ein besonders schöner Name sein, einer, der zu dem Tier und ihrem neuen Glück passe.
Unbeschwert wie schon lange nicht mehr lief sie geschäftig zwischen den beiden Kammern hin und her, kramte in der Kiste mit ihren Habseligkeiten herum und fand schließlich das, was sie gesucht hatte: eine Fotografie im fein ziselierten Silberrahmen, die sie so lange auf dem Tisch herumschob, bis sie ihrer Meinung nach gut zur Geltung kam. Kurz vor Seffis Umzug in die Schweiz waren sie zusammen zum Fotografen gegangen, Marie, Josef, die beiden Töchter Seffi und Agnes und die Schwiegersöhne. Sie trugen ihre Sonntagskleider, Marie saß in der Mitte auf einem hochlehnigen Holzstuhl wie auf einem Thron, einen Strauß künstlicher Blumen im Arm, Josef hatte eine Hand auf ihre Schulter gelegt, und links und rechts daneben standen die Kinder. Alle blickten so ernst und gemessen in die Kamera, wie es die Situation erforderte.
»Es wäre so schön, wenn Seffi und Agnes uns jetzt sehen könnten!«, rief Marie und rückte das Foto noch ein wenig weiter zur Mitte. Dann wies sie Josef an, das Kanapee ans Hoffenster, wie sie es nannte, zu schieben, dann wieder zurück, weil es an der anderen Wand doch besser passe. Schließlich kletterte sie sogar die steile hölzerne Leiter in der Schlafkammer hoch auf die Bühne, die zu ihrer leisen Enttäuschung allerdings nur aus einem schmutzigen Holzboden mit allerhand Spinnweben zwischen den Dachbalken und jeder Menge verstaubtem Gerümpel zu bestehen schien. »Vielleicht kannst du morgen schauen, ob doch etwas Verwendbares dabei ist!«, rief sie beim Hinunterklettern Josef zu. »Aber als Erstes brauchen wir Feuerholz. Es ist kalt hier drin, wahrscheinlich wurde schon lange nicht mehr geheizt. Und das Fenster auf der Bühne lässt sich auch nicht schließen, ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Kannst du es versuchen? … Josef?« Fragend blickte sie ihn an. Er stand am Fenster, die Arme vor der Brust verschränkt, und wirkte mit einem Mal so unglücklich, dass sie das Kätzchen, das leise schnurrend um sie herumstrich, behutsam auf das Kanapee setzte und nach Josefs Hand griff. »Du kannst das! Du wirst der beste Verwalter sein, der je auf dem Hof war.«
Er schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht … Aber …«
»Aber …?«
Josef warf ihr einen unglücklichen Blick zu. »Neben dem Fräulein hat anscheinend Berthe das Sagen auf dem Hof, das ist die große Frau mit dem Schlüsselbund. Die ganzen Jahre hat sie wohl für die Verwaltung hier gesorgt, die Arbeiten angeordnet, die Löhne ausgezahlt, eben alles, was auf einem großen Hof anfällt. Jetzt wird ihr die Arbeit zu viel, hat sie gemeint, und deshalb stellen sie jetzt mich als Verwalter ein. Aber was ich eigentlich sagen will …« Er zögerte und holte tief Luft. »Berthe erwartet, dass ich gleich morgen in der Früh abreise, zu einer Viehauktion in die Schweiz. Marie, dann muss ich dich für drei Tage allein lassen, und das Herz wird mir schwer bei diesem Gedanken.«
»Ich bin doch nicht allein, ich habe Gesellschaft.« Marie deutete auf das Kätzchen, das sich in einer Ecke des Kanapees zusammengerollt hatte. »Pass bloß auf, womöglich vermisse ich dich überhaupt nicht.« Das sagte sie schelmisch lächelnd, obwohl ihr nicht wohl war bei dem Gedanken, auch nur einen Tag ohne Josef zu sein.
Er nickte und zog sie an sich. Es sei ja nur für eine kurze Zeit, hörte sie ihn murmeln, was solle da schon geschehen.
Wenig später verließ er das Häuschen, um, wie er vorgab, in seinem Büro noch kurz einige Unterlagen für die Auktion zu studieren. So ist das also, dachte er und spürte, wie Bitterkeit in ihm hochstieg. So ist das also, den Menschen, den man liebt, zu belügen, und das nur, weil man über alles liebt. Doch auf gar keinen Fall durfte Marie von dem tragischen Unglück erfahren, das ihn und Emerenz Schelkle verband, alles würde er dafür tun, sie aus dieser unheilvollen Verbindung herauszuhalten, und dafür war er zu allem bereit.
Mit raschen Schritten hatte er den Hof überquert, hinüber zum Wohnhaus, wo er an der Tür bereits von Berthe erwartet wurde. »Vergiss nicht, das Fräulein bedarf äußerster Schonung«, sagte sie. »Also Obacht mit dem, was du sagst.« Sie deutete mit einer Kopfbewegung zur Treppe. »Aber jetzt schnell hinauf zu eurem Wiedersehen. Du wirst schon ungeduldig erwartet.«
Sie lächelte anzüglich, und Josef hörte den missbilligenden Ton in dem, wie sie es sagte. Er schüttelte den Kopf, wollte etwas erklären. Doch da ertönte von oben ein Poltern, als stampfe jemand mit aller Macht auf den Fußboden, und eilig wandte Berthe sich um. Er folgte ihr durch den dunklen holzgetäfelten Flur, an dessen Längsseite sich ein mächtiges Hirschgeweih an das andere reihte, denn der Vater des Fräuleins war ein begeisterter Jäger gewesen, vorbei an Türen, die alle geschlossen waren, die Treppe hinauf. Kein Geräusch war zu hören im Haus, kein Klappern von Töpfen in der Küche, kein lautes Lachen und Kreischen der Mägde, nicht einmal die Stufen der ausgetretenen Holztreppe knarrten; über allem lag eine beklemmende Stille, die ihm das Atmen schwer machte. Schweigend öffnete Berthe am Ende des Flurs eine Tür, wortlos bedeutete sie ihm einzutreten. Dann verschwand sie, und er stand ihr allein gegenüber. Dem Fräulein. Emerenz.
Berge bestickter Kissen im Rücken, lag sie auf einem Diwan orientalischer Machart, neben sich ein niedriges Tischchen aus Messing – die einzigen Möbelstücke in der geräumigen Kammer. Über ihr hing in einem breiten Goldrahmen ein Ölgemälde, das eine italienische Landschaftsmalerei mit Zypressen und einer Burgruine zeigte und in Josefs Augen von minderer Qualität war. Die Fensterläden waren geschlossen, obwohl es draußen noch helllichter Tag war; ein Kerzenständer mit ein paar flackernden Kerzen spendete nur mäßig Licht. In der Luft, die so abgestanden war, dass es Josef fast den Atem nahm, lag der Geruch von Siechtum und Krankheit.
Über den Knien des Fräuleins war eine gesteppte Decke mit grellem Blumenmuster ausgebreitet, die sie nun hochzog bis zur Brust und mit der einen Hand so fest umklammert hielt, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. In der anderen hielt sie einen massiven Knotenstock mit versilbertem Knauf, mit dem sie vermutlich gerade eben auf den Boden gestampft hatte. Mit unbewegter Miene musterte sie Josef, bis schließlich ein verstohlenes Lächeln über ihre knochigen Gesichtszüge glitt. Erst jetzt gelang es ihm, in der schmalen Gestalt mit schwarzer Spitzenhaube über dem bleichen Gesicht wieder die junge Emerenz zu erahnen, eine dralle, rotblonde Frau, die an jenem Abend die ganze Zeit über so aufreizend gelacht hatte …
»Es ist lang her …«, sagte er schließlich, als das Schweigen ihn zu erdrücken drohte. »Über dreißig Jahre.«
»Zweiunddreißig Jahre, acht Monate und vier Tage.«
Betroffen senkte er den Blick. Nein, Emerenz würde nie vergessen und nie verzeihen; wie vermessen hatte er nur sein können, darauf zu hoffen. Er wollte etwas erwidern, eine Entschuldigung vorbringen, erklären, dass alles nur der Wille seines Vaters gewesen sei; er selbst wäre bereit gewesen, sich seiner Verantwortung zu stellen. Doch seine Stimme war rau, und es kam ihm vor, als bringe er nichts heraus als ein unbeholfenes Stammeln.
Mit einer herrischen Handbewegung gebot sie ihm zu schweigen. »Ich habe dich geliebt, den schönsten jungen Mann, den ich je gesehen hatte«, sagte sie dann mit so gleichmütiger Stimme, als lese sie einen fremden Text vor. »Ja, ich habe dich oft beobachtet bei den Festen im Dorf. Aber du hast nicht einen einzigen Blick für mich gehabt, hast immer nur mit deinen Freunden zusammengestanden. Dem Vater hab ich frank und frei heraus gesagt, dass ich nur den Josef will. Ich glaub sogar, er hätt mir den Wunsch selbst dann erfüllt, wenn der Gsellhuberhof nicht so wohlhabend gewesen wäre. Du und ich, wir hatten noch kein einziges Wort miteinander geredet, da haben unsere Väter unsere Hochzeit bereits bis ins Kleinste ausgehandelt. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden, als ich es erfahren habe. Ich war sicher, dass es dir auch so ergeht. Dass ich für dich wäre, was du für mich warst. Ja, du warst ein junger Gott für mich. Ich habe dich mit jeder Faser meiner Seele angebetet … Mein Glück wurde noch größer, als ich dich an jenem Abend sah.« Ihre Stimme stockte, und Tränen traten ihr in die Augen. »Dieser Abend, der mein Schicksal besiegeln sollte.« Schluchzend verstummte sie.
Als sie schließlich weitersprach, hatte sich ihr Tonfall verändert, atemlos klang sie und aufgeregt. »Ich weiß aber nicht mehr, wer da so entsetzlich geschrien hat, dass es mich heute noch schaudert, und ich muss es endlich wissen. War ich es? Warst du es? … Sag!« Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie ihn an, presste beide Hände auf die Ohren, als würde sie ihn immer noch hören, diesen einen schrillen Schrei, ein Schrei, von dem auch Josef nicht hätte sagen können, wer ihn ausgestoßen hatte in der vergnügten Gesellschaft von damals, an die er sich mit einem Mal mit einer solch erschreckenden Klarheit erinnerte, als sei es erst gestern geschehen.
Es waren junge Leute gewesen, die sich auf einer kleinen Anhöhe um das lodernde Johannisfeuer versammelt hatten, die Frauen trotz des recht kühlen Wetters in leichten Musselinkleidern, mit Strohhüten auf dem Kopf, die von bunten Bändern gehalten wurden. Er stand etwas abseits, zusammen mit zwei Freunden, Kaspar und Leopold, die, wie ihm jetzt wieder einfiel, sich lautstark wegen einer Zeitungsmeldung gestritten hatten. Angeblich gab es in Amerika einen weiblichen Konstabler, was ein raffinierter Schachzug wäre, behauptete Kaspar und grinste breit, denn jetzt ließen sich Diebe bereitwillig verhaften, ja sie stünden quasi Schlange. Leopold wandte ein, dass es sich nach einer Zeitungsente anhörte, und außerdem, wo käme man denn hin, wenn Frauen Polizisten würden, demnächst wollten sie nur noch mehr. »Wehe, wenn du einer Frau auch nur den kleinen Finger gibst …«, hatte er gesagt und dabei ein Gesicht gezogen, als habe er in dieser Hinsicht schon Wunder weiß was an Erfahrungen gemacht. Josef, den die beiden schließlich nach seiner Meinung fragten, lachte nur und meinte, das sei ihm völlig egal.
Ein frischer Wind war mittlerweile aufgekommen, noch schlugen die Flammen hoch, und alles wartete ungeduldig, dass es endlich Nacht würde. Denn dann würden die Paare sich finden, um Hand in Hand über die Glut zu springen, ein uraltes Ritual, mit dem sie ihre Liebe bekräftigten.
»Fragst du die Emerenz?«, wollte Kaspar wissen.
Josef zuckte bloß mit den Schultern. Natürlich war es für ein Mädchen eine Schande, nicht zum Springen aufgefordert zu werden. Doch was kümmerte ihn, wie es der Emerenz ging. Er hatte anderes im Kopf: eine heftige Schwärmerei für eine Schauspielerin am Königlichen Theater in Stuttgart, über die er alles verschlang, was er in der Zeitung nur finden konnte; er träumte von ihren feurigen Augen, den rabenschwarzen Haaren und einem alabasterweißen Schwanenhals, den er mit Küssen überdecken würde. Wenn … Ja, wenn … Heimlich sparte er für einen Theaterbesuch in nicht allzu ferner Zeit, vielleicht konnte er seinem Vater ja weismachen, in Stuttgart einen landwirtschaftlichen Vortrag zu besuchen, oder, noch besser, eine Ausstellung moderner Landwirtschaftsmaschinen. Denn das war das Lieblingsthema des Alten. Josef dagegen interessierte es nicht im Geringsten, wie ihm auch die ganze Landwirtschaft eigentlich gleichgültig war. Doch um seine gefeierte Schauspielerin endlich einmal zu sehen, würde er dieses Opfer bringen. An Emerenz dagegen wollte er lieber gar nicht denken, und das, obwohl ihm wenige Tage zuvor der Vater eröffnet hatte, dass die Hochzeit mit ihr endlich beschlossene Sache sei. Der alte Schelkle habe sich zwar wegen der Mitgift zunächst etwas geziert, sich dann aber doch großzügig gezeigt. »Seine Emerenz ist ja nicht grad eine Schönheit«, hatte der alte Gsellhuber geknurrt. »Das weiß der Schelkle natürlich auch. Da musste er schon noch ein paar gute Äcker drauflegen.«
Dem Plan des Vaters zu widersprechen, hatte Josef nicht gewagt. Lediglich am letzten Sonntag beim Kirchgang hatte er der Mutter gegenüber gejammert, dass er mit neunzehn doch viel zu jung zum Heiraten sei, und gefallen würde ihm die Emerenz auch nicht mit ihren hervortretenden Augen und dem gewaltigen Doppelkinn.
»Bub, das wird schon noch«, hatte seine Mutter erwidert. Die ewig gebückte Gestalt hatte sich gereckt, um liebevoll seine Wange zu tätscheln. »Die Emerenz ist ein gutes Stück älter als du, neun oder zehn Jahre, so genau weiß ich das gar nicht. Du solltest dich glücklich schätzen, mein Sohn, denn da kommen mit Gottes Hilfe viel Erfahrung und jugendlicher Drang zusammen.«
»Du musst die Emerenz schon fragen, ob sie mit dir springt«, hörte er jetzt den anderen Freund sagen, hustend, weil der Qualm in ihre Richtung zog. »Ich hab gehört, sie soll ziemlich nachtragend sein.« Wieder zuckte Josef mit den Schultern. Er überlegte sogar, einfach nach Hause zu gehen, der Abend langweilte ihn inzwischen. Zudem könnte es Ärger geben, denn der Schultheiß hatte das Johannisfeuer verboten, nachdem es im letzten Jahr zu einem großen Brand gekommen war, der zwei Menschen das Leben gekostet hatte. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis ein besorgter Dorfbewohner dieses Feuer auf der Anhöhe entdecken und die Obrigkeit alarmieren würde. Während Josef noch unschlüssig war – gehen oder doch noch bleiben? –, hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Alle Blicke wandten sich ihm zu, als Emerenz, das Gesicht gerötet, mit ausgestreckten Armen auf ihn zukam. »Los jetzt!«, rief sie überlaut. »Wir springen als Erste!«
Widerwillig ließ er sich von ihr zum Feuer ziehen, ja, er spürte einen Augenblick sogar fast eine Art Abscheu vor dieser jungen Frau, deren dickliches Gesicht im Feuerschein fiebrig glühte und die ununterbrochen lachte, auch noch, als Josef den Kopf schüttelte und meinte, nein, man könne noch nicht springen, der Holzstoß sei zu hoch, sie müssten warten.
»Traut der Bub sich nicht?«, fragte Emerenz lachend, die Hände in die breiten Hüften gestemmt und mit gerunzelter Stirn, als betrachte sie das Warenangebot eines Händlers, weniger an Josef gerichtet, mehr an die Umstehenden, die sofort in wieherndes Gelächter ausbrachen, das ihm später während endlos quälender Grübeleien als Auslöser erschien für die Entscheidung, die er damals binnen Sekunden getroffen hatte: Grob hatte er Emerenz am Handgelenk gepackt und zum Feuer gedeutet, aber nicht zur Seite, wo das Holz bereits so weit heruntergebrannt war, dass auch ein Ungeübter mit etwas Geschick hätte springen können, sondern zur Mitte, wo sich die glühenden Scheite noch immer hoch türmten. Kühl blickte er Emerenz an, kühl erwiderte sie seinen Blick, dann nickte sie.
Um sie herum war es still geworden. Nur das Knistern und Knacken des Holzes war zu hören, als sie Anlauf nahmen, Hand in Hand, wie es der Brauch verlangte. Und dann lachte Josef plötzlich auf, frei wie ein Vogel fühlte er sich, als er weit über das Feuer flog, das Herz erfüllt von unbändigem Jubel. Der aber schlagartig endete durch einen lauten Schrei und das entsetzte Aufstöhnen der Umstehenden, die hilflos mit ansehen mussten, wie Emerenz sich von Josefs Hand losgerissen und seitwärts gesprungen war, vielleicht in der plötzlichen Erkenntnis, dass der Holzstoß für sie doch zu hoch war. Aber diese schnelle Drehung hatte ihr nichts genützt, im Gegenteil: Sie war unglücklich auf dem harten Boden aufgekommen, sonderbar verdreht lag sie da auf der Wiese, und als Josef sich erschrocken über sie beugte, war ihr Gesicht totenbleich, und sie lachte nicht mehr.
Natürlich zog das Unglück polizeiliche Ermittlungen im Dorf nach sich, die aber, weil man sich ja kannte und unter den Beteiligten auch die Söhne einiger Großbauern waren, keine weiteren Konsequenzen hatten außer einer ernsten mündlichen Verwarnung der Schulbuben, die für ein paar Groschen den Holzstoß zusammengetragen hatten. Emerenz war noch in derselben Nacht mit dem Pferdegespann ins Hospital in die Kreisstadt gebracht worden, denn der eilig hinzugezogene Wundarzt, der sie als Erster untersucht hatte, war sicher, dass nur eine rasche Operation ihr Leben retten würde.
Alsbald gab es jedoch böse Zungen im Dorf, die behaupteten, die nächtliche wilde Fahrt über holprige Straßen habe ihr mehr geschadet als der unglückselige Sturz. Gerüchte machten die Runde, sogar von einem gebrochenen Genick war die Rede, aber Genaueres erfuhr man nicht. Mit der Zeit allerdings sprach es sich doch herum: dass es da nichts zu operieren gab, die Emerenz ab der Brust gelähmt war und dies ein Leben lang so bleiben würde.
Gepeinigt von Schuldgefühlen, war Josef entschlossen, das Eheversprechen einzuhalten, ohne jede Liebe zwar, aber wegen der Ehre muss es sein, erklärte er seinem Vater, und fühlte sich zum ersten Mal im Leben wie ein Mann. Der alte Gsellhuber nannte ihn daraufhin einen ausgemachten Dummkopf, und was er eigentlich glaube, wozu er überhaupt auf der Welt sei. »Du musst unser Sach zusammenhalten, mehr schaffst du sowieso nicht. Lass endlich die Finger von deiner unnützen Pinselei, kümmer dich lieber endlich um unseren Hof!« Er zog verächtlich die Mundwinkel nach unten. »Einen Stammhalter wirst ja wohl noch zeugen können. Aber dazu braucht’s eine andere Frau.«
Nach vielem Hin und Her war der Ehevertrag schließlich wieder aufgelöst worden, denn der alte Gsellhuber hatte dem Schelkle klargemacht, dass die Emerenz mit ihrer Lähmung wertlos geworden sei für seinen Sohn. Umsonst war die Auflösung dann allerdings nicht; er musste dem Schelkle drei seiner besten Äcker und ein ordentliches Stück Wald überschreiben, was er aber erst nach der Androhung machte, ansonsten würde man sich vor Gericht treffen. Dann würde es richtig teuer werden. Denn alleinige Schuld am Unglück der Emerenz habe genau genommen ja nur Josef.
»Nun …?«
Josef blickte auf. Er hatte Mühe, sich zu besinnen.
»Dieser Schrei«, erinnerte Emerenz ihn. Aufmerksam blickte sie ihn an. »Von wem kam dieser Schrei?«
Erschöpft zuckte er mit den Schultern; er wollte nicht mehr erinnert werden. Zu seiner Verwunderung schien Emerenz sich damit zufriedenzugeben. »Nun gut, dann werde ich weiter darüber nachdenken müssen, so lange, bis es mir einfällt.«
Er lauschte, denn plötzlich glaubte er, ein Geräusch an der Tür gehört zu haben. »Hat es nicht gerade geklopft?«, fragte er voller Hoffnung, das Gespräch beenden zu können.
»Nein, bestimmt nicht. Ich habe Berthe gesagt, dass wir auf keinen Fall gestört werden möchten. In diesen Dingen ist sie sehr genau. Und unser Gespräch ist noch nicht beendet.«
»Was willst du von mir?«, brach es aus ihm heraus. »Ich verstehe dein Verhalten nicht. Bei dieser fürstlichen Bezahlung hättest du den besten Experten des Landes als Verwalter bekommen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob du wirklich jemanden brauchst …« Er zögerte, denn er erinnerte sich an Berthes eindringliche Worte, dass Emerenz geschont werden müsse. »Die Papiere, die Berthe mir heute Vormittag gezeigt hat, lassen insgesamt doch auf eine recht ordentliche Verwaltung schließen. Natürlich, manches könnte man anders angehen, aber das ist mit vielen Dingen so. Also frage ich mich, warum?«
Sie räusperte sich und sprach dann mit so leiser Stimme, dass er sich vorbeugen musste, um sie zu verstehen: »Berthe hat es die ganzen Jahre über recht gut gemacht, das stimmt schon. Allerdings sind in der letzten Zeit einige Umstände eingetreten, die mich zunehmend daran zweifeln lassen. Ich brauche also jemanden, auf den ich mich absolut verlassen kann … Nein, unterbrich mich nicht! Ich habe dieses Wort bewusst gewählt. Damals konnte ich mich nicht auf dich verlassen. Jetzt kannst du deine Schuld begleichen. Ich habe mir alles sehr genau überlegt.« Ihre Stimme war lauter geworden. »Jetzt haben nämlich wir beide etwas zu verlieren. Aber unser Kontrakt wird zu unser aller Nutzen sein.« So unerwartet, dass Josef zusammenzuckte, stampfte sie mit dem Stock auf den Boden. »Knie nieder! Hier vor mir! Schwör mir deine ewige Treue! Dass du fortan immer für mich und diesen Hof da sein wirst, so, wie es damals hätte sein sollen.«
Unwillkürlich trat Josef einen Schritt zurück. Sie lächelte und wirkte dabei mit einem Mal so heiter, als handle es sich um eine angeregte Plauderei bei Tisch. »Mein lieber Josef, es besteht keinerlei Grund für dein Erschrecken. Ich versichere dir, dieses Gelöbnis geht nur dich und mich an. Niemand wird davon erfahren, auch nicht deine Frau, keine Sorge. Ich habe gehört, sie ist um einiges jünger als du; also wird sie damals noch ein Kind gewesen sein und vermutlich nichts von dem Unglück wissen. Und sie wird mich elenden Krüppel nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Aber sie wird glücklich sein, einen tüchtigen Verwalter als Ehemann zu haben, einen Mann, der den Schelklehof noch wohlhabender macht und dabei reich wird. Also überleg nicht lang! Knie nieder und gelobe es! Jetzt! Morgen ist es zu spät!«
Es kam ihm wie eine sonderbare Form einer verspäteten Buße vor, als er schließlich niederkniete, die eiskalte Hand nahm, die sie ihm entgegenstreckte, und stockend die Worte wiederholte, die sie ihm vorsprach. »Ich gelobe, dir jetzt und in alle Zukunft treu zu dienen. Bis dass der Tod uns scheidet.«
Ich mache es nur für Marie, dachte er verzweifelt, ich will, dass sie ein gutes Leben hat und eine Zukunft für unser Kind. Alles täte ich dafür, alles.
Er sprang auf, denn es hatte geklopft, ganz deutlich hatte er es jetzt gehört. Als er sich an der Tür nochmals umdrehte, sah er in den Augen des Fräuleins blanken Hass.
Marie hatte Josef vom Fenster aus nachgeblickt, wie er eilig über den Hof lief, bis er im Nebel nicht mehr auszumachen war. Dann, unschlüssig, was sie als Erstes tun sollte und weil ihr kalt war, hüllte sie sich in ihr großes wollenes Umschlagtuch und setzte sich auf das Kanapee neben das Kätzchen, das tapsig auf ihren Schoß kletterte.
»Da sind wir nun, wir beide«, flüsterte sie und strich ihm sanft übers Fell. »Ja, da sind wir nun, wir beide«, wiederholte sie, weil es gar so still war, eine Stille, die sie so nicht kannte. In ihrer Kammer in der Kirchgasse hatte man die Kirchenglocken gehört, auch des Nachts den Stundenschlag, und tagsüber das ununterbrochene Rattern und Pfeifen der Eisenbahn, den Lärm der Handwerker aus den umliegenden Wohnungen, ihr Hämmern und Sägen, dazu das Kindergeschrei von der Straße und ab und zu die durchdringende Stimme eines Hausierers, sehnsüchtig erwartet von mancher Hausfrau, der mit lauter Stimme seine einzigartig billigen Waren anpries.
Auf dem Schelklehof dagegen war es still, so still, als würde alles unter einem grauen Leichentuch liegen. Im nächsten Moment allerdings schalt Marie sich wegen dieser Vorstellung, und wie um sich Mut zu machen, trällerte sie Wenn alle Brünnlein fließen,