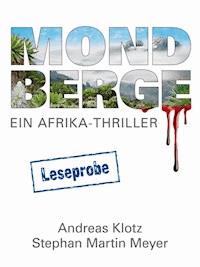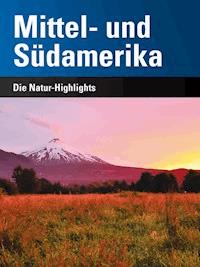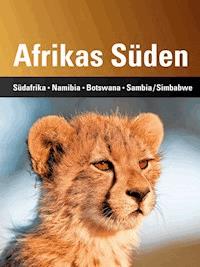4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Urlaub mit Rakí. Chaos im Paradies. Esteban und Maria fliegen nach Kreta. In Paleochora, dem Mekka der Individualtouristen, erwarten sie Abenteuer der kuriosen Art. Mit dabei: ein naives Stoffschaf und ein versoffener Plüschbär, die sich unverschämt in ihr Leben einmischen. Die beiden Freunde sehen sich als die vermeintlich besseren Urlauber, meiden Touristenfallen und erkunden die echte kretische Kultur. Doch Maria, die mit spitzer Zunge und zynischem Humor ihre Umgebung kommentiert, treibt alle in den Wahnsinn. Esteban, ein Dichter auf der Suche nach sich selbst, kämpft mit seiner sexuellen Orientierung und wird durch eine Begegnung mit einem attraktiven Griechen herausgefordert. Kretische Reise beleuchtet die Eigenarten deutscher und anderer europäischer Touristen und die archaische Welt der Kreter. Ein irrwitziger Trip voller Ironie und Selbstfindung, der die Leser an die traumhafte Südküste Kretas entführt. Ein Muss für alle, die nach Kreta reisen. Unvermeidlich, wenn du einmal in Paleochora warst. Ein fantastischer Coming out Roman. Griechenland pur. Archaisch und orignial. Das schreibt die Presse: Thomas Dahl schreibt im Kölner Stadtanzeiger zu diesem Roman: »Durch entlarvende Persönlichkeitsstudien wird das Buch zu einer pointierten Zivilisationskritik. Schwärmerische Landschaftsbeschreibungen machen die Erzählung zugleich zu einem Ferienerlebnis, die, wenngleich sie unkonventionell sein mag, selbst eine Sexszene niveauvoll übersetzt. Ouzo, Raki und Moussaka werden dezent, aber geschmackvoll in die Kapitel transferiert. Daher gilt eine unbedingte Reiseempfehlung: ab in den Süden Kretas - natürlich mit Stephan Martin Meyers hoch amüsanter wie aufklärerischer Lektüre. Schließlich erinnert die Kretische Reise daran, nicht im abgeriegelten Zuhause auf Glückseligkeit zu warten.« Das sagen die Leser:innen: »Wer das Mittelmeer liebt, wer die Griechen liebt, wer die Liebe liebt, der muss Meyer nach Kreta folgen. Er wirbelt mit seinem reizenden Personal alles, was man so über Ferien in Kreta zu wissen glaubt, durcheinander. Dank seiner großen Liebe zu Kreta und seiner profunden Kenntnisse von Land und Menschen, führt uns Meyer aber sicher durch alle sich bietenden Labyrinthe hindurch mindestens einem wunderbaren Happy End entgegen. Kaum vorstellbar, das jemand, der das Buch gelesen hat, nicht sofort nach Kreta will.« »Eine tolle Urlaubs- und Sommerlektüre!« »Jede Zeile des Buches hat mich an die kretische Südküste versetzt!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kretische Reise
Eine Sommersatire an Kretas Südküste
Stephan Martin Meyer
Abreise
Wir fahren weg, obwohl wir uns Sorgen um den Job machen, eine kranke Oma und eigentlich nicht genug Geld zum Verreisen haben. Wir packen die Koffer Anfang Mai mit dem Nötigsten und fliegen in die Sonne – allerdings muss man bedenken, dass das Nötigste für meine Begleiterin schon eine Menge Holz ist. Genauer gesagt: ein sehr großer Koffer. Ohne Rollen. Den sie niemals selbst trägt. Aber was soll’s – wir haben ja Urlaub.
Nicht lange stand die Frage des anzuvisierenden Ziels im Raum. Venusköpfchen schlug vor und ich schlug ein. Sie suchte den Flug, ich buchte die Tickets. Sie will Abenteuer, ich sehne mich nach Ruhe. Ich kenne den Ort bereits, sie noch nicht. Wir machen alles gemeinsam und gehen dabei arbeitsteilig vor. Konsequent.
Venusköpfchen ist natürlich nicht nur ein Kopf. Sie ist viel mehr. Eine Frau. Schön wie die Venus von Milo, allerdings mit zwei funktionstüchtigen Armen. Anbetungswürdig wie die Venus von Botticelli, nur würde sich die hiesige niemals in eine Muschel stellen und an Land treiben lassen. Aber sie ist durchaus die Verkörperung geistiger Liebe. Ein Verwirrspiel ohne Ende. Immer Flausen im Kopf. Kaum zu bändigender Wahnsinn, verpackt in einen wunderschönen Menschen mit einem Herzen aus Gold. Eine gestandene selbstbewusste Frau. Meine beste Freundin. Ein echter Kumpel. Mein Venusköpfchen.
»Nun mach mal halblang«, putzt mich Venusköpfchen runter und gibt mir einen Nasenstüber. »Wenn du mich so über den grünen Klee lobst, dann denken die Leser:innen vermutlich, ich sei hässlich wie ein Grottenolm.«
»Grottenolme sind nicht so hässlich, wie du annimmst.«
»Du lenkst ab.«
Venusköpfchen ist also eine schöne Frau.
»Ist das nicht ein bisschen verkürzt?«
Venusköpfchen ist die mit Abstand schönste Frau, die ich jemals gesehen habe.
»Moment – was ist mit dieser Schauspielerin – wie hieß sie doch gleich – Marlene Dietrich?«
»Die Dietrich ist tot.«
Meine Geliebte ist so schön, dass ich sie ununterbrochen ansehen könnte. Punkt.
»Das klingt irgendwie so, als seien wir ein Paar. Dabei sind wir nur Freunde.«
Natürlich sind wir nur Freunde. Beste Freunde. Kumpels. So wie Josef und Maria. Wie Kermit und Piggy. Wie Gitte und Hænning. Wie Ernie und Bert. Alles nur gute Freunde. Wir teilen viel miteinander. Oft den Humor. Nicht die Wohnung. Und nie das Bett.
»Jetzt erzähl mal den Leuten nicht gleich unsere ganze Lebensgeschichte. Du sollst über die Reise nach Kreta schreiben. Mehr nicht. Punkt.«
Und über unsere Begleiter.
»Legst du jetzt los?«
Venusköpfchen steht mit dem gepackten Koffer in ihrer Tür. Ich stehe davor, sehe sie an und stecke das Notizbuch weg, um ihr einen kräftigen Schmatzer auf die Nase zu setzen.
Los geht’s.
»Hallo«, sagt das Schlamm.
»Hallo«, sage ich.
Das Schlamm zieht die Augenbrauen hoch, sieht mir tief in die Augen und rührt mich an.
»Lass das«, sage ich. »Du kannst es so oft versuchen, wie du willst. Du bleibst hier.«
»Was?«, fragt das Schlamm und zieht die Augenbrauen noch höher.
»Hör auf«, sage ich und wende mich ab. »Wir fahren ohne dich nach Kreta.«
»Was?«, wiederholt das Schlamm seine Frage, weil es die vorherige schon wieder vergessen hat.
»Eins«, sage ich.
Das Schlamm schläft auf der Stelle ein und fällt um. Das ist allerdings nicht schlimm, denn erstens ist das Schlamm ganz klein und fällt nicht tief und zweitens besteht es zu fünfundneunzig Prozent aus Polyacryl.
Ruckartig hebt das Schlamm wieder den Kopf. »Du lügst«, blökt es und schläft erneut ein.
Vermutlich sollte ich an dieser Stelle ein paar Worte zum Schlamm verlieren, bevor ein eilfertiger Leser (oder eine Leserin) mit Avancen zum Tierschutz die Polizei ruft. Ein Schlamm ist – obwohl es das natürlich selbst vollkommen anders sieht – ein Kuscheltier. Es ist ein Bündel aus gewebtem Stoff in Beige und Schwarz, zurechtgeschnitten in China, wie das Etikett an seinem Allerwertesten mitteilt, gefüllt mit weißer Watte und einem sandartigen Material im Bereich des Stummelschwanzes, womit es allerliebst wackeln kann. Oben sind zwei sehr kleine Plastikknöpfe sehr nah nebeneinander an den Kopf genäht, die wohl Augen sein sollen.
Aufgewachsen ist das Schlamm in der Stofftierabteilung des Kölner Karstadt zwischen vielen seiner Art, einer ganzen Herde sozusagen, der es zum Behufe einer Schenkung an meine Begleiterin entrissen wurde. Seine damals beste Freundin war eine depressive Stoffgiraffe. Gerda. Die Herde hat es längst vergessen, da sein Kopf bekanntlich mit Watte gefüllt ist und es sich logischerweise nichts merken kann. Fast nichts. Verrückterweise behält es genau die Informationen, die es lieber nicht hätte mitbekommen sollen. Der Kontakt zu der Giraffe brach selbstverständlich damals ab. Hin und wieder fällt dem Schlamm dieselbe ein und es fragt unter Tränen nach Gerda.
Ein Schlamm ist eine ungewöhnliche Kreuzung aus dreiundzwanzig Stunden Schlaf und einem zu klein geratenen Lamm. Über seinen Namen macht es sich niemals Gedanken, denn würde es das tun, würde vermutlich die Watte innerhalb von Sekundenbruchteilen zu einem kleinen hässlichen Klumpen schmelzen. Schade wäre es für das Schlamm – der Umwelt wäre es ein Genuss. Denn dann würde es weniger reden.
Aber da das Schlamm nun einmal da ist, macht es auch keinen Hehl aus seiner Anwesenheit. Die einfachste und effektivste Methode, sich das Schlamm vom Hals zu halten und es vor allem daran zu hindern, unerträglichen Unsinn von sich zu geben, ist, es zu beauftragen, bis drei zu zählen. Da das Gehirn eines Schlamms schnell überfordert ist, fällt es bereits nach der Eins augenblicklich in Tiefschlaf, aus dem es erst dann wieder erwacht, wenn es von einer Fünf träumt. Warum Letzteres so ist, konnte bislang niemand herausfinden. Auch Informationen, wie schnell nach dem Einschlafen ein Schlamm-Traum von einer Fünf heimgesucht wird, entziehen sich derzeit wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Unser Schlamm auf jeden Fall schläft jetzt. So besteht große Hoffnung, die Wohnung verlassen und ins Taxi zum Flughafen springen zu können, bevor es sein Gesicht an das Fenster des Schlafzimmers pressen und bittere Tränen der Verzweiflung vergießen kann oder es sich den Kopf wegen der Hoffnungslosigkeit der Situation am Fensterrahmen blutig schlägt und sich das Herz publikumswirksam aus der Brust reißt.
»Wohin geht ihr?«, fragt das Schlamm und macht mit drei Worten jede Hoffnung auf einen ruhigen Urlaub zunichte. Die Fünf scheint erstaunlich früh im Traum des Schlamms erschienen zu sein.
»Lass es doch mitkommen, Hasenzähnchen«, bittet das Venusköpfchen mitgefühlig. Ein vor Begeisterung wahnsinniges Schlamm-Gesicht blickt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Und da man Venusköpfchen keinen Wunsch ausschlagen sollte, packe ich das wiedererwachte Schlamm an den Ohren und stopfe es in die Tasche.
»Aua, aua, aua, aua«, jammert das Schlamm.
»Ruhe jetzt«, murmele ich, denn ich will keine Diskussion mit dem Taxifahrer darüber führen, ob aus meiner Tasche eine Stimme erklingt, die sich über seine Fahrweise beklagt.
»Ich muss kotzen«, grollt es aus des Venusköpfchens Koffer.
»Oh nein«, meine ich fassungslos. »Das hast du nicht ernsthaft getan.«
Doch. Hat sie. Venusköpfchen hat auch seine Exzellenz, den ehrwürdigen Öwwes mitgenommen. Ich verehre Venusköpfchen wirklich. Ich werde sie stets verehren. Aber ihr Mitgefühl gegenüber sprechenden Stofftieren habe ich nie verstanden. Zumindest nicht immer. Für das Schlamm gibt es handfeste Argumente. Die eng stehenden Augen, der leicht debile Blick, die Naivität und nicht zuletzt der Unterhaltungswert, der sich durch seine Gesprächsfetzen ergibt. Aber bei Öwwes hört mein Verständnis auf. Alles hat seine Grenzen.
Um einen Öwwes zu verstehen, muss man einmal in Köln gewesen sein. Diese Stadt, die sich wie ein Kuhfladen zu beiden Seiten eines schmutzigen Flusses ausbreitet, zugepflastert mit hässlichen Gebäuden zwischen vollbetonierten Plätzen, die keine Plätze im herkömmlichen Sinne sind, angefüllt mit penetrant singenden Eingeborenen, die zwar von der ersten Lebensstunde an in Kopfschmerzen verursachendem Bier eingelegt werden, dabei aber unschlagbar sympathisch sind. Wer hier aufgewachsen ist, der kennt seinen Öwwes. Wer hinzugezogen ist, braucht einen Vermittler. Denn Öwwes ist niemand anderes als ein kleiner Junge, dessen Eltern sich mit der französischen Aussprache des Namens ihres Sprösslings, den sie zwar selbst gewählt, aber nie verstanden haben, schwertun. Yves. Wie der Saint Laurent. Oder der Klein. Oder der Rocher. Und da der Kölner importierte Fremdworte immer so ausspricht, als wären sie dem eigenen Idiom entsprungen, klingt ein Yves eben wie ein Öwwes. Manchmal auch wie ein Üffes. Das ist eine Frage der Rheinseite.
Der gerade in des Venusköpfchens Koffer zu kotzen drohende Öwwes jedoch ist keinesfalls in Köln aufgewachsen. So wie das Schlamm aus China stammt, sind seine Wurzeln in Bangladesch zu finden, worauf er sich einiges einbildet, denn er sieht darin den Beweis, ein Weltenbummler zu sein, ein Seefahrer, ein Marco Polo der besonderen Art, wenn nicht gar einer der berühmten Freibeuter, die die Weltmeere jahrhundertelang mit Angst und Schrecken überzogen. Aber machen wir uns nichts vor: Noch vor einem Jahr saß ebendieser Öwwes in der ersten Etage einer Kölner Shoppingmall, wie es sie zu Tausenden in unserer Republik gibt, mitten unter sorgfältig frisierten Barbies, die nichts als Luft zwischen den Plastikohren haben. Öwwes ist ein Bär. Nicht aus dem Hause Steiff, wie seine adeligen Zeitgenossen, sondern von einer Billigfirma, deren Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue ausgebeutet werden. Vorausgesetzt, das Dach ihrer Fabrik bleibt da, wo es im Sinne des Erbauers sein sollte, und die Essensrationen reichen, um den Energiehaushalt zumindest in den Vierzehn-Stunden-Schichten zu sichern.
Ebenjener Öwwes liegt nun im Koffer des Venusköpfchens, beschwert sich, dass er zu wenig Alkohol habe und dass es viel zu eng sei.
»Wir können den Teddy nun wirklich nicht allein zu Hause lassen. Letzten Sommer hat er meine gesamte Wohnung verwüstet.« Venusköpfchen sieht mich streng an. »Du erinnerst dich?«
Ich erinnere mich.
»Was?«, fragt das Schlamm aus meiner Tasche.
Ich gebe auf. Und hieve den Bären mitsamt seiner augenblicklichen Unterkunft in den Kofferraum des vor der Tür haltenden Mietfahrzeugs, das von einem iranischen Taxifahrer gesteuert wird, und hoffe das Beste. Was auch immer das sein wird.
»Ooooh«, stöhnt Öwwes aus dem Koffer.
»Zum Flughafen«, murmele ich dem Iraner zu, der irritiert in Richtung Kofferraum schaut, und wir steigen ein. »Aber nicht zu schnell fahren. Bitte.«
Der Mann hinter dem Steuer fixiert mich mitleidig.
»Wird Ihnen schlecht?«, will er wissen.
»Nein, mir nicht.«
»Ihrer Frau?«
»Nein.«
»Warum dann langsam fahren?« Die buschigen Augenbrauen ziehen sich in die Höhe wie beim Schlamm. Er lässt den Motor aufheulen.
»Das wollen Sie nicht wissen, glauben Sie mir.«
Das Taxi fährt mit Schwung an.
Öwwes kotzt.
Ankunft
Fünf Stunden später landet der große, lang gestreckte Vogel auf der holprigen Landebahn des Flughafens von Chania im Westen Kretas. Venusköpfchen setzt ihre normale Gesichtsfarbe auf und erlaubt mir, ab sofort wieder über das Geschehen zu schreiben. Fliegen ist offenbar nicht so ihr Ding. In den letzten Stunden hat sie sich bloß an meinen Arm gekrallt und leise vor sich hin gewimmert. Wider ihrer Erwartung hat sie es überlebt. Zum Glück!
In den Koffern ist Ruhe.
»Jamas!«, brüllt Venusköpfchen in die flirrende Hitze und weckt dadurch den ernüchterten Bären.
»Jassas!«, schreie ich hinterher, weil ich sie nicht oberlehrerhaft darüber belehren will, was der Unterschied zwischen einer griechischen Begrüßung und einer ebensolchen Zuprostung zwecks Rakí-Genusses ist. Aber dafür ist es zu spät.
»Klugscheißermodus abstellen!«, brüllt Venusköpfchen doppelt so laut wie vorher.
»Was?«, fragt das Schlamm.
Ich organisiere zwei Bustickets in die Innenstadt. Nicht dass wir dort bleiben wollen, beileibe nicht. Menschen haben wir daheim zu Genüge um uns herum. Ruhe wollen wir diesmal. Und Abenteuer. So lautet der einstimmige Beschluss. Ruhige Abenteuer und abenteuerliche Ruhen sollen es werden. Unten im Süden. Da, wo es keine anderen Tourist:innen gibt. Nur Griechen und Griechinnen und uns. Also erwerbe ich auch noch zwei Tickets in den Süden.
Eine Herde schwedischer Urlauber:innen mit angebrannten Armen und Gesichtern wartet hinter wie Girlanden drapierten Absperrungen darauf, von den jugendlichen Promotionteams auf die Eincheckschalter losgelassen zu werden. Dänische Mittsechziger stopfen sich gierig importierte Zigaretten in den Mund, auf die sie in den vergangenen vier Stunden haben verzichten müssen. Drei minderjährige Berlinerinnen prügeln sich um einen Kofferkuli. Griechische Männer lungern zwischen Taxis herum, lassen klimpernd ihre Komboloi um die Finger kreisen – jene wie Rosenkränze anmutenden Kettchen, die keinerlei religiöse Bedeutung haben.
»Herrlich. So stelle ich mir Grönland vor«, formuliert Venusköpfchen ihre Gefühle, von denen sie mitgerissen wird.
»Griechenland«, korrigiere ich dummerweise.
»Ach, ob nun Ön oder Iechen – das ist doch egal.« Sie wendet sich mir zu. »Jetzt einen Ouzo.« Sie sieht mich durchdringend an, als ich nicht umgehend reagiere. »Ich sagte: jetzt einen Ouzo!«
»Der Bus fährt in acht Minuten.«
»Dann trinken wir den Ouzo eben im Bus«, bestimmt Venusköpfchen, weist energisch auf ihren Koffer, schnappt sich eines der Tickets und stolziert auf die ordentlich nebeneinander abgestellten Busse am Ende des Parkplatzes zu.
Ich habe meine Tasche so gepackt, dass ich jederzeit schnell einen Bus erreichen kann. Aber ich habe wieder einmal vergessen, dass Venusköpfchen darauf verzichtet, sich Gedanken um die anvisierte Himmelsrichtung zu machen. Sie hat also einfach von allem etwas in ihren Koffer gestopft, der jedes Mal zu schwer ist, um ihn problemlos durch den Check-in zu bekommen. Das Ungleichgewicht strapaziert meinen Rücken, doch darauf kann ich jetzt nicht achten, denn das Busticket zwischen den Lippen löst sich allmählich auf.
Das Venusköpfchen ist bereits in ein Gespräch mit dem Busfahrer und seinem Fahrkartenverkäufer verwickelt, als ich um die Stoßstange des Busses biege.
»Da bist du ja«, sagt sie lachend. »Stelios fährt unseren Bus.«
»Jassu Stelios«, bringe ich keuchend hervor, nachdem ich meine Tasche fallen gelassen und das Ticket zwischen den Lippen hervorgezogen habe.
»Wenn du einen Griechen ansprichst, dann musst du das S in seinem Namen weglassen«, rügt mich die Herrscherin.
Sie hat in ein paar Minuten mehr über die griechische Sprache gelernt als ich in vielen Jahren Urlaub auf dieser Insel.
»Jassu Telios«, korrigiere ich mich also und bekomme dafür von der Gefährtin einen Schlag auf den Hinterkopf. Ich lasse ihren Koffer erschöpft auf meine Tasche plumpsen.
»Aua«, beschwert sich das Schlamm.
»Aua«, blafft mich Öwwes an.
»Puh«, stöhne ich.
Venusköpfchen, Stelios und der namenlose Ticketverkäufer sehen mich herausfordernd an.
»To Chania?«, fragt Stelios.
Ich nicke.
»Other side«, sagt er und weist mit der Hand um den Bus herum.
Ich schleppe Tasche und Koffer zur geöffneten Klappe, werfe sie in den vollkommen leeren Laderaum – bei dem es folglich egal wäre, wo sich ein mitzunehmender Koffer befindet –, was natürlich lautstarke Beschwerden aus der Tiefe des Raums nach sich zieht, und taumele zurück zur Tür. Eine kleine Plastikflasche macht soeben die Runde. Das Venusköpfchen gibt mir einen Kuss auf die Nase. Sie riecht wunderbar nach Anis. Wir besteigen den Bus.
Chania. Der staubige Busbahnhof. Aussteigen, quengelndes Gepäck tragen, ein anderer Bus, einsteigen, weiterfahren. Die Nordküste. Hotel reiht sich an Hotel.
»Wohin fahren wir bloß?«, beklagt sich mit ernster Miene das Venusköpfchen. »Wohin bringst du mich?« Kopfschüttelnd stiert sie aus dem Fenster.
Blaue Pools voller dicker Nordeuropäer. Saubere Restaurants mit bunten Fotos auf den Speisekarten, damit die ausländischen Gäste nicht so viel lesen müssen, wenn sie nur essen wollen. Beim Gabi serviert heute Schnitzel mit Pommes und Bratkartoffeln mit Speck. Gamla Stans Restaurang bietet Köttbollar und Jansons Frestelse an.
»Hasenzähnchen«, meint Venusköpfchen besorgt zu mir, »werde ich diese Reise überleben?«
»Sicher«, sage ich. »Vermutlich«, schränke ich ein. »Eventuell«, schiebe ich nachdenklich hinterher.
Zwei britische Sonnenanbeter:innen verirren sich in unseren Bus. Wir wollen sie rauswerfen, mögen sie jedoch nicht anfassen. Die Badehosen, Bikinis und Badetücher sind so hässlich, dass ich befürchte, meine Finger an Ort und Stelle zu verlieren, wenn ich sie damit in Berührung bringe. Darunter: ehemals milchweiße Haut, die nach ein paar Stunden Sonnengenuss tiefrot geworden ist. Der Geruch überparfümierter Sonnenmilch durchströmt kurz meine Nasenflügel, bis ich das Atmen auf den Mund verlege. Venusköpfchen rollt mit den Augen, wackelt mit dem Kopf, nuckelt an der Ouzoflasche, die beinahe leer ist.
»Nein, das kann ich nicht überleben. Ich werde an Augenkrebs sterben.«
»Wir müssen nicht mit Angelsachsen sprechen«, entgegne ich schmunzelnd. »Wir sind in einem sehr gemütlichen deutschen Hotel untergebracht.«
Venusköpfchen sieht mich entsetzt an, versteht meinen Scherz und schlägt mir dann zehn Minuten lang auf den Hinterkopf. Die Rothäute steigen irritiert an ihrer Hotelanlage aus und sehen uns durch die schmutzige Scheibe ratlos an. Venusköpfchen streckt ihnen die Zunge heraus und dreht ihnen eine lange Nase. Der Bus fährt weiter. Bergauf. Endlich.
Die Berge. Kurvige Straßen. Wundervoll. Kleine Dörfer voller uralter Männer und Frauen. Sehr griechisch. Kinder und Jugendliche werden hier nicht angebaut. Was sollen die auch hier tun? Wenn doch einmal neues Leben entsteht, dann purzelt es die Berge hinunter an die Küsten der quer im Mittelmeer liegenden Insel und bevölkert die dortigen Ortschaften. Aber hier oben: nur Alte.
Kakopetros. Mesavlia. Floria. Die Bäume wachsen niedrig, sie streifen den Bus, der mit Vollgas durch die Orte braust. Eine Vollbremsung macht der Busfahrer nur für die schwarz gewandete, runzelige Eingeborene, die mit einem knotigen Stock bewehrt und einer Tüte voll toten Kaninchens in der Hand am Wegesrand steht und dem fauchenden Fahrzeug auflauert. Sie klettert keuchend die steilen Stufen empor, hockt sich auf einen der beiden Sitze vor uns und dünstet aus.
Vor mir Dünstung, neben mit Schnappatmung. Meine Begleiterin muss noch viel lernen, wenn sie sich hier gesund halten will. Der obligatorische Fahrkartenmann trottet auf unsere neue Begleiterin zu, diskutiert eine, zwei, drei Minuten mit ihr, zieht sich dann unverrichteter Dinge wieder zurück. Die Alte hat gesiegt.
Ortswechsel. Die Alte kullert raus, ein Offizieller springt herein. Der Kontrolleur. Selbstverständlich hat uns der Fahrkartenverkäufer längst auf gültige Fahrscheine untersucht. Aber man weiß ja nie, vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Also ein Inspektor. Mein Ticket hat den Aufenthalt zwischen den Lippen nicht gut vertragen, doch es wird akzeptiert. Der kleine Riss wird etwas vergrößert.
Ein Ort weiter: der Kontrolleur des Kontrolleurs. Sie nicken sich freundlich zu, plaudern einen Kilometer miteinander, dann wird gearbeitet, jeder Fahrschein ausgiebig begutachtet. Der Riss wird noch länger. Griechische Fahrkartenkontrolleurkontrolleure erkennen an der Länge eines Risses im Fahrschein die Ernsthaftigkeit ihrer Kollegen.
Kandanos. Plemeniana. Grigoriana. Venusköpfchen sitzt still, blickt aus dem Fenster. Hin und wieder stöhnt sie leise. Eine Weile mache ich mir Sorgen, es gehe ihr vielleicht nicht gut. Doch es scheinen Wohllaute zu sein, die ihren elegant geschwungenen Lippen entströmen. Olivenhaine und üppige Kastanien ziehen an uns vorüber. Die Luft flirrt vor Hitze. In engen Kurven schlängelt sich die Straße durch die Berge.
Eine neue Brücke erscheint in der schmutzigen Windschutzscheibe des Busses. Die engen Schluchten, durch die sich der Bus bis vor einigen Jahren quälte, sind überbrückt. Zugewucherte Restwege im Seitenfenster. Straßenlaternen, wahrscheinlich aus irgendeinem Topf der Europäischen Union finanziert, zieren die Brücke rechts und links. Angeblich sind sie nicht ans Stromnetz angeschlossen. Aber was soll’s, immerhin stehen die hübschen Laternen jetzt da. Und im Moment scheint auch die Sonne, wer braucht da schon künstliches Licht.
Karge Hügel schieben sich ins Blickfeld. Die Macchia. Dornengestrüpp, kilometerweit. Bienenkästen. Einzelne Olivenbäume. Früher, damals, vor langer Zeit war die Insel bedeckt mit Wald. Gewaltige Zypressen und Zedern haben Kreta bevölkert. Wunderbar für den Bau von Schiffen und Häusern geeignet. Unzählige Machthaber kamen und gingen. Sie alle nahmen so viel Holz mit, wie sie tragen konnten. In venezianischen Bauten macht sich kretischer Wald sehr gut.
Kakodiki. Vlithias. Kalamos. Die letzten Orte vor der Küste. Venusköpfchen presst die Nase an die Scheibe. Ruckartig wendet sie sich mir zu.
»Wir müssen den Bus anhalten. Sofort.« Große Augen.
»Nein, das müssen wir nicht.«
»Doch. Das Schaf hat Angst im Dunkeln.«
Sie erhebt sich. Ich ziehe sie auf den Sitz zurück.
»Erstens ist das kein Schaf, sondern ein Lamm, zweitens ist das Ding aus Stoff und verspürt keine Angst und drittens hat es einen dreistündigen Flug überlebt, da wird es auch die Busfahrt überstehen.«
Ich sehe das Venusköpfchen ernst an.
»Im Flugzeug war es tiefgefroren. Da konnte es nichts spüren.« Sie ist wirklich besorgt. »Es weint immer so fürchterlich, wenn es dunkel ist.« Ein leichter Schauer läuft über ihren Arm. »Bitte, halt den Bus an.«
»Wir sind gleich da.«
Zwischen zwei Hügeln öffnet sich eine türkise Fläche. Unter dem strahlenden Himmel, der zum Horizont immer weiter ausbleicht, schwimmt ein anderes Blau. Ein kitschiges, weißes, türkises, grünes Blau. Eines, das uns sagen will, dass es unendlich ist. Das Libysche Meer. Knapp dreihundert Kilometer bis Afrika. Ein Katzensprung. Wir staunen ob der Farben. Plötzlich ist da diese Aufregung. Gleich werde ich an dem Ort sein, den ich für mich gefunden habe. Gleich werde ich die alten Häuser sehen. Und ich werde erfahren, ob meine Gefährtin meine Vorlieben teilt. Ein skeptischer Blick zur Seite. Augen. Strahlend diesmal. Das Schaf ist vergessen. Leichtes Klopfen von unten. Nein, das kann nicht sein. Es ist in einer Tasche, darin kann es nicht klopfen. Das muss der Motor sein.
Paleochora • Παλαιοχώρα • باليوكورا • Παλαιόχωρα • Палеохора • Paleókhora • Palaiochora. Die alte Stadt. Eine Landzunge schiebt sich ins Meer hinein. Das Ortsschild, von der Dorfjugend im letzten Winter mit allerlei Waffen in ein grobes Sieb verwandelt. Eine schmutzige Allee am Ortseingang. Das alte Rathaus. Die schmalen Straßen mit den hohen Bordsteinen. Maulbeerbäume mit weiß gestrichenen Stämmen säumen den Weg. Ein verfallenes Kastell thront über dem Ort.
Der Bus wendet an der Station, parkt zwischen Bäumen und entlässt uns aus der klimatisierten Luft in die kretische Hitze. Venusköpfchen stöhnt laut auf.
»Wasser!«, ruft sie. »Ich verdurste!«
Verdutzt dreht sich ein hagerer Deutscher, der mit uns im Bus saß, um, schüttelt den Kopf, setzt dazu an, etwas zu sagen, wird jedoch von meiner Dame unterbrochen.
»Hallo Sie da, haben Sie Erbarmen. Mein Mann schlägt mich. Ich habe seit drei Tagen nichts gegessen. Und jetzt lässt er mich auch noch verdursten.« Sie schnappt sich den Arm des bemitleidenswerten Herrn, hängt sich bei ihm ein und haucht erneut: »Wasser!«, wobei sie übertrieben lispelt.
»Also so was ...«, schimpft der Behängte, schüttelt sie ab, nimmt seinen Rucksack aus dem Laderaum und stapft davon.
»So, den sind wir los«, sagt Venusköpfchen, marschiert einmal um den Bus herum, wartet darauf, dass ich ihr folge, und zeigt auf unser Gepäck. Gehorsam nehme ich Koffer und Tasche, setze auch meinen Tagesrucksack auf die Schultern, und dann führe ich sie in den Ort ein.
Zimmer mit Aussicht
Jubelschreie begleiten die Zimmerbesichtigung. Das Schlamm führt einen unbändigen Tanz quer über beide Betten auf. Venusköpfchen rennt immer wieder zwischen Zimmer und Balkon hin und her, tut dabei jedes Mal so, als sehe sie den Meerblick aufs Neue. Öwwes zieht sich mit der von der Zimmerwirtin gestifteten Flasche Weißwein in den Kühlschrank zurück, aus dem zunächst ein deutlich vernehmbares Plopp! und dann das übliche Gluckern zu hören ist.
Ich versuche gar nicht erst, die Gemüter zu beruhigen, denn ich bin mir der Heikelei der Situation durchaus bewusst. Wenn ich es wagen würde, einen der drei bei ihren augenblicklichen Unternehmungen zu unterbrechen, dann würden sich die anderen beiden sofort und für die kommenden Wochen mit dem Gerügten verbrüdern. Damit wäre für mich der Urlaub vom ersten Tag an zum Scheitern verurteilt. Ich gehe duschen. So kann ich zwar immer noch die Freudenbekundungen hören, muss jedoch visuell nicht mehr daran teilhaben.
Kurz darauf: Das Schlamm ist zufrieden und schläft, Öwwes schnarcht aus dem Kühlschrank und die gnädige Frau will sich aufbrezeln. Schließlich steht der erste Abend dieser Reise an. Eine Stunde braucht sie. Ich lege derweil meine Socken nach Farben sortiert in die kleine Kommode, wissend, dass Venusköpfchen sowieso die gesamte Schublade für sich beanspruchen wird, hänge die Oberhemden auf Bügel, obwohl ich nicht sicher sein kann, ob das Schlamm diese als Schaukeln erkennen und dann natürlich alle Hemden zerknittern wird, und drapiere Sonnencreme und Aftersun auf meinem Nachttisch, wenngleich die Frau darauf bestehen wird, die Betten zusammenzuschieben, damit mehr Gemütlichkeit aufkommt. Die Dame steht nämlich auf Gemütlichkeit wie sonst keine. Sie kommt zwar aus Norddeutschland, wo man bekanntlich mit der Gemütlichkeit eher auf Kriegsfuß steht und gerne mit Gummistiefeln zu Bett geht, aber irgendein süddeutsches Gen muss sich bei ihr doch eingeschlichen und das System durcheinandergewürfelt haben.
Der Ausmarsch. Die Treppe runter, rechts um die Ecke, zur Straße, die direkt am Wasser entlangführt. Wir wohnen im antiken Teil der Stadt. Des Ortes. Des Dorfes. Hierher hat es in erster Linie die Alten von der Insel Gavdos verschlagen, die seinerzeit auf dem vorgelagerten Eiland nicht mehr leben durften. Sie haben ihre Architektur mitgebracht und damit weite Teile Paleochoras geprägt: niedrige, einetagige Hütten aus grob gemauertem Stein, mit kleinen Eingängen und winzigen quadratischen Fensterhöhlen, nach Gavdos ausgerichtet, damit die Menschen jeden Morgen als Erstes ihre ehemalige Heimat sehen konnten. Manche der Hütten sind sandfarben getüncht, viele im Grau der Felsen. Die Erde um die Behausungen ist rot, beinahe so intensiv wie in Afrika. Das ganze Dorf erinnert vielerorts an den nahe gelegenen Kontinent.
Das Meer schlägt seicht an die Felsen, die als Wellenbrecher unterhalb der Straße im Wasser liegen. Vor uns erstreckt sich die schroffe Küste Kretas bis zum Horizont. Beinahe senkrecht fallen die Gesteine in die See hinab, sind umsäumt von türkisen Wellen. Zum Inland hin erheben sie sich viele Hundert Meter hoch. Jede Bergkette ist in der Entfernung von einem zusätzlichen Schleier aus Dunst verhangen, bis der Übergang zwischen Wasser, Bergen und Himmel schließlich nicht mehr auszumachen ist. Im Südosten liegt majestätisch der feuchte Traum aller Paleochora-Individualist:innen: Gavdos. Das Eiland im unendlichen Wasser. Daneben Gavdopoula. Winzig, unbewohnt und auf die Entfernung kaum zu erkennen.
Staunend lauscht Venusköpfchen meinen Ausführungen zu den nahen Inseln, die so unerreichbar sind wie eine Sahnetorte im Schaufenster einer geschlossenen Konditorei. Und sofort begeistert sich meine charmante Begleitung für eine Überfahrt, will sich erkundigen, wann die Boote fahren. Ich winke ab und berichte ihr von den furchtbaren Sitten der Bewohner.
»Vor langer Zeit lebte ein Mann auf Gavdos, der sein Lebtag nicht viel mehr tat, als zu trinken. Da beschlossen seine Freunde und Nachbarn, ihn von seinem Fluch auf die denkbar grausamste Weise zu heilen: Sie setzten ihn mit Wasser und Paximadi, dem Knäckebrot der Kreter, auf Gavdopoúla aus und versprachen, ihn nach vier Wochen wieder abzuholen. Der Mann beschimpfte seine Folterknechte auf das Ausführlichste, doch die ließen sich nicht beirren und ließen ihn zurück. Vier Wochen gingen ins Land, jeden Tag fragten sich die Männer, ob ihr Freund das Martyrium wohl überleben werde. Schließlich war die Zeit um und sie machten sich auf den Weg, um ihn zurück in die Gemeinschaft zu holen. Wie mussten sie sich wundern, als sie ihn, den Ausgesetzten, fröhlich winkend und vollkommen besoffen auf dem kleinen Eiland vorfanden. Wie sich herausstellte, war eine Weile zuvor ein Schiff südlich der Insel gekentert. An Bord hatte es unter anderem beste französische Weine geladen. Zwei der Fässer hatte es nach Gavdopoúla verschlagen. Der Einsame hatte sie mit Genuss bis zur Neige geleert.«
»Die haben ihn wirklich ohne Wein oder Ouzo auf der Insel ausgesetzt?«, erkundigt sich die Gattin besorgt. »Das ist unhöflich ...«
»Archaische Sitten gehören hier auch heute noch zum Alltag.«
Venusköpfchen schüttelt verwundert den Kopf, schmiegt sich an meine Schulter und bittet darum, zum Essen ausgeführt zu werden. Ich willige ein.
Bei Anastasia
An der Promenade reihen sich die Restaurants aneinander, Kellner stehen Spalier, locken die Gäste in ihre Höhlen, um ihnen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Die Fähre aus Sougia gleitet schwerelos als kleiner Punkt um die Spitze des Krokodils, den Felsen, der seinen Namen wegen seiner an das Reptil erinnernden Form erhalten hat. Wir studieren die Speisekarten auf der Suche nach einer Gaumenfreude, die uns zufriedenstellt.
Restaurants mit Fotos auf den Karten kommen für Venusköpfchen auf keinen Fall infrage. Auch keine, in denen nur Touristen sitzen. Griechen müssen da sein. Mindestens einer. Ist aber keiner da, denn die echten Hellenen gehen nicht vor neun Uhr essen. Und es ist erst halb acht.
»Was das Schäfchen wohl macht?«, lenkt Venusköpfchen kurz ab. Ich traue mich, die Frage zu ignorieren. Heute ist unser kinderfreier Abend.
Zu guter Letzt wird in einem Lokal eingekehrt, das von einer fantastisch lachenden Frau mittleren Alters geleitet wird. Griechen sind zwar auch hier nicht, aber in die Küche bittet man uns, zeigt uns die Töpfe und öffnet die Deckel. Gefüllte Auberginen und Tomaten duften in einer Vitrine. Zucchiniblüten gefüllt mit Reis lachen mich an. Moussaka wartet darauf, aufgewärmt zu werden. Dann öffnen sich die Geschmacksknospen beim Anblick einer großen Auflaufform.
»Goat Stifado«, lacht die Wirtin, die sich als Anastasia vorstellt.
»Herrlich«, jubiliert Venusköpfchen.
»Vorzüglich«, lache ich.
Aber keine Chips dazu. Lieber die Zucchiniblüten. Und Salat. Und Zaziki. Und natürlich griechischen Wein. Nicht den fiesen geharzten. Den Landwein. Weiß. Wunderbar. Hinsetzen.
Blick aufs Meer. Ruhe. Das Boot wird allmählich größer. Wellen versuchen immer wieder, es aus dem Gleichgewicht zu bringen, doch es schippert tapfer weiter auf die Mole des kleinen Ortes zu. Fischer fahren aufs Wasser hinaus, versenken Netze, kehren heim. An den Nachbartisch setzt sich ein Paar, das schon optisch als durch und durch deutsch zu erkennen ist: Er trägt ein überaus hässliches groß geblümtes Hemd, braune Socken in Wandersandalen unter käsigen Beinen in viel zu kurzen Hosen. Sie ein zu eng geschnürtes Wickelkleid unter tiefen Tränensäcken. Die beiden schweigen über den Speisekarten. Von ihnen geht eine düstere Trostlosigkeit aus, die mich an entfernte Verwandte erinnert, die den Spaß aus ihrem Leben vertrieben haben. Cousinen meines Vaters und deren Sippschaft. Gelangweilt und gottesfürchtig. Mit bunten Hemden und engen Kleidern, so möchte ich dem Paar am Nachbartisch zuwerfen, vertreibt man nicht die Langeweile aus dem Leben. Das gelingt nur, wenn man sich in das Leben selbst stürzt und es mit Schafen und Bären und Venusköpfchen bevölkert. Schlagartig wird mir klar, dass da neben uns die Verkörperung meiner größten Angst sitzt. Ich wende die Augen schnell ab und erkenne, dass die Dame meine Empfindungen uneingeschränkt teilt. Und sie hat ein bewährtes Mittel gegen die Langeweile des Lebens in petto: den klassischen Konfrontationszynismus. Mit nichts anderem sollte ich bei ihr rechnen.
Venusköpfchen befördert aus der Tiefe ihrer Tasche ein kleines Büchlein hervor, legt es auf den Tisch. Schloss Gripsholm. Was Intellektuelles. Der Wein wird lachend gebracht.
»Pass auf, die sprechen uns gleich an«, murmelt Venusköpfchen sich zu mir vorbeugend und verdreht die Augen zu unseren Nachbarn.
»Er ist Lehrer an einer Waldorfschule und sie ist Sekretärin beim Verfassungsschutz«, füge ich hinzu.
»Nein, nein, nein! Sie leiten zusammen eine vegane Pizzeria in Wuppertal«, verbessert mich meine Begleitung.
»Wieso sollten die uns ansprechen?«
»Er schielt schon zu meinem Buch herüber, um zu erfahren, welchen Landes Leute wir sind.«
Und wie fast immer behält sie recht.
»Ach, das ist lange her, dass ich den Tucholsky gelesen habe«, sagt der Waldorflehrer laut und nickt Venusköpfchen zu. »Man trifft heute ja kaum noch Leute, die anspruchsvolle Literatur lesen. Die meisten wollen ja nur noch billig unterhalten werden. Wir lesen zurzeit wieder die Joseph-Romane von Thomas Mann. Die sind natürlich nicht für jedermann. Aber man darf sich ja nicht von der Unterhaltungsindustrie dominieren lassen. Gefällt es Ihnen in Pale?«
»Wir sind zufrieden, vielen Dank«, antworte ich, weil ich einen Eklat verhindern möchte. Aber es ist zu spät. Venusköpfchen wendet ihr Venusköpfchen zur Seite und lächelt dem Herrn am Nachbartisch freundlich zu. Auf Übergriffigkeiten wie seine reagiert sie höchst empfindsam.
»Sie kennen sich bestimmt in diesem Ort gut aus«, nimmt sie das Gespräch auf. »Wo bitte bekomme ich denn so ein Polyester-Oberhemd, wie Sie es tragen? Mein Mann möchte sich im Urlaub mal so richtig gehen lassen.«
»Ach, das habe ich vor zehn Jahren hier auf der Hauptstraße bei Jannis gekauft«, antwortet der Herr, erfreut über die gelungene Kommunikation. »Den Laden gibt es leider nicht mehr. Da sind jetzt diese Chinesen mit den Billigklamotten drin.«
»In Pale hat sich so viel verändert in den letzten dreißig Jahren«, pflichtet ihm seine Frau bei, wobei ihr Kopf eigenartig hin und her wackelt. »Nicht mehr die Ruhe wie früher. Jetzt kommen schon die Russen.«
»Wirklich?« Venusköpfchen mimt Entsetzen. »Die Russen sind jetzt aber auch überall, gell?«
»Woher kommt ihr denn, wenn ich mal so frech fragen darf?«, fragt der Herr frech und wechselt dabei ins freundschaftliche Du, ohne das Venusköpfchen um Erlaubnis gebeten zu haben. Ein grober Fehler. »Ich bin der Klaus aus Hamburg.«
»Ich bin Gabi«, sagt Gabi ihr Glas erhebend. »Wir kommen schon seit zweiunddreißig Jahren hierher und wollen gar nicht mehr an einen anderen Ort.«
»So ein Zufall«, lacht Venusköpfchen spitz auf. »Wir sind auch aus Hamburg. Ich bin die Ulrike und das hier ist mein Verlobter Markus.« Sie deutet hinter sich, also auf mich. Meine Angebetete hat mir im Laufe unseres gemeinsamen Seins schon viele Namen gegeben. Je nach Stimmung waren es Kosenamen oder Beschimpfungen. Eine reine Bürgerlichkeit ausstrahlende Benennung hat sie mir jedoch noch nie zugewiesen.
»Jaja, die Welt ist klein«, sprudelt es aus Gabi heraus. Ich registriere ihren Impuls, sich zu erheben und zu uns herüberzukommen. Und ich bete darum, dass sie es bleiben lässt. Sonst wird sie diesen Abend nie wieder vergessen. Venusköpfchen hasst es, von Fremden angequatscht zu werden. »Was macht ihr denn beruflich? Vielleicht gibt es ja Überschneidungspunkte in unseren Leben.«
»Das glaube ich nicht«, erwidert meine Dame. »Mein Mann arbeitet bei den Finanzbehörden als Sachbearbeiter der Buchstaben Di bis Do. Und ich selber bin Ohrenbärbändigerin beim Malayischen Wanderzirkus.« Sie macht eine bedeutungsschwere Pause. »Kennen Sie den zufällig?«
»War der nicht neulich im Fernsehen? Ich habe da eine Dokumentation über chinesische Künstler gesehen. Die sahen allerdings gar nicht chinesisch aus. Und ich gucke natürlich sonst kein Fernsehen. Das ist ja alles nur noch Mist. Höchstens mal einen Naturfilm oder eine Sendung auf Arte. Alles andere ist widerlich. Diese privaten Sender zeigen ja bloß Sendungen, wo sich die Leute gegenseitig anschreien und dann ausziehen. Ich sage meinem Mann immer: Das ist pure Pornografie ist das.« Gabi holt kurz Atem. »Welche Tiere bändigst du denn?«
»Zurzeit habe ich eine Dressurnummer mit einem Braunbären und einem Schaf.«
»Ach ...«
»Leider muss ich das Schaf ständig neu dressieren, weil es seine Aufgaben immer wieder vergisst.«
»Eins«, werfe ich kurz ein.
»Chrrrrr«, schnarcht Venusköpfchen und lässt den Kopf sinken.
Die Ziege unter Zucchiniblüten rettet Gabi und Klaus das Leben. Ein Satz mehr und Venusköpfchen hätte den Verstand verloren.
»Fünf«, sage ich schnell, als das Essen auf dem Tisch landet. Ich trinke einen großen Schluck griechischen Wein.
»Dürfen wir uns zu euch setzen?«
Das ist die dümmste Frage, die Gabi einfallen konnte. Sitzt sie doch schon mit ihrem Wickelkleid auf der geflochtenen Sitzfläche des kretischen Stuhls, platziert ihr Weinglas neben dem leer geleckten Teller des Venusköpfchens und greift zu meinem Entsetzen nach deren Kette, die an den letzten Helgolandurlaub mit ihrem Verflossenen erinnert.
Diese Kette zu berühren ist niemandem erlaubt. Sie ist heilig. Geradezu seliggesprochen. Schließlich war der Verflossene eine magische Gestalt von unergründlicher Tiefe. Schauspieler an irgendwelchen Theatern. International versteht sich. Hochgelobt. Viel geehrt. Nur leider nicht vertrauenswürdig. Sagt zumindest das Venusköpfchen. Die flachen weißen Steine für die Kette hat er eigenhändig gesammelt, mit Schaumwein zur Mitternacht gespült, in einer dunklen Werkstatt durchbohrt, auf eine am Strand gefundene Kordel gezogen, die sicherlich dereinst mit einer herrschaftlichen Schaluppe den Äquator überquerte. So hat er es ihr erzählt, als er sie ihr nach vollzogenem Akt in den Dünen um den schlanken Hals legte. Danach ist er verschwunden, hat die umschmeichelte Dame zwischen den steilen Felsen ihrer Einsamkeit zurückgelassen und ward fortan nicht mehr gesehen. Zumindest nicht von meiner Angebeteten. Die Begegnung war kurz. Kaum drei Wochen. Und doch hat sie nachhaltig Eindruck hinterlassen. Bei Venusköpfchen. So sehr, dass die Kette zum wichtigsten Utensil ihrer äußeren Dekoration wurde. Sie zu berühren ist ein Sakrileg, das ich nur einmal unternommen habe, nicht wissend, welche Folgen es haben würde.
Heute lächelt Venusköpfchen, als Gabi die Finger ausstreckt. Ich sehe die Augen aufblitzen. Klaus präsentiert seinen ausgefallenen Kleidungsgeschmack auch an unserem Tisch, hebt mir ein Glas Rakí entgegen, das ich schnellstens herunterspüle, um ja nichts von dem zu verpassen, was sich nun abspielen wird.
Venusköpfchen neigt das Haupt ihrer Geschlechtsgenossin zu, lächelt, säuselt.
»Ist sie nicht wunderschön?«
»Sie ist traumhaft. Hast du die Steine selber gesammelt?«
Eifrig nickt die Gattin, nimmt einen tiefen Schluck aus ihrem Weinglas, lässt es sanft auf die Tischdecke gleiten, zwinkert mir kurz zu und hebt an.
»Das war damals nach dem schlimmen Unfall, bei dem mein Mann und meine Zwillinge ums Leben kamen.«
Gabi zieht die Augenbrauen hoch, Interesse bekundend, nicht ahnend, dass sie in eine Katastrophe läuft, nickt mitleidig.
»Wir waren zu der Zeit beim ugandischen Staatszirkus angestellt und reisten durch die kleinen Orte westlich des Victoriasees. Dschungel, Savanne, Elefanten, Löwen, Giraffen, Tiger und haitianische Riesenleguane haben nachts an unserem Wohnwagen gekratzt. Mein Mann hat sie alle immer vertrieben. Er war Raubtierbändiger und brauchte den wilden Tieren nur zuzuflüstern, seine Kinder schliefen – schon verschwanden sie in der Dunkelheit.« Ein Griff zur Weinkaraffe, das Glas gefüllt, an den Mund gesetzt, die Stimme geschmiert. Und weiter. »Eines späten Tages schabte wieder etwas an der Tür. Mein Mann öffnete, sprach eine Weile in die Finsternis und dann wandte er sich zu mir herum. Die Geister der Savanne brauchen meine Hilfe, sagte er. Seine Großmutter hatte ihm die Kommunikation mit den Erscheinungen seiner Welt vermittelt. Er war Afrikaner, Ruander. Denen liegt das im Blut. Auf jeden Fall bestand er darauf, unsere Jungs mitzunehmen. Die Zwillinge. Ich habe ihm vertraut. Und er hat den Geistern vertraut. Die Tür schloss sich hinter meiner Familie und ich blieb allein zurück. Lange habe ich auf die Geräusche aus der Wildnis gelauscht. Ich habe Schreie gehört, Feuer knisterte irgendwo hinter dem Wohnwagen. Unheimlich Gestalten zogen am Fenster vorbei. Nach ungezählten Stunden war es beendet. Stille. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also bin ich nach draußen getreten. Meine Söhne und mein Mann warteten schon auf mich. Vor der Tür. Genauer gesagt: Ihre Köpfe warteten. Ihre Körper sind nie gefunden worden. Die Geister werden sie mitgenommen haben. Nur die Häupter haben sie mir gelassen. Sie sahen mich mit ihren trüben Augen an, die Münder zu Fratzen verzogen, und waren stumm.« Die Zähne habe sie aus den Kiefern ihres Mannes und der Zwillinge vorsichtig herausgelöst und geschliffen, ergänzt mein Venusköpfchen, und lässt die flachen weißen Steine gedankenverloren durch die Finger gleiten.
Gabi zieht entsetzt die Hand zurück.
»Das ist Afrika. Dort ist alles immer noch so eng verbunden mit der Natur. Wenn ich diese Kette trage, dann habe ich das Lächeln meiner Kinder stets bei mir.«
Ich frage mich schon lange, woher das Venusköpfchen die vielen Ideen für ihre Geschichten nimmt. Kaum ein Tag vergeht, an dem sie sich nicht etwas Skurriles ausdenkt und den Lebewesen in ihrer Umgebung erzählt. Nicht immer haben die Menschen dabei Glück. So geht es auch gerade Gabi, die einen tiefen Schluck aus ihrem Weinglas nehmen muss, bis sie sich in der Lage sieht, wenigstens zu nicken. Klausens Unterkiefer befindet sich in einer recht debil wirkenden Pose, als seine Angetraute ihn am Arm fasst und den Vorschlag macht, langsam zu Bett zu gehen.
Venusköpfchen hat ein bisschen zu viel Wein getrunken.
Erster Tag
Der erste Abend am Urlaubs- und Entspannungsort meiner Wahl ist glimpflich zu Ende gegangen. Die Dame meines Vertrauens hat ihr Bett aus eigenem Antrieb gefunden und die Tiere schliefen glücklicherweise schon, als wir die Köpfe auf die Daunen respektive die mit Baumwollresten gefüllten Kopfkissenersatzstücke legten.
Und nun? Jetzt tagt ein neuer Tag. Sonne, wohin man schaut. Venusköpfchen hat heute einen Venuskopf. Sie grummelt vor sich hin, während sie die Spuren der Nacht aus ihrem hübschen Gesicht entfernt. Und eine Stunde später sitzen wir im nicht gerade üppigen Schatten einer Tamariske auf der Terrasse des nahen Cafés. Schlamm und Öwwes haben wir im Zimmer gelassen – man wird doch noch in Ruhe frühstücken dürfen.
Venusköpfchen will typisch kretisch speisen. Ich versuche, sie davon abzuhalten, empfehle ihr die hervorragenden Spiegeleier des Cafébetreibers Nikos, aber sie lächelt nur milde.
»Spiegeleier?« Sie schmunzelt noch einen Moment. Dann verzieht sich ihr Gesicht zu einem schmerzverzerrten Irgendwas. »Bist du von allen guten Geistern verlassen?«
Gelassen steht Nikos neben ihr und grinst.
»Ich will das essen, was die Kretarier auch essen. Und zwar pronto.« Sie wendet sich Nikos zu.
»I’d like to take some classical Cretan food for breakfast.«
»Dann empfehle ich Ihnen Dakos. Typischer geht es nicht.«
Ich nehme die Spiegeleier. Mit getoastetem Brot. Nikos verschwindet in seiner Küche und brutzelt.
»Warum sagst du mir denn nicht, dass der Deutsch kann.«
»Du hast mir keine Gelegenheit dazu gegeben.«
»Und warum sind wir eigentlich in einem Café, in dem man Deutsch spricht?«
»Das Gasthaus war schon vorher da.«
»Vor was?«
»Vor Claudia.«
»Wer ist Claudia?«
»Die Frau von Nikos.«
»Wer ist Nikos?«
»Du hast gerade bei ihm Dakos bestellt.«
»Und was hat Claudia damit zu tun?«
»Sie kommt aus Freiburg, also eigentlich aus Elmshorn, aber zuletzt aus Freiburg.«
»Und was macht die hier?«
»Die arbeitet hier. Im Café.«
»Ach.«
»Einmal die Dakos.« Ein Teller landet vor Venusköpfchen. »Und einmal die Spiegeleier. Kali orexi.«
Nikos nickt freundlich und verschwindet wieder.
»Was sollte das denn jetzt?«, will mein Venusköpfchen wissen. »Callis anorexie – was heißtn das?«
»Guten Appetit.«
»Und was hat das mit Rainer Calmund zu tun?«
»Nichts.«
»Kann man das wirklich essen?« Jetzt hat sie entdeckt, was da auf ihrem Teller liegt. »Sieht aus wie Zwieback mit Tomatenpampe, Paprika und Schafskäse.