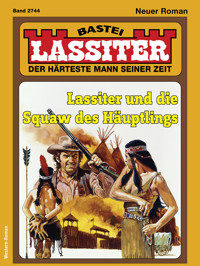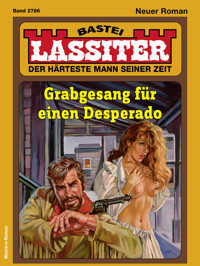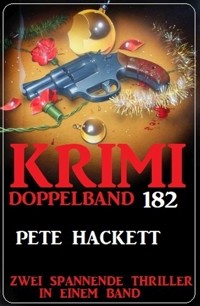
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Trevellian - Verschollen in Chinatown (Pete Hackett Trevellian und das Internat der Mörder (Pete Hackett) Richard Kirtland führt ein exklusives Internat. Nur die Elite des Landes lässt ihre Kinder in seiner Schule ausbilden und erziehen. Als einer der Schüler eines Nachts bei ihm anruft, um ihm mitzuteilen, dass sein Zimmergenosse gerade an einer Überdosis Heroin gestorben ist, denkt Kirtland deshalb zuerst an den Ruf seiner Schule. Mithilfe des Anrufers bringt er den Toten in eine Bauruine. Tatsächlich wird der Schule keine Aufmerksamkeit geschenkt, aber vier Monate später gibt es wieder einen Toten und jetzt kommt das FBI ins Haus, denn es handelt sich um einen Mord.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett
Krimi Doppelband 182
Inhaltsverzeichnis
Krimi Doppelband 182
Copyright
Trevellian – Verschollen in Chinatown: Action Krimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Trevellian und das Internat der Mörder
Krimi Doppelband 182
Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian - Verschollen in Chinatown (Pete Hackett
Trevellian und das Internat der Mörder (Pete Hackett)
Richard Kirtland führt ein exklusives Internat. Nur die Elite des Landes lässt ihre Kinder in seiner Schule ausbilden und erziehen. Als einer der Schüler eines Nachts bei ihm anruft, um ihm mitzuteilen, dass sein Zimmergenosse gerade an einer Überdosis Heroin gestorben ist, denkt Kirtland deshalb zuerst an den Ruf seiner Schule. Mithilfe des Anrufers bringt er den Toten in eine Bauruine. Tatsächlich wird der Schule keine Aufmerksamkeit geschenkt, aber vier Monate später gibt es wieder einen Toten und jetzt kommt das FBI ins Haus, denn es handelt sich um einen Mord.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER TONY MASERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian – Verschollen in Chinatown: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 118 Taschenbuchseiten.
Der Handel mit geschützten Tieren ist äußerst lukrativ, das gilt besonders für Nashorn-Produkte. Bei einer Ermittlung wegen illegalen Glücksspiels werden die FBI-Agenten Trevellian und Tucker darauf aufmerksam, eine Chinesen-Mafia scheint dahinterzustecken. Weil es um viel Geld geht, sind die Leute skrupellos und gehen wortwörtlich über Leichen – auch die der beiden Agenten.
1
Wir hatten den Club Andalusia in der Lower East Side umstellt. Die Kollegen vom New York Police Department leisteten uns Schützenhilfe. Es waren ein ganzes Dutzend Beamte, die man uns zur Verfügung gestellt hatte.
Von einem V-Mann hatten wir erfahren, dass in dem Club illegales Glücksspiel betrieben wurde.
Wir waren wieder einmal gefordert. Aber solche Einsätze waren fast alltäglich. Ob nun illegales Glücksspiel, Prostitution oder Drogenhandel der Grund für eine Razzia war – wir verfügten über die entsprechende Routine.
Der Chef des Clubs hieß Antonio Benito und war Italoamerikaner.
Ich leitete den Einsatz und stand per Headset mit Police Lieutenant Coburn in Verbindung. Es war 23 Uhr vorbei. Der Hof des Etablissements war von Polizei besetzt. Bei dieser Gruppe befand sich Milo Tucker. Auch mit ihm konnte ich Verbindung aufnehmen.
Die Neonschrift über der Eingangstür des Clubs warf rote Lichtreflexe auf den Gehsteig und die Fahrbahn. Am Straßenrand parkten die Autos dicht an dicht. Hin und wieder fuhr ein Fahrzeug vorüber. Wir befanden uns in der Water Street und das war keine Hauptverkehrs- sondern eine stille Nebenstraße, wobei ich still im Zusammenhang mit dem Verkehrsaufkommen meine. Ansonsten gab es ein halbes Dutzend Bars und Discotheken in dieser Straße, und dort ging es alles andere als still zu.
In der ersten und zweiten Etage des Gebäudes waren vor den Fenstern sämtliche Jalousien heruntergelassen. In diesen beiden Stockwerken sollten – den Ausführungen unseres V-Manns entsprechend – die illegalen Spielhöllen betrieben werden.
»Fertig?«, fragte ich.
»Ja. Wir sind bereit«, kam es aus dem Lautsprecher meines Headsets. Es war Police Lieutenant Coburn, der antwortete.
»Also dann, Zugriff!«, gebot ich.
Wir drangen gleichzeitig von vorne und von hinten in das Gebäude ein. Die Ausgänge wurde gesichert. In der Bar rief ich: »Das ist eine Razzia. Halten Sie Ihre Ausweise oder Führerscheine bereit.«
An der Theke traf ich mich mit Milo und Jack Coburn. »Ich habe zwei Mann bei der Treppe zum Obergeschoss postiert«, erklärte Milo.
»Gehen wir hinauf!«, sagte ich.
Hier unten war unsere Anwesenheit nicht vonnöten. Die Gäste würden überprüft werden, und wer nicht gerade zur Fahndung ausgeschrieben war oder noch eine weiße Nase vom Koksen hatte, hatte nichts zu befürchten.
Im Treppenhaus brannte Licht. In dem kleinen Flur, der bei der Hintertür endete, gab es drei Türen. Zwei führten in die Toiletten, die Dritte war verschlossen. Ein Blick durch das Schlüsselloch sagte mir, dass es in dem Raum finster war.
Wir stiegen die Treppe nach oben. Es gab dort eine Wohnungstür. Sie war geschlossen. Wahrscheinlich hatte man hier oben von der Razzia noch gar nichts mitbekommen.
Milo legte seinen Daumen auf die Klingel. Und es dauerte keine drei Sekunden, dann wurde die Tür geöffnet. Ein rothaariger Bursche mit Bürstenschnitt und den Schultern eines Mister Olympia füllte das Türrechteck aus. »Was wollt ihr?«, fragte er unfreundlich. »Diese Räume sind Privat und …«
Mir war klar, dass man hier nicht so ohne Weiteres reinkam. Da wir Zivilkleidung trugen, war davon auszugehen, dass uns der Bursche für Zocker hielt, die einen Tipp bekommen hatten, die aber nicht – aus welchen Gründen auch immer – willkommen waren.
Als ich aber meine ID-Card zückte und sie dem stiernackigen Rotschopf vor die Nase hielt, wurden seine Augen weit. Er verschluckte sich, grunzte eine Verwünschung, trat schnell zurück und wollte die Tür zuwerfen, doch ich stellte meinen Fuß hinein und so schwang das Türblatt wieder auf. Der Muskelmann wollte sich herumwerfen.
Ich schnappte ihn am Hemdkragen. »Moment!«, stieß ich hervor. »Nicht so schnell. Lassen Sie uns auch mitkommen.«
Der Bulle war von mir zurückgerissen worden, jetzt warf er sich herum und schlug nach mir. Ich duckte mich, und die Faust radierte über meinen Kopf hinweg. Wenn er mich getroffen hätte, würde er mir sicher das Nasenbein zertrümmert haben.
Mit einem Fußfeger holte ich den Burschen von den Beinen. Damit hatte er nicht gerechnet. Ich erkannte es an seinem erschrecken Gesichtsausdruck, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor, gegen die Wand fiel und sich dann lang auf den Boden legte. Ein erschreckter Laut entrang sich ihm. Er fand nicht einmal die Zeit, sich mit den Armen abzufangen.
Milo bückte sich und bog Mr. Rotkopf den linken Arm auf den Rücken. Eine Handschelle klickte, im nächsten Moment die zweite und der Türsteher, oder als was er auch immer fungierte, war schachmatt gesetzt. Milo und Coburn stellten ihn auf die Beine. Er atmete stoßweise durch die Nase, wenn Blicke töten könnten, wäre ich jetzt tot umgefallen.
Das alles innerhalb weniger als einer halben Minute abgelaufen.
Wir befanden uns in einem schmalen Flur, der gut fünf Yards lang war. Links und rechts zweigten Türen ab. Von der Apartmenttür aus hatten wir keinen Einblick in den dahinterliegenden Raum. Aber auch wir konnten nicht gesehen werden. Und unsere kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Gorilla war fast lautlos vonstatten gegangen. Bei den wenigen Geräuschen, die zu vernehmen gewesen waren, war kaum zu befürchten, dass jemand in dem ehemaligen Apartment die richtigen Schlüsse gezogen hatte. Die Kerle waren sicher auch viel zu sehr in ihr Spiel vertieft.
Stimmengemurmel war zu vernehmen. Ich glitt bis zur Ecke des Flures und konnte einen Blick in das ehemalige Wohnzimmer der Wohnung werfen. Da standen fünf Tische. Um jeden saßen Männer herum. Lampen, die über den Tischen von der Decke hingen, sorgten für Helligkeit. Zigarren- und Zigarettenrauch wogte dicht und hing in Schlieren um die Lampen.
Die Kerle spielten Karten. Vor jedem von ihnen lagen Bündel von Dollarnoten und stapelten sich Münzen. Soeben sagte einer der Männer. »Noch eine Karte.« Irgendwo erscholl ein Fluch, dann klatschte ein kleiner Packen Karten auf den Tisch. »Heute ist nicht mein Tag!«, schimpfte einer der Zocker.
Jetzt sah man uns. Milo und Coburn waren neben mich getreten. Nach und nach richteten sich die Augen aller Anwesenden auf uns. Im Raum herrschte plötzlich Atemlosigkeit.
»FBI New York!«, rief ich in die eingetretene Stille hinein. »Bleiben Sie auf Ihren Plätzen und legen Sie die Hände auf den Tisch.«
Jack Coburn sprach jetzt leise in sein Mikrofon.
Einige Polizisten, die Coburn in die erste Etage beordert hatte, erschienen. Zwei von ihnen übernahmen den Rotschopf und führten ihn ab. Wir überließen den Kollegen das Feld und stiegen hinauf in die zweite Etage.
Dort bot sich uns ein ähnliches Bild. Einige der Spieler wanden sich wie Würmer, wenn wir ihre Ausweise sehen wollten und ihre Namen erfassten. Gewiss war so manche treusorgende Ehefrau der felsenfesten Überzeugung, dass ihr Mann in einer geschäftlichen Angelegenheit unterwegs sei oder an seinem Arbeitsplatz Überstunden schob. In Wirklichkeit gab er sich dem zwielichtigen Vergnügen des Glücksspiels hin.
Die Türsteher und den Geschäftsführer führte man in Handschellen ab. Die Spieler wurden in Gruppen aus dem Gebäude gebracht und in Transporter dirigiert, die sie zum Police Department brachten, wo sie verhört werden sollten.
Milo, Jack Coburn und ich fuhren nach Clinton in die 55. Straße, in der Antonio Benito eine komfortable Penthousewohnung besaß. Ihn festzunehmen war nur eine Formsache. Wir holten ihn aus dem Bett. Das Girl, das er bei sich hatte, war entsetzt und weinte.
Benito brachten wir ins Field Office, wo wir noch in der Nacht verhörten. Wir mussten auch ein Verhaftungsprotokoll anfertigen. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach seiner Verhaftung hatte Antonio Benito nämlich das Recht auf eine Anhörung, anlässlich welcher der Haftrichter zu entscheiden hatte, ob er in polizeilichem Gewahrsam bleibt oder gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt wird. Unser Protokoll sollte dem Richter als Entscheidungshilfe dienen.
Benito hatte das Recht zu schweigen. Davon machte er Gebrauch. Das heißt nicht, dass er den Mund gehalten hätte. Er beschimpfte uns und verlangte lautstark nach seinem Rechtsanwalt. Also ließen wir ihn abführen und in Gewahrsam nehmen.
Dann telefonierte ich mit Jack Coburn, der zusammen mit einigen Kollegen erste Verhöre im Police Department durchführte. »Die Spieler sind geständig«, sagte er. »Die meisten von ihnen machen sich fast in die Hosen vor Angst. Sie können einem fast Leid tun.«
»Was ist mit dem Personal?«
»Das haben wir noch nicht vernommen. Hat Benito eine Aussage gemacht?«
»Ohne seinen Anwalt will er kein Wort von sich geben«, erwiderte ich. »Aber wenn wir die Geständnisse der Spieler und vielleicht auch des Personals haben, können wir ihn überführen. Schicken Sie mir die Vernehmungsprotokolle«, bat ich. »Wir werden Sie, Benito betreffend, auf dem Laufenden halten.«
»Vielen Dank – und gute Nacht«, sagte Coburn.
Ich legte auf.
In Gemeinschaftsarbeit fertigten wir das Protokoll bezüglich der Razzia und der Festnahme Benitos, wobei Milo mir die Arbeit des Tippens überließ.
»Was machen wir nun mit dem angebrochenen Abend?«, fragte ich, als das Protokoll fertig und mit einigen Mehrfertigungen ausgedruckt war, und schaute Milo an.
Er grinste. »Um diese Zeit kommst du kaum noch in ein vernünftiges Lokal. Das Mezzogiorno hat längst geschlossen. Wir werden also hungrig zu Bett gehen müssen.«
Ich warf einen Blick auf das Ziffernblatt meiner Armbanduhr. Es war drei Uhr vorbei. »Du hast Recht«, sagte ich. »Morgen früh müssen wir wieder fit sein. Also beschließen wir es für heute.«
Ich fuhr meinen Computer herunter, dann verließen wir unser Büro und fuhren in die Tiefgarage. In der Nähe seiner Wohnung setzte sich Milo ab, dann fuhr ich nach Hause. Ich schlief in dieser Nacht ruhig und tief. Wir hatten einen Erfolg zu verzeichnen gehabt und das vermittelte das Gefühl einer tiefen, psychischen Befriedigung.
2
Will Hollow rannte um sein Leben. Zwei Männer verfolgten ihn. Nachdem sie per E-Mail mit Chi Wong einen großen Rauschgiftdeal vereinbart hatte, war Hollow von Boston in den Big Apple gekommen.
Er war um Mitternacht mit Chi Wong verabredet gewesen. Sie wollten sich beim buddhistischen Tempel in der Mott Street treffen. Dort wollte Hollow zehn Kilogramm reines Heroin von Chi Wong in Empfang nehmen.
Es war eine Falle. Hollow gehörte einer Mafia an, die den Rauschgifthandel in Boston kontrollierte. Die Chinesenmafia New Yorks aber streckte ihre Hände nach Boston aus – sie wollte dort Fuß fassen und das illegale Geschäft mit dem Verbrechen an sich reißen. Ein chinesischer Dealer, der der Bostoner Mafia in die Hände gefallen war, hatte den Namen Chi Wong genannt.
Die Bostoner Mafia schickte Hollow. Er sollte Chi Wong erschießen. Ihn hielten die Verbrecher für den New Yorker Drogenboss. Darum verabredete sich Hollow mit dem Chinesen, um angeblich Rauschgift zu kaufen.
Aber Chi Wong war nicht alleine gekommen. Plötzlich sah sich Hollow zwei Leibwächtern gegenüber, als er seine Pistole ziehen wollte, um dem Chinesen eine Kugel zu servieren.
Hollow hatte die Flucht ergriffen, ohne einen Schuss abgegeben zu haben. Die Angst vor den Chinesen peitschte ihn vorwärts. Seine Füße schienen kaum den Boden zu berühren. Passanten, die trotz der fortgeschrittenen Stunde den Gehsteig bevölkerten, wich er aus oder stieß sie einfach zur Seite. Einige kernige Beschimpfungen folgten ihm. Hinter sich hörte er das Getrappel der Schritte seiner Verfolger. Seine Lungen begannen zu stechen, sein Atem flog, und dann kam auch noch das Seitenstechen. Mit seiner Kondition war es nicht zum Besten bestellt.
In Hollow saß noch der Schreck über das unerwartete Auftauchen der beiden Kerle. Sie hatten in den Büschen des Parks hinter dem Buddhistentempel gesteckt. Er hatte die Pistole ins Schulterholster zurückgestoßen und Gas gegeben, denn wie hätte er begründen sollen, dass er ohne Geld – abgesehen von den etwa fünfhundert Dollar, die er in der Tasche hatte – zu einem Rauschgiftgeschäft gekommen war?
Er flitzte die Water Street hinunter und wollte den Corlears Hook Park erreichen, um sich dort zu verstecken. Im Park, davon war er überzeugt, konnte er seinen Verfolgern entkommen.
Er schaffte es nicht. Plötzlich erhielt er einen derben Stoß in den Rücken, er stolperte und stürzte. Schmerzhaft rieben seine Handflächen über die Betonplatten des Gehsteiges. Er schrie auf. Die beiden Chinesen hatten ihn eingeholt. Es handelte sich um durchtrainierte Bodyguards, denen der von einem nicht gerade gesunden Lebenswandel gezeichnete Gangster kaum etwas entgegenzusetzen hatte.
Sie zerrten ihn auf die Beine. »Seid ihr Bullen?«, knirschte er. Seine Handflächen brannten wie Feuer. Sie waren aufgeschürft und bluteten.
Er bekam keine Antwort. Einer der Chinesen griff unter seine Jacke und angelte sich sein Schießeisen. Dann dirigierten sie ihn den Weg zurück, den sie gekommen waren. Passanten beobachteten sie, aber niemand schritt ein. Entweder die Zuschauer hielten dies auch für einen Polizeieinsatz, oder sie hielten es mit den drei weisen Affen; nichts hören, nichts sehen, nicht sprechen.
Sie erreichten die dunkle Stelle wieder, an der der Deal hätte stattfinden sollen. Da stand der Wagen des Chinesen. Es war ein schwerer Lexus. Hollow musste sich auf den Beifahrersitz setzen. Einer der Chinesen setzte sich hinter ihn und drückte ihm die Mündung einer Pistole gegen die Schläfe. Chi Wong nahm ebenfalls auf dem Rücksitz Platz. Der dritte Chinese klemmte sich hinter das Lenkrad, ließ den Motor an und fuhr los.
»Warum bist du abgehauen?«, fragte Chi Wong.
»Als ich die beiden aus den Büschen kommen sah, bekam ich es mit der Angst«, antwortete der Amerikaner.
»Du lügst. Wir wissen, dass du nach New York gekommen bist, um mich zu erschießen.«
Schlagartig trocknete Hollows Hals aus. Er schluckte und hatte das Gefühl, dass ihn eine unsichtbare Hand würgte. »Wie – wie kommst du darauf?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Ich weiß es eben. Warum warst du erpicht darauf, dass ich alleine komme?«
»Ich wollte keine Zeugen dabei haben«, sagte Hollow und räusperte sich. Der Knoten, der in seinem Hals saß, würgte ihn. Seine eigene Stimme kam ihm fremd vor.
»Keine Zeugen für den Mord an mir, wie?«
»Für den Deal.«
»Wo hast du das Geld für den Stoff?«
Hollow überlegte krampfhaft, was er darauf antworten sollte. Einige Sekunden verstrichen, in denen er eine Antwort im Kopf formulierte, dann erwiderte er: »Ich wollte mich erst von der Güte des Heroins überzeugen. Wer kauft schon die Katze im Sack?«
Chi Wong lachte. »Ihr habt in Boston Li Laotse-ten geschnappt. Es ist mir zu Ohren gekommen. Man muss eben seine Fühler nach allen Richtungen ausstrecken. Li hat euch von mir erzählt. Wer ist dein Boss?«
»Du irrst dich«, beteuerte Hollow. »Ich weiß nichts von diesem Li Laotse-ten. Ich wollte mit dir ein Geschäft machen. Zehn Kilo Heroin …«
Etwas legte sich von hinten um Hollows Hals. Seine weiteren Worte erstickten. Es war ein geschmeidiger Draht, der brutal zusammengezogen wurde. Hollow griff mit beiden Händen danach, doch es gelang ihm nicht, seine Finger zwischen den Draht und seinen Hals zu schieben. Er bäumte sich auf, warf sich hin und her. Die Lungen drohten ihm plötzlich zu platzen. Seine Augen weiteten sich, seine Lippen sprangen auseinander. Verzweifelt japste er nach Luft. Schwindelgefühl griff nach ihm, Nebel schien vor seinem Blick zu wogen, Benommenheit überwältigte ihn, und dann verschwamm alles vor seinen Augen. Den Schmerz, als der Draht tief in seine Haut schnitt, spürte er nicht mehr. Er wurde bewusstlos, sein Körper erschlaffte. Aus dem Zustand der Bewusstlosigkeit glitt er hinüber in die jenseitige Welt.
3
Am Morgen verhörten wir Antonio Benito. Sein Anwalt hatte sich eingefunden. Er gebot seinem Klienten, nur zu sprechen, wenn er es erlaubte.
»Sie sind Besitzer des Club Andalusia?«, fragte ich. Wir befanden uns im Vernehmungsraum, der sich im Zellentrakt im Keller des Federal Building befand. Es gab hier nur einen Tisch und einige Stühle, eine Computeranlage, auf der Vernehmungsprotokolle getippt wurden, weißes Neonlicht, einen Telefonapparat und kahle Wände. Der einzige Schmuck war ein eisernes Kreuz über der Tür.
Benito schaute seinen Anwalt an, dieser nickte, Benito sagte: »Ja, das ist richtig.«
»In der ersten und zweiten Etage des Gebäudes wurde illegal um hohe Einsätze gespielt. Was haben Sie uns dazu zu sagen?«
Der Anwalt schüttelte den Kopf. Benito schwieg.
»Wir haben fast vier Dutzend Spieler in Gewahrsam genommen«, sagte Milo. »Die Leute sind geständig. Sie wussten, dass illegales Glücksspiel verboten ist. Der Name Ihres Geschäftsführers wurde einige Male erwähnt. Sicher ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn überführt haben. Und er wird seinen Kopf ganz sicher nicht allein in die Schlinge stecken.«
Kopfschütteln des Anwalts, Schweigen von Seiten Benitos.
»Mein Mandant weiß von nichts«, schnappte der Anwalt. »Er hatte auch keine Ahnung, dass in der ersten und zweiten Etage des Gebäudes, das er vor einiger Zeit käuflich erworben hat, illegales Glücksspiel betrieben wird. Sie halten Mr. Benito zu Unrecht fest. Ich werde bei der Anhörung beantragen, dass mein Mandat sofort wieder auf freien Fuß zu setzen ist.«
»Darüber muss der Richter entscheiden«, sagte ich und lächelte. »Ist doch seltsam, nicht wahr? Ihr Mandant kauft ein ganzes Haus und kümmert sich nicht weiter darum. Er weiß nicht, was in diesem Gebäude vor sich geht. Das Glücksspiel hat wahrscheinlich sein Geschäftsführer inszeniert, und das alles ohne sein Wissen. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Wissen Sie eigentlich, dass im Moment ein Team in Mr. Benitos Wohnung ist und eine Durchsuchung durchführt?«
Benito zuckte zusammen. Er warf seinem Anwalt einen verunsicherten Blick zu.
Ich sprach weiter: »Wir haben den Geschäftsführer des Lokals, die Türsteher, und die Spieler. Ihr Geschäftsführer wird singen, Mr. Benito. Auch die Türsteher werden reden, und die Spieler. So wird sich ein Mosaikstein zum anderen fügen, und zuletzt haben wir Sie am Kanthaken.«
Wieder traf den Anwalt ein verunsicherter Blick. Die Kiefer des Anwalts mahlten. Deutlich war von seinen Zügen abzulesen, dass es hinter seiner Stirn krampfhaft arbeitete.
»Wie wäre es mit einem Deal?«, fragte Benito plötzlich. »Ich könnte euch etwas Interessantes bieten, und ihr lasst mich dafür laufen.«
»Wir kommen der Sache näher«, murmelte Milo. »Was für ein Deal?«
»Was sagen Sie zu meinem Vorschlag?«
»Ich möchte mit meinem Mandanten unter vier Augen sprechen!«, stieß der Anwalt hervor.
Milo und ich wechselten einen Blick, ich nickte, dann verließen wir den Vernehmungsraum. Ich zog die Tür hinter mir ins Schloss.
»Er weiß scheinbar, wenn er verloren hat«, knurrte Milo.
»Egal, was er uns zu bieten hat«, sagte ich. »Wir können ihn nicht laufen lassen. Illegales Glücksspiel ist ein Officialdelikt, das die Staatsanwaltschaft von sich aus zu verfolgen hat.«
»Aber wenn er geständig ist und uns vielleicht noch wertvolle Hinweise liefert, kommt er vielleicht mit einem milden Urteil davon. Wir sollten den Staatsanwalt hinzuziehen. Sicher hat uns Benito etwas mitzuteilen, was für uns von Interesse ist.«
»Warten wir erst einmal ab, was für einen Deal er uns vorschlagen will.«
Ich ging vor der Tür auf und ab. Unsere Unterhaltung schlief ein. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Ich war gespannt, was Benito zu sagen hatte. Dass er sich selbst belastete, war kaum anzunehmen. War ihm etwas zu Ohren gekommen, das dazu angetan war, das FBI auf den Plan zu rufen?
Die Minuten verstrichen. Manchmal war eine Stimme durch die geschlossene Tür zu vernehmen. Was gesprochen wurde, konnten wir jedoch nicht verstehen. Es hörte sich an, als könnten sich der Anwalt und sein Mandant nicht einigen.
Schließlich aber wurde die Tür geöffnet. Der Rechtsanwalt streckte den Kopf heraus. »Sie können wieder hereinkommen.«
Gespannt-erwartungsvoll musterte ich Benito.
Auch Milos Blick hing an dem Italoamerikaner.
Es war der Anwalt, der das Wort ergriff. »Sicher sind Sie beide nicht kompetent, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Ich verlange deshalb, dass ein Vertreter der Staatsanwaltschaft hinzugezogen wird.«
»Rentiert es sich überhaupt?«, fragte Milo.
Der Anwalt nickte. »Mein Mandant wird ein Geständnis ablegen und Ihnen über etwas Mitteilung machen, was ihm zu Ohren gekommen ist. Etwas, das für Sie sicherlich von größtem Interesse ist. Ein Schmuggel im großen Stil – eine Sache für die Bundespolizei.«
Ich nickte. »In Ordnung. Ich rufe bei der Staatsanwaltschaft an. Das kann aber dauern.«
»Ich nehme mir die Zeit«, sagte der Anwalt. »Eine gute Gelegenheit, noch einmal über alles mit meinem Mandanten zu sprechen.«
Milo und ich verließen den Vernehmungsraum. Vor der Tür stand ein Wachtmeister, zu dem ich sagte: »Benito bespricht sich mit seinem Anwalt. Sperren Sie die Tür ab. Wir sind in einer halben Stunde wieder zurück.
Wir fuhren hinauf in den 23. Stock, wo unser Büro lag, ich rief bei der Staatsanwaltschaft an, und man sagte mir zu, einen kompetenten Mann vorbeizuschicken, dann meldete ich uns bei Mr. McKee an. Der Assistant Director nahm sich sofort Zeit für uns. Er saß hinter seinem Schreibtisch. »Schon durch mit der Vernehmung Benitos?«, fragte er und machte eine Handbewegung, die uns bedeuten sollte, Platz zu nehmen.
»Nein.« Es war Milo, der antwortete, als wir an dem kleinen Konferenztisch saßen, um den einige lederbezogene Stühle gruppiert waren. »Er will mit uns ein Geschäft machen. Deshalb haben wir einen Staatsanwalt angefordert.«
»Soeben erhielt ich eine Meldung, dass aus dem East River ein Leichnam gefischt worden ist«, sagte der Chef. »Ein Weißer, Amerikaner, der seinen Führerschein einstecken hatte. Sein Name ist Will Hollow, und er lebte in Boston.«
»Starb er gewaltsam?«, fragte ich.
»Ja. Laut Polizeiarzt dürfte der Tod etwa um Mitternacht eingetreten sein. Der Tote hatte Würgemale am Hals, die von einem dünnen Draht stammen könnten. Aber etwas Genaueres wird der Gerichtsmediziner feststellen.«
»Da es sich um einen Mann aus Boston handelt, ist es ein Fall für das FBI«, gab Milo zu verstehen.
»Da Sie Ihre Sache so gut wie abgeschlossen haben und der Rest nur noch Formsache ist, wollte ich Sie beide bitten, sich des Falles anzunehmen«, kam es von Mr. McKee.
Wir nickten in Stereo. »Klar, Sir«, sagte ich. »Wir werden uns nach der Vernehmung Benitos sofort mit dem Police Department in Verbindung setzen.«
»Was ist das für ein Geschäft, das Ihnen Benito vorgeschlagen hat?«
»Wenn man seinem Anwalt glauben darf, handelt es sich um Schmuggel im großen Stil – eine Sache für das FBI. Ob es sich nun um Drogen, Waffen oder sonst etwas handelt, wissen wir noch nicht.«
»Halten Sie mich auf dem Laufenden«, bat der Chef.
Wir sagten es zu.
Eine halbe Stunde später kam der Staatsanwalt. Sein Name war Hollub. Er würde die Anklage gegen Antonio Benito vertreten, falls es zu einer solchen kam, wovon ich im vorliegenden Fall aber fest überzeugt war.
Wir begaben uns in den Vernehmungsraum.
Antonio Benito rang die Hände. Sein Anwalt saß neben ihm. Als wir eintraten, erhob dieser sich, um dem Staatsanwalt die Hand zu geben. Wir setzten uns an die andere Seite des Tisches.
»Dann schießen Sie mal los«, sagte Hollub. »Was haben Sie zu bieten, und was wollen Sie dafür?«
»Es geht um die Chinesenmafia und um den Schmuggel von Hörnern des Nashorns.«
Ich war ziemlich überrascht. »Um den Schmuggel von Nashorn-Hörnern«, entfuhr es mir. Mit allem hatte ich gerechnet, aber nicht damit. Aber ich begriff sogleich. In Indien und Ostasien schreibt man dem zu Pulver geriebenem Horn potenzsteigernde Wirkung zu. Der Mythos entstand mit der Tatsache, dass die Paarung der Nashörner zwanzig bis achtzig Minuten dauern kann. Aber auch gegen viele andere Krankheiten soll das zu Pulver geriebene Horn angeblich helfen. Seit Jahrhunderten geistert dieser Irrglaube in den Köpfen impotenter Konsumenten herum. Im Endeffekt ist das Pulver völlig wirkungslos.
Aber ganz sicher lässt sich ein Geschäft damit machen.
Die Einfuhr war verboten. Soviel wusste ich. Das ist auf das Washingtoner Artenschutzübereinkommen zurückzuführen, das den internationalen kommerziellen Handel mit gefährdeten Tieren und Pflanzen und deren Produkten regelt.
Die Stimme Benitos fuhr in meine Gedanken. »So ist es. Einer meiner Angestellten hat mir erzählt, dass ein gewisser Hsien Hsing-hai in Queens ein Haus besitzt und dort über hundert Hörern gelagert sein sollen.«
»Die chinesische Mafia!«, stieg es aus Milos Kehle. »Hat sie etwa die Hand im Spiel?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Benito. »Aber es könnte sein. Was sagen Sie dazu? Finden Sie das Haus Hsing-hais in Queens, und Sie werden die Gewissheit haben, dass ich weiß, wovon ich rede.«
»Sie werden der Förderung des illegalen Glücksspiels beschuldigt«, sagte der Staatsanwalt. »Das ist kein Kavaliersdelikt. Aber wenn sich Ihr Hinweis als wahr herausstellen sollte, wird sich das sicher auf das Strafmaß auswirken, das Sie zu erwarten haben. Ich werde in meinem Plädoyer dann deutlich unter der vom Gesetz vorgesehenen Strafe bleiben.«
»Darüber werden wir sprechen müssen«, sagte der Rechtsanwalt.
»Warten wir erst, ob an dem Hinweis etwas dran ist«, versetzte Hollub.
4
Es war kein großes Problem, herauszufinden, dass sich das Haus Hsien Hsing-hais in der 35th Avenue mitten im Flushing Meadows Corona Park befand. Milo und ich fuhren nach Queens. Es handelte sich um ein unauffälliges Einfamilienhaus mit einem Vorbau und einem Erker auf dem Dach, in weiß und blau gehalten, mit einer Rasenfläche vor dem Haus, die bis zum Gehsteig reichte und von diesem mit einem lebenden Zaun abgegrenzt war. Eine Doppelgarage war an das Haus angebaut.
Wir saßen im Wagen und beobachteten das Gebäude einige Zeit. Es mutete wie verlassen an. Nach einiger Zeit stiegen wir aus und gingen zum Haus. Ich versuchte, einen Blick durch das Fenster in die Garage zu werden, aber im Innern war es dunkel, und so konnte ich kaum etwas erkennen.
Milo läutete an der Haustür. Es dauerte nicht lange, dann wurde das Fenster über der Haustür hochgeschoben, und ein Mann reckte seinen Kopf ins Freie. Er war Amerikaner, und wir hatten ihn – wie ich unschwer aus seinen abstehenden Haaren und dem verschlafenen Gesichtsausdruck schließen konnte – aus dem Bett geholt.
»Was ist denn los?«, fragte der Bursche ärgerlich.
»Dieses Haus gehört doch Hsien Hsing-hai?«, fragte ich.
»Ja. Ich habe es gemietet. Wenn Sie von irgendeiner Versicherung kommen sollten, lassen Sie sich gesagt sein, dass ich …«
»Wir sind vom FBI!«, rief ich und unterbrach ihn. »Machen Sie auf. Wir haben mit Ihnen zu sprechen.«
Ihm entfuhr eine Verwünschung, dann schob er mit einem Ruck das Fenster nach unten.
Wenn wir aber angenommen hatten, dass er innerhalb der nächsten Minute die Haustür öffnen würden, sahen wir uns getäuscht. Wir warteten zwei Minuten, dann läutete Milo Sturm. In dem Haus rührte sich nichts mehr.
»Bleib du an der Vordertür«, stieß ich hervor und lief um das Haus herum. Es gab eine Terrasse. Die Terrassentür war offen. Der Bursche, der das Haus bewohnte, hatte die Flucht ergriffen. Ich ging in das Haus hinein und stand im Wohnzimmer. Es war geschmackvoll eingerichtet. Einige Türen führten in andere Räume, eine Treppe schwang sich zur Mansarde empor.
Ich ging zur Haustür und entriegelte sie, nahm die Sicherungskette aus der Verankerung und ließ Milo ins Haus.
Wir durchsuchten sämtliche Räume. Ein kurzer Flur führte zu einer Tür, durch die man die Garage betreten konnte. Hier stapelten sich Kartons. Ich öffnete einen und staunte nicht schlecht, als ich feststellte, dass er tatsächlich Hörner von Nashörnern beinhaltete.
Vorsichtshalber öffnete ich noch einen zweiten Karton, und auch er enthielt Hörner.
Benito hatte also gewusst, wovon er sprach.
Ich rief das Police Department an und bat, ein Team zu schicken, das sich um die wertvolle Ware kümmerte und im Haus Spuren sicherte.
Dann erkundigten wir uns bei einem Nachbarn nach dem Bewohner des Hauses. Der Mann sagte: »Ich weiß nur, dass er Arthur Salzman heißt. Ich habe mal ein Paket, das an ihn adressiert war, in Empfang genommen. Er lebt allein in dem Haus.« Der Mann wiegte den Kopf. »Ein komischer Heiliger. Hat sich mit niemandem abgegeben, grüßt kaum, ist nur selten zu Hause. Vor ein paar Tagen brachte ein Siebeneinhalb-Tonner eine ganze Ladung Kartons. Was sie beinhalten weiß ich nicht. Ich nehme aber an, dass Salzman ein selbständiges Gewerbe betreibt, und dass sich in den Kartons die Ware befindet, mit der er handelt.«
Das war wahrscheinlich gar nicht mal so weit von der Wahrheit entfernt.
Wir kehrten in das Haus zurück, berührten aber nichts, um keine Spuren zu zerstören. Nach etwa einer Stunde erschienen die Kollegen von der Spurensicherung. Ich klärte sie mit wenigen Worten auf, dann übernahmen sie alles Weitere, und wir fuhren nach zurück nach Manhattan.
Die SRD hat ihren Sitz in der Bronx. Da sie auch für gerichtsmedizinische Untersuchungen zuständig ist, fuhren wir nach Norden, um uns den Mann anzusehen, der mit Würgemalen am Hals aus dem East River gefischt worden war.
Der Tote war noch nicht obduziert worden. Deutlich war der Abdruck der Schnur oder des Drahtes um seinen Hals zu erkennen. Das Gesicht war vom letzten Schrecken im Leben Will Hollows verzerrt. Die Augen waren geöffnet und muteten an wie Glasstücke.
Es war kein schöner Anblick.
Wir sprachen mit dem Pathologen. »Die Leiche hat eindeutig nur wenige Stunden im Wasser gelegen«, gab er zu verstehen. »Dem ersten Augenschein nach wurde der Mann stranguliert und dann in den Fluss geworfen.«
Wir sprachen auch mit dem Beamten der SRD, der für die Auswertung der Obduktionsergebnisse zuständig war. »Wir wissen nichts über ihn, außer dass er Will Hollow heißt, sechsunddreißig Jahre alt ist und in Boston lebt. Ich habe NCIC bemüht, aber Hollow ist nicht erfasst.«
NCIC steht für National Crime Information Center. Dort werden auf Bundesebene alle Polizeiakten zusammengetragen. Dieses Fahndungsarchiv enthält fast 40 Millionen Akten und Bilddateien. Dort ist jeder noch so kleine Eierdieb erfasst.
»Also keine Vorstrafen«, murmelte ich.
»Nein. Zumindest nicht unter dem Namen Hollow.«
»Sicher«, murmelte ich. »Seine Fingerabdrücke oder eine DNA-Analyse bringen vielleicht ein positives Ergebnis.«
»Wahrscheinlich wurde er mit einem Würgedraht stranguliert«, sagte der Beamte. »Asiaten arbeiten gern mit dieser Methode. Muss jedoch nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings groß.«
»Chinesen«, sagte Milo.
Der Beamte nickte. »Nicht auszuschließen.«
»Informieren Sie uns über das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung«, bat ich, dann verließen wir die SRD und fuhren zum Federal Building.
Da sich die Arrestzellen im Keller des Hochhauses befanden, begaben wir uns gleich zur Zelle Antonio Benitos. »Ihr Tipp hat sich als sehr wertvoll erwiesen. Sagt Ihnen der Name Arthur Salzman etwas?«
»Wer soll das sein?«
»Er bewohnt das Haus.«
»Keine Ahnung. Mir wurde nur der Name Hsien Hsing-hai genannt. Aber mein Informant hat auch nur am Rande von den Hörnern gehört und mir das, was er wusste, berichtet.«
»Wollten Sie etwa in das Geschäft einsteigen?«, fragte Milo.
»Gott bewahre. Sich mit den Chinesen anzulegen ist tödlich. Und lebensmüde bin ich nicht.«
Wir fuhren nach oben und gingen sofort zu Mr. McKee, um Bericht zu erstatten.
»Dann bleibt Ihnen im Moment nur, die Fahndung nach Salzman einzuleiten, Jesse, Milo«, meinte der Assistant Director. »Außerdem können Sie diesem Chinesen, diesem – äh …«
»Hsien Hsing-hai«, sagte ich.
»… diesem Hsien Hsing-hai ein wenig auf die Finger schauen.«
»Das werden wir ganz sicher«, versprach ich. »Was den Mord an Will Hollow anbelangt, werden wir die Kollegen in Boston einschalten. Vielleicht ergibt sich, zu wem Hollow in New York Kontakt hatte.«
Zunächst brachten wir die Fahndung nach Arthur Salzman auf die Reihe. Dann nahm ich telefonisch mit dem Field Office in Boston Verbindung auf. Der Kollege sagte mir zu, in der Wohnung Hollows eine Durchsuchung durchzuführen und mich vom Ergebnis zu unterrichten.
Am Nachmittag erhielt ich einen Anruf vom Police Department, in dem mir mitgeteilt wurde, dass es sich um mehr als hundert Nashorn-Hörner gehandelt hatte, die in der Garage in Queens gefunden wurden, und dass der Schwarzmarktpreis dafür bei etwa 3,5 Millionen Dollar lag.
Es war also ein immenser Fang, der uns da ins Netz gegangen war.
*
Hsien Hsing-hai wohnte in der Pell Street. Chinatown präsentierte sich uns in seiner ganzen Farbenpracht. Transparente waren über die Straßen gespannt. Überall über den Türen und an den Häusern befanden sich chinesische Schriftzeichen. Buntes Treiben der Händler und quirliges Leben auf den Straßen – das waren die Markenzeichen von Chinatown. Die Gehsteige waren voller Menschen. Geschäfte, Bars, Speiserestaurants …
Hsien Hsing-hai wohnte in einem vierstöckigen Haus, in dessen Erdgeschoss ein Gemüse- und Obsthändler seine Waren feil bot. Der Chinese wohnte in der zweiten Etage. Ob die Wohnung ihm gehörte, wussten wir nicht.
Er öffnete uns die Tür und lächelte freundlich. Auf dem Grund seiner dunklen Augen jedoch glaubte ich lauernde Anspannung erkennen zu können. Die Augen waren an dem Lächeln nicht beteiligt. »Was führt Sie zu mir?«, fragte er in holprigem Englisch.
Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass er genau wusste, wer wir waren. Womöglich hatte Salzman mit ihm telefoniert. Das war natürlich nur eine Vermutung, aber sie hatte sich in mir festgesetzt und ließ sich nicht verdrängen.
»Mein Name ist Trevellian«, stellte ich mich vor. »Mein Kollege Tucker. Wir sind vom FBI New York. Können wir Ihnen einige Fragen stellen?«
»Bitte, Gentlemen, treten Sie ein.« Hsien Hsing-hai gab die Tür frei und machte eine einladende Handbewegung. Wir gingen in die Wohnung. Sie bot viel Kitsch. An den Wänden hingen einige chinesische Seidenmalereien hinter Glas.
»Was kann ich für Sie tun?«
Die Freundlichkeit des Chinesen war nicht echt. Das spürte ich mit untrüglichem Instinkt. Sie war aufgesetzt und brachte meine Nerven zum Schwingen.
»Sie besitzen ein Haus in Queens«, sagte ich, und es war keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Ja, in der fünfunddreißigsten Avenue. Was ist damit? Ich habe es an einen Mann namens Arthur Salzmann vermietet.«
»Wissen Sie, welcher Art von Broterwerb Salzman nachgeht?«, fragte Milo.
»Er handelt mit Computern«, sagte der Chinese. »Warum fragen Sie? Hat es mit Salzman etwas Besonderes auf sich?«
»Wir haben in seiner Garage Kartons gefunden, in denen sich über hundert Nashorn-Hörner befinden.«
Hsien Hsing-hai prallte zurück. »Nashorn-Hörner?«
»Ja, Nashorn-Hörner. In Ihrem Land wird diesen Hörnern doch potenzsteigernde Wirkung nachgesagt.«
»Man spricht von Aphrodisiakum«, sagte der Chinese und nickte. »Ja, in pulverisierter Form soll das Horn potenzsteigernd sein. Aber warum kommen Sie deshalb zu mir? Ich habe das Haus in Queens als Geldanlage gekauft.«
»Womit verdienen Sie denn Ihre Brötchen?«, wollte Milo wissen.
»Ich habe in diesem Haus das Erdgeschoss und zwei weitere Stockwerke vermietet. Darüber hinaus kassiere ich Miete von Salzman. Außerdem bin ich an einem Speiserestaurant beteiligt. Ich bin ein genügsamer Mensch und komme mit wenig Geld aus.«
Hsien Hsing-hai lächelte ununterbrochen. Mir drehte sich fast der Magen um. Diese geheuchelte Freundlichkeit ging mir auf die Nerven und trieb meinen Adrenalinspiegel in die Höhe.
Ich gab dem Chinesen eine von meinen Visitenkarten. »Sollte sich Mr. Salzman bei Ihnen melden, geben Sie uns bitte Bescheid.«
»Warum sollte er sich bei mir melden? Ich habe privat nichts mit ihm zu tun. Jeden Monatsersten bekomme ich die Miete für das Haus auf mein Konto gutgeschrieben, und nur das interessiert mich.«
Wir verabschiedeten uns von Hsien Hsing-hai. Als wir wieder im Wagen saßen und zur Federal Plaza fuhren, fragte mich Milo, was ich von dem Chinesen hielt.
»Schwer zu durchschauen«, sagte ich. »Dieses überfreundliche Gegrinse …« Ich brach ab, denn ich wollte keine Aversionen schüren. Oberstes Gebot eines Polizisten ist Neutralität. Von persönlichen Gefühlen durften wir uns nicht leiten lassen.
5
Am darauffolgenden Tag, nachmittags, erhielt ich einen Anruf aus Boston. Der Kollege sagte: »Wir haben die Telefongespräche Hollows ausgewertet und seinen Computer gecheckt. Danach hatte er des Öfteren eine Nummer in New York angerufen, außerdem gibt es eine E-Mail, in der er einem gewissen Chi Wong ankündigte, dass er am dreißigsten November nach New York komme, um das Geschäft abzuwickeln. Die Art des Geschäfts hat er allerdings nicht beschrieben.«
»Habt ihr herausgefunden, wem der Anschluss zuzuordnen ist, mit dem Hollow des Öfteren telefonierte?«
»Natürlich. Er gehört ebenfalls diesem Chi Wong. Jetzt wäre es natürlich nützlich, wenn wir wüssten, was für eine Art Geschäft Hollow meinte.«
»Geben Sie mir die Telefonnummer. Vielleicht finden wir es dann heraus.«
Der Kollege diktierte mir die Zahlenfolge, ich schrieb sie auf, dann bedankte ich mich und beendete das Gespräch.
Ich wählte die Nummer sofort an. Chi Wong meldete sich. Ich nannte ihm meinen Namen und verschwieg nicht, dass ich vom FBI war, dann kündigte ich unseren Besuch innerhalb der nächsten Stunde an.
Wir fuhren in die Upper West Side, West 85th Street, wo Chi Wong wohnte. Er wohnte nicht in Chinatown, wie die Hälfte aller New Yorker Chinesen. Die Upper West Side war ein nicht gerade billiger Stadtteil. Ich war gespannt auf den Chinesen.
Das Wetter war nasskalt. Ein bewölkter Himmel hing über New York. Es hatte schon einmal geschneit, aber der Schnee war in der Zwischenzeit wieder weggetaut. Es war die Art von Wetter, die ich hasste, und bei der Erkältungskrankheiten vorprogrammiert waren. Man fand nicht die richtige Kleidung. Entweder man war zu leicht angezogen und fror, oder man war zu warm angezogen und schwitzte. Egal, wie man es machte – es war immer verkehrt.
Der Verkehr war katastrophal. In New York hielt sich der Smog. Ein Hupkonzert erfüllte die Straßenschluchten. Manchmal erklang eine Sirene. Die Ampeln meinten es nicht gut mit uns. Wir gerieten in jede Rotphase, die der Broadway von Süden nach Norden zu bieten hatte.
Aber jede Reise findet einmal ein Ende, und so kamen auch wir in der 85th an. Am Gehsteigrand waren Bäume gepflanzt worden. Die Straße endete am Central Park. Von dort, wo ich parkte, konnte man einen kleinen Ausschnitt des Parks, dieser grünen Lunge New Yorks, sehen.
Chi Wong wohnte im Haus mit der Nummer 215. In der Halle des Hochhauses saß hinter der Rezeption ein Wachmann. Es gab aber auch einen elektronischen Wegweiser, ein Monitor auf einem Metallbein, durch dessen Programm man sich scrollen konnte und das zu jeder Apartmentnummer den Bewohner preisgab.
Wir wussten von Chi Wong, dass er in der achten Etage wohnte. Apartment Nummer 812. Der Wachmann musterte uns unverhohlen, stellte aber keine Fragen, als wir schnurstracks zum Aufzug gingen. Ich drückte den Knopf, und der Lift kam nach unten. Mit einem leisen Rumpeln hielt er an, die Edelmetalltür glitt lautlos auf, wir stiegen ein.
Milo drückte den Knopf mit der Nummer acht. Wir wurden in die Höhe getragen, oben ging die Tür wie von Geisterhand gesteuert wieder auf, und gleich darauf standen wir vor Apartment 812. Milo klingelte.
Es dauerte keine halbe Minute, dann konnte ich sehen, dass von innen jemand durch den Spion schaute, im nächsten Moment hörte ich eine Kette rasseln, dann ein metallisches Geräusch, als die Tür entriegelt wurde, und dann schwang sie auf.
Vor uns stand ein Chinese von höchsten eins-sechzig, seine Haare waren über der Stirn stark gelichtet, er war mit einem schwarzen Hausmantel bekleidet und – lächelte. Sein Lächeln erinnerte mich an Hsien Hsing-hai, und es mutete mich an wie das Zähnefletschen eines zorniges Dobermanns.
»Sie sind die beiden Gentlemen vom FBI, wie?«, fragte der Chinese in fließendem Englisch. Er war um die Vierzig. Seine Augen waren eng, der Kopf hatte eine eckige Form. Um seinen dünnlippigen Mund glaubte ich einen brutalen Zug wahrzunehmen. »Womit kann ich Ihnen dienen?«
»Sie brauchen uns nicht zu dienen«, konnte ich mir verkneifen, zu sagen, setzte aber sofort mein freundlichstes Lächeln auf und fuhrt fort: »Wir haben einige Fragen an Sie, Mr. Chi Wong.«
»Treten Sie näher«, forderte uns der Chinese auf, die Wohnung zu betreten. Wir gingen an ihm vorbei und befanden uns in einem amerikanisch eingerichteten Wohnzimmer ohne jeden Firlefanz, wie ich ihn in Hsien Hsing-hais Wohnung gesehen hatten.
Chi Wong schloss die Tür. Wir wandten uns ihm zu. »Kennen Sie einen Mann namens Will Hollow?« Ich fiel sofort mit der Tür ins Haus.
Ich glaubte in den braunen Augen des Chinesen ein Aufblitzen wahrzunehmen, er hielt meinem Blick stand, nickte und sagte: »Ja. Hollow lebt in Boston. Wir stehen in geschäftlicher Beziehung.«
»Welche Art von Geschäften?«, wollte ich wissen und ließ den Chinesen nicht aus den Augen. Die Mimik eines Menschen kann eine Menge verraten, und ich wollte mir kein Muskelzucken in seinem Gesicht entgehen lassen.
»Er handelt mit chinesischen Spezialitäten. Morcheln, Bambusspitzen, speziellen Gewürzen – mit allem eben, was man für die chinesische Küche braucht. Ich betreibe ein Speiserestaurant.«
»Interessant«, sagte ich. Und einer jähen Eingebung folgend setzte ich hinzu: »Alleine, oder haben Sie einen Geschäftspartner?«
»Es gibt einen stillen Teilhaber. Er ist mit fünfzig Prozent an dem Geschäft beteiligt. Sein Name ist Hsien Hsing-hai.«
Ich war ziemlich verblüfft. Schloss sich hier ein Kreis? Milo und ich wechselten einen vielsagenden Blick. »Sagt Ihnen der Name Arthur Salzman etwas?«, fragte ich sogleich.
Chi Wong schüttelte den Kopf. »Nein. Aber warum fragen Sie mich nach Will Hollow? Weshalb interessiert sich das FBI für ihn? Macht er illegale Geschäfte?«
Täuschte ich mich, oder hatte sich das Grinsen in Chi Wongs Gesicht verstärkt? Und plötzlich glaubte ich auch ein heimtückisches Funkeln in seinen Augen wahrzunehmen. »Will Hollow ist tot«, sagte ich.
Der Chinese zog den Kopf zwischen die Schultern und schaute mich entsetzt an. »Er – ist – tot?«, stammelte er und knetete seine Hände. »Woran ist er denn gestorben?« Seine Stimme hatte sich gefestigt, er musterte mich fragend.
Entweder ich hatte ihn wirklich so sehr überrascht, oder er war ein ausgezeichneter Schauspieler.
»An Halsschmerzen«, sagte Milo an meiner Stelle, und der Chinese widmete seine Aufmerksamkeit meinem Partner. »Man hat ihn erwürgt«, differenzierte Milo mit dem nächsten Atemzug.
»Bei Konfuzius – wie schrecklich.« Chi Wong hatte sich theatralisch an den Hals gegriffen und schaute mit allen Anzeichen des Entsetzens abwechselnd Milo und mich an.
»Hollow ist nach New York gekommen, um mit Ihnen ein Geschäft abzuwickeln«, sagte ich. »Der Deal sollte am dreißigsten November stattfinden. Was für ein Geschäft war das, und meldete sich Hollow am dreißigsten November bei Ihnen?«
»Es ging um eine Lieferung von fünftausend tiefgefrorenen Frühlingsrollen«, sagte Chi Wong. »Hollow machte einen derart günstigen Preis, dass ich nicht nein sagen konnte. Allerdings meldete er sich nicht mehr bei mir. Der arme Kerl. Wer mag ihn umgebracht haben?«
»Wenn wir das wüssten, wären wir einen gehörigen Schritt weiter«, knurrte Milo.
Ich hinterließ auch bei Chi Wong eine Visitenkarte und bat ihn, mit uns Verbindung aufzunehmen, wenn ihm etwas einfallen sollte, das vielleicht von Wichtigkeit für uns sein konnte.
6
Ein Mann führte seinen Schäferhund Rex im Central Park spazieren. Es war ziemlich Früh. Zwischen den Wolkenkratzern Manhattans wob noch die Dunkelheit. Bob Vaugham, so lautete der Name des Mannes, ließ seinen Hund von der Leine, nachdem er den East Drive überquert hatte. Irgendwo schlug eine Kirchenglocke siebenmal. Es war kalt. Die Temperaturen waren unter den Gefrierpunkt gesunken. Am Himmel flimmerten noch die Sterne. Die Sichel des Mondes stand im Westen.
Der Hund lief von dem Mann weg und hob bei einem Gebüsch das Bein. Bob Vaugham war jeden Tag schon um diese Zeit mit seinem Hund unterwegs, denn um acht Uhr begann sein Dienst bei der Straßenreinigung New Yorks, und er war alleinstehend, so dass niemand seinen Hund spazieren führen konnte.
In Manhattan brannten schon hunderttausende von Lichtern. Man behauptete, New York schlafe nie. Das war natürlich übertrieben. In den frühen Morgenstunden war auch auf den Straßen der Downtown nichts los.
Der Hund verschwand plötzlich um die Büsche. Vaugham, der fürchtete, dass Rex einen Hasen oder eine Katze aufgespürt hatte, rief den Hund. Rex begann hinter den Büschen wie verrückt zu kläffen. Vaugham folgte ihm hinter den Buschgürtel. Der Magen krampfte sich ihm zusammen, als er den reglosen Mann am Boden liegen sah. Ein Penner, der hier seinen Rausch ausschlief, konnte es nicht sein, denn das Bellen des Hundes hätte ihn geweckt. Der Mann war entweder besinnungslos oder tot.
»Ruhig, Rex! Aus!« Vaugham sprach scharf, und der Hund winselten nur noch. Dann beugte sich Vaugham über die reglose Gestalt am Boden und rüttelte sie. »O mein Gott«, entrang es sich ihm, als der Mann kein Lebenszeichen von sich gab. Vaugham richtete sich auf, holte sein Handy aus der Manteltasche und tippte die Nummer des Notrufs. Sofort meldete sich jemand, er sagte: »Ich befinde mich im Central Park südlich des Wildlife Conservation Centers. Da liegt ein Mann. Ich glaube, er ist tot.«
»Ich schicke sofort eine Polizeistreife«, sagte der Mann vom Notruf. »Wo genau befinden Sie sich?«
»Zwischen dem Wollman Rink und dem East Drive.«
»Bleiben Sie dort und warten Sie auf die Polizei.«
»Okay.« Vaugham beendete die Verbindung. Von der Fifth Avenue und vom Central Park South her waren Motorengeräusche zu vernehmen. Es war Anfang Dezember, und die Tage waren kurz, die Nächte lang. Um diese Zeit begann die morgendlich Rushhour.
Es dauerte eine Viertelstunde, dann kam ein Patrol Car der City Police an. Vaugham führte die Cops zu dem Toten. Die Dunkelheit begann sich zu lichten. Einer der beiden Polizisten klemmte sich sofort hinter das Funkgerät und rief das Police Department an. Und weitere zwanzig Minuten später waren die Beamten von der Mordkommission zur Stelle. Der Fundort wurde mit einem gelben Trassenband weiträumig abgesperrt, die Spurensicherung machte sich an die Arbeit.
7
Uns erreichte die Nachricht gegen neun Uhr. Im Central Park war ein Toter gefunden worden, der am Hals Würgemale wie von einem dünnen Draht aufwies. Weil der Mord dieselbe Handschrift trug wie der Mord an Will Hollow, informierte man uns.
Um wen es sich bei dem Toten handelte, war nicht bekannt. Der Kollege vom Police Department hoffte jedoch, über IAFIS ans Ziel zu kommen. Hierbei handelt es sich um das Archiv zur Überprüfung von Fingerabdrücken, in dem mehrere Millionen Prints erfasst waren.
Wir fuhren zum Tatort. Die Staatsanwaltschaft hatte die Leiche beschlagnahmt und ins gerichtsmedizinische Institut überführen lassen. Es gab Reifenspuren im Gras, aber keine Abdrücke des Profils. Man hatte den Leichnam von der Transverse Road No. 1 zwischen die Büsche chauffiert und abgeladen. Die Spurbreite wurde vermessen. Daraus konnte man vielleicht Schlüsse auf die Automarke ziehen.
Wir fuhren zur Pathologie. Der Arzt, der sich um unser Anliegen kümmerte, führte uns in den Kühlraum und zog einen der Schübe auf. Der Tote war mit einem weißen Laken zugedeckt. Der Doc schlug es über dem erstarrten Gesicht zurück.
Ich traute meinen Augen nicht.
Vor uns lag Arthur Salzman, der das Haus Hsien Hsing-hais in Queens gemietet hatte. Seine Augen waren geöffnet, der Mund war weit aufgerissen, als wollte er noch im Tod nach Luft schnappen. Um den Hals zog sich eine dünne, rote Würgespur, die von einem Draht stammen konnte.
Damit war die Identität des Toten geklärt.
Ich nahm mit dem Police Department Verbindung auf. Der Mann, der den Polizeieinsatz im Park koordiniert hatte und auf dessen Schreibtisch alle Erkenntnisse im Hinblick auf den Mord zusammenliefen, hieß Warren McKinley. Ich klärte ihn bezüglich der Identität des Ermordeten auf und berichtete ihm, dass das Haus in der 35th Avenue in Queens, das Salzman bewohnte, bereits von der Spurensicherung unter die Lupe genommen worden war.
»Der Mord lässt den Schluss zu«, sagte ich, »dass man, nachdem wir Fahndung nach Salzman eingeleitet haben, wohl befürchtete, dass er geschnappt werden und dem Verhör nicht standhalten würde. Salzman war wahrscheinlich nur einer der kleinen Fische in der Angelegenheit mit den geschmuggelten Nashorn-Hörnern. Man hat mit ihm einen potentiellen Zeugen aus dem Weg geräumt.«
»Und wer – denken Sie – steht hinter Salzman?«, fragte McKinley.
»Die Chinesenmafia«, erwiderte ich. »Das Haus, das Salzman bewohnte, gehört einem Mann namens Hsien Hsing-hai. Er ist stiller Teilhaber an einem Speiserestaurant, das Chi Wong betreibt. Hierbei handelt es sich um den Red Dragon in der Bayard Street.«
»Sind Sie der Meinung, dass Hsing-hai und Chi Wong der chinesischen Mafia angehören?«
»Das weiß ich nicht.«
»Haben Sie Hsing-hai wegen der Ermordung Salzmans schon vernommen?«, fragte McKinley.
»Nein. Aber das werden wir sofort nachholen.«
Wir fuhren in die Pell Street und trafen Hsien Hsing-hai an. Das Lächeln schien ihm ins Gesicht geklebt worden zu sein. Als er mich ansah, hatte ich das Empfinden, von einem Reptil angestarrt zu werden. »Sie schon wieder?« Es hörte sich ungeduldig an und passte überhaupt nicht zu seinem Lächeln.
»Können wir drinnen reden?«, fragte ich und vollführte mit der rechten Hand eine entsprechende Geste ins Innere der Wohnung.
»Sicher, kommen Sie herein. Ich weiß nichts von den Machenschaften meines Mieters. Aber das habe ich Ihnen ja schon gesagt.«
Wir gingen in die Wohnung, und Hsing-hai schloss die Tür, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und musterte uns erwartungsvoll.
»Ihr Mieter wurde ermordet«, sagte ich.
Im Gesicht des Chinesen zuckte kein Muskel. »Wer sich in die Gefahr begibt, kommt darin um«, dozierte Hsing-hai.
»Was meinen Sie?«
»Nun, er hat verbotener Weise mit Nashorn-Hörnern gehandelt. Das haben Sie mir selbst berichtet. Es ist kaum anzunehmen, dass er keine Helfershelfer hatte. Wahrscheinlich ist er seinen Komplizen unbequem geworden, nachdem Sie seine Machenschaften aufgedeckt haben. Und darum brachten sie ihn um. In solchen Kreisen fackelt man nicht lange.«
»Sie wissen ja ziemlich gut Bescheid.«
»Ich lese die Zeitung, und ich sehe mir die Nachrichten auf dem lokalen Sender an. Der Handel mit Aphrodisiaka ist ebenso illegal wie der Drogenhandel. Und dafür, wie die Drogenmafia mit Leuten, die ihr gefährlich werden können, umgeht, gibt es genügend Beispiele.«
Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er genau wusste, wovon er sprach. Er tanzte uns auf der Nase herum. Aber wir hatten keinen Hebel, wo wir ansetzen hätten können. Hsing-hai war schlüpfrig wie ein Aal. Sein Gesicht mutete an wie eine Maske. Er verriet sich mit keinem Wimpernschlag.
Vielleicht war es aber auch meiner Aversion ihm gegenüber zuzuschreiben, dass ich ihm nicht so recht glauben wollte. Instinktives Misstrauen – das war es. Im Laufe der Jahre, in denen ich beim FBI arbeitete, hatte ich ein gerütteltes Maß an Menschenkenntnis erworben, ich roch es geradezu, wenn man mir unehrlich begegnete.
Wir verließen die Wohnung des Chinesen und fuhren nach Queens. Die Türen des Hauses waren von der Staatsanwaltschaft versiegelt worden, auch das Garagentor. Ich schaute durch das Fenster in die Garage, konnte aber nichts sehen, außer dem matt glänzenden Blech eines Autos. Ich war mir sicher, dass die Garage von den Kollegen ausgeräumt worden war.
Ich rief bei der Staatsanwaltschaft an. Man sagte uns zu, einen kompetenten Mann zu schicken, der uns in die Wohnung lassen und hinterher die Tür wieder versiegeln würde.
Unsere Geduld wurde auf eine lange Probe gestellt. Der Staatsanwalt kam erst nach fast einer Stunde. Er brach eines der Siegel auf und öffnete uns die Tür mit einem Nachschlüssel. Wir gingen in das Haus. Die Kollegen von der SRD hatten unübersehbare Spuren hinterlassen. Feiner schwarzer Puder bedeckte jede Oberfläche, auf der ein Fingerabdruck zu finden sein könnte.
Der Computer fehlte. Nur der Monitor, ein Scanner, zwei Lautsprecher und ein Drucker standen auf dem Schreibtisch, außerdem lagen einige Kabel da, die von den peripheren Geräten zum Tower geführt hatten.
Wir durchsuchten noch einmal sämtliche Schränke und Sideboards, fanden aber nicht den geringsten Hinweis darauf, welche Kontakte Salzman gepflegt hatte. Ich nahm den Telefonhörer vom Apparat und drückte die Rufwiederholungstaste. Eine sexy-rauchige Stimme meldete sich und erklärte mir, dass es 12 Uhr 35 war. Die letzte Telefonverbindung Salzmans war also die mit der automatischen Zeitansage gewesen.
Ich rief bei der SRD an und erkundigte mich, ob man die Telefonate Salzmans der letzten Zeit vor seinem Tod überprüfen würde. Der Kollege hörte sich fast beleidigt an, als er sagte: »Das gehört dazu wie ein Festplattencheck, die Sicherung von Fingerabdrücken und die Feststellung der DNA anhand von Haaren, Blutflecken, Sperma und, und, und …«
»Bei welcher Telefongesellschaft war Salzman Kunde?«
»T-Mobile USA. Wollen Sie uns etwa vorgreifen?«