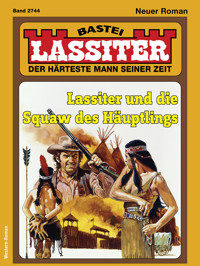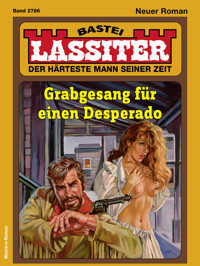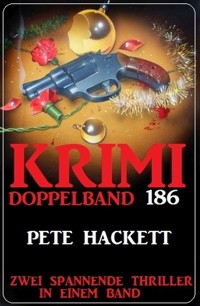
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Trevellian und die späte Reue (Pete Hackett) Trevellian und der geheimnisvolle Mörder (Pete Hackett) Milo Tucker und Jesse Trevellian, Spezialagenten des FBI, sind in New York erfolgreich, um eine Drogenmafia dingfest zu machen. Sie wissen aber, dass deren Platz andere Kriminelle einnehmen werden. Gleichzeitig trachtet ein Unbekannter nach Milos Tuckers Leben. Drei Anschläge überlebt er mit viel Glück. Beide Agenten müssen diesen Unbekannten ausschalten. Die Situation spitzt sich zu und Milo muss sich etwas einfallen lassen, um sich und seinen Kollegen zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett
Krimi Doppelband 186
Inhaltsverzeichnis
Krimi Doppelband 186
Copyright
Trevellian und die späte Reue: Action Krimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Trevellian und die geheimnisvollen Mörder
Krimi Doppelband 186
Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian und die späte Reue (Pete Hackett)
Trevellian und der geheimnisvolle Mörder (Pete Hackett)
Milo Tucker und Jesse Trevellian, Spezialagenten des FBI, sind in New York erfolgreich, um eine Drogenmafia dingfest zu machen. Sie wissen aber, dass deren Platz andere Kriminelle einnehmen werden. Gleichzeitig trachtet ein Unbekannter nach Milos Tuckers Leben. Drei Anschläge überlebt er mit viel Glück. Beide Agenten müssen diesen Unbekannten ausschalten. Die Situation spitzt sich zu und Milo muss sich etwas einfallen lassen, um sich und seinen Kollegen zu retten.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER TONY MASERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und die späte Reue: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 124 Taschenbuchseiten.
Zweiundzwanzig Jahre ist es her, dass vier Männer einen Bankraub beginnen. Sie haben alle eine bürgerliche Existenz aufgebaut, als ohne Vorwarnung einer von ihnen umgebracht wird. Die übrigen bekommen Drohbriefe und versuchen sich zu schützen. Vergeblich. Die FBI-Agenten Trevellian und Tucker stellen fest, dass sie nicht nur einen Mörder jagen.
1
Randolph McNelly schaute auf seine Armbanduhr. Es war kurz vor neunzehn Uhr. Seine Sekretärin und die Schreibkraft hatten bereits ihren Feierabend angetreten. Der Rechtsanwalt blätterte eine Seite in der Akte um, die er gerade studierte. Es ging um einen Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. McNelly vertrat den Unfallverursacher. Er las den Schriftsatz der gegnerischen Seite zu Ende, dann griff er nach dem Diktiergerät. »Bitte schreiben Sie in der Sache …«
Es läutete. McNelly schaltete das Diktiergerät aus und legte es zur Seite. Er erhob sich und verließ sein Büro, öffnete die Tür zu dem Korridor, in dem seine Kanzlei untergebracht war, und sah einen Mann Mitte dreißig vor sich, der verlegen lächelte und sagte: »Ich bin ein paar Minuten früher dran. Entschuldigen Sie.«
McNelly ahnte nicht, dass er sich mit dem Tod verabredet hatte.
»Sie sind Mister Henders, nicht wahr? Kommen Sie herein.« McNelly geleitete den Besucher in sein Büro und forderte ihn auf, Platz zu nehmen. Als der Mann saß, fragte er: »In welcher Angelegenheit kommen Sie zu mir?«
»Es ist eine heikle Angelegenheit«, kam es nichtssagend zurück. Der Besucher, der sich Henders nannte, lächelte hintergründig und griff unter seine Jacke. Als seine Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie eine Pistole mit aufgeschraubtem Schalldämpfer.
Der Rechtsanwalt prallte zurück. Sein Gesicht veränderte sich, zeigte tiefes Erschrecken, seine Augen flackerten unruhig. »Was soll das?«, entrang es sich ihm. »Was …«
»Ich sagte es ja: Es ist eine heikle Angelegenheit. Aber es wäre vergeudete Zeit, es Ihnen lang und breit zu erklären.« Mit dem letzten Wort drückte Henders ab. Der Schalldämpfer schluckte die Detonation. Die Wucht der Kugel riss McNelly vom Stuhl. Er kam gar nicht mehr richtig zum Denken. In seiner Brust schien eine Explosion stattzufinden. Dann schwanden ihm die Sinne. Aus dem Zustand der Besinnungslosigkeit glitt er hinüber in den Tod.
Ohne die Spur einer Gemütsregung starrte der Killer auf die reglose Gestalt. Ein brutaler, gnadenloser Zug hatte sich in seinen Mundwinkeln eingeprägt. Er erhob sich und verstaute die Pistole unter der Jacke. Dann verließ er das Büro.
2
Mr. McKee bat uns, zu ihm zu kommen. Milo und ich ließen ihn nicht warten. Mandy lächelte uns freundlich zu. »Geht nur hinein. Der Kaffee kommt gleich.«
»Du bist ein Schatz«, grinste Milo.
Dann betraten wir das Büro des Assistant Directors. Er telefonierte. Mit einer Handbewegung forderte er uns auf, Platz zu nehmen. Wir setzten uns an den kleinen Besprechungstisch. Nachdem der AD das Gespräch beendet hatte, kam er zu uns, gab jedem von uns die Hand und setzte sich.
Erwartungsvoll musterten wir ihn.
»Das Police Department hat einen delikaten Fall an uns abgegeben, Gentlemen«, begann der Chef. »Es geht um den Mord an einem Rechtsanwalt. Sein Name ist Randolph McNelly. Er wurde am Abend des elften April in seinem Büro erschossen.«
»Vor einer Woche also«, schloss ich.
»Genau gesagt vor sechs Tagen«, verbesserte Mr. McKee.
»Seit wann sind wir für Mord zuständig?«, fragte Milo.
»Im Büro des Rechtsanwalts wurde eine Pistole gefunden«, sagte Mr. McKee. »Eine nicht registrierte Waffe. Sie wurde einer ballistischen Analyse unterzogen.« Der AD machte eine kurze Pause. »Mit dieser Waffe wurde vor über zwanzig Jahren bei einem Bankraub in New Jersey ein Angestellter erschossen.«
Ich pfiff zwischen den Zähnen.
»Das ist ein Hammer«, murmelte Milo.
»Der Bankraub wurde nie geklärt«, ergriff wieder Mr. McKee das Wort. »Es waren damals vier maskierte Räuber. Sie entkamen unerkannt. Der Fall wurde irgendwann ad acta gelegt. Doch jetzt, nach fast einem Vierteljahrhundert, sieht es so aus, als würde sich eine Spur zu den Räubern abzeichnen.«
»Man geht also davon aus, dass McNelly an dem Bankraub beteiligt war?«, fragte ich.
»Auf der Pistole wurden ausschließlich seine Fingerabdrücke festgestellt«, antwortete der AD. »Die Mordkommission nimmt an, dass vielleicht der Bankraub und der Mord an McNelly in einem Zusammenhang stehen.«
»Das ist natürlich nicht auszuschließen«, murmelte ich.
»Klären Sie den Bankraub«, sagte der AD. »Und wenn Sie ihn geklärt haben, wissen wir vielleicht auch, wer McNellys Mörder ist. Noch etwas, meine Herren. Bei der forensischen Untersuchung wurde festgestellt, dass McNelly an Darmkrebs erkrankt war. Er hätte höchstens noch ein halbes Jahr zu leben gehabt. Unklar ist, ob er über seine lebensbedrohliche Erkrankung im Bilde war.«
Mr. McKee erhob sich, ging zu seinem Schreibtisch und nahm eine dünne Mappe, mit der er zu uns zurückkam. In diesem Moment kam Mandy mit einer Thermoskanne ins Büro. Der Chef reichte mir die Mappe. »Das sind die Gutachten und Protokolle den Mord an McNelly betreffend. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.«
3
Ich sprach mit dem ermittelnden Beamten von der Mordkommission Manhattan. »In McNellys Terminkalender ist vermerkt, dass er um neunzehn Uhr einen Termin mit einem gewissen Henders vereinbart hatte«, erklärte der Kollege. »Es ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem Henders um seinen Mörder handelt. Wobei nicht anzunehmen ist, dass der Mörder unter seinem richtigen Namen einen Termin vereinbarte.«
»Wurden irgendwelche Spuren festgestellt, die einen Hinweis auf den Mörder zuließen? Fingerabdrücke zum Beispiel? Was hat die ballistische Analyse ergeben?«
»Fingerabdrücke gab es eine ganze Reihe, unter anderem die Prints eines Mannes namens Ben Carson, der polizeibekannt ist. Carson wurde überprüft. McNelly hat ihn in einer Strafsache vertreten. Carson hat für die Zeit des Mordes ein hieb- und stichfestes Alibi. Es ist auch kein Grund ersichtlich, der ihn bewogen haben könnte, seinen Rechtsanwalt umzubringen. Die tödliche Kugel war vom Kaliber neun Millimeter Luger. Keine Übereinstimmung mit registrierten Geschossen.«
»Also kein Hinweis auf die Person des Mörders«, konstatierte ich.
»Das ist leider so, Trevellian.«
Ich bedankte mich und beendete das Gespräch.
»Das ist nicht viel«, kam es von Milo, der dank des aktivierten Lautsprechers jedes Wort verstehen konnte, das gesprochen worden war. »Man kann auch sagen, das ist gar nichts.«
»McNelly war vierundvierzig Jahre alt«, bemerkte ich. »Der Bankraub fand vor zweiundzwanzig Jahren statt. Zu dieser Zeit müsste McNelly noch studiert haben.«
»Und als Student brauchte er sicher das Geld. Wie viel wurde damals überhaupt erbeutet?«
»Dreihunderttausend Dollar. Bei vier Tätern waren das fünfundsiebzigtausend für jeden. Ein warmer Regen für einen sicher nicht mit Reichtümern gesegneten Studenten.«
Milo grinste. »Warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen, als ich studierte? Auch ich war ziemlich mittellos.«
»Du warst eben schon in jungen Jahren ein gesetzestreuer Bürger«, versetzte ich flapsig.
»Darum bin ich zu nichts gekommen. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Aber Spaß beiseite, Jesse. Wir sollten uns mal mit McNellys Sekretärin unterhalten, natürlich auch mit seiner Gattin. Vielleicht auch mit McNellys Eltern, falls sie noch leben. Wäre doch interessant, zu erfahren, wie er als zweiundzwanzigjähriger Student sein Leben meisterte.«
Die Sekretärin hieß Amalie Stoneborn. Sie war um die fünfzig Jahre alt, hatte die dunkel gefärbten Haare zu einem Knoten gebunden und trug eine Brille mit rosarotem Rahmen. Da McNellys Kanzlei geschlossen war, statteten wir der Lady unseren Besuch in ihrer Wohnung ab.
»Ich kann es noch gar nicht fassen«, murmelte sie. »Das ist alles so schrecklich. Mister McNelly war doch so ein guter Mann. Er zerriss sich fast für seine Mandanten.«
»War es üblich, dass er Abends arbeitete?«, erkundigte ich mich.
»Er arbeitete sogar an den Wochenenden«, erwiderte Mrs. Stoneborn. »Er war ein Workaholic und seiner Arbeit zuliebe vernachlässigte er sogar seine junge Frau. Wir haben uns oft gefragt, wie sie das so erträgt.«
»Was wissen Sie über den Termin am elften April um neunzehn Uhr?«
»Nichts. Mir sagt der Name Henders nichts. Es handelt sich um keinen unserer Mandanten. Ich weiß nur, dass dieser Henders ein paar Tage vor dem elften anrief und um einen Termin bat. Nach Absprache mit Mister Henders legte ich den Termin fest. Dieser Henders erklärte, dass er tagsüber nicht in New York sei und bat um einen Termin am Abend.«
»Sicher«, murmelte Milo. »Er wollte McNelly alleine in der Kanzlei antreffen. Wann machten Sie am elften Feierabend, Mrs. Stoneborn?«
»Ich verlasse immer zwischen siebzehn und achtzehn Uhr die Kanzlei. Ebenso die Schreibkraft.«
»Das muss der Mörder gewusst haben«, sagte ich. »Wahrscheinlich war er über die Gewohnheiten hier gut unterrichtet.«
»Vereinbarte Mister McNelly des öfteren Termine außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Kanzlei?«, wollte Milo wissen.
»Natürlich«, erwiderte die Sekretärin. »Terminvereinbarungen nach Feierabend oder an den Wochenenden waren nicht unüblich.«
»Wurde Mister McNelly eventuell bedroht?«
»Davon weiß ich nichts.«
Mrs. Stoneborn konnte uns nicht weiterhelfen. Wir fuhren nach Clinton, in die 54th Street. Dort befand sich McNellys Wohnung. Mrs. McNelly öffnete uns die Tür. Es handelte sich um eine dunkelhaarige, ausgesprochen attraktive Frau Ende zwanzig. Ihre langen Haare fielen in weichen Wellen auf Schultern und Rücken. Über die Gegensprechanlage hatte ich ihr schon unsere Namen genannt und sie auch nicht im Unklaren darüber gelassen, dass wir vom FBI kamen.
»Ich bin Special Agent Trevellian«, stellte ich mich vor. »Mein Kollege Tucker. Können wir mit Ihnen sprechen, Mrs. McNelly?«
»Kommen Sie herein.«
Das Wohnzimmer, das wir betraten, was luxuriös eingerichtet. Man sah auf den ersten Blick, dass der Hausherr kein armer Mann war. Die Möbel waren gediegen, in schweren Vitrinen glitzerte Bleikristallglas, die Gemälde an den Wänden waren echt, bei dem Teppich handelte es sich gewiss um einen echten Perser, die Polstergarnitur war aus weißem Leder und wirkte ausgesprochen wuchtig.
»Nehmen Sie Platz, Agents«, forderte uns die Frau auf. Als wir saßen, ließ auch sie sich nieder. Sie verschwand fast in dem Sessel. Diese Frau mutete zart und zerbrechlich an. Ihr Kinn war weich geformt, ihr Mund schön geschnitten. Der Blick ihrer dunklen Augen war unergründlich. Sie zog mit ihrer Erscheinung und ihrer Ausstrahlung sicher jeden Mann in ihren Bann.
Ich machte mich frei von subjektiven Gedanken jedweder Art und sagte: »Sie können sich denken, weswegen wir zu Ihnen gekommen sind, Ma‘am.«
Sie nickte. »Es ist furchtbar. Jemand muss meinen Mann gehasst haben. Ein anderer Grund als Hass ist für den niederträchtigen Mord nicht erkennbar. Vielleicht einer seiner Prozessgegner.«
Trotz allem schien sie mir sehr gefasst zu sein.
»Sprach Ihr Mann mit Ihnen über die Verabredung am elften um neunzehn Uhr?«, fragte ich.
»Ja. Er wies mich darauf hin, dass es wieder einmal später werden würde, weil er sich mit einem Mann verabredet habe, der tagsüber keine Zeit hat, einen Termin wahrzunehmen.«
»Nannte er einen Namen?«
»Nein.«
»Sprach Ihr Mann davon, dass er bedroht werde?«
Wieder verneinte die Frau. »Ich wüsste nicht, dass mein Mann irgendwelche Feinde hatte«, fügte sie hinzu.
»Nennen Sie uns seine Freunde«, forderte Milo.
Die Frau musste nicht lange nachdenken. »Mein Mann arbeitete viel – viel zu viel – und hatte keine Zeit für irgendwelche Freunde. Manchmal traf er sich mit einem früheren Studienkollegen zum Essen. So vier- bis fünfmal im Jahr. Jason Mennert war während des Studiums der beste Freund meines Mannes.«
»Mennert studierte auch Jura?«
»Ja. Er ist Abteilungsleiter bei der Stadtverwaltung.«
»Kennen Sie Mennert persönlich?«
»Ich war einige Male dabei, wenn Sie sich trafen. Mennert wohnt in East zweiundzwanzigsten Straße. Ich kann Ihnen seine Telefonnummer geben.«
»Ich bitte darum«, sagte ich.
Cora McNelly ging zum Telefon, das auf einem Board stand, klappte ein Register auf, nahm einen Notizzettel und vermerkte darauf die Telefonnummer, dann kam sie zurück und gab mir den Zettel. Sie hatte den Namen dazugeschrieben. Ich gab den Notizzettel Milo. »Leben die Eltern Ihres Mannes noch?«
»Nur die Mutter. Sie wohnt in Staten Island, Conger Street.«
Milo notierte die Adresse.
»Im Büro Ihres Mannes wurde eine Pistole gefunden«, fuhr ich fort. »Haben Sie eine Ahnung, woher er sie hat?«
Unter dem linken Auge der Frau begann ein Muskel zu zucken. Zeichen einer inneren Erregung? Ich registrierte es. »Ich hatte keine Ahnung, dass mein Mann überhaupt eine Waffe besitzt«, sagte Cora McNelly.
»Mit dieser Waffe wurde vor zweiundzwanzig Jahren ein Bankraub in New Jersey verübt. Ein Bankangestellter wurde mit ihr erschossen.«
Ihr Gesicht verschloss sich. »Sie denken doch nicht, dass mein Mann eine Bank überfallen hat?«
»Aus welchen Verhältnissen stammt Ihr Mann? Waren seine Eltern gut situiert? Wissen Sie, wie er sein Studium finanzierte?«
»Sein Vater war Kraftfahrer bei einer Spedition, die Mutter war Hausfrau und zog fünf Kinder auf. Aus den Erzählungen weiß ich, dass es der Familie meines Mannes nicht gerade rosig ging. Randolph kellnerte, um sich das Geld für sein Studium zu verdienen. Von zuhause konnte er keine finanzielle Unterstützung erwarten. – Daraus schließen Sie doch nicht etwa, dass er eine Bank überfiel? Du lieber Himmel, doch nicht Randolph!«
»Seit wann kennen Sie Ihren Mann?«
»Ich lernte ihn vor sieben Jahren kennen. Vor vier Jahren haben wir geheiratet.«
Wir stellten noch einige mehr oder weniger belanglose Fragen, ihr Verhältnis zu ihrem Mann betreffend, im Hinblick auf seine Geschwister, hinsichtlich seiner beruflichen und außerberuflichen Gewohnheiten. Dabei erfuhren wir, dass er seit zwei Jahren Mitglied in einem Golfclub war, in der ganzen Zeit aber allenfalls zweimal dem Golfspiel frönte. »Randolph kannte nur seine Arbeit«, erklärte Mrs. McNelly. »Für sie lebte und – und …«
Sie brach ab und schluckte würgend.
… starb er, wollte sie wohl sagen. Sekundenlang herrschte betretenes Schweigen. Dann fragte ich: »Wussten Sie, dass Ihr Mann an Darmkrebs litt?«
»Nein. Falls er Bescheid wusste, sprach er nie mit mir darüber.« Tränen füllten ihre Augen. »Ich – ich kann das alles noch gar nicht begreifen. Ich kann einfach nicht glauben, dass er tot sein soll.«
»Wer ist sein Arzt?«, fragte Milo.
Cora McNelly nannte uns den Namen und die Adresse. Dann verließen wir sie.
4
Randolph McNellys Mutter bestätigte, was wir schon von Cora McNelly vernommen hatten. Randolph McNelly hatte sich sein Studium durch Aushilfsjobs finanziert. Mrs. McNelly wurde, während wir mit ihr sprachen, immer wieder von ihren Gefühlen übermannt und weinte. Was wir von ihr erfuhren, half uns nicht weiter. Auch sie hatte keine Ahnung, dass ihr Sohn an Darmkrebs erkrankt war.
Wir sprachen mit McNellys Arzt. »McNelly wusste Bescheid«, gab der Doc zu verstehen. »Als ich ihm die Diagnose eröffnete, blieb er erstaunlich ruhig – geradezu unheimlich ruhig.«
»Warum wurde er nicht behandelt?«
»Der Krebs hatte in seinem Körper schon überall Metastasen gebildet. Es gab keine Hilfe mehr. McNelly ertrug sein Schicksal mit bewundernswerter Tapferkeit. Ich glaube, das Wissen um seinen nahen Tod ließ ihn noch verbissener arbeiten. Vielleicht suchte er in seiner Arbeit auch nur Ablenkung von der Tatsache, todgeweiht zu sein.«
Als wir auf dem Weg in die 22nd Street waren, sagte Milo: »Es scheint keinen dunklen Punkt im Leben McNellys zu geben. Er jobbte während seines Studium, wurde ein angesehener Anwalt, verdiente eine Menge Geld, riss sich für seine Mandanten den Hintern auf. Glaubst du, dass ein solcher Mann eine Bank überfällt und einen Angestellten erschießt?«
»Die Pistole, die in seinem Büro gefunden wurde, spricht dafür.«
»Vielleicht ist er erst später in ihren Besitz gelangt«, wandte Milo ein.
Ich zuckte mit den Schultern. »Leider kann er uns darauf die Antwort nicht mehr geben.«
Jason Mennert wohnte im Gebäude Nummer 132. Es war das Penthouse, das er bewohnte. Auf mein Klingeln öffnete niemand. »Wir hätten uns telefonisch rückversichern sollen, ob er zuhause ist«, sagte ich zu Milo.
Im Sportwagen, der über einen Bordcomputer verfügte, suchte ich die Telefonnummer der Stadtverwaltung heraus. Dann rief ich dort an und ließ mich mit Jason Mennert verbinden. »Guten Tag, Mister Mennert«, sagte ich, dann nannte ich meinen Namen und stellte mich als FBI-Agent vor. »Wir würden Sie gerne sprechen.«
»In welcher Angelegenheit?«
»Es geht um den Mord an Randolph McNelly.«
»Ich dachte es mir. Nun, es ist vielleicht nicht so gut, wenn das FBI an meinem Arbeitsplatz erscheint. Kann ich zu Ihnen kommen?«
»Natürlich.« Ich nannte ihm das Stockwerk und die Zimmernummer im Federal Building, dann vereinbarten wir, dass er am kommenden Vormittag um neun Uhr bei uns vorsprechen sollte.
Er kam pünktlich. Mennert war ein großer, schlanker Mann, dessen Haare sich schon grau zu färben begannen. Er knetete unablässig seine Hände. Ich fragte mich, ob ihn die Tatsache, dass wir vom FBI waren, so nervös machte.
Als er saß, begann ich: »Sie wissen, dass Randolph McNelly in seinem Büro erschossen wurde.«
»Natürlich.« In seinen Mundwinkeln zuckte es. »Es hat in allen Zeitungen gestanden, außerdem brachten es die Lokalnachrichten. Furchtbar! Haben Sie schon eine Spur zu seinem Mörder?«
»Nein. Sie waren Mister McNellys Freund?«
»Während unserer Studienzeit waren wir die besten Freunde«, erzählte Mennert. »Aber dann trennten sich unsere Wege und wir trafen uns nur noch selten. Ganz riss der Kontakt jedoch nicht ab. So ungefähr alle drei Monate trafen wir uns zu einem gemeinsamen Essen. Rand war ziemlich eingespannt.«
»Hatte er außer Ihnen noch Freunde?«
»Wir gehörten einer Studentenverbindung an. Sicher waren da noch einige Kommilitonen, mit denen so etwas wie eine lose Freundschaft bestand.«
»Welche Studentenverbindung?«
»Phi Delta Phi.«
»Was bedeutet das im Klartext?«, fragte Milo.
»Philous Dikaiooi Philosophoi. Die griechischen Buchstaben stehen für das Motto der Verbindung und bedeuten Freunde der Justiz und der Weisheit.«
»Sie haben auch Jura studiert?«
»Richtig. Nach dem Staatsexamen habe ich mich für einen Job im öffentlichen Dienst entschieden.«
»Nennen Sie uns Namen«, forderte ich.
Er schaute mich fragend an.
»Die Namen der Kommilitonen, mit denen McNelly eine lose Freundschaft verband.«
Mennert legte die Stirn in Falten. Dann sagte er: »Wilson Bancroft, Dennis Wolters, John Vanderbildt, Glenn Patterson. Es gab sicher noch einige mehr, aber sie fallen mir im Moment nicht ein. Warum wollen Sie die Namen wissen? Denken Sie, dass einer der Männer etwas mit dem Mord an McNelly zu tun hat?«
»Es besteht der Verdacht, dass Randolph McNelly an einem Bankraub beteiligt war, der vor zweiundzwanzig Jahren stattfand«, sagte ich.
Einen Moment biss Mennert die Zähne zusammen. Hart traten die Backenknochen aus seinem Gesicht hervor. Doch dann lachte er schallend auf und stieß hervor: »Das soll wohl ein Witz sein?« Er schaute mich an und sein Grinsen erstarrte. »Sie machen doch Witze, Agent, oder etwa nicht?«
»Sehe ich aus wie ein Witzbold?«
Das Grinsen in seinem Gesicht war vollkommen erloschen. Er zwinkerte. »Wie kommen Sie darauf?«
»In seinem Besitz befand sich die Pistole, mit der ein Bankangestellter bei dem Überfall erschossen wurde.«
»Das muss nichts bedeuten.«
»Muss es nicht. Doch dann stellt sich die Frage, wie McNelly in den Besitz der Waffe kommt.«
Milo mischte sich ein. »Haben Sie noch Verbindung zu Bancroft, Wolters, Vanderbildt und – äh …«
»… Patterson.«
»Genau«, sagte Milo und grinste etwas verlegen. »Ich werde mir die Namen aufschreiben müssen.«
»Nein«, sagte Mennert kopfschüttelnd. »Ich habe zu keinem von denen noch Kontakt. Nachdem wir unser Studium beendet hatten, riss er ab. Bancroft ist Richter, Wolters ist in der Zwischenzeit Leiter der juristischen Abteilung der Bowery Savings Bank. Was Vanderbildt und Patterson treiben, weiß ich nicht.«
»Wie finanzierten Sie Ihr Studium?«, fragte ich. »Von McNelly wissen wir, dass er jobbte.«
»Nun, meine Eltern waren gut situiert, mein Vater war Steuerberater und betrieb eine eigene Kanzlei.«
»Sie Glücklicher konnten sich also voll und ganz Ihrem Studium widmen«, meinte Milo mit einem süffisanten Grinsen um die Lippen.
»Ja, ich habe meinen Eltern sehr viel zu verdanken.«
»Können Sie uns die Adressen von Bancroft, Wolters, Vanderbildt und Patterson nennen?«, fragte Milo.
»Nein. Wie ich schon sagte: Der Kontakt riss vor fast zwanzig Jahren ab, nachdem wir das Studium beendet hatten. Danach ging jeder seiner Wege.«
»Hast du noch Fragen, Milo?«
»Im Moment nicht.«
Ich gab Mennert eine von meinen Visitenkarten. »Falls Ihnen noch etwas einfällt, das für uns von Interesse sein könnte, rufen Sie mich bitte an.«
Jason Mennert schob die Karte ein, erhob sich, reichte mir die Hand und sagte: »Rand war sicher kein Kind von Traurigkeit. Aber eine Bank hat er ganz sicher nicht überfallen. Er musste während seiner Studienzeit sozusagen von der Hand in den Mund leben. Es wäre aufgefallen, wenn er plötzlich über Geld verfügt hätte – mehr Geld, als er aufgrund seiner Situation haben konnte.«
Mennert verabschiedete sich auch von Milo, dann verließ er das Büro. Milo und ich wechselten einen Blick. »Was hältst du von ihm?«, fragte Milo.
»Gehobener Mittelstand, typischer Beamter, der in seinem Leben wahrscheinlich noch nicht einmal falsch geparkt hat.«
»Der erste Eindruck kann oft täuschen.«
»Sicher«, murmelte ich, griff nach einem Kugelschreiber, zog ein Blatt Papier aus dem Drucker und schrieb die Namen auf, die uns Mennert genannt hatte, ehe wir sie wirklich vergaßen. Dann machten wir uns an die Arbeit. Ich rief bei der Bowery Savings Bank an. Auch Milo griff nach dem Telefonhörer. Seine Aufgabe war es, herauszufinden, wo Wilson Bancroft und John Vanderbildt wohnten.
Eine halbe Minute später hatte ich Dennis Wolters am Apparat. Er besaß eine angenehme, dunkle Stimme. Ich klärte ihn auf, weshalb ich anrief. Als ich ihn fragte, wann ich ihn sprechen könnte, bat er mich, ihn nach Feierabend zuhause aufzusuchen. Er wohnte in Queens, Ruscoe Street, Nummer 98. Ich erklärte ihm, dass wir um neunzehn Uhr bei ihm vorsprechen würden.
Laut Telefonbuch gab es nur einen Glenn Patterson in New York City. Ich rief ihn an. Seine Frau meldete sich. Ich fragte sie, ob ihr Mann Jura studiert habe. Sie verneinte. Ihr Mann sei Arbeiter in einer Kartonagenfabrik erklärte sie, ich bedankte mich und beendete das Gespräch. Bei diesem Glenn Patterson handelte es sich nicht um den Mann, den wir suchten.
Milo legte auf. Er hatte sich einige Notizen gemacht, während er sprach. Jetzt sagte er: »Bancroft ist Richter im Criminal Courts Building. Er wohnt zwei-sieben-fünf Greenwich Avenue. Wir können ihn jederzeit in seinem Büro besuchen. Morgen Vormittag leitet er allerdings eine Verhandlung.«
»Um neunzehn Uhr haben wir eine Verabredung mit Wolters. Wir machen einen Ausflug nach Queens.«
»Vorher sollten wir einen Happen essen«, schlug Milo vor. »Eine Pizza mit Schinken und Champions wäre sicher nicht zu verachten.«
»Dagegen ist gewiss nichts einzuwenden«, erklärte ich.
»Vorher aber will ich noch herausfinden, wo wir diesen John Vanderbildt finden«, sagte Milo, griff nach der Computermaus und fing an zu klicken.
5
Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, Dennis Wolters ins Federal Building vorzuladen. Aber wir wollten etwas von ihm, und wir hatten es uns zur Gewohnheit gemacht, unsere Fälle vorsichtig anzugehen und nicht voreilig mit Kanonenkugeln auf Spatzen zu schießen. Während wir nach Queens fuhren, sagte Milo: »Nehmen wir mal an, Bancroft, Wolters, Mennert, Vanderbildt und Patterson haben damals zusammen mit McNelly die Bank überfallen …«
»Es waren insgesamt nur vier Bankräuber«, wandte ich ein, ehe Milo weitersprechen konnte.
»Okay, dann eben McNelly und drei von den Genannten. Kann es nicht sein, dass wir McNellys Mörder unter seinen ehemaligen Komplizen suchen müssen?«
»Möglich ist alles. Aber was könnte nach dieser langen Zeit das Motiv für den Mord sein?«
»Das ist die Frage.«
Das Gespräch schlief wieder ein. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Was Milo angesprochen hatte, war natürlich nicht von der Hand zu weisen. Der ganze Fall war ziemlich mysteriös. Fakt war nur, dass McNelly ermordet wurde, dass er zusammen mit drei Komplizen vor zweiundzwanzig Jahren möglicherweise eine Bank überfallen hat, und dass er an einer unheilbaren Krankheit litt, die innerhalb der kommenden sechs Monate sowieso einen Schlusspunkt unter sein Leben gesetzt hätte.
Bei dem Haus, das Dennis Wolters bewohnte, handelte es sich um ein schönes Einfamilienhaus mit verspielten Erkern, das in einem mittelgroßen Grundstück lag, das von einer mannshohen Hecke begrenzt wurde. Die Zufahrt zur Garage war gepflastert. Zwischen dem Gehweg, der zur Haustür führte, und der Garagenzufahrt gab es eine Rosenrabatte. Die Buschrosen waren wie eine Hecke zugeschnitten und hatten grün auszutreiben begonnen. Es war noch hell. Im Nachbargarten schnitt ein Mann Äste aus einem dichten Busch. Er schaute zu uns her. Ich nickte ihm zu. Dann läutete Milo an der Haustür. Ein Mann Mitte der vierzig öffnete. Er war mittelgroß und schmächtig. Auf seinem Kopf gab es nur noch einen dunklen Haarkranz. Er trug eine Brille, hinter deren dicken Gläsern seine Augen unnatürlich groß erschienen. »Sie sind die Gentlemen vom FBI, nicht wahr?«
Ich stellte uns vor.
»Ich habe Sie schon erwartet.« Seine sonore Stimme wollte ganz und gar nicht zu seiner Erscheinung passen. »Kommen Sie herein.«
Er verströmte Ruhe und Besonnenheit.
Im Wohnzimmer begrüßte uns Mrs. Wolters, dann entschuldigte sich die Frau, ging in einen angrenzenden Raum und schloss hinter sich die Tür.
Wir setzten uns.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, fragte Wolters höflich.
»Wir kommen gerade vom Abendessen«, antwortete ich. »Jeder von uns hat einen halben Liter Wasser zur Pizza getrunken. Aber vielen Dank, Mister Wolters.«
»Ich habe keine Ahnung, wie ich dazu beitragen könnte, den Mord an Randolph aufzuklären«, sagte Wolters und kam damit auf den Punkt.
»Sie kannten McNelly gut?«
»Wir waren Studienkollegen.«
»Dann gehörten Sie sicher auch Phi Delta Phi an«, bemerkte Milo.
»Bei dieser Organisation bin ich heute noch Mitglied. Eine internationale Juristenverbindung.« Wolters lächelte. »Das spricht doch hoffentlich nicht gegen mich?«
Auch ich lachte. Doch sogleich wurde ich wieder Ernst. »Es geht uns darum, McNellys engeren Freundeskreis während seiner Studienzeit zu bestimmen. Es besteht der Verdacht, dass McNelly vor zweiundzwanzig Jahren zusammen mit drei Gefährten in New Jersey eine Bank überfallen hat. Es war die Niederlassung der M & T Bank. Ein Bankangestellter kam bei dem Überfall ums Leben.«
»Sie suchen seine Mittäter also unter seinen Studienkollegen?«
»Es ist das Naheliegendste.«
Wolters verzog den Mund. »Steht fest, dass Randolph damals die Bank überfallen hat?«
»Nein. Bei ihm wurde lediglich die Waffe gefunden, mit der der Angestellte erschossen wurde.«
»Nun, meine Beziehung zu Randolph war nicht so eng, dass ich mit ihm eine Bank überfallen hätte. Um mein Studium zu finanzieren habe ich teils gejobbt, teils haben mich meine Eltern unterstützt.«
»Wo waren Sie am elften April um sieben Uhr abends?«
»Wurde am elften nicht Randolph ermordet?«
»Sehr richtig.«
»Stehe ich etwa im Verdacht, sein Mörder zu sein?«
»Beantworten Sie einfach die Frage, Mister Wolters«, bat ich.
»Sicher. Sie machen Ihren Job. Am elften um neunzehn Uhr war ich zuhause. Ich habe täglich um sechzehn Uhr Feierabend und es kommt nur ganz selten vor, dass ich nicht sofort nach Hause fahre. Meine Frau kann es bestätigen.« Er erhob sich, ging zu der Tür, durch die vorhin seine Gattin das Wohnzimmer verlassen hatte, und sagte: »Komm doch bitte mal heraus, Sylvia.«
Die Frau bestätigte Wolters‘ Aussage. Ich bedankte mich bei ihr, und sie fragte: »Was werfen Sie denn meinem Mann vor, weil er ein Alibi benötigt?«
»Nichts«, erwiderte ich. »Wir gehen nach dem Ausschlussprinzip vor. Nachdem Sie Ihrem Mann ein Alibi bescheinigten, brauchen wir uns mit ihm schon nicht mehr befassen.«
»Ich erkläre dir alles, wenn die Gentlemen wieder gegangen sind, Sylvia«, versprach Dennis Wolters.
Die Frau verließ das Wohnzimmer wieder.
»Hatten Sie noch Kontakt mit McNelly, nachdem Sie Ihr Studium beendet hatten?«, fragte Milo.
»Wir hatten noch einmal ein Studententreffen. Das war vier oder fünf Jahre, nachdem wir fertig waren. Ich traf dort Randolph und sprach auch kurz mit ihm. Er erzählte mir, dass er eine eigene Kanzlei eröffnet habe.«
»Was war McNelly für ein Mann?«
»Nun, er ließ nichts anbrennen, wie man so schön sagt.« Wolters grinste. »Ansonsten kann man nichts Negatives über ihn sagen. Er lieferte als einer der wenigen ein Prädikatsexamen ab. Ein hochintelligenter Bursche. Doch er hatte es nicht gerade einfach. Von zuhause hatte er nichts zu erwarten. Er war auf sich alleine gestellt. Aber er hat seine Situation gemeistert. Wenn er sich in etwas verbissen hatte, dann zog er das auch durch.«
»Er war also ein konsequenter Mann«, resümierte ich.
»So kann man ihn charakterisieren«, bestätigte Wolters.
»Hatten Sie mit Jason Mennert, Wilson Bancroft, John Vanderbildt und Glenn Patterson nach ihrem Studium noch Kontakt?«
Wolters fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Hatte ich ihn mit meiner Frage etwas aus der Fassung gebracht? Er lehnte sich in seinem Sessel zurück. Mir kam es vor, als wollte er Zeit gewinnen, um seine Antwort zu formulieren. Doch schon im nächsten Moment schüttelte er den Kopf. »Der eine oder andere von ihnen war damals bei dem Studententreffen. Ich glaube, mit Mennert habe ich damals sogar gesprochen. Himmel, das ist eine Ewigkeit her.«
»Also keinen Kontakt«, sagte Milo.
»Keinen«, bestätigte Wolters. »Ich habe andere Leute kennengelernt und unterhielt zu keinem meiner Kommilitonen nach Abschluss des Studiums Kontakt.«
»Wie eng war die Freundschaft zwischen McNelly und Jason Mennert?«
»Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Wir haben miteinander gesprochen, haben Kurse besucht, sind auch mal einen Trinken gegangen. Ich habe mich nicht dafür interessiert, wer mit wem befreundet war. Ich kann Ihnen zum Verhältnis zwischen Rand und Jason nichts sagen.«
Ich ließ auch bei Wolters eine Visitenkarte zurück. Dann fuhren wir nach Manhattan zurück. Die Sonne war untergegangen, die Schatten waren verblasst. Der Himmel war bleigrau. Zurück in Manhattan lud ich Milo bei seiner Wohnung aus, dann fuhr auch ich nach Hause.
Ich gab mich keinen Illusionen hin. Auch Bancrofts Vernehmung würde kein brauchbares Ergebnis bringen. Wir stocherten im Dunkeln herum. Nach über zwanzig Jahren einen Bankraub aufzuklären erschien mir nahezu unmöglich zu sein. Es gab keine Spuren mehr. Ich nahm mir vor, die Ermittlungsakten den Bankraub betreffend zu studieren. Vielleicht ergab sich irgendein Hinweis.
6
»Sie waren bei mir.« Mehr sagte Dennis Wolters nicht.
»Was stellten sie für Fragen?«
»Fragen, mein Verhältnis zu Rand betreffend, sie sprachen von Phi Delta Phi, wollten wissen, was Rand für ein Bursche war, und sie verlangten von mir ein Alibi für den Abend des elften April.«
»Haben diese Schnüffler etwa eine Spur aufgenommen?«
»Sie wissen nichts«, sagte Wolters mit Bestimmtheit im Tonfall. »Wobei ich mich selbst frage, wer Rand umgebracht hat. Hat der Mord überhaupt etwas mit dem Bankraub zu tun? Verdammt, wie konnte dieser Narr nur die Pistole aufheben? Er hat damals doch erzählt, dass er sie in den Hudson geworfen hat.«
»Es ist so, und wir können es nicht ändern. Aber ich glaube, wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Wir haben keine Spur hinterlassen. Sie kommen an uns nicht ran. Wie hast du unser Verhältnis beschrieben?«
»Als lose Kameradschaft«, antwortete Wolters. »Ich erklärte den Agents, dass der Kontakt nach Abschluss des Studiums abriss.«
»Was ja auch den Tatsachen entspricht. Hast du schon mit Jason gesprochen?«
»Nein.«
»Zu mir kommen die beiden Agents morgen.«
»Sie können uns nichts am Zeug flicken«, knurrte Wolters. »Allerdings dürfen wir keinen Fehler machen. Aber wir sind ja keine Dummköpfe.«
»Ich rufe dich an, sobald die Agents bei mir waren«, sagte Wilson Bancroft. »Und jetzt rufe ich Jason an. Bis dann, also.«
»Bis dann.« Wolters legte den Hörer auf den Apparat. Er zog die Unterlippe zwischen die Zähne und kaute darauf herum.
Warum musste Randolph McNelly sterben? Wer hatte ihn umgebracht? Steckten Bancroft oder Mennert dahinter? Wenn ja, was trieb sie? Bohrende Fragen, auf die Wolters keine Antwort fand. Er war misstrauisch geworden. Ja, sie überfielen damals die Bank in New Jersey. Er, McNelly, Wilson Bancroft und Jason Mennert. McNelly erschoss den Angestellten, als dieser Alarm auslösen wollte. Es war eine Kurzschlusshandlung gewesen.
Jahrelang lebte er, Dennis Wolters, in der Angst, aufzufliegen. Das gab sich, und irgendwann dachte er nicht mehr daran. Der Fall war längst irgendwo in den Archiven verstaubt. Jetzt – so schien es – hatte ihn die unselige Vergangenheit wieder eingeholt. Ein eisiger Schauer rann ihm über den Rücken hinunter und verursachte ihm Gänsehaut. Düstere Bilder stiegen aus den Nebeln der Vergangenheit.
7
Mr. McKee bat uns zu sich. Es war morgens, kurz nach acht Uhr. »Wie weit sind Ihre Ermittlungen in der Mordsache McNelly vorangeschritten?«, fragte er, nachdem er uns begrüßt hatte und wir Platz genommen hatten.
Milo und ich berichteten abwechselnd.
»Das ist noch nicht viel«, sagte der Assistant Director. »Aber es war ja auch nicht zu erwarten, dass Sie nach dieser kurzen Zeit schon Resultate vorweisen können.« Er nahm eine zusammengelegte Zeitung und hob sie hoch. »Es gibt einen Reporter oder Journalisten bei der Times, der schon um einiges weiter zu sein scheint als Sie. Aber lesen Sie selbst.«
Ich faltete die Zeitung auf. Bankraub nach über zwanzig Jahren aufgeklärt?, hieß die fette Überschrift. Untertitel: Renommierter Rechtsanwalt als Bankräuber entlarvt.
Ich war von den Socken. Dann las ich: »Der Überfall auf die M & T Bank, New Jersey, vor zweiundzwanzig Jahren, bei dem ein Angestellter erschossen wurde und vier Täter 300.000 Dollar erbeuteten, scheint endlich aufgeklärt zu sein. Bei dem kürzlich ermordeten New Yorker Rechtsanwalt Randolph McNelly wurde die Tatwaffe sichergestellt. McNelly war zur damaligen Zeit noch Jurastudent. Es ist davon auszugehen, dass die anderen Täter McNellys studentischem Umfeld zuzuordnen sind. Wie aus zuverlässiger Quelle bekannt wurde, besteht kein Zweifel an McNellys Täterschaft …«
»Von wem hat die Times die Information?«, fragte ich.
Der AD hob die Schultern, ließ sie wieder sinken und erwiderte: »Es muss im Police Department eine undichte Stelle geben. Anders ist es nicht zu erklären. Sie sind doch mit Lew Harker von der Times gut bekannt. Vielleicht können Sie herausfinden, wer der Informant ist.«
Wir kehrten in unser Büro zurück. Ich rief Lew Harker sofort an. Er meldet sich. »Hallo, Lew. Ich bin es, Jesse.«
»Ah, lange nichts gehört von dir. Ich kann mir schon denken, weshalb du anrufst.«
»Dann brauche ich mich ja nicht mit langen Erklärungen aufzuhalten. Wer hat den Artikel verfasst?«
Lew lachte. »Willst du dem armen Burschen den Kopf abreißen?«