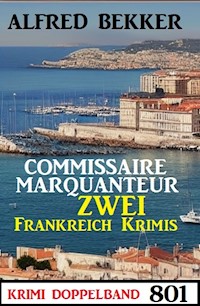Commissaire Marquanteur und der Killer von Point-Rouge:
Frankreich-Krimi
von Alfred Bekker
Ein Bandenkrieg unter Drogendealern in Marseille ruft die
Commissaire Marquanteur und die Sonderabteilung FoPoCri auf den
Plan. Unliebsame Zeugen werden durch einen Profikiller
ausgeschaltet. Als auch beteiligte Anwälte getötet werden, wird die
Suche intensiviert, aber der Killer ist geschickt. Er hat jedoch
ein eindeutiges Merkmal, auf das sich die Fahndung konzentriert –
sehr kleine Füße.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Manchmal fragt man sich, welchen Sinn all das macht, was wir
tun.
Da macht man einen Schritt vor, und dann sorgen andere dafür,
dass es hinterher wieder mindestens genauso viele Schritte zurück
geht.
Vielleicht muss ich erst einmal erklären, wer ich bin und
worum es geht, sonst können sie nicht nachvollziehen, was ich
meine. Mein Name ist Pierre Marquanteur. Ich bin Commissaire.
Soweit, so gut.
Ich gehöre zu einer Sondereinheit, die für die Bekämpfung des
organisierten Verbrechens gegründet wurde. Sie nennt sich Force
spéciale de la police criminelle und ist hier in Marseille
angesiedelt.
Zusammen mit meinem Kollegen François Leroc übernehme ich die
wirklich kniffligen Fälle, die größere Ressourcen und Fähigkeiten
benötigen.
Wir riskieren unser Leben, um unseren Job erfüllen zu
können.
Und wenn dann ein Krimineller, von dem man genau weiß, dass er
schuldig ist, durch juristische Winkelzüge wieder auf freien Fuß
kommt, dann ist das gerade für unsereins ziemlich schwer zu
verdauen.
Aber das ist wohl auch eine Seite unseres Berufs, mit der man
irgendwie klarkommen muss.
2
Hugo Grenadille hob die Hand zum Victory-Zeichen, als er die
Stufen des Gerichtsgebäudes hinab schritt. Eine Handvoll Polizisten
schirmten den Mann ab, der soeben wegen eines Verfahrensfehlers
einer Verurteilung wegen Mordes entgangen war.
Mehrere Kamerateams und Dutzende von Reportern drängten sich
um Grenadille, der die Aufmerksamkeit sichtlich genoss.
Eine Mikrofonstange reckte sich Grenadille entgegen.
»Ein kurzes Statement!«, rief jemand.
Grenadille grinste.
»Was soll ich sagen? Wir leben eben in einem Rechtsstaat«,
lachte er und bleckte dabei zwei Reihen makellos weißer Zähne.
Hugo Grenadille ahnte nicht, dass er sich in dieser Sekunde im
Fadenkreuz eines Zielfernrohrs befand.
Mein Kollege François Leroc und ich hielten uns etwas abseits
des Menschenauflaufs auf, der rund um den Haupteingang des
Gerichtsgebäudes entstanden war.
Hugo Grenadille war des Mordes an einen Barbesitzer in
Pointe-Rouge bezichtigt worden, aber Staatsanwalt David Lohmer war
mit seiner Anklage sang- und klanglos untergegangen. Es hatte sich
herausgestellt, dass Beweismittel teilweise unter gesetzwidrigen
Bedingungen erhoben worden waren. Man hatte den Verdächtigen nach
seiner Verhaftung nämlich nicht hinreichend über seine Rechte
aufgeklärt.
Darüber hinaus waren im Verlauf des Verfahrens die Zeugen der
Anklage reihenweise umgefallen, hatten ihre Aussagen zurückgezogen
oder waren nicht mehr bereit, sie vor Gericht zu bestätigen. Die
Staatsanwaltschaft vermutete, dass diese Zeugen unter Druck gesetzt
worden waren. Beweise hatte sie dafür allerdings nicht vorlegen
können.
Plötzlich hatte sich niemand mehr daran erinnern können, dass
Hugo Grenadille die Bar, in der das Verbrechen verübt worden war,
am Tatabend überhaupt betreten hatte.
Wir vom Polizeipräsidium Marseille ermittelten seit Langem
gegen jenen Mann, der als Auftraggeber dieses Mordes verdächtigt
wurde.
Niko Dragnea.
Ein Mann, der hinter vorgehaltener Hand auch als der »Wäscher
von Pointe-Rouge» bezeichnet wurde. Er war an Dutzenden von Bars,
Clubs und Diskotheken im gesamten Marseille beteiligt oder betrieb
sie in eigener Regie. Diese Etablissements, so glaubten wir,
dienten einzig und allein der Wäsche von Drogengeldern.
Hugo Grenadille, der als Dragneas Mann fürs Grobe galt, schien
sich in seiner Rolle als Medienstar immer mehr zu gefallen.
»Ich danke der Staatsanwaltschaft dafür, dass sie nicht in der
Lage war, ein ordentliches Verfahren auf die Beine zu stellen. Ich
danke außerdem meinen Anwälten, dass sie es geschafft haben, diesem
besser ungenannt bleibenden Schmalspurrechtsverdreher, der durch
politische Schleimscheißerei zum Staatsanwalt werden konnte, mal
gezeigt wurde, wo seine Grenzen sind. Es würde mich nicht einmal
wundern, wenn er sich sogar sein Universitätsdiplom und seinen
Doktorhut selbst gekauft hat.«
»Ein widerlicher Kerl«, kommentierte François den Auftritt
Hugo Grenadilles, der sich immer weiter in seinen Triumph
hineinzusteigern schien.
Plötzlich veränderte sich Hugo Grenadilles Gesichtsausdruck.
Er wurde starr. Mitten auf seiner Stirn erschien ein roter Punkt,
der rasch größer wurde. Gleichzeitig ging ein Ruck durch seinen
Körper. Er sackte in sich zusammen.
Tumult entstand.
Eine Kugel hatte Hugo Grenadilles Stirn durchschlagen.
Instinktiv ging meine Hand zum Griff meiner SIG Sauer P 226. Ich
blickte an der Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes empor, das dem
Gericht gegenüber lag. Von dort aus musste der Schuss gekommen
sein.
Das dritte Fenster im siebten Stock war offen. Ein Windstoß
wehte die Gardine ins Freie. Wahrscheinlich die Zugluft, die
entstand, wenn jemand gleichzeitig die Wohnungstür öffnete. Der
Killer machte sich offenbar schleunigst davon.
»Los! Vielleicht kriegen wir den Kerl noch!«, rief ich
François zu.
»Seit wann glaubst du an Wunder, Pierre?«
3
Wir kämpften uns durch die Menge, während im Hintergrund
bereits Sirenen von Einsatzfahrzeugen der Polizei und der
Notfallambulanz schrillten. Anschließend rannten wir über die
Straße. Der Van eines Pizza-Service bremste mit quietschenden
Reifen. Der Fahrer zeigte mir einen Vogel, ich ihm meinen
Dienstausweis des Polizeipräsidiums Marseille.
Endlich erreichten wir die andere Straßenseite.
Über Handy hatte François längst unsere Zentrale in der
Dienststelle verständigt. Von dort aus würden alle weiteren als
notwendig erachteten Maßnahmen ergriffen werden.
Wir erreichten den Eingang des gewiss schon etwas älteren,
aber in einem Top-Zustand befindlichen Hauses. Ein Bürohaus der
gehobenen Sorte – ohne den Komfort der modernen Glaspaläste, aber
mit dem Charme und dem Stil der Architektur der Dreißiger.
Anwaltskanzleien residierten hier. Die unmittelbare Nähe zum
Gerichtsgebäude war zweifellos ein Standortvorteil, der es
zumindest für Kanzleien der mittleren Kategorie attraktiver
erscheinen ließen, sich hier einzumieten statt in einer Etage
irgendeines teuren Glaspalastes.
In der Eingangshalle patrouillierten Angehörige eines privaten
Security Service in schwarzen Uniformen herum. Sie trugen
sechsschüssige kurzläufige Revolver vom Typ Smith & Wesson
Kaliber 38 an den Gürteln. Ich ging auf den ersten Mitarbeiter der
Security zu, zeigte ihm meinen Dienstausweis und sagte: »Pierre
Marquanteur, FoPoCri. Vom dritten Fenster im siebten Stock ist auf
das Portal des Gerichtsgebäudes geschossen worden. Sorgen Sie mit
Ihren Leuten dafür, dass die Ausgänge, das Treppenhaus und die
Aufzüge bewacht werden! Niemand darf das Haus verlassen, bevor
unsere Verstärkung nicht eingetroffen ist und die Personen
kontrollieren konnte.«
»Ja, kein Problem.«
Ich gab ihm meine Karte.
»Da ist meine Handynummer drauf. Melden Sie sich sofort, wenn
sich hier unten etwas tut!«
»In Ordnung.« Er steckte die Karte ein. »Drittes Fenster,
siebter Stock, sagten Sie?«
»Ja.«
»Das müssen die Räume von Watton & Partner sein. Die sind
letzte Woche ausgezogen. Seitdem steht die Etage leer, weil sich
noch kein Nachmieter gefunden hat, der bereit war, die horrende
Miete zu bezahlen!« Der Mitarbeiter der Security drehte sich um.
Sein Name stand in Großbuchstaben an seinem Uniformhemd: B. Borné.
»Hey, Jacques! Bring die Commissaires ins Siebte! Aber pass
auf! Kann sein, dass sich da oben ein schießwütiger Killer
herumtreibt.«
Jacques – dem Hemdaufdruck nach hieß er Jacques Tihange – zog
Revolver und Generalschlüssel und bedeutete uns, ihm zu folgen.
Borné bellte inzwischen Befehle an seine Leute durch die
Eingangshalle. Ein weiterer Mitarbeiter der Security, der seinen
Platz in einem Kubus aus Panzerglas hatte und von dort aus den
Eingang überwachte, griff zum Telefonhörer, um Anweisungen
weiterzugeben.
Jacques Tihange führte uns zum Treppenhaus. Wir konnten nur
hoffen, dass Borné auch wirklich meinen Anweisungen folgte und in
Kürze noch ein paar Mitarbeiter der Security hier in Stellung
gingen und sich die schwarzen Sheriffs nicht nur auf die Aufzüge
konzentrierten. Schließlich musste innerhalb kürzester Zeit dem
Täter jegliche Fluchtmöglichkeit genommen und jedes noch so kleine
Loch gestopft werden.
Wenn es nicht ohnehin schon zu spät war.
Wir nahmen jeweils zwei bis drei Stufen mit einem Schritt.
Dabei stellte sich heraus, dass es Jacques Tihange in puncto
Kondition durchaus mit zwei durchtrainierten Commissaire wie
François und mir aufnehmen konnte.
Schließlich erreichen wir den siebten Stock. Ein kurzer
Korridor führte zu den Räumen von Watton & Partner. Das
Firmenschild war abmontiert.
Lediglich ein Umriss und die Schraubenlöcher waren noch zu
sehen.
»Hieß nicht einer der Verteidiger von Grenadille Watton?«,
fragte François.
»Allerdings!«
Die Zugangstür zum Bereich von Watton & Partner war durch
eine Glastür vom Eingangsbereich getrennt, wo sich auch der Zugang
zu den Aufzügen befand. Die überprüften wir zuerst.
Keine der vier Kabinen war gerade in Höhe des siebten Stocks.
Drei befanden sich auf dem Weg nach unten, die vierte bewegte sich
aufwärts, wie anhand der Leuchtanzeigen erkennbar war.
»Wenn der Kerl den Lift genommen hat, sind wir zu spät«,
stellte Tihange fest.
»Aber dann läuft er hoffentlich Ihren Kollegen in die Arme!«,
erwiderte François.
Tihange steckte den Generalschlüssel ins Schloss der
Glastür.
»Ist offen!«, stellte er überrascht fest.
»Bleiben Sie hier und achten Sie auf den Fahrstuhl!«, sagte
ich.
»Aber …«
»Das ist jetzt unser Job, Monsieur Tihange!«
Mit der SIG in der Faust öffnete ich die Tür. François folgte
mir. Lautlos traten wir in den Korridor. Zu beiden Seiten befanden
sich die Türen zu den Büroräumen, in denen diese ihre Mandanten
berieten. Ganz klassisch und konservativ. Kein Großraumbüro und
abgesehen von der Eingangstür gab es auch keinerlei Glas.
Seriosität schien bei Watton & Partner Trumpf gewesen zu sein.
Ich fragte mich, weshalb diese Kanzlei ihren Sitz mit freiem
Ausblick auf die künftige Stätte des zu erringenden juristischen
Triumphs, den die Mitarbeiter von Watton & Partner für ihre
Mandanten zu erringen hatten, aufgegeben hatte.
Das dritte Fenster musste sich im ersten oder zweiten Zimmer
auf der rechten Seite befinden. Die Räume auf der anderen Seite des
Korridors waren zur Rückseite ausgerichtet und kamen nicht infrage.
Ich trat die erste Tür auf. François sicherte auf dem
Flur.
Ein kahler Raum ohne Möbel lag vor mir. Die Abdrücke auf dem
hellblauen Teppichboden zeigte genau an, wo die einzelnen
Möbelstücke gestanden hatten.
Beide Fenster waren geschlossen.
Ich schnellte zurück, machte François ein Zeichen.
Diesmal war er dran, die Tür aufzustoßen und den Raum als
Erster zu betreten, während ich auf dem Flur sicherte.
Mit der SIG in der Faust machte er einen Schritt in den
Nachbarraum, dessen Tür nur angelehnt gewesen war. Das Fenster
stand offen. Anders als in den ultramodernen Bürotürmen, die sich
zwanzig oder noch mehr Stockwerke in den Himmel über Marseille
Mitte erheben, bei denen sich die Fenster oft aus Angst vor
Selbstmördern gar nicht mehr öffnen lassen und Frischluft einzig
über die Klimaanlage in die Räume gebracht werden kann, waren hier
ganz herkömmliche Schiebefenster zu finden, wie sie in den meisten
französischen Häusern üblich sind.
François senkte die Waffe.
Dies war also der Ort, von dem aus geschossen worden war.
»Los, lass uns die anderen Räume noch kurz durchsuchen!«,
sagte François.
»Warte!«
»Was ist?«
»Hier stimmt was nicht.« Ich deutete auf den Vorhang am
Fenster. Er hing schlaff herunter, bewegte sich nicht. »Monsieur
Tihange, öffnen Sie die Glastür!«, rief ich.
»Steht offen!«, gab Tihange einen Augenblick später
zurück.
François sah mich verständnislos an.
»Worauf willst du hinaus, Pierre?«
»Kein Durchzug, François! Der Kerl ist nicht durch die Glastür
zu den Aufzügen gelaufen.«
»Sondern?«
Ich rannte über den Flur, stieß die Tür gegenüber auf. Sie war
nur angelehnt. Mit der SIG in der Hand trat ich ein. Eines der zum
Hinterhof ausgerichteten Fenster stand offen. Zugluft entstand und
ließ die Tür hinter mir zuschlagen. Ich lief zum Fenster und
blickte in den Hinterhof. Ein Mann mit Baseball-Kappe und einer
Sporttasche über der Schulter ging eiligen Schritts auf die etwa
hundert Meter entfernte Ausfahrt des von mehrstöckigen Bauten
eingerahmten Hinterhofs zu, der vor allem als Parkplatz
diente.
Über eine Außentreppe konnte man hinab gelangen. Ich zögerte
keine Sekunde, schwang mich aus dem Fenster, erreichte den ersten
Absatz der Treppe und rannte sie hinunter.
»Stehen bleiben! FoPoCri!«, rief ich dem Kerl mit der
Baseball-Kappe hinterher.
Der Kerl drehte sich um.
OM (Olympique Marseille) stand in Großbuchstaben auf seiner
Mütze. Die Augen waren durch eine Sonnenbrille mit Spiegelgläsern
verdeckt, so dass man von seinem Gesicht lediglich Nase und
Kinnpartie sehen konnte.
Der Mann mit der OM-Mütze griff unter seine blousonartige
Jacke, riss eine Waffe hervor und feuerte sofort in meine Richtung.
Schüsse peitschten, kratzten Funken sprühend am Metallgestänge der
Feuertreppe entlang oder gruben sich in das vergleichsweise weiche
Mauerwerk.
Ich feuerte zurück.
François hatte inzwischen das Fenster erreicht und gab mir
ebenfalls Feuerschutz.
Der Kerl rannte auf die Ausfahrt zu.
Ich sah zu, dass ich hinunterkam, nahm mehrere Stufen mit
einem Schritt, sprang und rutschte, bis ich schließlich den Asphalt
des Hinterhofs unter den Schuhen hatte.
Wieder peitschten Schüsse in meine Richtung. Ich duckte mich
hinter eine parkende Limousine, feuerte zurück, ohne jedoch zu
treffen.
Der Mann mit der OM-Mütze hatte jetzt die Einfahrt zum
Hinterhof erreicht.
Ein Wagen bremste. Es handelte sich um einen Renault in
Silbermetallic. Der OM-Mann richtete die Waffe auf den Fahrer,
umrundete die Motorhaube, riss die Fahrertür auf und zerrte den
etwa fünfzigjährigen Mann am Steuer grob heraus.
»Nicht schießen!«, zitterte der Ford-Fahrer.
Der Killer gab ihm einen Schlag mit dem Lauf seiner Pistole,
der ihn niedersinken ließ. Dann setzte er sich ans Steuer. Er
setzte den Wagen zurück. Rücksichtslos fuhr er auf die sich an die
Einfahrt anschließende Straße. Ein Wagen bremste mit quietschenden
Reifen.
Ich rannte hinterher, zielte auf die Reifen des Ford. Den
vorne rechts erwischte ich. Der OM-Mann startete trotzdem durch.
Funken sprühten und ein Geruch von verbranntem Gummi verbreitete
sich, als der Renault nach vorne schoss.
Der OM-Mann vollführte mit dem Renault einen riskanten
Fahrbahnwechsel. Ein Peugeot musste bremsen. Zwei weitere Fahrzeuge
fuhren auf. Ein Fahrradkurier konnte gerade noch rechtzeitig
ausweichen.
Mit aufheulendem Motor und über den Asphalt kratzender Felge
vorne rechts dröhnte der Renault die Fahrbahn entlang.
Ich erreichte die Straße, sprang auf den Kofferraum eines
parkenden Wagens, legte die SIG Sauer P 226 an und feuerte.
Zwei Schüsse.
Einer traf den Reifen hinten rechts.
Es war ohnehin schon ein Wunder gewesen, wie der OM-Mann es
geschafft hatte, den Renault trotz des zerschossenen Vorderreifens
in der Spur zu halten. Jetzt brach er hinten aus, schabte an einer
Reihe parkender Fahrzeuge entlang und blieb schließlich an einem
von ihnen hängen.
Die beiden verbleibenden Reifen drehten durch. Die Metallfelge
sprühte Funken wie ein Schweißgerät.
Der OM-Mann öffnete die Tür, riss die Waffe empor und feuerte
in meine Richtung. Ich duckte mich, sprang vom Wagen und rannte
hinter ihm er.
Keine fünfzig Meter entfernt befand sich eine U-Bahnstation.
Der OM-Mann rannte die Stufen hinab, die in die Tiefe führten.
Hinunter in die unterirdische Stadt aus U-Bahnhöfen,
Schienentunneln und Abwasserkanälen, von denen nur noch ein
Bruchteil in Gebrauch war. Mehrere Stockwerke tief reichte dieser
Maulwurfbau unter die Oberfläche.
Ich setzte dem flüchtigen OM-Mann, den ich für den Mörder Hugo
Grenadilles hielt, weiter nach. Ein Strom von Menschen kam mir
entgegen, hielt mich auf, und es nützte mir auch nichts, dass ich
mit meiner Polizeimarke herumwedelte. Es waren einfach zu viele.
Schon nach wenigen Augenblicken hatte ich den OM-Mann aus den Augen
verloren.
Aber noch war ich nicht bereit aufzugeben.
Schließlich erreichte ich den Bahnsteig.
Ein Zug fuhr gerade weg.
Der Bahnsteig war voller Menschen. Eine Minute später stand
ich fast allein dort. François sah ich die Treppe hinunterkommen,
die SIG in der einen und den Dienstausweis in der anderen
Hand.
Er sah sich suchend um.
Von dem OM-Mann war nirgends eine Spur zu finden.
Ich steckte meine Pistole weg und griff stattdessen zum Handy,
um sicherzustellen, dass der gerade Richtung Seepark abgefahrene
Zug bei der nächsten Station von Kollegen der Marseiller Polizei
unter die Lupe genommen wurde. Meine knappe Täterbeschreibung
sollte dabei helfen: Der Killer war mindestens eins-achtzig groß,
männlich, Baseball-Kappe mit der Aufschrift OM und eine Sporttasche
der Firma Nike.
»Danach könnte man nicht einmal ein Phantombild fabrizieren,
Pierre«, tadelte mich François, der alles mitbekommen hatte. Auch
er steckte jetzt die SIG zurück ins Holster und ließ den
Dienstausweis in der Jackentasche verschwinden.
»Sehr witzig, François! Leider hat der Kerl auf meine
Aufforderung seine Brille nicht abgenommen, damit ich ihn besser
sehen kann!«
4
Wir kehrten zurück zum Tatort.
Nur eine Viertelstunde später war dort bereits der Teufel los.
Rund um das Portal des Gerichtsgebäudes natürlich auch. Ein Wagen
des Gerichtsmediziners war vorgefahren, um die Leiche von Hugo
Grenadille abholen.
Der gesamte Bereich vor dem Gerichtsgebäude und um das
gegenüberliegende Gebäude war abgesperrt worden. Uniformierte
Kollegen der Polizei hatten das übernommen. Außerdem waren ein
halbes Dutzend Commissaire am Tatort eingetroffen, darunter unsere
Kollegen Léo Morell und Josephe Kronbourg. Stéphane Caron, der
stellvertretende Chef des Polizeipräsidiums Marseille traf zusammen
mit seinem Kollegen Boubou Ndonga etwas später ein. Wenn ein
Bluthund dieser Größe des organisierten Verbrechens selbst das
Opfer eines Mordanschlags wurde, war das ein Fall für die FoPoCri.
Schließlich lag nahe, dass dahinter eine Fehde unter organisierten
Gangsterbanden steckte.
Kollegen der Erkennungsdienstes, dem im Präsidium ansässigen
zentralen Erkennungsdienst, dessen Einrichtungen von allen
Marseiller Polizeieinheiten benutzt wurden, trafen ein. In
besonderen Fällen hatten wir darüber hinaus die Möglichkeit, auch
unsere eigenen erkennungsdienstlichen Mitarbeiter und Labore
einzuschalten. In diesem speziellen Fall reichten die Kapazitäten
unserer Kollegen vom Erkennungsdienst vollkommen aus.
Polizeihauptmeister Ralph Maiziere leitete den Einsatz unserer
Kollegen. Maiziere war ein bärbeißiger, sommersprossiger Mann mit
roten Haaren. Seine bretonischen Vorfahren waren nicht zu leugnen.
»Einem Widerling wie Hugo Grenadille dürfte wohl kaum jemand
eine Träne nachweinen«, meinte er, als wir uns zusammen mit meinem
Kollegen Stéphane Caron in einem der leer stehenden Büroräume von
Watton & Partner trafen.
»Trotzdem werden wir den Mord an ihm mit derselben Intensität
verfolgen wie jedes andere Verbrechen«, erwiderte ich. »Auch, wenn
jetzt der eine oder andere sagen wird, dass es mit Grenadille den
Richtigen getroffen hat.«
»Einen Mann, der um keinen Preis der Welt hätte freikommen
dürfen!«, war Maiziere überzeugt. »Ich glaube nicht, dass ihn in
Pointe-Rouge viele Leute vermissen werden!«
Stéphane zuckte die Achseln.
»Wer weiß, vielleicht hat ihn sogar dieser Niko Dragnea auf
dem Gewissen.«
»Sein eigener Boss?«, fragte François.
»Warum nicht?«, erwiderte Stéphane. »Grenadille war für
Dragnea der Mann fürs Grobe – und so ein Mann fürs Grobe weiß doch
häufig über die dunkelsten Kellerlöcher Bescheid, die sein
Auftraggeber zu verbergen hat.«
»Wenn wir erst einmal den Killer haben, bekommen wir auch den
Boss, der hinter ihm steht«, war ich überzeugt.
Die Liste derer, die Grenadille den Tod gewünscht hatten,
musste ziemlich lang sein. Dutzende von kleinen Bar- und
Ladenbesitzer, denen Grenadille im Auftrag von Dragnea auf die Füße
getreten war. Natürlich auch die Konkurrenz im Geldwäschegeschäft,
die Grenadille recht erfolgreich eingedämmt hatte. Nach unseren
Ermittlungen war Grenadille es gewesen, der seinem Boss den Weg
nach oben buchstäblich frei geboxt hatte. Oft genug mit
Unterstützung von einschlägig bekannten Kriminellen oder
Straßengangs. Grenadille war schlau genug gewesen, sich die Hände
nur dann schmutzig zu machen, wenn er vollkommen sicher sein
konnte, nicht erwischt zu werden.
Mein Handy schrillte.
Es war die Zentrale. Ich bekam Bescheid darüber, dass unser
Zeichner Commissaire Perouche auf dem Weg zum Tatort war, um mit
mir und François ein Phantombild des Täters zu erstellen, das
möglichst schnell an die Medien gegeben werden sollte.
Michel Prevoust vom Erkennungsdienst trat zu uns. Ich kannte
Michel von anderen Einsätzen her, hatte ihn aber in seinem
schneeweißen Ganzkörperschutzanzug mit Kapuze und Mundschutz nicht
erkannt. Erst jetzt, da er beides zur Seite schob, sah ich, mit wem
ich es zu tun hatte.
»Hi, Michel!«
»Hi, Pierre.«
Er begrüßte auch die anderen und meinte schließlich: »Diese
Anzüge sind das pure Grauen. Angeblich sollen die atmungsaktiv
sein.«
»Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, im
Außendienst zu sein«, grinste François.
Aber das Tragen dieser Schutzanzüge hatte sich in der
Spurensicherung bewährt. Gerade die Technik der DNA-Analyse und der
Einsatz von Luminol, um normalerweise unsichtbare oder teilweise
schon entfernte Spuren sichtbar zu machen, hatten das Geschäft der
Spurensicherung in den letzten Jahren revolutioniert. Eine Schuppe,
die aus dem Haar eines Beamten rieselte, konnte am Tatort zu einem
dermaßen verwirrenden Befund führen, dass der Fortgang der
Ermittlungen dadurch stark verzögert wurde.
»Viel kann man im Moment noch nicht sagen«, erklärte Prevoust.
»Der Raum war leer, der Täter hat keine Patronenhülse hinterlassen,
und das Projektil kann erst nach der Obduktion der Leiche
untersucht werden, denn soweit ich den Gerichtsmediziner verstanden
habe, steckt es noch in Grenadilles Kopf.«
»Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn die Waffe schon mal
benutzt worden wäre«, meinte Stéphane.
»Fingerabdrücke gibt es nirgendwo«, fuhr Prevoust fort. »Der
Täter hat Handschuhe getragen. Er hatte allerdings Öl unter den
Füßen und hat deswegen ein paar Abdrücke produziert, die mit bloßem
Auge fast nicht sichtbar sind, aber …«
»Ihr habt da so eure Tricks«, schloss ich.
Michel nickte.
»Worauf du wetten kannst! Der Kerl trug Turnschuhe der Marke
Nike, Größe einundvierzig. Ich würde daher auf einen eher kleinen
Täter schließen.«
»Ich habe den Mann gesehen«, sagte ich. »Eins-achtzig war der
mindestens, vielleicht sogar noch größer!«
Michel hob die Augenbrauen.
»Schuhgröße einundvierzig passt nicht so richtig dazu,
oder?«
»Kannst du laut sagen!«
»Aber an den Messungen wirst da ja wohl nicht zweifeln
wollen.« Michel Prevoust zuckte die Schultern und lächelte
verschmitzt. »Wie ihr das zusammenbringt – diesen großen Kerl und
die kleinen Füße – das ist euer Problem. Aber dafür habt ihr ja
eure berühmte Ausbildung in der Polizeihochschule hinter euch.« Ein
bisschen Ironie schwang in Michels Worten mit. Ich hatte zufällig
von einem seiner Kollegen mal gehört, dass Michel Prevoust selbst
mal versucht hatte, die Aufnahmetests bei der Polizei zu bestehen
und gescheitert war. Vielleicht kamen daher die Seitenhiebe auf die
Polizei, die er sich hin und wieder wohl einfach nicht verkneifen
konnte.
»Das ist zumindest ein sehr auffälliges körperliches Merkmal,
das uns bei der Fahndung helfen wird«, glaubte Stéphane. »Was
wollen wir mehr?«
Während der Zeit, wie wir am Tatort zubrachten, stellte sich
noch mehr heraus. So waren sämtliche Fenster der siebten Etage
geschlossen gewesen, wie die Mitarbeiter des Security Service
versicherten. Auch die Spurenlage an dem Fenster zum Hinterhof,
durch das der Täter über die Feuerleiter geflüchtet war, ergab,
dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf diesem Weg das
Gebäude betreten hatte. Vielmehr sprach alles dafür, dass er auf
dem herkömmlichen Weg in die ehemaligen Räumlichkeiten von Watton
& Partner gelangt war.
Mit Hilfe von B. Borné fanden wir schließlich die
entsprechende Video-Sequenz der Überwachungskamera im
Eingangsbereich. In dieser Sequenz sprach er kurz mit einem
Mitarbeiter der Security, dessen Identität schnell ermittelt war.
Er hieß Rainier Gervais, war vierunddreißig Jahre alt und galt nach
B. Bornés Angaben als außerordentlich zuverlässig. Die
Video-Sequenz konnte uns, was das Äußere des Killers anging, zwar
nicht wirklich weiterhelfen, abgesehen davon, dass sich unsere
Spezialisten vom Innendienst darum kümmern konnten, ob der Kerl mit
der OM-Mütze tatsächlich auch Schuhgröße 41 hatte, was mit Hilfe
neuester biometrischer Messverfahren auch anhand von Videoaufnahmen
möglich war.
Gervais konnte sich jedoch über die bekannten Details hinaus
noch an zwei weitere wichtige Einzelheiten erinnern. Erstens hatte
der OM-Mann Gervais‘ Angaben nach stark nach Menthol und Zigaretten
gerochen. Und zweitens konnte sich der Wachmann daran erinnern,
dass er sich nach der Kanzlei Brugger, Gerlonde & Parte im
achten Stock erkundigt.
»Ich habe kurz bei der Kanzlei durchgerufen, um mich danach zu
erkundigen, ob er dort tatsächlich einen Termin hatte. Sonst hätte
ich ihn gar nicht zu den Fahrstühlen gelassen«, berichtete Gervais.
»Sicherheit wird bei uns nämlich groß geschrieben, müssen Sie
wissen.«
»Hat er einen Namen genannt?«, fragte ich.
Gervais nickte. »Pierre Meyere.«
»Nicht besonders originell.«
»Habe ich auch gedacht, Commissaire Marquanteur. Aber wenn
Brugger, Gerlonde & Parte einen Termin mit einem gewissen
Pierre Meyere vereinbart hat und in der Eingangshalle taucht jemand
mit diesem Namen auf, dann habe ich keinen Grund, denjenigen daran
zu hindern, das Gebäude zu betreten.«
»Es macht Ihnen auch niemand einen Vorwurf«, versicherte
ich.
»Wer hätte auch schon ahnen können, dass es sich bei diesem
Typ um einen Killer handelt? Schließlich können wir unmöglich bei
all den Mandanten der in diesem Haus residierenden Anwälte Leibes-
und Gepäckvisitationen durchführen. Dann hätten wir sehr schnell
deren gesamte Mandantschaft verprellt.«
Wenig später statteten wir der Kanzlei Brugger, Gerlonde &
Parte einen kurzen Besuch ab. Wir bekamen dort die Auskunft, dass
tatsächlich ein Mann namens Meyere telefonisch um einen Termin
gebeten hatte. Er wollte angeblich Rechtsauskunft in einer
Erbschaftsangelegenheit. Wie unsere Kollegen Léo Morell und Josephe
Kronbourg herausfanden, hatte dieser ominöse Pierre Meyere auch in
zwei anderen Kanzleien angerufen, um einen Termin zu bekommen, war
dort jedoch auf spätere Termine vertröstet worden.
Inzwischen traf unser Zeichner, Commissaire Perouche, ein, der
zusammen mit dem Mitarbeiter der Security Gervais, François und mir
ein Phantombild erstellte. Dazu benutzte er natürlich schon lange
nicht mehr Block und Bleistift, sondern einen hochmodernen Laptop
mit einer speziellen Software zur Erstellung brauchbarer
Phantombilder.
Da in diesem Fall niemand besonders viel vom Gesicht des
Verdächtigen gesehen hatte, blieb das Ergebnis trotz eines
Top-Bildprogramms und dem unbestreitbaren Können Perouches eher
dürftig.
Wir waren gerade damit fertig, als uns ein sehr interessantes
Ergebnis der Kollegen des Erkennungsdienstes erreichte. Es war
Michel Prevoust, der mir die Neuigkeit per Handy mitteilte.
»Am Schloss der Glastür, die zu den Räumen von Watton &
Partner führen, sind keinerlei Spuren eines Einbruchs erkennbar. Da
wir davon ausgehen, dass der mutmaßliche Täter über diesen Weg an
den Tatort gelangt ist, muss man daraus eigentlich den Schluss
ziehen, dass er wahrscheinlich einen Schlüssel hatte oder ihn
jemand hereingelassen hat, Pierre.«
»Ich danke dir, Michel.«
Wenig später besprach ich die Sache mit François und
Stéphane.
»Wenn ihr mich fragt, dann gibt es da nur zwei Möglichkeiten,
wie er an den Schlüssel herangekommen sein kann«, sagte Stéphane.
»Entweder hatte er einen Helfer bei den Wachleuten oder bei Watton
& Partner.«
»Dürfte auf jeden Fall interessant sein, diese Kanzlei mal
unter die Lupe zu nehmen«, fand ich.
5
Es war später Nachmittag. Niko Dragnea saß mit zwei
dunkelhaarigen Schönheiten in den Armen an einem Tisch im Buena
Vista Club, einer Disco, die als Tummelplatz von Kokain-Dealern für
den gehobenen Bedarf bekannt war. Niko Dragnea kontrollierte diesen
Laden über einen Strohmann namens Rafi Hazrat. Der Buena Vista Club
diente ihm vor allem zur Geldwäsche. Gewinn brauchte der Club
ansonsten kaum abzuwerfen. Tat er es doch – umso besser.
Wichtig war nur, dass der Umsatz möglichst hoch war. Je höher
der Umsatz, desto mehr schwarzes Geld konnte man durch ihn
hindurchschleusen und zu schneeweißem Kapital machen, mit dem sich
ganz legale Geschäfte machen ließen. Und genau darauf waren sie
alle aus, die mit illegalen Geschäften ihr Geld machten. Die
Drogenbarone ebenso wie die Paten der Müll-Mafia oder
Falschgeldhändler, die mit dem Export von falschen Euro-Noten nach
Osteuropa oder in die ehemaligen GUS-Staaten ein Vermögen machten.
Das Problem blieb immer dasselbe – und Männer wie Niko Dragnea
hatten die Lösung dafür.
Die Drogenhändler, die allabendlich im Club herumhingen und
ihren Stoff an Rechtsanwälte, Yuppies – karrierebewusste, meist
junge Menschen, die großen Wert auf ihre äußere Erscheinung legen –
und andere Kunden verhökerten, die bereit waren, für guten Koks
etwas mehr auszugeben, als man an den Straßenecken dafür
hinblättern musste, nahm Dragnea eigentlich nur in Kauf. Im Grunde
stellten sie eine Gefahr für sein Geschäft dar – wenn auch nicht
für ihn persönlich, denn im Zweifelsfall musste sein Strohmann für
alle rechtlichen Folgen den Kopf hinhalten.
Dragnea waren diese schmierigen Typen, die allabendlich an den
Tresen herumhingen oder ihre Hüften zu den Rhythmen wiegten, die im
Buena Vista gespielt wurden, zuwider.
Aber da es die Leute von Ben Toufique waren, dem Koks-König
von Pointe-Rouge, der es geschafft hatte, so etwas wie der
Generalvertreter eines Drogensyndikats in Marseille zu werden,
konnte Niko Dragnea die Koksdealer nicht aus dem Buena Vista und
anderen seiner Clubs verbannen. Schließlich war Ben Toufique einer
seiner wichtigsten Kunden. Davon abgesehen hatte er mehr Männer
unter Waffen als sonst irgendjemand in dem Viertel.
Für Gäste hatte das Buena Vista um diese Zeit noch gar nicht
geöffnet. Aber bevor der Publikumsverkehr losging, wollte sich der
Boss noch etwas amüsieren. Eine Champagnerflasche stand auf dem
Tisch. Die Gläser schäumten über, und die beiden Girls, die Dragnea
im Arm hielt, schienen bester Laune zu sein.
Rafi Hazrat, Dragneas Strohmann, stand hinter dem Schanktisch
und beobachtete misstrauisch die Szene. Hazrat war Mitte dreißig,
hatte dunkel gelocktes Haar und war sehr hager. Er hatte bei
Dragnea als Türsteher angefangen. Jetzt konnte er sich Clubbesitzer
nennen, auch wenn ihm durchaus klar war, dass er seine Existenz
auch jetzt noch zu hundert Prozent Dragnea verdankte.
»Auf die Zukunft, Mädels!«, rief Dragnea, der bereits mehrere
Champagnergläser geleert hatte.
Die Mademoiselles kicherten.
Aber dieses Kichern erstarb von einem Augenblick zum anderen,
als die Eingangstür vom Buena Vista zur Seite flog.
Ricky Balmorte, der breitschultrige und fast zwei Meter große
Türsteher des Buena Vista, taumelte durch den Raum und flog der
Länge nach zu Boden. Mit einem Fluch auf den Lippen wischte er sich
das Blut von der Nase.
Ein unglaublich dicker Mann Anfang vierzig und in einen
schneeweißen Maßanzug gekleidet, betrat den Raum. Das blauschwarze
Haar war nach hinten gekämmt. Drei Kerle mit schwarzen
Rollkragenpullovern und Bodybuilderfigur begleiteten ihn. Sie
trugen Maschinenpistolen vom Typ MP 7 der Firma Heckler und Koch im
Anschlag.
»Monsieur Toufique!«, stieß Dragnea völlig verblüfft
hervor.
Mit allem hätte er jetzt gerechnet, nur nicht damit, dass
ausgerechnet Ben Toufique ihm einen Besuch abstattete.
Der Koks-König von Pointe-Rouge deutete auf den am Boden
liegenden Balmorte.
»Lausige Bodyguards beschäftigen Sie, Dragnea«, tadelte er den
Mann hinter den Champagnergläsern.
Die Mademoiselles saßen jetzt auf einmal ziemlich steif da.
Ihre Gesichter erbleichten.
Ben Toufique trat näher.
Hazrat machte eine unbedachte Bewegung, die damit quittiert
wurde, dass gleich zwei von drei MP 7-Läufen auf ihn gerichtet
wurden.
»Hey, keine Panik! Am besten, wir bleiben alle ganz ruhig!«,
zeterte Hazrat.
Toufique steckte sich eine Zigarre in den Mund und zündete
sich an.
»Indem Sie das hier dulden, begehen Sie gerade eine
Ordnungswidrigkeit, Hazrat«, lachte Toufique, blies den Rauch in
die Luft und lächelte kalt. »Schließlich ist das Rauchen in
sämtlichen Lokalen nicht nur in Marseille verboten – und bei
Zuwiderhandlung wird der Besitzer in Regress genommen!«
»Monsieur Toufique, ich …«, flüsterte Hazrat, aber der Mann in
Weiß bedeutete ihm mit einer kurzen, knappen Geste zu schweigen.
»Gehen Sie einfach eine Weile spazieren, klar?«
Hazrat wandte den Blick in Dragneas Richtung.
»Ist schon in Ordnung, Rafi!«, sagte dieser.
Toufique versetzte dem am Boden liegenden Türsteher einen
Tritt.
»Und nehmen Sie dieses Stück Scheiße mit, Hazrat! Ich will
mich mit Ihrem Boss mal ungestört unterhalten.«
Ricky Balmorte bleckte die Zähne wie ein Raubtier. Die obere
Reihe war so gleichmäßig, dass sie falsch sein musste. Er ballte
die Fäuste.
»Ist schon gut!«, schritt jetzt Dragnea ein. »Tut, was
Monsieur Toufique wünscht!«
»Ist das Ihr Ernst, Monsieur Dragnea?«, vergewisserte sich
Ricky Balmorte.
»Ja, klar!«, bestätigte Dragnea.
Balmorte erhob sich. Zusammen mit Hazrat verließ er den
Raum.
»Ihr verschwindet auch besser!«, knurrte Toufique die beiden
Girls an Dragneas Tisch an. »Tut mir wirklich leid, normalerweise
habe ich nichts gegen charmante Gesellschaft, aber diesmal stören
mich eure Ohren.«
Die beiden jungen Frauen ließen sich das nicht zweimal sagen
und verzogen sich sofort – offensichtlich froh darüber, den Raum
verlassen zu können. Dragnea schluckte.
»Jetzt sind wir allein, Dragnea!«
»Wollen Sie einen Schluck Champagner, Monsieur
Toufique?«
»Was gibt‘s denn zu feiern?«
»Was wollen Sie?«
Toufique setzte sich an den Tisch und ließ sich dabei von
einem seiner Leibwächter den Stuhl zurechtrücken. Den Zigarrenrauch
blies er Dragnea direkt ins Gesicht.
»Unser beider Geschäfte sind – wie soll ich mich da angemessen
ausdrücken – ziemlich eng miteinander verwoben.«
»Ja. So ist es«, murmelte Dragnea fast tonlos. »Das stimmt
…«
»Und da werden Sie es doch sicher verstehen, dass ich anfange,
mir Sorgen zu machen, wenn ein Kerl, der als Dragneas Bluthund
bekannt wurde, plötzlich ungeniert von einem Profikiller auf den
Stufen des Gerichtsgebäudes niedergestreckt wird.«
»Sie sprechen von Grenadille!«
»Natürlich spreche ich von Grenadille – und wie Sie hier so
ruhig sitzen und Champagner schlürfen können, ist mir ehrlich
gesagt unbegreiflich.«
Einige Augenblicke lang herrschte Schweigen.
Einer von Toufiques Leibwächtern zapfte sich ungefragt ein
Bier und trank es halb leer, bevor er den Mund verzog und es mit
vor Ekel verzerrtem Gesicht stehen ließ.
»Ich habe keine Ahnung, wer hinter dem Anschlag auf Grenadille
steckt«, behauptete Dragnea.
»Wirklich nicht? Eigentlich liegt es nahe, dass jemand von
Ihrer direkten Konkurrenz dahintersteckt. Jemand, der Sie treffen
will und Ihnen dafür erst einmal einen Bauern aus dem Spiel nimmt.
Aber ich nehme an, dass Grenadille in Ihrem ganz persönlichen Spiel
sehr viel mehr als nur ein Bauer war – habe ich recht?«
»Hören Sie, Monsieur Toufique, Sie brauchen sich keine Sorgen
zu machen. Ich habe meine Organisation im Griff und gegen
Konkurrenz kann ich mich wehren.«