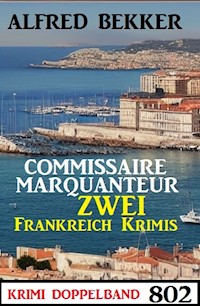von Alfred Bekker
Ein Kokain-Dealer sprengt sich und seinen Zulieferer während
einer Polizeiaktion in die Luft. War er lebensmüde oder wurde ihm
etwas untergeschoben? Die „Force spéciale de la police criminelle“
kurz FoPoCri rätselt über das Motiv und vermutet eine
rivalisierende Bande. Aber auch deren Köpfe werden in die Luft
gesprengt. Commissaire Marquanteur und seine Kollegen aus Marseille
laufen zunächst dem Tod hinterher, bis sich eine erste Spur
ergibt.
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen,
Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb
er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry
Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica
Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick,
Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Marseille im Jahr 2001…
Wenn ein Mann explodiert, mag man sich das im wörtlichen Sinn
gar nicht vorstellen.
Aber manchmal reicht es auch schon völlig, wenn das im
übertragenen Sinn geschieht.
Ich schlenderte einen der Landungsstege im Yachthafen von
Marseille entlang.
Die Sonne schien.
Das blaue Wasser des Mittelmeers funkelte, als sei es von
glitzernden Perlen übersät. Am Himmel stand kaum eine Wolke. Nur
hin und wieder war da ein weißer Klecks in der großen, hellblauen
Fläche. Eine Wolke - oder der Kondensstreifen eines
Flugzeugs.
Ein Tag, von dem man denken konnte, dass ihn eigentlich nichts
zu trügen vermochte.
Aber ich arbeite ja in einem Job, in dem man schon von Berufs
wegen immer nur das Schlimmste erwartet.
Wer ich bin?
Oh, Pardon.
Mein Name ist Marquanteur.
Pierre Marquanteuer.
Ich bin Commissaire bei einer Sonderabteilung in Marseille,
die sich vor allem der Bekämpfung des organisierten Verbrechens
widmet.
Wie ich schon sagte: Es war ein Tag, so schön, dass man sich
nur fragen konnte, wann etwas Schlimmes passieren würde, sodass die
statistische Wahrscheinlichkeit wiederhergestellt wäre.
Ich sah eine Katze auf dem Steg, die elegant daherschritt. Sie
balancierte am Rand des Stegs entlang und blickte immer mal wieder
hinab zum Wasser.
Na, wem gehörst du denn?, dachte ich. Eine Streuner-Katze?
Vielleicht. Oder sie gehörte einem der vielen Yachtbesitzer, deren
Boote hier nebeneinander lagen und leicht im Wasser schaukelten,
während vom Meer her ein leichter Wind über den Yachthafen von
Marseille strich.
Und dann explodierte plötzlich ein Mann.
Zum Glück allerdings nur im übertragenen Sinn.
Ein Mittvierziger mit hoher Stirn und sehr kräftigen
Augenbrauen begann plötzlich laut zu schimpfen. Dabei gestikulierte
er mit ausholenden Handbewegungen. Worum es da ging, verstand ich
nicht. Ich hatte auch keine Ahnung, in welchem Zusammenhang diese
Explosion der Gefühle ausgelöst worden war.
Die Gesichtsfarbe des Mannes wechselte jetzt in ein ziemlich
ungesund wirkendes Dunkelrot.
Ein paar andere Männer standen in der Nähe und schienen ebenso
überrascht über diesen Gefühlsausbruch zu sein, obwohl sie mit
Sicherheit besser darüber informiert waren, worum es da eigentlich
in der Sache genau ging.
Die Katze miaute.
Ihr Blick ging jetzt auch in die Richtung, in der sich das
Geschehen abspielte.
Da regte sich jemand offenbar ziemlich auf. So sehr, dass es
selbst einer Katze auffiel.
Immer heftiger wurden die Gesten - und immer schriller der
Tonfall. Seine Stimme überschlug sich geradezu.
Einer der anderen Männer versuchte, beruhigend auf ihn
einzureden.
Aber davon wollte der Mann mit den starken Augenbrauen nichts
wissen.
Allein seine Gestik machte das ganz unmissverständlich
klar.
Ich wartete ab.
Als Polizist hat man selbst in der Freizeit den Drang,
gegebenenfalls einzugreifen, wenn eine bestimmte Eskalationsstufe
überschritten war.
Und das schien mir bald erreicht zu sein.
Das war wie bei überkochender Milch. So ein verbaler Amoklauf
konnte innerhalb kürzester Zeit in eine handgreifliche
Auseinandersetzung übergehen. Und spätestens dann konnte man dem
Ganzen nicht mehr einfach so seinen Lauf lassen.
Die Katze miaute erneut.
Der Streithahn stapfte nun davon.
Er trampelte geräuschvoll über den Steg - zuerst mir entgegen
und dann an mir vorbei. Ich musste ihm ausweichen, um nicht von ihm
angerempelt werden.
Er murmelte irgendetwas Unfreundliches vor sich hin.
Die Männer, mit denen er sich gestritten hatte, sahen zu mir
herüber und zuckten mit den Schultern, so als wollten sie sagen:
Was können wir dafür, dass der so ausrastet?
Ein Mann war explodiert.
Besser auf diese Weise, als auf die Art, mit der ich es ein
paar Tage später zu tun haben sollte…
*
Wir trugen Nachtsichtgeräte und kugelsichere Westen.
Es war kein Einsatz wie jeder andere.
Mitten in dem Waldstück im Park befanden sich mehrere
Limousinen mit laufendem Motor auf einen schmalen, unbefestigten
Weg, der normalerweise nur von Joggern benutzt wurde. Etwa ein
halbes Dutzend Personen standen herum. Die Spannung war
unübersehbar. Männer in dunklen Anzügen und MPis im Anschlag ließen
nervös den Blick schweifen. Hier war eine ganz große Sache im
Gang.
Und wir waren dabei.
Ein ziemlich hagerer Mann mit aschgrauen Haaren und ein Riese
mit starkem Übergewicht standen sich gegenüber. Jeder hatte seine
Kolonne von bis auf die Zähne bewaffneten Leibwächtern in der Nähe.
Unter den Bodyguards des Hageren befanden sich mein Freund und
Kollege François Leroc …
Undercover nennt man das selbst auf Französisch.
Wir hatten ihn als verdeckten Ermittler bei Jean Duclerc,
einem Kokain-Händler untergebracht. Da einige von Duclercs Leuten
in letzter Zeit bei den immer wieder aufflackernden Bandenkriegen
umgekommen waren, hatte François die Chance gehabt, ziemlich
schnell in eine ziemlich wichtige Position zu kommen. Über die
Mikrofone, die François am Körper trug, hörten wir jedes Wort, das
gesprochen wurde.
Wir standen kurz vor dem entscheidenden Moment.
Der Mann, an den wir eigentlich heran wollten, war der
Dicke.
Antoine Floquet, einer der aggressivsten Bandenchefs, die zur
Zeit aus der Unterwelt emporstrebten. Er hatte einen Teil des
Kokain-Handels binnen kürzester Zeit unter seine Kontrolle
gebracht. Wir hatten Grund zu der Annahme, dass er dabei nicht
einmal vor der Ermordung von Verwandten haltgemacht hatte. Ein
Krimineller, dem die Regeln der Altvorderen offenbar nicht
sonderlich viel bedeuteten. Floquet war zweiunddreißig – wenn ihm
nicht ein früher Tod durch seine Fettsucht einen Strich durch die
Rechnung machte, hatte er eine glänzende Karriere in der Unterwelt
vor sich.
Wenn man sowas Karriere nennen will…
Aber wir dachten gar nicht daran, ihn noch weiter hochkommen
zu lassen.
Das wollten wir verhindern.
Floquet hatte jetzt schon genug auf dem Kerbholz.
Und in dieser Nacht wollten wir den Sack zumachen.
Seinem kriminellen Spiel sollte nun ein Ende bereitet
werden.
Endgültig.
Irgendwo zwischen den Büschen saß einer unserer Kollegen mit
einer Video-Kamera. Richtmikrofone waren außerdem noch auf die
Szenerie gerichtet. Wir waren also nicht nur auf die Mikros
angewiesen, die der Kollege François Leroc gut getarnt am Körper
trug.
Man konnte nie wissen …
Das Schlimmste, was uns passieren konnte, war, am Ende ohne
gerichtsverwertbare Beweise in nennenswertem Umfang vor dem
Staatsanwalt zu stehen. Dieser Schlag gegen das organisierte
Verbrechen musste sitzen. Andernfalls hatten wir in den nächsten
Jahren einiges an Ärger zu erwarten. Denn zweifellos hatte der
Dicke große Pläne.
»Erst das Geld!«, sagte einer von Floquets Leuten.
Wir hörten ihn alle über unsere Ohrhörer. Ich hielt die
Dienstpistole vom Typ SIG Sauer P 226 mit beiden Händen, wie zwei
Dutzend weitere Kollegen bereit dazu, jeden Moment aus dem Gebüsch
hervorzustürzen und der Aktion den krönenden Abschluss zu geben:
Floquets Verhaftung, nachdem man ihn in flagranti beim Deal seines
Lebens erwischt hatte.
Jeder von uns wartete darauf, dass der stellvertretende Chef
Stéphane Caron den Einsatzbefehl an uns alle weitergab. Bis dahin
hieß es, regungslos auszuharren.
Jean Duclerc winkte einem seiner Leute. Ein bulliger Kerl im
dunklen Anzug kam mit einem Koffer herbei, öffnete ihn, so dass
Antoine Floquet den Inhalt sehen konnte.
»Jetzt die Ware!«, forderte Jean Duclerc.
In Antoine Floquets Mundwinkel steckte ein Zigarrenstummel. Er
nahm ihn mit zwei Fingern heraus, verzog das Gesicht.
Das Ding war offenbar erloschen. Anstatt etwas zu sagen,
machte er eine knappe Geste. Einer seiner Leute öffnete einen
Kofferraum. Floquet deutete dorthin. Er spuckte irgendetwas aus,
winkte Duclerc herbei und ging mit ihm zusammen zum Wagen.
Die Leibwächter beider Seiten wurden etwas nervös, als Floquet
seine fleischige Pranke auf Jeans Schulter legte.
Sie erreichten den Wagen.
Es standen zu viele Leute herum. Man konnte nicht sehen, was
sich im Kofferraum befand. Aber wenn sich unser V-Leute-Netz nicht
völlig vertan hatte, dann war der Kofferraum voll von sorgfältig
abgepacktem Kokain höchster Reinheitsstufe.
Kollege François Leroc wich etwas zurück. Er wusste, dass es
gleich losgehen würde. Sein Blick streifte kurz über die
umliegenden Büsche. Er wollte natürlich möglichst nicht in der
Schusslinie stehen, wenn es losging.
Wir trugen Kevlar-Westen, François aber nicht.
Floquet nahm ein Plastikpäckchen aus dem Kofferraum heraus.
Der Inhalt war weiß.
»Hier, Jean! So guten Stoff hast du noch nie …«
Weiter kam Floquet nicht mehr. Eine gewaltige Detonation riss
Jean Duclerc förmlich auseinander und erwischte auch den nur wenige
Zentimeter von ihm entfernt stehenden Floquet. Beide wurden durch
einen Feuerball eingehüllt. Die in der Nähe stehenden Leibwächter
wurden wie Puppen durch die Luft geschleudert. Schreie gellten
durch die Nacht.
»Verdammt, was ist da los?«, hörte ich meinen Kollegen Fred
Lacroix über mein Headset, das mich mit den anderen akustisch
verband.
Ganz offensichtlich war jemand schneller als wir gewesen und
hatte Floquet auf seine Weise ausgeschaltet. Leider würde ihm jetzt
niemand mehr irgendwelche Fragen stellen können.
Aber das war vielleicht auch der Sinn dieser Aktion.
Druckwelle und Hitze waren bis zu uns spürbar gewesen.
Wer immer dahinter stehen mochte, hatte auf Nummer Sicher
gehen wollen.
Sekunden später glich der Treffpunkt mitten im Waldstück einem
Schlachtfeld. Schrecklich verstümmelte, halbverkohlte Leichen und
Leichenteile lagen überall herum.
Die Überlebenden rappelten sich auf. Einer der Kerle ließ vor
lauter Nervosität seine MP losknattern. Einige Zweige kamen von den
Bäumen herunter.
»Einsatz!«, befahl Stéphane Caron über Headset an alle.
Auch wenn diese Aktion absolut nicht so verlaufen war, wie wir
sie geplant hatten – wir mussten sie jetzt so zu Ende bringen, dass
uns wenigstens die niederen Chargen der Bande nicht durch die
Lappen gingen. Ich sah mich nach François um.
Er trug zwar Mikros am Körper, so dass wir hören konnten, was
in seiner Umgebung gesprochen wurde, aber ein Ohrhörer wäre zu
risikoreich gewesen.
Wir stürzten mit der Waffe im Anschlag aus unserer Deckung
hervor.
»FoPoCri! Waffen fallenlassen!«, erscholl es über ein
Megafon.
Offenbar glaubte einer der Kerle nicht daran, er ballerte mit
seiner MP drauflos. Ich warf mich zu Boden.
Sandrine Petit, eine junge Kollegin, die gerade bei uns auf
der Dienststelle angefangen hatte, erwischte die Garbe voll. Ihr
Körper zuckte. Der Großteil der Projektile traf sie am Oberkörper.
Dort, wo die Kevlar-Weste sie gut schützte. Trotzdem konnten solche
Treffer blaue Flecken, manchmal sogar Rippenbrüche verursachen,
denn die Aufprallenergie der Geschosse wurde durch die
Undurchlässigkeit der Weste ja lediglich auf ein größeres Gebiet
verteilt, so dass ihnen die Durchschlagskraft genommen wurde. Die
Wucht blieb.
Sie schrie auf.
Eine Kugel erwischte sie am Kopf.
Der MPi-Mann ließ uns keine andere Wahl. Nur
Sekundenbruchteile später zuckte auch sein Körper. Mehrere von uns
feuerten auf ihn. Er sackte zu Boden, blieb regungslos
liegen.
Vielleicht hatte er einfach nicht daran glauben können, dass
es wirklich die FoPoCri war, die sie eingekreist hatte.
Angesichts der Explosion hatte er wohl eher mit einer
konkurrierenden Gang gerechnet.
Für unsere Kollegin Sandrine Petit war es der erste und letzte
Einsatz dieser Art gewesen.
Wir rappelten uns auf, stürmten weiter. Die anderen
überlebenden Gangster waren zum Glück vernünftiger. Angesichts der
Übermacht warfen sie die Waffen weg.
Jetzt sah ich auch François. Er hatte sich hinter einer der
Limousinen verschanzt.
Einen nach dem anderen nahmen wir fest. Insgesamt fünf
Personen. Ein weiterer war in einem beklagenswerten Zustand. Er lag
in seinem Blut. Über Funk forderten wir die Notfallambulanz an.
Meine Kollegen Boubou Ndonga und Fred Lacroix führten
Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, aber es war fraglich, ob sie ihn lange
genug durchbringen konnten.
Ich steckte schließlich die SIG wieder ein, wandte mich an
François.
»Alles okay?«
»Mit mir schon, Pierre.«
»Das meinte ich.«
François war so geschockt wie wir alle. Vielleicht sogar noch
ein bisschen mehr. Denn um ein Haar hätte auch er so dicht bei der
Detonation gestanden, dass nicht viel mehr als ein paar
abgerissene, halbverkohlte Gliedmaßen von ihm übrig geblieben
wären.
Ich hörte beiläufig, wie Stéphane Caron die Kollegen des
zentralen Marseiller Erkennungsdienstes anforderte. Außerdem sollte
Clement Loubet, unser Chef-Feuerwerker, so schnell wie möglich den
Weg hierher finden. Wahrscheinlich befand sich Clement gerade im
Bett und musste erst herausgeklingelt werden. Aber was die
Detonation anging, die hier stattgefunden hatte, so mussten wir
einen Spezialisten an die Sache heranlassen.
François und ich traten an den Kofferraum der Limousine heran,
vor dem Jean Duclerc und Antoine Floquet ihren Deal hatten über die
Bühne bringen wollen.
Überall war Kokainstaub.
Stoff in einem Wert, wie ihn sich ein gewöhnlicher Sterblicher
kaum vorstellen konnte, war im wahrsten Sinn des Wortes in die Luft
gegangen. Einiges war direkt verschmort. Aber einige Kilos verwehte
jetzt der Wind.
»Sandrine Petit hat es erwischt«, meinte ich.
»Die Neue?«, fragte François.
»Ja.«
»Verdammt!«
Ich sah mir die Stelle an, an der die Überreste von Floquet
und Duclerc zu finden waren. Es war kaum etwas von den beiden übrig
geblieben. Ein Anblick wie aus einem Gruselkabinett. Es konnte
einem schlecht werden dabei.
»Offenbar hat Floquet es mit seinem aggressiven Eroberungskurs
etwas übertrieben«, meinte ich.
François nickte düster.
Wir sind beide einiges gewöhnt. Schließlich kommt es im Rahmen
unserer Tätigkeit als Commissaire häufig vor, dass wir einen Tatort
in Augenschein nehmen müssen. Aber diesmal war François' Gesicht
ziemlich blass geworden.
»Die Zahl von Floquets Feinden dürfte genauso schnell
angestiegen sein wie die Zahl seiner Untergebenen«, meinte mein
Freund und Kollege.
»Fällt dir irgendetwas ein, was im Nachhinein auf das hier
hinwies?«, fragte ich François. Schließlich war er in den letzten
Wochen beinahe rund um die Uhr in Duclercs Umgebung gewesen.
François wirkte nachdenklich, schüttelte dann schließlich den
Kopf.
»Das sollte ein ganz normaler Deal werden. Vielleicht etwas
größer als bisher. Duclerc sollte von Floquet zu einem seiner
Hauptverteiler aufgebaut werden.«
»Sagte Duclerc das?«
»Ja. Aber Jean ging davon aus, dass ihm in Floquets
Organisation eine blendende Zukunft bevorstünde.«
»Offenbar hatte jemand was dagegen.«
»Allerdings!« François machte eine kurze Pause, ehe er dann
fortfuhr: »Die beiden hatten übrigens noch ein anderes Geschäft
vor.«
»Welches?«
»Handel mit gefälschtem CiproBay. Du weißt doch, dieses
Anti-Milzbrand-Präparat. Der Hersteller kommt mit der Lieferung
kaum nach und verdient sich 'ne goldene Nase daran, seit ein paar
Irre dazu übergegangen sind, Milzbrandsporen in großem Stil über
die Post an Abgeordnete und Medienvertreter zu verschicken.«
Eine regelrechte Hysterie war seitdem in dieser Hinsicht
ausgebrochen. Auch bei unseren Kollegen der Sûreté waren schon
derartige, mit Milzbrand-Sporen versehene Sendungen eingegangen. Ob
islamistische Terroristen dahintersteckten oder einheimische
Terror-Gruppen war noch nicht klar. Zur Zeit sah es eher danach
aus, dass dieser mörderische Spuk aus unserem eigenen Land kam. Und
dann gab es natürlich die unzähligen Trittbrettfahrer, die statt
Milzbrandsporen nur Waschpulver versandten, um damit Panik
auszulösen.
Floquet schien eine andere Art von Trittbrettfahrer gewesen zu
sein.
Mit nachgemachten und vielleicht sogar völlig wirkungslosen
Anti-Milzbrand-Präparaten konnte man jetzt vielleicht ein Vermögen
machen. Aber nur, wenn man schnell war. Wenn der Bayer-Konzern die
Produktion erst gesteigert und die Regierung sich reichlich
bevorratet hatte, war die Gewinnchance vertan.
»Was wusste Duclerc darüber?«, fragte ich.
François machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Ich würde sagen – gar nichts. Er war nur völlig happy
darüber, dass der große Floquet auch ihn an diesem Business
beteiligen wollte.«
»Dann herrschte also wirklich Sonnenschein zwischen den
beiden.«
»Absolut!«
2
Als wir am nächsten Morgen im Büro von Monsieur Jean-Claude
Marteau, dem Chef unserer Dienststelle in Marseille saßen, hatten
einige von uns Mühe, ein Gähnen zu unterdrücken. Selbst der
legendäre Kaffee von Monsieur Marteaus Sekretärin Melanie half da
nur bedingt. Der nächtliche Einsatz steckte uns noch in den
Knochen. Und die Art und Weise, wie der Einsatz beendet worden war,
konnte keinem von uns gefallen.
»Es scheint, als würden die Auseinandersetzungen im
Kokain-Geschäft wieder mit einer Brutalität geführt, die wir lange
nicht hatten«, sagte Monsieur Marteau mit ernstem Gesicht.
Außer François und mir waren auch die Kollegen Fred Lacroix,
Boubou Ndonga, Stéphane Caron, Léo Morell und Josephe Kronbourg
anwesend. Dazu noch ein paar Innendienstler. Clement Loubet, der
Cheffeuerwerker hatte mit seinen Leuten die Nacht über
durchgemacht. Er hatte dicke Ringe unter den Augen. Ich hoffte,
dass er und seine Kollegen wenigstens etwas über die Ursache der
Detonation herausgefunden hatten.
Maxime Valois konnte natürlich auch nicht fehlen.
Der Innendienstler hatte die Videoaufzeichnungen ausgewertet,
die bei dem Einsatz entstanden waren.
»Diesen Vorteil haben wir diesmal immerhin«, meinte er. »Wir
haben hervorragende Aufnahmen dieses Mordanschlags – und darum
handelt es sich zweifellos, wie mir Clement sicher bestätigen
wird!«
Clement Loubet nickte.
»Absolut!«
Valois führte uns dann eine bestimmte, entscheidende Stelle
aus den Aufnahmen vor. Es handelte sich um genau den Moment, in dem
die Detonation die beiden Drogenhändler zerrissen hatte. Valois
wandte sich mit einem Ausdruck des Bedauerns an uns.
»Tut mir leid, dass ich euch das nochmal zumuten muss,
Kollegen. Aber bedenkt, dass ich mir diese Szene mindestens
hundertmal ansehen musste, um zu Erkenntnissen zu kommen.
Appetitlich ist das nicht, aber …«
»Schon gut, Max«, unterbrach ihn Monsieur Marteau mit einem
leichten Anflug von Ungeduld.
Maxime Valois nickte.
»Wenn Sie die Bilder in Zeitlupe sehen, dann wird es deutlich,
was ich meine. Ich habe die Aufnahmen mit Clement durchgesprochen,
und wir sind uns einig.«
»Worin?«, hakte Monsieur Marteau nach.
»Darin, dass Jean Duclerc den Sprengstoff bei sich gehabt
haben muss. Sehen Sie.«
In der Zeitlupe konnten wir verfolgen, wie die Detonation bei
Duclerc ihren Anfang nahm. Er blickte an seinen Körper hinab.
Sekundenbruchteile später flog sein Bauch mehr oder weniger
auseinander. Jedenfalls hatte es den Anschein.
Innerhalb eines Augenaufschlags war dann nichts mehr zu sehen.
Nur noch grelles Licht.
Monsieur Marteau runzelte die Stirn.
»Könnte das ein Unfall gewesen sein?«, fragte unser
Chef.
»Durchaus«, meinte Valois. »Allerdings sprechen einige Dinge
dagegen.«
»Welche zum Beispiel?«
Valois wandte sich an Clement Loubet, unseren
Cheffeuerwerker.
Dieser nippte gerade an seinem Kaffeebecher. Er hatte diese
anregende Ladung Koffein mit Sicherheit noch viel nötiger als wir.
Schließlich hatten wir immerhin ein paar Stunden Schlaf hinter uns,
während Loubet die Nacht hatte durcharbeiten müssen.
»Bei dem verwendeten Sprengstoff handelt es sich
höchstwahrscheinlich um Sakalit-13«, erklärte Loubet. »Eine
Substanz, die sich vor allem für die Verwendung bei elektronischen
Zündern, Zeitzündern und dergleichen eignet. Sakalit-13 ist extrem
sicher. Dass die Ladung aus Versehen losgegangen ist, würde ich
fast kategorisch ausschließen. Wenn ein Unfall vorlag, dann hat es
an einer falschen Einstellung des elektronischen Zünders
gelegen.«
»Haben Sie darüber schon irgendwelche näheren Erkenntnisse?«,
fragte Monsieur Marteau.
Clement Loubet schüttelte bedauernd den Kopf.
»Leider nein«, sagte er. »Am Tatort konnten keinerlei Spuren
der Zündvorrichtung gefunden werden. Und dass es sich um
Sakalit-13-Sprengstoff handelt, wissen wir eigentlich nur durch
eine charakteristische Verfärbung der Stichflamme zu Anfang der
Detonation. Soll ich das Band noch einmal zurückspulen?«
»Ich glaube, das ist nicht nötig«, entschied Monsieur Marteau.
Er wandte sich an Stéphane Caron, seinen Stellvertreter. Der
flachsblonde Commissaire hatte die Beine übereinander geschlagen.
»Lassen Sie Ihre Kontakte, die Sie im Untergrund haben, spielen,
Stéphane. Es muss da doch jemanden geben, der Floquet nicht leiden
konnte und ihm deswegen auf die Füße treten wollte.«
»In Ordnung«, nickte Stéphane.
»Vielleicht weiß ja auch einer Ihrer Informanten etwas über
ein paar Kilo Sakalit-13, die verschwunden sind.«
»Gramm!«, korrigierte Clement Loubet. »Von dieser Substanz
sind nicht mehr als ein paar Gramm nötig, um eine derartige
Detonation zu erzeugen.«
Monsieur Marteau hob respektvoll die Augenbrauen.
»Alle Achtung!«, staunte er. »Wer immer dieses Teufelszeug
entwickelt hat, muss einiges auf dem Kasten haben!«
»Die Zeiten, in denen man für die Entwicklung eines neuen
Sprengstoffs den Nobelpreis bekommt, sind allerdings wohl vorbei«,
warf ich ein. Ich hatte mir die Bemerkung einfach nicht verkneifen
können.
Monsieur Marteau nickte nachdenklich.
»Mir kann diese Art von Fortschritt auch gestohlen bleiben,
Pierre. Aber vielleicht kommen wir über den Sprengstoff an die
Täter. Wenn es sich um eine Neuentwicklung handelt, dann kann es
nicht allzu viele Produzenten geben.« Monsieur Marteau wandte sich
an Fred Lacroix. »Vielleicht könnten Sie das abchecken, Fred. Max
braucht erst einmal eine Mütze voll Schlaf.«
»Ich kümmere mich darum«, versprach Fred.
Monsieur Marteau wandte sich jetzt mir und François zu.
»Sie kannten von uns allen Jean Duclerc am besten, François«,
stellte er fest. François bestätigte das durch ein Nicken. »Wäre er
zu einem Selbstmord fähig gewesen?«
»Sie meinen, er ist mit einer Ladung Sprengstoff um den Bauch
an Floquet herangegangen, um ihn in die Luft zu jagen?«
»Inzwischen ist in dieser Hinsicht ja nichts mehr
unmöglich.«
François atmete tief durch.
»Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen.«
»Wieso?«, hakte Monsieur Marteau nach.
»Er hing erstens keinen fanatischen Ideen nach, wenn man davon
absieht, dass er davon besessen war, Geld zu scheffeln. Zweitens
war er ausgesprochen wehleidig, ein richtiger Hypochonder. Dauernd
hat er seine Leute damit genervt. Selbst beim Zahnarzt brauchte er
eine Vollnarkose.«
»Aber Sie haben die Bilder gesehen, François.«
»Sicher.« François zuckte die Achseln. »Das, was ich gesehen
habe, kann ich mit dem Mann, den ich kennengelernt habe, nicht
zusammenbringen.«
»Sie kennen Jean Duclercs privates Umfeld am besten, François.
Ich möchte, dass Sie es zusammen mit Pierre durchleuchten.«
»In Ordnung.«
Etwa eine halbe Stunde später saßen François und ich in
unserem gemeinsamen Dienstzimmer. Der Computerbildschirm flimmerte,
und wir blätterten in Dossiers und Computerausdrucken. Einige
Dutzend Personen gehörten zum Umfeld Duclercs. Ein Teil davon war
in der letzten Nacht verhaftet worden oder umgekommen. Was den Rest
anging, mussten wir entscheiden, wo es sich lohnte
anzusetzen.
Außerdem lagen uns Verbindungsnachweise und Abhörprotokolle
seiner Telefon-, Fax- und E-Mailverbindungen vor. Alles nur
harmloses Zeug. Der Deal im Park war durch einen Boten bestätigt
worden, den Floquet geschickt hatte. Und wäre François nicht bei
Jean Duclercs Leuten erfolgreich eingeschleust gewesen, hätten wir
vielleicht nie davon erfahren.
François warf schließlich genervt den leeren Kaffeebecher in
den Papierkorb.
»Da ist doch nichts dabei!«, meinte er. »Jedenfalls nichts,
was uns etwas darüber verraten könnte, wieso Jean sich in die Luft
gesprengt hat.«
»Hast du gestern Nacht nicht irgendetwas bemerkt?«, fragte
ich.
»Ich saß neben ihm. Es war wie immer. Jean glaubte, dass er
einen Migräneanfall kriegt und war ziemlich stinkig, weil er zu
nervös war, seine Tabletten aus der Jackentasche zu fingern. Er hat
furchtbar herumgeschrien. Aber das war bei Jean nichts Besonderes.
Er war für seinen Jähzorn berüchtigt. Da brauchst du dir nur die
Abhörprotokolle anzusehen.«
»Lass die vergangenen Wochen noch mal Revue passieren,
François! Vielleicht fällt dir im Nachhinein irgendein Detail ein,
das uns weiterbringen könnte.«
»Ich war die ganze Zeit in seiner Nähe – zusammen mit ein paar
anderen Gorillas, die er angeheuert hatte. Bis auf die zwei oder
drei Stunden, in denen er sich den Backenzahn hat ziehen lassen.
Mit Vollnarkose.«
Ich sah mir das Verzeichnis der Personen auf, die unter den
Telefonkontakten zu finden waren.
»Bei diesem Dr. Vincent Caillaux«, stellte ich fest.
»Der hat eine noble Adresse am Park. Wir mussten vor der Tür
stehen und Wache halten.«
»Du Ärmster!«
François verzog das Gesicht.
»Lass uns mit Chantal Monis anfangen.«
»Wer ist das? Ich finde sie hier nicht auf der Liste.«
»Eine Edelnutte. Jean war ihr völlig verfallen. Dass du sie
auf der Telefonliste nicht findest, liegt daran, dass ihr Anschluss
unter dem Namen von Rainard Briand zu finden ist. Er bezahlt ihn
schließlich auch.«
»Wer ist Briand? Ihr Zuhälter?«
»Genau.«
»Musstet ihr vor Chantals Apartment auch Wache halten,
François?«
»Sehr witzig! Wenn ich mir nicht ein paar Wochen Löcher in den
Bauch gestanden hätte, wären wir nie an Floquet und Duclerc
herangekommen.«
3
Die Praxis von Dr. Vincent Caillaux lag in einem exklusiven
Komplex am Park. Die Promis, die hier ihr Domizil aufgeschlagen
hatten, konnten zu Fuß hierherkommen, wenn sie eine Behandlung der
Sonderklasse haben wollten. Hypnose, Bohren mit dem Laser und
nötigenfalls auch eine Vollnarkose waren hier kein Problem.
Die Sprechstundenhilfe blickte auf, als der Mann mit der Narbe
vor dem Tresen auftauchte. Sie erschrak etwas. Die Narbe zog sich
von der Nasenwurzel fast bis zum Kinn. Ansonsten hatte der Mann ein
kantiges Gesicht und wirkte sehr gepflegt. Er trug einen
dunkelgrauen, dreiteiligen Anzug.
Und Handschuhe. Dunkle, eng anliegende Lederhandschuhe.
Schon das war merkwürdig.
Am Kittel der Sprechstundenhilfe hing ein kleines Schild, auf
dem ihr Name stand. Claire Cellier. Sie war hübsch, hatte
brünettes, leicht gelocktes Haar und ein feingeschnittenes
Gesicht.
»Tut mir leid, aber Sie sind etwas zu früh. Wir haben noch
nicht geöffnet, und außerdem müssten Sie sich vorher
anmelden.«
Der Mann mit der Narbe griff unter sein Jackett. Eine
Automatik mit langgezogenem Schalldämpfer kam darunter
hervor.
Die Sprechstundenhilfe schreckte zurück. Sie hatte keine Zeit,
einen Schrei auszustoßen. Der Narbige drückte ab. Der Schuss traf
sie mitten in der Brust, ließ sie zusammenzucken und dann auf ihren
rollbaren Drehsessel sinken. Die Wucht des Geschosses sorgte dafür,
dass sie mitsamt dem Drehsessel zurückrollte, bis sie gegen den
stählernen Karteischrank stieß.
Der Narbige ging in Richtung der Behandlungsräume. Er stieß
eine der Türen auf, ließ den Blick durch den Raum schweifen. In der
Mitte stand ein Behandlungsstuhl. Der Raum roch nach
Desinfektionsmitteln.
Der Narbige nahm sich den nächsten Raum vor.
Dr. Vincent Caillaux saß an einem Computerschirm. Vor einem
Leuchtfeld hingen Röntgenbilder.
Caillaux drehte sich herum.
Er war ein jugendlich wirkender Mittvierziger. Das Haar war
nach hinten gekämmt. Sein Teint sah nach Höhensonne aus. Trotzdem
wurde Caillaux in diesem Augenblick aschfahl.
Er hob die Hand.
»Nein!«, flüsterte er, als er die Waffe in der Hand des
Narbigen sah.
Dieser zögerte keine Sekunde. Blutrot leckte das Mündungsfeuer
aus dem Schalldämpfer heraus.
Caillaux stürzte sich im selben Moment nach vorn, wollte sich
auf seinen Mörder werfen. Es war der Mut der Verzweiflung, der ihn
trieb.
Der Schuss erwischte ihn nicht richtig. Nicht so, wie der
Narbige das geplant hatte. Nur ein Durchschuss durch die Schulter.
Caillauxs weißer Kittel verfärbte sich rot. Das Loch, das das
gewaltige Kaliber der Automatik in den Körper des Getroffenen
hineinriss, war immens. Das Projektil trat an der anderen Seite
wieder hervor und krachte in den Computer hinein. Der Bildschirm
zersprang. Scherben wurden durch den gesamten Raum geschleudert.
Kleine, geschossartige Scherbensplitter. Der Narbige hob schützend
die Hand in Höhe der Nasenwurzel, kniff die Augen zusammen.
Caillaux hatte ihn erreicht, umfasste mit einer Kraft, die ihm
der Narbige gar nicht zugetraut hatte, den Waffenarm des Killers.
Ein Schuss löste sich, riss ein Loch in die Decke und ließ Putz
herunterrieseln.
Der Narbige ließ das Knie hochfahren, traf damit den Zahnarzt
im Unterleib. Caillaux stöhnte auf. Ein zweiter Tritt, mit dem
Vollspann ausgeführt, ließ Caillaux zu Boden gehen.
Caillaux rollte herum.
Der Narbige richtete die Automatik auf seinen Kopf.
Zweimal kurz hintereinander drückte er ab.
Caillaux zuckte zurück. Seine Augen erstarrten. Das große
runde Loch mitten in seiner Stirn ließ keinerlei Zweifel darüber,
dass er nicht mehr unter den Lebenden weilte.
Eine Blutlache bildete sich auf dem Boden.
Der Narbige atmete tief durch, steckte die Waffe ein.
Vielleicht sollte ich in Zukunft mit kleinerem Kaliber
arbeiten, dachte er. Das macht weniger Dreck!
Er holte das Handy aus der Innentasche seiner Jacke, betätigte
eine Kurzwahltaste. Innerhalb weniger Augenblicke stand die
Verbindung.
»Ihr könnt zum Aufräumen raufkommen, Jungs«, knurrte der
Narbige kalt.
4
François betätigte die Sprechanlage eines Apartments in
Vauban. Eine ziemlich luxuriöse Adresse. Chantal Monis' Geschäfte
mussten ganz gut gehen. Andererseits bediente sie wohl auch eine
Kundschaft, die sich nicht in irgendeiner Absteige abfertigen
ließe.
»Ja, bitte?«, fragte eine rauchige Stimme.
»François Leroc, FoPoCri!« stellte François sich vor. »Mein
Kollege Marquanteur und ich möchten Ihnen gerne ein paar Fragen
stellen.«
»Worum geht es?«
»Das möchten wir ungern hier auf dem Flur besprechen, wo
Kameras alles aufnehmen, Madame Monis. Können wir
hereinkommen?«
»Und wenn ich mich weigere?«
»Wir können Sie natürlich vorladen. Aber Sie würden uns und
sich eine Menge Unannehmlichkeiten ersparen, wenn wir das so über
die Bühne bekommen.«
Es klickte in der Anlage. Chantal Monis schien zu
überlegen.
Sie schien ziemlich lange dazu zu brauchen. Ich wurde schon
ungeduldig. Dann öffnete sich endlich die Tür.
Chantal Monis trug nichts weiter als einen sehr knappen
Seidenkimono, als sie uns öffnete. Was immer Chantal auch in den
Momenten getan hatte, in denen sie uns hatte warten lassen – fürs
Anziehen konnte sie bei der knappen Garderobe kaum so lange
gebraucht haben. Sie verschränkte die Arme unter den Brüsten. Das
lange dunkle Haar fiel bis weit über die Schultern.
Wir hielten ihr unsere Ausweise hin.
»Okay, kommen Sie herein!«, meinte sie. »Aber ich habe nicht
viel Zeit.«
»Da geht es Ihnen wie uns«, sagte ich.
Sie drehte sich herum. Wir betraten einen großen Wohnraum.
Flauschiger Teppichboden bedeckte den Boden, so dass man die
Schritte kaum hören konnte. François schloss die Tür.
Chantal Monis deutete auf eine Sitzecke.
»Setzen Sie sich, wenn Sie wollen. Etwas zu trinken kann ich
Ihnen leider im Moment nicht anbieten. Meine Champagner-Flaschen
sind abgezählt. Und wenn jemand wie Sie auftaucht, dann wohl sicher
nicht aus einem Anlass, den man feiern könnte.«
»Was glauben Sie denn, weswegen wir hier sind?«, fragte
François, dessen Blick ansonsten wie magisch angezogen an dem
tiefen Ausschnitt von Chantals Kimono hing.
Sie verzog das Gesicht, bildete mit den vollen Lippen einen
Schmollmund.
»Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung!«
Dann wurden ihre Augen schmal. Sie starrte François an.
»Hey, ich kenne Sie doch irgendwoher! Ist noch nicht lange
her, da habe ich …«
»Ich war bei Jean Duclercs Wachmannschaft«, half François ihr
auf die Sprünge.
Ihr fiel der Kinnladen herunter. Ihr eher dunkler Teint wurde
jetzt blass. Sie schluckte, biss sich auf die Lippe.
»Jetzt sagen Sie aber bitte nicht, dass Sie Jean gar nicht
kennen«, meinte ich.
»Jedenfalls ist mir nun klar, dass er unter Bewachung der
Polizei stand!«
»Jean Duclerc war ein Drogenhändler. Wir waren ihm auf der
Spur. Als er sich mit seinem Großdealer traf, ist er explodiert«,
berichtete François knapp.
Sie hob die Augenbrauen.
»Er ist was?«, flüsterte sie.
»Ich meine das so, wie ich es sage«, erklärte François. »Er
trug offenbar Sprengstoff am Körper. Sein Großdealer, der Stoff und
er selbst sind mehr oder minder zerfetzt worden. Ein paar Gorillas
beider Seiten hat es auch erwischt.«