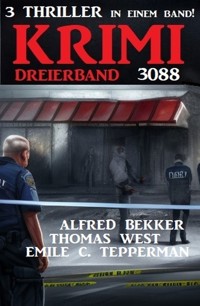
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Jesse Trevellian und der Unterhändler (Thomas West) Jesse Trevellian und der Polizistenmörder (Alfred Bekker) Marty Quade oder Es ist noch Platz im Sarg (Emile C. Tepperman) Ein Police Lieutenant in Queens wird tot aus dem East River geborgen. Ermittler Jesse Trevellian und sein Kollege Milo Tucker ermitteln in diesem Fall. Die Kugeln, die ihren Kollegen niedergestreckt haben, stammen aus einer Waffe, die zuvor bereits einmal in einer Schießerei im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen benutzt wurde.Und dann wird plötzlich der nächste Polizist ermordet... Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden, Sidney Gardner, Jonas Herlin, Adrian Leschek, John Devlin, Brian Carisi, Robert Gruber und Janet Farell.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West, Alfred Bekker, Emile C. Tepperman
Krimi Dreierband 3088
Inhaltsverzeichnis
Krimi Dreierband 3088
Copyright
Jesse Trevellian und der Unterhändler
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Jesse Trevellian und der Polizistenmörder
Marty Quade oder Es ist noch Platz im Sarg: Krimi
Krimi Dreierband 3088
Thomas West, Alfred Bekker, Emile C. Tepperman
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Jesse Trevellian und der Unterhändler (Thomas West)
Jesse Trevellian und der Polizistenmörder (Alfred Bekker)
Marty Quade oder Es ist noch Platz im Sarg (Emile C. Tepperman)
Ein Police Lieutenant in Queens wird tot aus dem East River geborgen. Ermittler Jesse Trevellian und sein Kollege Milo Tucker ermitteln in diesem Fall. Die Kugeln, die ihren Kollegen niedergestreckt haben, stammen aus einer Waffe, die zuvor bereits einmal in einer Schießerei im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen benutzt wurde.Und dann wird plötzlich der nächste Polizist ermordet...
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden, Sidney Gardner, Jonas Herlin, Adrian Leschek, John Devlin, Brian Carisi, Robert Gruber und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Jesse Trevellian und der Unterhändler
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 123 Taschenbuchseiten.
Auf Empfehlung des US-Kongresses beschließt New York City, Schweizer Banken zu boykottieren, bis diese angemessene Ersatzzahlungen für Holocaust-Opfer leisten. Milliardengeschäfte zwischen Schweizer Banken und New Yorker Großkonzernen drohen zu platzen. Urs Zimmermann soll als Unterhändler diese Unternehmen dazu bringen, die Verträge mit den Schweizern einzuhalten. Da ihm mehrere Millionen Dollar Prämie winken, scheut sich der skrupellose Finanzmakler nicht, den Gangster Frank Scalio anzuheuern, der die Unternehmer unter Druck setzen soll und auch vor Mord nicht zurückschreckt. Jesse Trevellian und Milo Tucker vom FBI sind den Verbrechern jedoch bereits auf der Spur. Als David Cohn, Vorstandsvorsitzender der „Transatlantik Traffic Bank“, sich vehement weigert, den Vertrag mit einer Schweizer Bank zu unterzeichnen, werden er und sein Sohn gekidnappt ...
Copyright
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
"Man kann sich seinen Job nicht aussuchen", dachte Toni >the fox< Anselutti. "Niemand kann das." Das kleine Akkordeon zwischen seinen schmalen Händen schickte sentimentale Melodien bis auf die andere Straßenseite hinüber. >This Land Is My Land< und >If I Had A Hammer<.
"Danke, Lady", rief er der alten Frau zu, die ihm zwei Quarters in den Hut warf. "Danke! Gott segne Sie!"
Sein Arsch tat ihm weh, er war es nicht gewohnt, auf hartem Asphalt zu sitzen. Aber was tut man nicht alles für Good Old Frank. Man kann sich seinen Job nicht aussuchen, wie gesagt.
Inbrünstig quetschte er die Melodien amerikanischen Volksgutes aus seinem Instrument. Und ließ keine Sekunde den verglasten Eingang zu einem der wenigen sanierten Häuser in diesem Teil der Mott Street aus dem Auge. Dort, gegenüber, residierte in der Parterre die renommierteste Anwaltskanzlei von Little Italy. Vanchetti oder Vinshatti - Toni hatte ein schlechtes Namensgedächtnis.
Toni >the fox< Anselutti würgte den letzten Akkord von >John Browns Body< fast zwei Takte zu spät ab. Er war ein unverbesserlicher Pathetiker. Dann tastete er hinter sich nach der Pumpgun unter seinem schäbigen Jackett zwischen Hauswand und seinem schmerzenden Rücken.
Die Waffe war scharf, was denn sonst - Toni saß ja schließlich nicht zum Spaß hier. Akkordeon konnte er auch zu Hause spielen. Oder im >Palermo<, seiner Stammkneipe in der Grand Street.
Und die jämmerlichen Dollars in dem alten Hut vor ihm auf dem Bürgersteig würde er übermorgen in der Samstagabendmesse in den Klingelbeutel werfen. Jedenfalls einen Teil davon. Und mit dem anderen Teil würde er eine Kerze für Rosina Scalio kaufen und vor dem Seitenaltar mit dem Bild der Heiligen Jungfrau anzünden.
Rosina Scalio.
Er sah auf die Uhr. Halb zehn. Um neun Uhr vormittags schon hatte sie den Termin bei ihrem Anwalt. Wie immer kam sie zu spät. Zu spät sogar, um ihre Scheidung einzureichen.
"Armer Frank", dachte Toni und griff noch einmal hinter sich nach seiner Pumpgun.
"Arme Rosina." Auf seinem stoppelbärtigen Gesicht spiegelte sich für einen Augenblick das ganze Dilemma wider, in das sein Auftrag ihn gestürzt hatte. Seine braunen Augen drehten sich fast flehend hinauf zum wolkigen Sommerhimmel Manhattans, bevor er wieder in die Tasten griff. Niemand kann sich seinen Job aussuchen. Schon sein Vater hatte das immer gesagt. Damals, als er für Good Old Franks Vater Leute weggemacht hatte.
>I'am Sailing<. Die ganze Sehnsucht dieses Stückes verstand er seinem Instrument zu entlocken - inbrünstig und wehmütig. Den weißen Cadillac sah er trotzdem. Rosinas Cadillac. Hundertfünfzig Meter links von ihm, vor der Kreuzung Mott Street, Kenmare Street stoppte er an der Ampel.
Verdammt! Er hatte nichts gegen die Frau. Er mochte sie sogar. Seitdem sie sich in Franks Bentley von ihm hatte vögeln lassen. Aber Good Old Frank war der Boss. Und der hatte beschlossen, dass sie wegmusste. So war das eben.
>I'am Sailing< brach ab, als hätte ein Strudel das Segelschiff verschlungen, und Toni >the fox< Anselutti zog das Gewehr unter seinem Jackett heraus. Er legte es neben sich auf die Straße und streckte das rechte Bein aus, um es zu bedecken. Noch stand der Cadillac ja vor der roten Ampel.
Er griff wieder nach dem Akkordeon und fing noch einmal von vorn an - >I am Sailing<. Der Cadillac fuhr an, rollte über die Kreuzung und verlangsamte, als er sich dem Haus der Vanchetti-Kanzlei näherte. "Oder Vinshatti", dachte Toni, "was weiß denn ich ..." Nicht den Bruchteil einer Sekunde ließ er den Cadillac aus den Augen.
Noch bevor die Nobelkarosse stoppte, schob sich ein silbergraues Mercedes Coupé in sein Blickfeld. Es hielt vor Toni am Straßenrand. Das Seitenfenster auf der Beifahrerseite senkte sich und ein schwarzbärtig umrahmtes, kupferfarbenes Gesicht grinste ihn an. Mustafa >Taffy< Zibany. Hinter ihm, am Steuer, erkannte Toni den Sohn Franks - Paul.
"Hi, Toni - wie geht's denn so?", rief der Nordafrikaner gut gelaunt. Er war schon seit acht Jahren in den Staaten und sprach immer noch ein haarsträubendes Englisch. Obwohl er sich als Basketballprofi fast tagtäglich mit Leuten abgeben musste, die ihn zwangen richtig hinzuhören und sich vernünftig auszudrücken.
Toni wurde nicht umsonst >the fox< genannt. Blitzschnell erfasste er die Situation. "Hey Taffy, wie soll's mir schon gehen - jeder tut seinen Job. Frank will wissen, ob seine Rosina wirklich zum Anwalt gegangen ist. Na und?"
Verstohlen spähte er auf sein rechtes Bein. Es bedeckte die Pumpgun nur teilweise. Bullshit ...
"Und du vertreibst dir die Zeit ein bisschen mit Musik", grinste Taffy, "he - deinen Job möchte ich haben!"
Toni sah die blonde Frau auf der anderen Straßenseite aus ihrem Luxusschlitten steigen, sah sie die Vortreppe hinauftänzeln, sah sie hinter der Glasfront verschwinden. Eine ungeheure Wut drängte sich in seinen Bauch. Am liebsten hätte er diesem verfluchten Afrikaner eine Ladung aus der Pumpgun in sein Kameltreibergesicht gejagt.
"Man tut, was man kann, du Idiot, und jetzt zieh' Leine ..." Es gefiel Toni nicht, dass der junge Paulie starr geradeaus durch die Windschutzscheibe blickte und ihn keines Blickes würdigte. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. Er richtete sich auf. Seine Rückenmuskulatur wurde hart wie ein Brett.
"Empfindlich heute, unser Füchsen." Taffy entblößte wieder sein tadelloses Gebiss. "Fühlt sich wohl ertappt ...?"
Toni sah, wie seine Schulter sich senkte. Als würde er nach etwas greifen, was unterhalb seines Sitzes lag. "Nun ja, wie soll ich sagen?" Der Kupferfarbene deutete mit einer Kopfbewegung auf den jungen Mann mit dem glänzenden schwarzen Zopf neben ihm. "Paulie ist nicht erbaut darüber, dass du seine Mutter mit dem Ding da unter deinem Bein überraschen willst."
Er lachte breit. Seine Hand erschien an der Fensteröffnung, sein Arm streckte sich heraus, eine schwingende Bewegung, und etwas fiel hart in Tonis Hut. Im gleichen Moment fuhr das Coupé mit schreienden Reifen an und raste davon.
Toni >the fox< Anselutti starrte wie gelähmt in seinen Hut: Auf den Münzen lag ein unglaublich hässliches Ding - gänseeigroß, gemustert wie ein Schildkrötenpanzer, schmutzig grün wie eine zertretene Kröte.
Für den Bruchteil einer Sekunde verweigerte sein Hirn die Arbeit. Eine Handgranate vor ihm im Hut - das durfte einfach nicht wahr sein ...
2
Schneebedeckte Bergriesen, soweit das Auge reichte. Urs Zimmermann liebte es die schweigende Majestät dieser Gipfel auf sich wirken zu lassen. Er gehörte nicht zu den Menschen, die sich angesichts solcher schwindelerregender Größe klein und begrenzt fühlten. Ihm vermittelte das Panorama der Walliser Alpen immer das Gefühl von Grenzenlosigkeit und Macht.
Er stand auf der Terrasse seiner kleinen Bergvilla und setzte das Fernglas an die Augen. Sorgfältig suchte er die Berghänge ab. In diesem Jahr lag die Schneegrenze deutlich tiefer als im Juni letzten Jahres. Vor wenigen Tagen hatte es hier oben sogar geschneit. Der Sommer war bis jetzt ein großer Flop.
Zimmermanns Grundstück und Haus - wenn man das kleine Schloss am Ortsrand von Zermatt so bezeichnen konnte - lagen unten im Tal, eingekreist von Schneegipfeln: Gornergrat, Oberrothorn, Matterhorn und Monte Rosa.
In den Hängen des Oberrothorns, einem schneebedeckten Dreieinhalbtausender, hatte Zimmermann sich vor zwei Jahren sein >Büro< bauen lassen, wie er das allen Ernstes nannte. Von hier oben aus, in über zweitausend Meter Höhe, machte er seine Geschäfte.
Nur die zahlreichen Antennen und Satellitenschüsseln auf dem Flachdach des Holzgebäudes ließen ahnen, dass es sich hier um mehr als nur irgendeine Berghütte handelte. Das, was Zimmermann sich hier, mitten in der schweigenden Bergwe lt für drei Millionen Franken hatte errichten lassen, war ein modernes Hochleistungsbüro. Vollgestopft mit Elektronik und mit drei Internet- und zwölf Telefonanschlüssen versehen.
Drei Millionen Franken hatte Zimmermann dafür investiert.
Von hier aus hielt er Kontakt zu seinen Geschäftspartnern in der ganzen Welt. Von hier aus verschob er Woche für Woche zwei- und dreistellige Millionenbeträge von Frankfurt nach Tokio und von Zürich an die Wall Street.
Die langsame Bewegung, mit der er das Fernglas über die Berghänge streifen ließ, stockte. Er hatte entdeckt, was er suchte. Der kleine Punkt näherte sich rasch und warf einen wachsenden Schatten auf das Schneefeld unter ihm.
Dann das typische Hämmern von Rotoren. Es schwoll rasch an und brach sich donnernd an den Hängen des Gornergrats.
Zimmermann verfolgte den Anflug des Helikopters, bis der über seinem Hubschrauberlandeplatz schwebte. Er setzte das Glas ab und beobachtete, wie die Maschine in etwa dreihundert Meter Entfernung neben seinem eigenen kleinen Helikopter aufsetzte.
Zwei Männer stiegen aus. Zimmermann zoomte ihre Gesichter heran. Er kannte sie nicht. Aber man hatte sie ihm angekündigt.
Er ging ins Haus und stellte die Kaffeemaschine an.
Eine Viertelstunde später saßen sie in dem kleinen Empfangszimmer des Bergbüros und tranken Kaffee. Die beiden Männer sahen aus, als wären sie unten im Tal direkt aus einer dunklen Luxuslimousine in den Hubschrauber gestiegen: Blütenweiße Hemden, teure Krawatten, dunkles Nadelstreifentuch.
Nach dem üblichen Small Talk kamen sie zur Sache. "Sie haben von dem Treffen in Zürich gehört?", sagte derjenige der beiden Männer, der sich mit >Dr. Bellheim< vorgestellte hatte.
Zimmermann verschränkte die Arme über der Brust und nickte. Er trug eine schwarze Lederweste über einem roten Seidenhemd. Dazu weiße Leinenhosen. Mit seinem grauen Lockenkopf und dem Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart wirkte er eher wie der Wirt einer Cocktailbar als wie ein Finanzjongleur.
"Die Vorstandsvorsitzenden der Banken und Firmen, die sich in Zürich getroffen haben, würden gern mit Ihnen zusammenarbeiten." Bellheim musterte Zimmermann aufmerksam.
"Sie dürfen ruhig etwas konkreter werden." Zimmermann verzog keine Miene.
"Nun - wie Sie wissen hat der amerikanische Kongress den US-Bundesstaaten empfohlen, ihre Geschäfte mit Schweizer Banken und Firmen zu boykottieren. Solange, bis unsere Großbanken Ersatzzahlungen für die Goldgeschäfte mit den Nazis während des zweiten Weltkrieg leisten."
Er griff in Tasche seiner Anzugjacke und holte eine Packung Benson & Hedges heraus. "Und Sie kennen auch die Summen, die diesbezüglich im Gespräch sind."
Wieder nickte Zimmermann. Schweigend beobachtete er Bellheim, der sich von seinem Begleiter Feuer geben ließ. Dieser zweite Mann, ein gewisser Baumgart, hatte noch kein Wort gesprochen.
"Noch mehr steht allerdings auf dem Spiel, wenn auch nur ein Bruchteil der Geschäfte platzt, die im Augenblick kurz vor dem Abschluss stehen", fuhr Bellheim fort. "Sie, Herr Zimmermann, haben in Yale studiert, Sie haben an der Wall Street gearbeitet, Sie haben sich zwischen 1988 und 1996 auf dem Parkett der Finanzwelt Manhattans bewegt. Mit einem Wort: Niemand verfügt über derart gute Kontakte zu den New Yorker Geschäftspartnern unserer Auftraggeber wie Sie."
Wieder machte er eine Pause und beobachtete Zimmermanns Reaktion. Der verriet mit keiner Geste und keinem Mienenspiel, dass er begriffen hatte: Sie wollten ihn als Unterhändler engagieren.
"Anfang nächsten Monats werden sich die Finanzchefs der amerikanischen Bundesstaaten in New York treffen und über die Empfehlung des Kongresses beraten. Wir haben keinen Zweifel daran, dass einige Staaten sich zu einem Boykott entschließen werden."
"Das glaube ich allerdings auch", sagte Zimmermann betont langsam.
"Giuliani in New York City hat leider schon entsprechendes signalisiert."
"Ich weiß." Zimmermann kannte den Bürgermeister von New York City persönlich. Wenn es darum ging, eine harte Linie zu fahren, stand er gewöhnlich in der ersten Reihe.
"Vier Prozent vom Gewinn jedes Geschäftes, das Sie retten können." Bellheim verständigte sich durch einen Blick mit seinem Begleiter. Der zog ein Kuvert aus der Innentasche seines Jacketts und legte es vor Zimmermann auf den Tisch. "Hier ist eine Liste mit den Projekten, um die es geht, und mit den Namen der Leute in New York City, die Sie besuchen sollten."
Sekundenlanges Schweigen. Zimmermanns Hirn arbeitete auf Hochtouren. Er verfügte über gute Insiderkenntnisse und hatte in etwa den Überblick über die Geschäfte, die Schweizer Banken und Firmen zurzeit in New York City abwickelten.
Vier Prozent vom Gewinn eines jeden Geschäfts, dass er retten würde ... Er überschlug die Zahlen und kam auf eine Summe, die sich der Zwanzig-Millionen-Grenze näherte.
"Sechs Prozent", forderte er. Bellheim leistete keinen großen Widerstand. Eine halbe Stunde später war man sich einig - fünf Prozent. Zimmermann begleitete die Männer zurück zu ihrem Hubschrauber und sah der Maschine nach, bis sie sich ins Tal hinabsenkte und aus seinem Blickfeld verschwand.
Danach ging er zurück in sein Bergbüro, setzte sich an einen PC und buchte für Zürich - New York über Frankfurt für das kommende Wochenende. Die Suite im >Carlyle< in der Upper East Side mietete er zunächst für einen Monat.
Anschließend fischte er in seiner Datenbank nach der Adresse eines Mannes, dessen Geschäftsmethoden er wegen ihrer Wirksamkeit schätzte. Der Name >Frank Scalio< flimmerte über seinen Monitor. Anders als Scalio würde Zimmermann niemals einem Mann das Ohr abschneiden, seine Kinder entführen, oder seine Leiche im Hudson versenken. Solche Methoden waren absolut rufschädigend. Abgesehen davon, dass man vom Gefängnis aus keine Finanzgeschäfte abwickeln konnte.
Aber manchmal musste man einfach auf solche Methoden zurückgreifen. Und dann war es günstig einen Spezialisten dafür an der Hand zu haben ...
3
Es war ein Donnerstag Anfang Juli. Viel zu früh legte sich die Dunkelheit auf die Stadt. Ich stand am Fenster meines Apartments und blickte in den grauschwarzen Himmel. Ein Gewitter braute sich zusammen.
"Dann eben nicht", murmelte ich und stellte meine Laufschuhe zurück in den Schuhschrank. Zum Joggen konnte ich auch später noch gehen. Nach dem Gewitter würde die schwüle Luft sich hoffentlich verzogen haben. Und dann würde es doppelt Spaß machen durch den Central Park zu traben.
Ich angelte mir eine Pizza aus dem Kühlfach und schob sie in den Mikrowellenherd. Zehn Minuten später saß ich mit dem dampfenden Stück und einer Dose Bier vor dem Fernsehgerät. Die Acht-Uhr-Nachrichten.
>Die Staaten Kalifornien und New York haben heute beschlossen, Ihre lange angedrohten Sanktionen gegen Schweizer Banken in die Tat umzusetzen...<
Ich mochte Sarah Boyle. Die dunkelblonde Nachrichtensprecherin strahlte eine Art von Weiblichkeit aus, die mich anzog, seitdem ich sie zum ersten Mal auf der Mattscheibe gesehen hatte.
>... weitere Bundesstaaten haben angekündigt, die Möglichkeiten eines Boykotts zu prüfen ...<
Viele der Nachrichtensprecher nervten mit einem verkrampften Grinsen, das sie wohl für ein Pokerface hielten. Nicht mal, wenn sie Horrormeldungen von Toten und Verletzten vortrugen, konnten sie sich dieses Grinsen verkneifen. Sarah Boyle dagegen sprach ernst und sachlich, und wenn besonders erschütternde Nachrichten auf ihrem Manuskript standen, zog sie kaum merklich die Augenbrauen hoch, und ihre Stimme nahm einen rauen Klang an.
>... wie ein Sprecher des Bürgermeisters mitteilte, hat die Stadt New York sich den Sanktionen bereits angeschlossen. Marc Cellinger aus der City Hall Manhattans ...<
Schon seit Monaten kam mir regelmäßig der Gedanke, sie einfach mal anzurufen. Nur, um ihr zu sagen, wie angenehm es wäre, wenn ihr sympathisches Gesicht auf der Mattscheibe erschien. Wer freut sich nicht über ein Kompliment, oder?
Statt Sarah war plötzlich ein von Reportern umringter Mann auf dem Bildschirm zu sehen. Die Einblendung stellte ihn als Finzanzchef des Bundesstaates Kalifornien vor.
>Kalifornien wird ab sofort neue Anlagen, Wertpapiere oder Immobiliengeschäfte mit den Schweizer Großbanken stoppen<, sagte er, und der Finanzhäuptling unserer schönen Stadt setzte noch einen drauf:
>Auch New York City wird sich entsprechend der Kongressempfehlung den Sanktionen gegen Schweizer Banken und Firmen anschließen. Wir denken sogar daran, sie auf Schweizer Produkte im Allgemeinen auszuweiten ...<
Ein Kongressabgeordneter kam zu Wort, ein Vertreter des Außenministeriums und ein Anwalt, der die Holocaust-Opfer beziehungsweise deren Hinterbliebene vertrat.
Erst nach dem Wetterbericht - oder genauer gesagt, nachdem Sarahs Gesicht für diesen Abend vom Bildschirm verschwunden war - machte ich mir klar, was ich da eben gehört hatte. Ich schnappte mir die New York Times dieses Donnerstages. Draußen grollte der Donner des durchziehenden Gewitters.
Beim Durchblättern der Zeitung hatte ich heute Morgen einen Hintergrundbericht über die Klage der Holocaust-Opfer gegen die Schweizer Banken überflogen. Den nahm ich noch einmal gründlich unter die Lupe.
Es ging um das Gold, das die Nazis in den dreißiger und vierziger Jahren ihren jüdischen Opfern geraubt und in der Schweiz deponiert oder verkauft hatten. Und es ging um die Konten von überlebenden oder getöteten Holocaust-Opfern, die angeblich nach Kriegsende von den Schweizer Banken unterschlagen worden waren.
Die Anwälte der Holocaust-Opfer verlangten 1,5 Milliarden Dollar Entschädigung. Die Banken hatten nicht einmal die Hälfte davon angeboten: 600 Millionen Dollar.
"Anderthalb Milliarden", murmelte ich und faltete die Zeitung zusammen. "Eine Menge Holz. Die Sanktionen werden sie wesentlich teurer zu stehen kommen."
Ich ging wieder zum Fenster und sah hinaus. Das Gewitter hatte sich inzwischen entladen, und der Regen nachgelassen. Ich holte meine Laufschuhe aus dem Schrank.
Eine halbe Stunde später trabte ich durch den Park. Ich genoss es, meine Lungen mit der gereinigten Luft zu füllen. Auf den Laubwäldern und über dem Wasserspiegel des Sees lag eine warme Dunstdecke.
Ich lief bis zum Anbruch der Dämmerung. Die Nachrichten hatte ich längst in einer Schublade der Kategorie zweitrangig in meinem Hirn abgelegt. In wenigen Tagen würden sie mich wieder einholen. Leider nicht in der Gestalt der schönen Sarah Boyle ...
4
Frederick Cohn griff zur Fernbedienung und stellte den Ton ab. Der Rest der Nachrichtensendung flimmerte stumm über die Mattscheibe. "Was wirst du jetzt tun, Dad?" Der etwas zwanzigjährige Mann mit dem kahl rasierten Schädel schnippte eine Philipp Morris aus der Schachtel.
Missbilligend blickte David Cohn von seinem Sessel zu seinem Sohn auf, der neben ihm stehend die Nachrichten über den Sanktionsbeschluss verfolgt hatte. Frederick wusste, dass sein Vater es hasste, wenn in seiner Gegenwart geraucht wurde. Und hatte sich frühzeitig daran gewöhnt, solche Blicke zu ignorieren.
"Ich versteh' deine Frage nicht, Frederick." Die Stimme, des kleinen, drahtigen Mannes entsprach der aristokratischen Haltung, mit der er in seinem Sessel thronte: kühl, beherrscht, fast arrogant.
Frederick lachte trocken. "Du verstehst sehr gut, Doktor. Wirst du unterschreiben oder nicht?"
Cohn senior sah durch die Bilder auf dem Fernsehschirm hindurch in irgendeine Ferne. "Die Regierung unserer Stadt hat beschlossen, sich an den Sanktionen zu beteiligen. Ich wüsste nicht, inwiefern für mich da noch ein Entscheidungsbedarf bestehen könnte."
"Einmal Soldat, immer Soldat!" Wieder das zynische Lachen Fredericks. Das war seine Art mit der Arroganz seines Vaters umzugehen. "Insofern, als dass dir in wenigen Tagen auf der Vorstandssitzung der >Transatlantik Traffic Bank< ein millionenschwerer Vertrag zur Unterschrift vorgelegt werden wird." Er war merklich lauter geworden. "Erzähl mir bloß nicht, deine Juristen würden nicht mindestens zehn Gründe nennen können, die einen Rückzug aus diesem Geschäft a priori ausschließen!"
David erhob sich und blieb mit auf dem Rücken verschränkten Armen vor seinem um einen Kopf größeren Sohn stehen. "Dafür, dass du meinen Beruf verachtest, bist du erstaunlich gut auf dem Laufenden."
Für Sekunden fixierten sich die scheinbar so ungleichen Männer schweigend - hier der hagere junge Mann in den schwarzen Wildlederhosen und dem kurzärmligen weißen Seidenhemd, in dessen feinen Gesichtszügen ein spöttisches Lächeln spielte, und dort der grauhaarige Endvierziger in anthrazitfarbener Anzughose und Weste und in blassblauem Hemd mit bordauxrotem Binder. Das Gesicht des Älteren schien aus Marmor gemeißelt zu sein.
David Cohns eisgraue Augen lösten sich von den eisgrauen Augen seines Sohnes. Bedächtig begann er in seinem großen Wohnzimmer auf und ab zu schreiten. Würdevoll und mit kerzengerader Wirbelsäule.
"Als hätte er ein Lineal verschluckt", dachte Frederick. Er hatte seinen Vater selten anders erlebt. Schon auf Fotos, die ihn als jungen Offizier der Air Force zeigten, posierte er genau in dieser Haltung.
Das Geschäft mit der Schweizer Großbank war so gut wie unter Dach und Fach. Er, David Cohn, musste als Vorstandsvorsitzender nur noch gegenzeichnen. Auf der Vorstandssitzung in fünf Tagen, am kommenden Dienstag. Es ging um den Bau eines Goldbergwerkes in Bolivien. Beide Banken wollten gemeinsam investieren und die Finanzierung tragen. Die Verhandlungen mit der Bolivianischen Regierung waren zäh genug gewesen. Und jetzt das.
"Die Regierung hat eine Entscheidung getroffen. Eine weise Entscheidung übrigens. Und ich habe mich daran zu halten", sagte er, ohne seinen Sohn dabei anzusehen.
"Mach dich doch nicht lächerlich, Dad!", platzte Frederick heraus. "Ein paar verkappte Cowboys rasseln mit den Sporen und lockern ihre Colts, und du nimmst das so tierisch ernst, als hätte Gott persönlich ..."
"Lass Gott aus dem Spiel!", unterbrach David scharf.
"… ein elftes Gebot erlassen. Du willst mir doch nicht erzählen, dass eine Heerschar von Brokern in der Wall Street ..."
"Gib die Kunstakademie auf und studiere etwas Vernünftiges!" David machte ein paar energische Schritte auf den Jungen zu. "Dann kannst du dich bei uns bewerben und irgendwann einmal auch mitreden!"
"… dass eine Heerschar von Bankern Millionenbeträge in den Wind schreibt, ihre Schweizer Geschäftspartner vor den Kopf stößt und wochenlang nach neuen auf die Suche geht, nur weil ..."
"Schweig!" Herrschte David seinen Sohn an.
"Ich will dir sagen, was die weitaus meisten deiner properen Kollegen tun werden!" Unbeirrt und genauso laut wie sein Vater fuhr Frederick fort. "Sie werden ihre Juristen solange Nachtschicht schieben lassen, bis die ihnen eine stolze Sammlung von Vertragsklauseln und Gesetzeslücken präsentieren. Und dann werden sie sich die schönsten heraussuchen, um den Regierungsbeschluss ..."
"Vergiss nicht aus welcher Familie du kommst!", brüllte David Cohn. Sein Gesicht nahm eine rötliche Färbung an. "Deine Großeltern", er stach mit dem Zeigefinger nach der Brust seines Sohnes, "und zwei meiner Onkel kamen in deutschen KZs ums Leben!" Die Erregung verzerrte seine Marmorzüge zu einem Spiegel lodernden Hasses. "Ihr Vermögen ist spurlos verschwunden! Versickert in den Labyrinthen der Nazikonten auf Schweizer Banken!" Die Gesichter der beiden berührten sich fast. "Vergiss das nie!"
Die große zweiflügelige Tür öffnete sich. Eine zierliche, elegant gekleidete Frau mit kastaninenbraunem Haarturm erschien im Türrahmen.
"Müsst ihr schon wieder streiten?" Ihre Stimme klang flehend.
"Schon gut, Rachel", flüsterte David.
Sekundenlang standen die Männer so dicht voreinander, dass einer den warmen Atem des anderen auf den Wangen spürte. Stumm sahen sie sich an. Als würde ihre hoffnungslose Liebe füreinander immer noch nach einer Brücke suchen. Und als könnten sie noch immer nicht fassen, dass Welten zwischen ihnen lagen ...
5
Stanley Morrison schaltete den Fernsehapparat aus. Ächzend quälte er seinen fetten Körper aus dem Sessel, schaukelte quer durch sein Wohnzimmer zum Telefontisch und ließ sich seufzend auf den Stuhl daneben fallen. Er griff zum Telefon und wählte die Nummer seines Sekretärs. "McCall?", meldete sich ein rauchiger Bass.
"Haben Sie die Nachrichten gesehen, McCall?"
"Hab' ich, Mr. Morrison. New York State und Kalifornien spielen starker Mann und wollen den Schweizern die Zähne zeigen."
"Reden Sie keinen Quatsch, McCall - hier geht es um Gerechtigkeit."
"Ist ja okay, Sir, aber um mir das zu sagen, rufen Sie sicher nicht an. Ich höre."
Seitdem Morrison stellvertretender Finanzchef von New York State war, tat er sich schwer mit der direkten Art seines Finanzsekretärs. Wie Schreibtisch und Dienstzimmer im Rathaus von Albany hatte er auch diesen aufsässigen Beamten von seinem Vorgängers übernommen. Seit zwei Jahren ärgerte er sich über die zynische Art dieses Querulanten.
Und McCall ließ keine Gelegenheit aus, ihn spüren zu lassen, dass er sich selbst für weit geeigneter hielt als seinen Chef, die Finanzen des Staates New York zu verwalten.
"Sie fahren morgen hinunter nach Manhattan. Ich will, dass Sie den Bankern und Generaldirektoren den Beschluss der New Yorker Regierung nicht nur schmackhaft machen, sondern auf seine Verbindlichkeit bestehen."
"Hab's kommen sehen", brummte McCall.
Morrison überhörte das. "Kümmern Sie sich vor allem um David Cohn, den Vorstandsvorsitzenden der >Transatlantik Traffic Bank< und um Washington Miller, den Chef des >International Merchant Instituts<. Beide Bankhäuser stehen vor Vertragsabschlüssen mit Schweizer Großbanken. Dass es dabei um Unsummen geht, brauche ich Ihnen nicht zu sagen."
"Nein, das brauchen Sie wirklich nicht." McCalls Stimme klang, als würde er grinsen.
Morrison ignorierte es. "Ich will, dass diese Banken von Ihren Geschäften mit der Schweiz Abstand nehmen." Schweigen. "Habe ich mich klar ausgedrückt, McCall?"
"Haben Sie, Sir. Ich werd' mein Bestes tun."
"Davon gehe ich aus."
Damit war das Gespräch beendet. Morrison stemmte seine zweihundertvierundachtzig Pfund aus dem Stuhl und schaukelte zu seiner Schrankbar. Dort schenkte er sich einen italienischen Grappa ein.
Während der Schnaps brennend seine Kehle hinabrann, dachte er nach. Sicher gäbe es geeignetere Leute, um den Regierungsbeschluss in der Manhattaner Geschäftswelt durchzusetzten als ausgerechnet McCall. Aber wenn sein Sekretär scheiterte - und davon ging Morrison aus - hätte er endlich einen Grund ihn abzusägen. Und dann würde er persönlich nach Manhattan fahren und den Boykott gegen die Schweiz auf Touren bringen.
Er schenkte sich noch einen ein und hob das Glas. "Also Stanley ..." Die Gewohnheit mit sich selbst zu sprechen, hatte sich in den letzten beiden Jahren bei ihm eingeschlichen. Seit seine Frau ihn mit den beiden Kindern verlassen hatte. "… wenn wir schon diesen Schweinehund von Saddam nicht kaputt bomben können, führen wir wenigstens einen hübschen kleinen Finanzkrieg gegen die Schweiz. Prost!" Er kippte den Grappa hinunter.
6
"Du wolltest sie töten, du Schwein ..." Die Stimme des kaum Fünfundzwanzigjährigen klang leise. Aber keineswegs ängstlich.
"Wie redest du mit deinem Vater!", brüllte Frank Scalio los. Sein aufgequollenes Altmännergesicht lief rot an. Die Adern an seiner Schläfe traten hervor. "Toni sollte sie observieren! Weiter nichts! Ich wollte wissen, ob sie tatsächlich den Mut hat, die Scheidung einzureichen!"
"Erzähl mir keinen Quatsch, Dad." Obwohl sein Vater aufgesprungen war und mit beiden Armen ruderte, wich Paul Scalio keinen Zentimeter von dessen Schreibtisch zurück. Seine Augen funkelten böse. Sein dichtes, zu einem Zopf zusammengebundenes schwarzes Haar glänzte ölig. "Du wolltest meine Mutter töten, weil du ihr nicht auszahlen willst, was ihr zusteht ..."
"Wie kannst du es wagen ...!" Frank plusterte sich auf und tobte in seinem Büro herum. Jeder wusste, wie er reagierte, wenn man ihn in die Enge trieb. Auch Paul wusste es. Und trotzdem stand er vor dem Schreibtisch und zeigte sich vollkommen unbeeindruckt. Das brachte den Senior noch mehr in Rage.
Im Hintergrund, neben der ledergepolsterten Bürotür, saß Mustafa >Taffy< Zibany. Unruhig rutschte er auf seinem Stuhl hin und her.
Frank, ein mittelgroßer zum Fettansatz neigender Mittfünfziger mit pomadigem Haar, dessen akkurat geordnete Strähnen die Glatze eher hervorhoben als tarnten, zog alle Register. Beschwor seine Ehre und seine Autorität als Oberhaupt der Organisation, verfluchte seine fast zwanzig Jahre jüngere Frau, Pauls Mutter, die er während eines Urlaubs in Sizilien als Fünfzehnjährige geheiratet hatte, und jammerte über die Arztrechnungen, die er für Anseluttis mittlerweile zweiwöchige stationäre Behandlung im Beekman Downtown Hospital bezahlen musste.
Seinem Killer war es zwar gelungen, die Handgranate in den Hauseingang neben sich zu werfen, aber abgesprengte Gesteinsbrocken hatten ihn fast skalpiert. Und er beklagte sich bitter über die anstehenden Zahlungen, die der Anwalt seiner Frau von ihm forderte.
"Sie begnügt sich nicht mit dem Unterhalt!", rief er. "Schmerzensgeld will sie! Schmerzensgeld!" Flehend hob er die Arme über den Kopf. "Heilige Mutter Gottes! Du weißt, dass dieses Luder die Ohrfeigen verdient hat! Doppelt soviel hat sie verdient! Und jetzt Schmerzensgeld ...! Ich bin ruiniert!"
Paul kannte seinen Vater. Jeder Versuch, seinen Wortschwall zu unterbrechen, war sinnlos. Er wartete, bis ihm die Puste ausging und Frank sich schwer atmend in seinen Bürosessel sinken ließ. Dort saß er seufzend und blickte mit weinerlicher Miene auf seine gefalteten, fleischigen Hände.
Paul verachtete ihn vor allem wegen seines pathetischen Hanges zum Selbstmitleid.
Als er merkte, dass sein Vater endlich Ruhe gab, stützte er sich auf den Schreibtisch und beugte sich zu ihm hinüber. Frank sah erschrocken auf. In seinen Augen flackerte Angst.
"Wenn du meine Mutter tötest, wirst du sterben", sagte Paul. Er sprach langsam und jedes einzelne Wort betonend. Und aufreizend langsam führte er seine Hand zur Brust und tippte sich dreimal ans Brustbein. "Ich persönlich werde dich umbringen."
Der Nordafrikaner hinter ihm erstarrte. Genauso wie Frank. Pauls hassfunkelnde Augen bohrten sich in den flackernden Blick seines Vaters. Bis dieser sich abrupt abwandte. Dann erst richtete Paul sich auf und verließ das Büro. Zibany folgte ihm mit weichen Knien.
Eine Zeit lang konnte Frank keinen klaren Gedanken fassen. Er fummelte eine Zigarillo aus dem Zigarrenkästchen auf seinem Schreibtisch. Während der herbe Duft ihres Rauches sich in seinem Büro ausbreitete, machte er sich seine Situation klar.
Jahrzehntelang hatte er gebraucht, um die Organisation in Little Italy aufzubauen und gegen die Konkurrenz zu verteidigen. Inzwischen gehörte er zu den angesehensten Männern zwischen der Bowery und dem Westlichen Broadway, zwischen der Canal und der Houston Street. Drogenhandel, Prostitution, Schutzgelderpressung und die vielen kleinen Spezialdienstleistungen, die zu seinem Repertoire gehörten, hatten ihn zum Millionär gemacht.
Und nun, wo er sich zur Ruhe setzen wollte, ließ Rosina, dieses Miststück, sich scheiden. Grund genug, sie zu töten. Jeder hier in Little Italy hätte Verständnis dafür gehabt. Aber nicht genug damit - diese Schlange besaß auch noch die Frechheit, ihn wegen Körperverletzung zu verklagen!
Die Hälfte seines Vermögens würde ihn dieser Rechtsstreit kosten, hatte sein Anwalt prophezeit.
Grübelnd tigerte Frank Scalio in seinem Büro auf und ab. Ich persönlich werde dich umbringen – jedes Mal, wenn die Worte seines Sohnes ihm durch den Kopf gingen, wenn er dessen hasserfülltes Gesicht auf seiner inneren Leinwand sah und seine drohende Stimme hörte, richteten sich seine Nackenhaare auf.
"Dieser missratene Bastard wird seine Drohung wahr machen", murmelte er vor sich hin. Er gestand sich nicht ein, dass er Paul fürchtete. Der Junge war so ganz anders als er selbst.
Irgendwann flüchtete er sich wieder hinter seinen Schreibtisch und griff zum Telefon. Auf die erste Nummer, die er wählte, meldete sich ein Mann mit dem Namen >Harry<.
"Hör zu, Harry", sagte Frank, "blas die Sache ab."
"Aber wieso denn, Boss, die Bremsleitung ist präpariert, in einer Stunde will Ihre Frau ..."
"Ich hab gesagt, die Sache wird abgeblasen, kapiert?"
"Aber Boss", die Stimme am anderen Ende der Leitung bekam einen flehenden Unterton. "Was soll ich machen, wenn Ihre Frau gleich in den Cadillac steigt!? Soll ich sagen >Tut mir leid, Sie müssen ein anderes Fahrzeug nehmen. Ihr Mann hat dafür gesorgt, dass Sie mit diesem hier auf dem Roosevelt Highway unter den nächstbesten Truck ..."
"Das ist mir scheißegal, was du ihr erzählst, du Hohlkopf! Von mir aus fackele die Kiste ab! Auf jeden Fall wird die Sache ein für alle Mal abgeblasen! Sonst liegst du morgen um die Zeit auf dem Grund des Hudsons!" Er knallte den Hörer auf und wählte die nächste Nummer.
"Hotel Carlyle? Geben sie mir Zimmer 212." Er wartete ein paar Sekunden. Dann meldete sich eine Männerstimme. "Hallo, Mister Zimmermann." Frank nahm den Hörer in die andere Hand und zog einen Notizblock zu sich heran. "Sie haben mich vor einer Woche angerufen. Ich hab's mir noch einmal überlegt. Meine Ablehnung war etwas voreilig. Einen Auftrag übernehme ich noch, bevor ich mich zur Ruhe setze."
"Freut mich, Mr. Scalio", sagte Zimmermann. "Freut mich, dass Sie doch noch mit einsteigen. Ihr Sohn wird erleichtert sein."
"Mein Sohn ...?" Frank machte ein begriffsstutziges Gesicht.
"Er arbeitet bereits seit einer Woche für mich ..."
7
Wir standen am Bug eines Bootes der New York Port Authority Police. Zweihundert Meter rechts von uns die Südspitze von Roosevelt Island. Links, etwas doppelt so weit entfernt, der Yachthafen von Long Island City.
"Sie haben ihn." Milo stieß mich an und deutete auf die beiden Taucher, die eben an der Oberfläche des East Rivers erschienen. Sie winkten den Männer zu, die am Heck des großen Bergungsschiffes gewartet hatten. Der Kranarm des Bergungsschiffes schwenkte herum. Quietschend sprang dessen elektrische Seilwinde an, und vier hakenbewehrte Stahltrossen senkten sich ins Wasser hinab.
Gleichzeitig sprangen drei weitere Taucher in den East River. Gemeinsam mit ihren Kollegen steuerten sie die Stahltrossen auf den Grund des Flusses, wo sie offensichtlich das Motorboot entdeckt hatten, das Zeugen gestern Vormittag an dieser Stelle sinken gesehen haben wollten.
Milo und ich interessierten uns brennend für das gesunkene Boot. Seit einigen Wochen musste sich unser New Yorker FBI-District Office mit einen Ring von Waffenhändlern beschäftigten, den wir in Verdacht hatten, nicht nur Waffen osteuropäischer Herkunft an die Unterwelt des Big Apples zu verkaufen, sondern auch mit spaltbarem Material zu handeln. Nicht erst seit Oklahoma waren unsere Behörden auf diesem Ohr besonders hellhörig.
Einer der Verdächtigen jedenfalls hatte sich unserem Observationsteam entzogen. Wir wussten, dass er häufiger mit dem Motorboot von Queens nach Manhattan übersetzte. Ihn in dem verunglückten oder sabotierten Boot zu finden, hätte uns nicht überrascht.
Es dauerte fast drei Stunden, bis die Trossen des Kranbootes endlich den Bug des Motorbootes an die Wasseroberfläche zogen. Und noch einmal zwei Stunden, bis die Leiche eines Insassen geborgen war.
Der Tote war wesentlich jünger, als der Mann, den wir zu finden gehofft hatten. Und er hatte ein scheußliches Loch im Hinterkopf. Ein Loch, wie es großkalibrige Waffen in Schädeldächer zu reißen pflegen.
Milo und ich sahen uns enttäuscht an. "Also - dann lass uns zurück zum Hafen fahren", brummte Milo und blickte auf seine Armbanduhr. Es war nach halb zwei. "Zeit für einen kleinen Imbiss."
Zwei Detectivs im Hafen von Long Island City hatten über Funk die Identität des Toten ermittelt. "Lassen Sie hören, Kollegen." Ich lehnte mich gegen das zivile Dienstfahrzeug der beiden Polizisten. Der eine saß auf dem Beifahrersitz und verschlang einen Hotdog. Der andere stand neben Milo und mir an der offenen Tür. Er hielt noch das Mikro des Autotelefons in der Hand.
"Der Mann an Bord des Motorbootes ist ein bekannter Immobilienhändler aus Lower Manhattan", berichtete er. "Eine Vermisstenanzeige ist erst heute Morgen eingegangen."
"Okay", brummte Milo. "Dann können wir ja gehen." Ich sah meinem Partner an, dass ihm der Magen knurrte. Wir wandten uns ab.
"Vielleicht auch nicht." Unser Kollege von der New York City Police gab uns mit einer Handbewegung zu verstehen, noch zu warten. "Gehört Erpressung nicht auch auf euern Dienstplan?", fragte er, während er seinem Partner das Mikro in den zivilen Dienstwagen hineinreichte.
Ich nickte. "Ist der Mann erpresst worden?"
"Sieht fast so aus. Mel Wyndham", er machte eine Kopfbewegung zu dem Zinksark, den zwei Beamten der Hafenpolizei gerade von Bord des Polizeibootes trugen, "hat Geschäfte mit Übersee gemacht. Und irgendjemandem passte das nicht. Er hat sich vor drei Tagen bei der Polizei gemeldet, weil er sich bedroht fühlte. Ziemlich komplizierte Sache. Am besten, ihr besorgt euch mal die Akte."
Wir taten mehr als das. Noch von Queens aus fuhren wir nach Lower Manhattan herunter und statteten dem Büro des Toten einen Besuch ab.
Ein ziemlich großes Büro in einem Hochhaus in der Fulton Street. Ich zählte mindestens zwanzig Mitarbeiter. Die Leitungsebene hinter den Türen ihrer Exclusiv Büros bekamen wir nicht zu Gesicht.
Abgesehen vom Stellvertreter Wyndhams. Er bat uns in ein Empfangszimmer. "Furchtbar", er schüttelte unablässig den Kopf. "Furchtbar." Er wies auf zwei Ledersessel. "Nehmen Sie doch bitte Platz, Gentlemen. Ist er ..."
Aus erschrockenen Augen sah er uns abwechselnd an und vergaß sogar sich hinzusetzen. "… ist er umgebracht worden?" Im Zeitlupentempo ließ er sich uns gegenüber auf einer Ledercouch nieder.
"Wie kommen Sie darauf?" Milo machte ein skeptisches Gesicht.
"Mr. Wyndham ist bedroht worden." Der Mann sprach plötzlich leise und mit heiserer Stimme. "Unser Büro vermittelt den Verkauf eines großen Fabrikkomplexes an einen deutschen Autobauer. Für die Finanzierung des Umbaus konnten wir eine Schweizer Bank gewinnen."
Ich horchte auf. "Als sich dann Anfang des Monats New York City dem Boykott Schweizer Banken anschloss, entschied sich Mr. Wyndham einen neuen Finanzierungsplan aufzustellen."
Sarah Boyle fiel mir ein. Und die Nachrichten über die Nazigoldaffaire. In den letzten zwei Wochen wollte dieses Thema nicht mehr aus den Schlagzeilen verschwinden. "Er weigerte sich also mit Schweizer Banken zusammenarbeiten?"





























