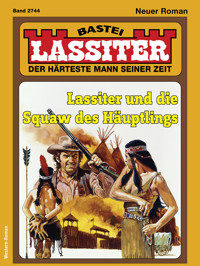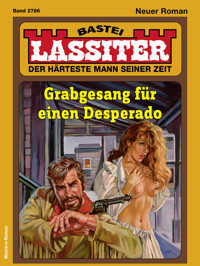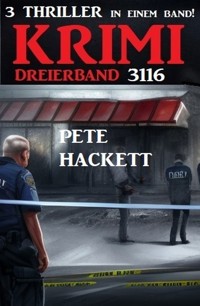
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis (XE399) von Pete Hackett: Trevellian und der Henker von Harlem Trevellian und der Tod in Chinatown Trevellian und die späte Reue Mortimer Hardin hat ein geniales Programm, mit dem man fast perfektes Falschgeld erzeugen kann. Leider gibt es gleich mehrere Parteien, die sich dafür interessieren und angesichts der immensen Gewinne auch keine Hemmungen haben, dafür über Leichen zu gehen. Ein harter Brocken für FBI-Agent Jesse Trevellian und seine Kollegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett
Krimi Dreierband 3116
Inhaltsverzeichnis
Krimi Dreierband 3116
Copyright
Trevellian und der Henker von Harlem: Action Krimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Trevellian und der Tod in Chinatown
Trevellian und die späte Reue
Krimi Dreierband 3116
Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Krimis
(XE399)
von Pete Hackett:
Trevellian und der Henker von Harlem
Trevellian und der Tod in Chinatown
Trevellian und die späte Reue
Mortimer Hardin hat ein geniales Programm, mit dem man fast perfektes Falschgeld erzeugen kann. Leider gibt es gleich mehrere Parteien, die sich dafür interessieren und angesichts der immensen Gewinne auch keine Hemmungen haben, dafür über Leichen zu gehen. Ein harter Brocken für FBI-Agent Jesse Trevellian und seine Kollegen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER A.PAANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www. AlfredBekker.de
postmaster@alfredbek ker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Trevellian und der Henker von Harlem: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 128 Taschenbuchseiten.
Wer tötet Rauschgifthändler mitten in New York? Die FBI-Agents Trevellian und Tucker setzen sich auf die Spur der „Initiative rauschgiftgefährdeter Jugendlicher“, die offenbar Recht und Urteilsvollstreckung in die eigene Hand nimmt. So gute Absichten auch dahinterstehen mögen, Mord geht gar nicht! Das FBI muss Lynchjustiz verhindern.
1
Es war ein regnerischer und kalter Oktobertag, als Benny Miller auf der Treppe einer Kellerwohnung in East Harlem, genauer in der East 123rd Street, an einer Überdosis Heroin starb.
Als seine Fixer-Freunde merkten, was Sache war, nahmen sie Reißaus.
Benny starb qualvoll. Das Rauschgift in seinem Körper warf ihn hin und her und schüttelte ihn. Er bäumte sich auf, erbrach sich, bekam keine Luft mehr. Der Tod kam nur langsam. Es war ein fürchterlicher Tod.
Benny war noch keine 18 Jahre alt.
Das Rauschgift hatte er von einem Dealer in Harlem gekauft, mit Geld, das er bei einem Überfall auf einen kleinen Milchladen erbeutet hatte. Es war mit Mehl gestrecktes Heroin …
Man sprach vom goldenen Schuss, den sich Benny gesetzt hatte.
Im Endeffekt aber war Benny Miller gestorben, weil sich ein skrupelloser Mafiaboss dem lukrativen Geschäft mit der tödlichen Sucht verschrieben hatte.
Es ließ sich sehr gut leben davon.
Der Name des Mafioso war Iwan Tschertschenkow.
Die Russenmafia begann sich mehr und mehr in Manhattan zu etablieren …
2
Es war Nacht in Harlem. Vor einer schummrigen Bar stand Bob Franklin, genannt „das Wiesel“. Das Wiesel war von schwarzer Hautfarbe und knapp 25 Jahre alt.
Es war nasskalt. Bob Franklin fröstelte. Eng zog er sich die imprägnierte Jacke um den Leib. Auf seinem Kopf saß eine rote Strickmütze mit einem schwarzen Streifen. Der Bursche trat auf der Stelle.
Bob Franklin wartete auf Kunden. In seinen Taschen trug er genau abgewogene Portionen Heroin, aber auch etwas Haschisch und ein paar LSD-Trips.
Das Wiesel hasste diesen Job, aber er übte ihn aus, weil er Kohle machen konnte, ohne sich die Finger zu beschmutzen oder sich den Rücken krumm zu arbeiten.
Ein Ford Mustang älterer Bauart schälte sich aus der Dunkelheit einer Seitenstraße. Mit blubberndem Motor rollte er langsam näher. Die beiden Scheinwerfer schnitten in die Finsternis wie grell-gelbe Lichtfinger. Der Asphalt schimmerte feucht. Hier und dort waren vom immer wieder einsetzenden Nieselregen kleine Pfützen zurückgeblieben. In den Rinnsteinen hatte sich abgefallenes, vertrocknetes Laub gesammelt. Ein kalter Wind zerrte an Bob Franklins gelber Regenjacke.
Bob Franklin hatte den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Er starrte dem Wagen entgegen. Auf der anderen Straßenseite marschierte eine Gruppe lärmender Jugendlicher vorbei. Hinter Franklin war der gedämpfte Lärm aus der Bar zu vernehmen. Wenn der Lärmpegel manchmal etwas zurückging, waren Fetzen von Soulmusik aus der Jukebox zu hören. Die rot leuchtende Neonschrift über der Tür des zwielichtigen Etablissements fiel auf Franklins Rücken und warf seinen Schatten lang in die Straße.
Der Ford hielt an. Er schaukelte ein wenig und ächzte in der Federung. Das Seitenfenster wurde heruntergekurbelt. Bob Franklin konnte undeutlich ein Gesicht wahrnehmen. Es war der Beifahrer. Franklin trat einen halben Schritt näher.
„Hi, Bob“, kam es aus dem Auto.
„Hi, Serikow“, versetzte Franklin. „Was gibt‘s?“
„Läuft das Geschäft?“
„Noch nicht so gut. Aber das kommt noch. Jetzt tanzen und schmusen sie noch da drin.“ Bob Franklin wies mit dem Daumen über seine Schulter. „Aber bald werden Sie mehr wollen. Dann brauchen sie ihre Trips …“
Er grinste. Auf seinem großen, weißen Gebiss spiegelte sich das Licht der Straßenlaterne auf der anderen Straßenseite.
„Der Chef will dich seh‘n. Steig hinten ein.“
Auf der anderen Straßenseite verschwanden die Jugendlichen in einer stockfinsteren Gasse. Es gab dort keine Straßenbeleuchtung. Das hier war die finsterste Gegend Harlems. Und die kriminellste …
Franklins Grinsen gefror. „Er selbst?“, entfuhr es ihm überrascht. „Sonst schickt er doch nur jemanden von euch, wenn‘s was zu reden gibt.“
„Nun, heute will er persönlich mit dir sprechen.“
„Was will er denn? Hab mein Zeug immer ordentlich verkauft und abgerechnet.“
Bob Franklin schien nervös zu werden. Er kaute auf seiner Unterlippe herum, schaute sich gehetzt um. „Der Platz hier ist gut, Leute. Wenn ich jetzt verschwinde, dann …“
„Steig ein!“, kam es schroff und ungeduldig aus dem Ford.
Franklin hüpfte von einem Bein auf das andere, als hätten sich unvermittelt seine Schuhsohlen stark erhitzt. „Ich …“ Er brach ab. Jedes weitere Wort wäre vergeudet gewesen. Franklin wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Er entschloss sich jäh. „Zur Hölle mit euch. Ihr könnt mich mal!“
Mit dem letzten Wort warf Bob Franklin sich herum und ergriff die Flucht.
Die Türen des Ford flogen auf. Fahrer und Beifahrer nahmen fluchend die Verfolgung des Schwarzen auf.
Doch Bob Franklin wurde nicht umsonst „das Wiesel“ genannt. Er gewann zusehends an Vorsprung. Manchmal warf er einen schnellen Blick über die Schulter nach hinten. Dann schnellte er plötzlich nach rechts und verschwand zwischen den Häusern. Er flitzte die Gasse hinunter, als säße ihm der Leibhaftige im Nacken. Der Weg war leicht abschüssig. Er rannte um sein Leben. Denn keiner der kleinen Dealer wie er, die die zweifelhafte Ehre bekommen hatten, den Boss persönlich zu Gesicht zu bekommen, ist je wieder lebend aufgetaucht. Man fischte sie aus dem East River oder fand sie außerhalb der Stadt auf einer Müllhalde.
Sie waren zum Tode verurteilt und zu ihrer Hinrichtung gebracht worden. Gnade kannte das Syndikat nicht.
Hinter Bob Franklin hämmerten die Absätze seiner Verfolger auf den Betonplatten des Gehsteiges. Wenn er zurückschaute, konnte er sie schemenhaft wahrnehmen.
Die Angst peitschte Bob Franklin vorwärts. Sie verlieh ihm Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Aber sie machte ihn auch unachtsam.
Es war eben sein Pech, dass im Pflaster des Gehsteiges an verschiedenen Stellen Betonplatten fehlten. In eines dieser Löcher trat Franklin. Rasender Schmerz von seinem Knöchel zuckte hinauf bis unter seine Gehirnschale, er strauchelte, ruderte mit den Armen, konnte seinen Sturmlauf nicht mehr abbremsen und krachte der Länge nach auf den steinharten Boden. Sein Mund klaffte auf, unwillkürlich brüllte er Angst und Schmerz hinaus.
Franklin kam nicht mehr hoch. Er lag auf allen vieren, als ihn seine beiden Häscher erreichten. Seine Hände waren vom Sturz aufgeschürft, seine Knie aufgeschlagen. Er blickte an den beiden Kerlen in die Höhe, und sie kamen ihm aus dieser Perspektive unheimlich groß und wuchtig und ausgesprochen bedrohlich vor. Die Dunkelheit hier in der Gasse verhüllte ihre Gesichter. In der Hand des einen glaubte Bob Franklin eine schwere Pistole wahrzunehmen.
Das Wiesel erschauderte. Seine Zähne schlugen aufeinander.
„Was wollt ihr denn von mir?“, keuchte es entsetzt.
Der eine der beiden versetzte ihm einen leichten Tritt. „Das haben wir dir doch gesagt, Nigger! Wir sollen dich zum Chef chauffieren.“
Der Bursche sprach einen harten Akzent, was verriet, dass er kein gebürtiger Amerikaner war.
„Steh auf. Und jetzt keine Mätzchen mehr, mein Freund, sonst holt dich der Teufel.“
Er half Franklin auf die Beine. Dabei fasste er ihn nicht mit Samthandschuhen an. Er packte das Wiesel einfach beim Genick und zerrte es brutal in die Höhe.
Franklin zitterte. Seine Knie waren butterweich. Er musste zweimal ansetzen, dann entrang es sich ihm: „Bitte, Leute, lasst mich laufen. Sagt dem Boss, ihr habt mich nicht erwischt. Erzählt ihm …“ Er verschluckte sich und musste husten. Wie ein Erstickender japste er nach Luft.
„Du kackst dir ja richtig in die Hose, Nigger“, stieß einer der beiden verächtlich hervor. „Als ich dich vor wenigen Tagen sah, da warst du richtig cool drauf. Hast du etwa ein schlechtes Gewissen?“
„Ich … Ihr … Schlechtes Gewissen – nein. Ich war immer einer der besten Verkäufer und …“
„Bis jetzt, Franklin“, kam es sanft. „Aber dann hast du angefangen, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Du hast guten Stoff abgezwackt und die Portionen, die du verkauft hast, mit Mehl gestreckt. Ein Junkie ist daran verreckt. Und wahrscheinlich war das nicht der letzte. Das können wir uns nicht leisten, Franklin. Damit ruinierst du uns das Geschäft.“
„O mein Gott“, schrie das Wiesel. „Niemals habe ich so was getan. Ihr müsst mir glauben. Ich käme niemals auf die Idee, den Boss zu betrügen. Wie kommt er darauf, dass ich …“
„Frag ihn selbst, Franklin. Und erzähl ihm dann deine Story. Aber jetzt schwing die Hufe! Hurtig, hurtig, mein schwarzer Freund. Oder müssen wir dir ein Feuer unter den schwarzen Arsch schüren?“
Bob Franklin taumelte vorwärts. Seine Beine vermochten ihn kaum zu tragen. Er hatte Angst, jämmerliche, hündische Angst – Todesangst. Denn er ahnte, was ihm bevorstand.
Sie bugsierten ihn in den Ford. Er musste auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Hinter ihn setzte sich der Kerl mit der Pistole. Er drohte: „Mach nur keine Zicken, Wiesel. Der Chef hat sicher nichts dagegen, wenn wir dich ihm tot vor die Füße legen.“
Bob Franklin wurde von einer Woge des Grauens durchlaufen. Er spürte Gänsehaut. Und es war nicht nur die Kälte, die von außen kam, die ihn frösteln ließ.
3
Sie brachten Bob Franklin nach Midtown, in die Nähe der St. Patricks Cathedral, und hier wurden ihm die Augen verbunden. Von nun an merkte er nur noch, dass es kreuz und quer durch New York ging. Einmal vernahm er das Heulen einer Schiffssirene, er wusste aber nicht, ob der Kahn auf dem East River oder auf dem Hudson River fuhr.
Endlich hielt der Wagen. Der Motor wurde abgestellt. Franklin wurde die Augenbinde abgenommen. Sie befanden sich in der tintigen Finsternis eines Hinterhofes. Ringsum sah Franklin nur mehrstöckige Wohn- und Geschäftshäuser.
„Aussteigen!“, wurde er angeherrscht.
In seinen Eingeweiden rumorte die Angst. Im Fegefeuer seiner Empfindungen konnte er keinen klaren Gedanken fassen. Mechanisch langte er nach dem Türgriff. Die Tür schwang auf. Die Innenbeleuchtung des Wagens ging an. Franklins Mund war trocken wie Wüstenstaub, sein Hals wie zugeschnürt.
Der Bursche, der im Fond gesessen hatte, nahm ihn draußen in Empfang. Franklin spürte den unerbittlich harten Druck einer Kanone auf seiner Niere.
Der Fahrer schob seine riesenhafte Gestalt aus dem Auto. Seine Tür schlug zu.
„Marsch!“, kommandierte der Mister mit dem Schießeisen. Im Vorbeigehen warf er die Tür der Beifahrerseite ebenfalls zu. Nach einigen Schritten flammte Licht auf. Ein Bewegungsmelder hatte die Treppenhausbeleuchtung und das mit dieser gekoppelte Hoflicht eingeschaltet. Geblendet schloss Franklin die Augen.
Derjenige, der den Ford gesteuert hatte, öffnete die Haustür. Der andere verstärkte seinen Druck mit der Beretta auf Franklins Nierengegend. Franklins Zähne schlugen zusammen wie im Fieber. Sein Herz raste. So konnte nur einem Mann zumute sein, wenn er in die Gaskammer oder zum elektrischen Suhl geführt wurde.
Sie dirigierten ihn in den Keller hinunter. Es gab dort einen erleuchteten Flur, von dessen beiden Seiten einige Türen in irgend welche Räume führten. Die Wände waren schmutzig und mit allen möglichen Sprüchen und Parolen beschmiert. Die Schritte seiner Begleiter hallten in dem leeren Korridor. Schließlich wurde Franklin in einen Raum auf der linken Seite gedrängt.
Und hier empfing ihn grelles Neonlicht. Ein Tisch stand da, vier Stühle, an einer Wand sah Franklin einen alten Rollschrank mit abgerissener Jalousie. Die Fächer waren leer. Daneben befand sich eine alte Anrichte.
Er wurde wortlos auf einen der Stühle gedrückt. Einer der beiden Kerle, die ihm Furcht einflößten, holte aus der Anrichte eine dünne, aber widerstandsfähige Schnur und fesselte Franklin auf dem Stuhl fest. Er knebelte ihn. Als es Franklin von dem Knebel hob und ihm weit die Augen aus den Höhlen traten, lachten sie schallend.
„Lass dir die Zeit nicht lang werden, Nigger“, knurrte der mit der Beretta ohne jede weitere Gemütsregung, dann drehten sie das Licht aus und verschwanden. Über Franklin schlug absolute Finsternis zusammen. Er hörte, wie sich auf der anderen Seite der Tür der Schlüssel knirschend drehte, dann wurde er abgezogen.
Franklin begann, an seinen Fesseln zu zerren. Der Knebel erstickte ihn fast. Aber die Fesseln hielten, und der Knebel ließ sich nicht herausstoßen.
4
Ein Mann näherte sich dem „Maxim“. Das Maxim war ein Junkie-Treff mitten in Harlem. Es ging auf Mitternacht zu. Ein Schwarzer in Jeans und Turnschuhen und einem gestrickten, abenteuerlich farbigen Mantel stand etwas abseits, ein ganzes Stück vom Rand des Lichtscheins entfernt, in einer Gruppe von Jugendlichen. Es waren Burschen und Girls. Hauptsächlich Schwarze.
Der Mann trug seinen Hut tief in der Stirn, die Hände hatte er tief in den Taschen seines Trenchcoats vergraben. Die Enden des Gürtels waren nicht zusammengebunden, sondern hingen lose an den Seiten des Mannes nach unten.
Er durchquerte den flackernden Lichtschein. Er hatte ein schmales, kantiges Gesicht, seine Lippen waren zusammengepresst, in den Mundwinkeln hatten sich dunkle Kerben gebildet. Er war Mitte 50, und er war weiß.
Ohne im Schritt zu stocken näherte er sich der Gruppe um den Burschen mit dem schreiend-farbigen Wollmantel, der in diesem Moment von einem der Jungs einige Dollarscheine entgegennahm und sie schnell in der Manteltasche verschwinden ließ. Er griff unter den Mantel, da sah er den Ankömmling. Seine Hand fiel nach unten. Misstrauisch fixierte er den Weißen.
Der blieb zwei Schritte vor der Gruppe stehen. Mit klarer, präziser Stimme sagte er: „Kinder, lasst die Finger vom Rauschgift. Jagt den dreckigen Dealer im bunten Mantel zum Teufel und kehrt um auf eurem sicheren Weg in die Hölle. Dort werdet ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit landen, wenn ihr das Teufelszeug nehmt.“
Einige der jungen Leute lachten.
Der Schwarze im Wollmantel drängte sich mit tänzelnden Schritten durch sie hindurch, umrundete den Weißen einmal, dann grinste er ihm ins Gesicht: „Wer bist du denn, Opa? Ein Prediger, ein selbsternannter Apostel, der irgend welche verirrten Schäfchen auf den Pfad der Tugend zurückbringen möchte?“
„Ich gehöre der Initiative rauschgiftgefährdete Jugendliche an, einer Selbsthilfeorganisation, die verirrte Schäfchen, wie du es so schön ausgedrückt hast, und ihre verzweifelten Eltern betreut, ihnen hilft und …“
„Aaah, ein Samariter bist du also. Heh, Opa, willst du dir damit den Weg in den Himmel freischaufeln? Oder machst du dich nur wichtig? – Verschwinde, bevor dich Floyd Tanner in den Arsch tritt. Du bist hier im verkehrten Film.“
„Wer ist Floyd Tanner?“, fragte der Mann im Hut furchtlos.
„Na, wer wohl, Opa? Ich bin das. Heh, Mann, ich werde dich mit einem fetten Tritt nach Hause schicken.“
Er fing wieder an, um den Mann im Trenchcoat herumzutänzeln. Er gehörte zur ganz besonders coolen Sorte. Die Jugendlichen amüsierten sich, stießen sich an und machten zotige Bemerkungen. Sie verhöhnten den Weißen.
Dieser drehte sich auf der Stelle. Er ließ Floyd Tanner nicht aus den Augen. Floyd Tanner fintete, hüpfte und zog eine aus seiner Sicht recht beeindruckende Show ab.
Der Mann im Trenchcoat aber zeigte nicht die Spur einer Gemütsregung. Er stieß rasselnd hervor: „Ihr Dealer seid schlimmer als die Pest im Mittelalter. Noch schlimmer aber sind die, die hinter euch stehen. Sie verdienen sich eine goldene Nase, und ihr kleinen Lichter seid nur ihr williges Werkzeug. Ihr geht über Leichen, euch ist nichts heilig. Aber die Strafe wird euch alle treffen. Ob Drahtzieher oder Straßenverkäufer wie dich. Denk über meine Worte nach, Junge, ehe es für dich zu spät ist.“
„Kleine Lichter – williges Werkzeug – Strafe“, echote der Neger. „Bist du‘n Bulle, weil du von Strafe redest? Ein verdammter Policeman? Ein predigender Cop? – Heh, Mann, verdufte, ehe ich wirklich zornig werde.“
Der Mann im Trenchcoat beachtete ihn nicht weiter. Sein Blick heftete sich auf die Gruppe der Jugendlichen. „Lasst die Finger von dem Teufelszeug, Leute. Ich weiß, wovon ich rede. Es reißt euch in den Abgrund. Und von dort gibt es kaum mehr ein Zurück. Die Nervenheilanstalt oder der Tod warten auf euch.“
Er machte abrupt auf dem Absatz kehrt und marschierte davon.
Floyd Tanner rief lachend: „Ihr lasst euch doch von dem Schwätzer nicht ins Boxhorn jagen, Leute. Also kommt her, damit wir das Geschäft abschließen. Der gute Floyd Tanner hilft euch, den Tiefen des Lebens zu entfliehen und himmelhochjauchzende Sphären zu erklimmen.“
Etwa drei Stunden nach Mitternacht hatte Tanner seinen Stoff verkauft. Er machte sich auf den Heimweg. Er tanzte, sang vor sich hin, steppte um eine Straßenlaterne herum und war voll überschäumender Zufriedenheit. In seiner Manteltasche knisterte ein dicker Packen Dollarscheine. Zehn Prozent gehörten ihm.
Tanner erstarrte jedoch, als hinter einem parkenden Lastwagen der Mann im Trenchcoat hervortrat. Der Schwarze erkannte ihn sofort. Er wollte etwas sagen, spürte die Bedrohung die von dem anderen ausging, aber da erklang schon die Stimme des Weißen. Sie klang fast traurig:
„Ich warnte dich doch, mein Junge. Sagte ich nicht, die Strafe wird euch alle treffen. Du hättest wirklich über meine Worte nachdenken sollen. Jetzt ist es zu spät.“
Der Mann zog seine Rechte aus der Manteltasche.
Seine Faust umspannte eine schwere Pistole.
Eine jähe Blutleere im Gehirn ließ Floyd Tanner wanken. Er streckte dem Mann seine Hände entgegen, als hätte er damit die Kugel abwehren können.
Aber die Kugel traf ihn mitten in die Brust. Tanner hörte noch den verschwimmenden Knall, dann erloschen in seinem Kopf die Lichter. Tot fiel er neben dem Lastwagen auf den Gehsteig.
Der Mann im Trenchcoat verschwand wie ein Schatten in einer Gasse.
5
Bob Franklin war trotz der Angst, die in ihm nagte und trotz seiner Fesseln, die ihm das Blut abschnürten, auf dem Stuhl eingeschlafen.
Er schreckte hoch, als die Tür zu dem fensterlosen Verlies, in dem er eingesperrt war, quietschend aufschwang. Der Neonstab an der Decke flammte auf. Die beiden Kerle, die ihn hergebracht hatten, traten in den Raum.
Verstört blinzelte Franklin sie an. Und im nächsten Moment kam mit aller Schärfe wieder die Panik. War seine letzte Stunde angebrochen? Der Aufruhr seiner Empfindungen raubte ihm fast den Verstand.
Er kannte die beiden. Sie waren die Mittelsmänner zwischen dem Boss und den Kerlen, die die Schmutzarbeit verrichteten, zu denen auch er, Bob Franklin, zählte. Allerdings wusste er nur die Vornamen der beiden Gorillas. Sie hießen Igor und Semjon. Der blondhaarige Kleiderschrank war Igor, der dunkelhaarige Kleiderschrank war Semjon. Beide hatten sie milimeterkurz geschorene Haare, und sie erinnerten den gefesselten Dealer an Agenten des KGB aus den Zeiten des kalten Krieges, wie er sie immer wieder in verschiedenen Thrillern gesehen hatte.
„Du hast noch einmal Glück gehabt, Nigger“, knurrte Igor und schnitt die Fesseln Bob Franklins auf. Franklin spürte den Schmerz in seinen Fingerkuppen, dieses Hämmern und Stechen, als seine Hände jäh durchblutet wurden. „Normalerweise sollte dein Kadaver schon auf irgendeiner Müllhalde liegen. Aber es ist etwas dazwischen gekommen, und du hast einen Sonderauftrag in der Tasche. Danke deinem großen Boss da oben, ich meine den hinter den Wolken.“
Er zog mit dem letzten Wort Franklin den Knebel aus dem Mund.
Der Schwarze atmete zuerst einmal tief durch. Nicht nur, weil der Knebel seine Zunge nicht mehr gegen den Gaumen drückte wie ein welkes Blatt, sondern weil er noch einmal eine Chance erhielt. Seine Hinrichtung war ausgesetzt, verschoben worden. Und wenn er sich anstrengte, fand er vielleicht sogar Gnade bei seinem Boss – seinem irdischen Boss natürlich.
„Sonderauftrag“, schnappte er. „Das ist gut. Ich mache alles, was der Chef von mir verlangt.“
„Das wollen wir dir auch geraten haben“, versetzte Semjon, der dunkelhaarige Mafioso mit der Figur eines Catchers.
„Was soll ich tun?“
Bob, das Wiesel, war plötzlich richtig quirlig vor Elan. Er fühlte sich wie neugeboren.
„Dasselbe wie bisher“, knurrte Igor zwischen den Zähnen. „Du verkaufst weiterhin deinen Stoff. Und zwar vor dem Maxim.“
Bob Franklin schaute verdutzt. „Ist das nicht Floyd Tanners Domäne?“
„Floyd wurde heute morgen mit einer fetten 45er Kugel in der Brust gefunden. Und du übernimmst seinen Platz.“
Bob Franklin zuckte zusammen.
Sie verbanden ihm die Augen, dann führten sie ihn nach oben. Er wurde zwischen Rücksitz und Lehne des Beifahrersitzes ins Auto gedrückt, so dass er nicht mehr zu sehen war, nachdem die Tür geschlossen wurde.
Bei der Mother African Methodist Episcopal Zion Church in der West 137th Street nahmen sie ihm die Augenbinde ab, gaben ihm eine Tüte voll mit exakt portioniertem Heroin, und warfen ihn aus dem Ford.
Igor sagte grollend: „Das ist Stoff für zehntausend Dollar. Deine zehn Prozent musst du draufschlagen. Aber du weißt ja Bescheid, Wiesel. Solltest du wieder mehr als zehn Prozent draus machen, dann finden sie dich auch mit einem Stück Blei in der Figur in irgendeinem Rinnstein. Klar?“
„Klarstens!“, versicherte Bob Franklin, verstaute das Rauschgift in den Taschen seiner Kleidung und warf die leere Tüte achtlos fort.
„Na denn – viel Glück.“
Die beiden Russen sprangen in den Wagen und rauschten davon.
Das Wiesel machte sich auf den Weg. Es war noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.
6
Am Nachmittag dieses Tages zitierte Mr. McKee Milo und mich in sein Büro. Wir nahmen Platz. Unser väterlicher Freund fragte: „Kaffee?“
Natürlich ließen wir es uns nicht entgehen, eine Tasse von Mandys vorzüglichem Kaffee zu genießen.
Mandy bekam den Auftrag von Mr. McKee, dann sah er uns – erst mich, dann Milo, dann wieder mich – an und begann: „In Harlem tut sich was, Leute. Es geht um Rauschgift. In der vergangenen Nacht wurde einer der Straßenverkäufer erschossen. Sein Name ist Floyd Tanner – ein Schwarzer.“
„Dass irgendwo eine Leiche im Rinnstein mit ‘ner Kugel in der Figur aufgefunden wird, ist dort oben an der Tagesordnung“, gab Milo zu verstehen. Er seufzte. „Aber wenn tatsächlich Rauschgift im Spiel ist, dann ist es wohl unser Fall.“
„So ist es“, nickte Mr. McKee. „Mir liegt der Bericht der Mordkommission vor. Einige Jugendliche haben sich heute Vormittag dort gemeldet und eine Aussage gemacht. Habt ihr schon mal was von einer Initiative rauschgiftgefährdete Jugendliche gehört?“
Wir schüttelten synchron die Köpfe. Ich sagte darüber hinaus: „Nein. Muss neu ins Leben gerufen worden sein. Aber irgend welche Initiativen werden täglich geboren, und oftmals lässt das Interesse der Initiatoren sehr schnell wieder nach.“
„Ja“, ergänzte Milo, „und fast jede Initiative ist ein Vorwand, um den eigenen Geldbeutel zu füllen.“
Mr. McKee lächelte. „Also, die Initiative gibt es scheinbar. Einige der Jugendlichen sagten aus, dass sie dabei waren, als Floyd Tanner an ein paar Fixer Heroin verscherbelte. Da gesellte sich ein Mann hinzu, Amerikaner, um die fünfundfünfzig, und stellte sich als Vertreter der Initiative rauschgiftgefährdete Jugendliche vor. Er soll einige Dinge von sich gegeben haben, die die Jugendlichen und auch Tanner wohl zunächst als humoristische Einlage auffassten. Zuletzt warnte er Tanner noch, und dann verschwand er wieder. Und jetzt ist Tanner tot.“
Mandy brachte den Kaffee. Sie schenkte uns ein. Er war heiß und schwarz, und der Duft stieg uns in die Nasen. Nichts gegen ein Kaffeekränzchen am Nachmittag, wenn nur nicht immer Mord und Totschlag die Themen gewesen wären.
Nun, das war so.
„Das sieht mir eher nach einem Racheakt aus“, meinte ich, nach kurzer Überlegung, nachdem ich vorsichtig von dem heißen Gebräu genippt hatte. Ja, er schmeckte genauso, wie er duftete.
„Wahrscheinlich ein Vater oder Onkel, dessen Sohn oder Neffe von diesen verdammten Straßenhändlern in die Sucht oder gar in den Tod getrieben wurde“, vermutete Milo. „Die Kerle, die das Gesetz gern in die eigene Hand nehmen, sind auch im Zeitalter der Saturn-Raketen und der ganzen Hochtechnologie nicht ausgestorben.“
„Daran habe ich auch schon gedacht“, versetzte Mr. McKee. „Nachdem kein Mensch diese Initiative zu kennen scheint, ist es leicht möglich, dass der Mörder Initiator und zugleich einziges Mitglied der Organisation ist. Ein Einzelgänger also, der – wie Sie es ausgedrückt haben, Milo –, das Gesetz in die eigene Hand nimmt.“
„Wir sollen uns sicher darum kümmern, Sir“, sagte ich.
„Ja, Jesse. Nehmt euch mal die Angehörigen der Junkies vor, die in den vergangenen sechs Monaten am Rauschgift gestorben sind.“
„Das dürfte das Problem nicht sein“, sagte ich. „Von den Kollegen des Narcotic Squad bekommen wir sicher eine umfangreiche Liste der Drogentoten. Aber es kann auch der Angehörige eines Süchtigen sein, der noch unter den Lebenden weilt. Und dann wird‘s problematisch.“
Ich trank von meinem Kaffee.
„Na denn – Cheerio“, murmelte Milo und hielt seine Tasse in die Höhe, als wollte er mit mir anstoßen. „Das bedeutet zunächst mal Schreibtischarbeit – rückenkrümmende, die Gehirnwindungen mobil haltende Bewältigung von Papierkram.“
Seine Stimme beinhaltete eine gute Portion Galgenhumor.
Schreibtischarbeit war uns beiden ein Gräuel.
„Ich denke“, wandte der Chef ein, „dass es nicht bei dem Vorfall von vergangener Nacht bleibt, Leute. Wenn ich den Täter richtig einschätze, dann ist es einer, der sich zum Richter und Henker aufgeschwungen hat. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass er sich als Vertreter oder Angehöriger einer Initiative vorstellte. Hätte er es gezielt auf diesen Floyd Tanner abgesehen gehabt, hätte er wohl vorher kaum über die Gefahren des Rauschgifts gepredigt und Tanner zur Umkehr angehalten. Dann hätte er ihn umgelegt, und für ihn wäre die Sache erledigt gewesen.“
Diese Theorie hatte einiges für sich – eine ganze Menge wahrscheinlich sogar.
Mr. McKee fuhr fort: „Vor allen Dingen drohte der Mörder, dass nicht nur die kleinen Straßenverkäufer zur Rechenschaft gezogen werden würden, sondern auch die Drahtzieher im Hintergrund. Sagt euch der Name Iwan Tschertschenkow etwas?“
„Ja“, erwiderte ich und versuchte in den Zügen meines Chefs zu lesen. „Russenmafia. Ist erst dabei, die Leiter emporzuklettern. Hat immer wieder bei den anderen Syndikaten auf Granit gebissen und schon so manche Schlappe einstecken müssen.“
„Getarnt als Kunstmäzen“, fügte Milo hinzu. „Besitzer einer eigenen Galerie – Schutzgelderpresser und Rauschgifthändler.“
„Genau der“, bestätigte Mr. McKee. „Dass er Schutzgelder erpresst und einen Rauschgifthandel aufgebaut hat, konnten wir ihm allerdings – leider, möchte ich sagen – noch nicht beweisen. Er residiert in der Upper East Side, in der Second Avenue.“
Ich war ein wenig verwirrt. „Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Mord an Floyd Tanner und dem Russen?“, fragte ich in der Hoffnung, nicht als begriffsstutzig rüberzukommen. Etwas verunsichert schaute ich von Mr. McKee auf Milo, aber dankenswerterweise zeigte der auch einen ziemlich ratlosen Ausdruck in den Augen.
„Der Name des Russen taucht – hinter vorgehaltener Hand natürlich –, immer wieder in der Harlemer Rauschgiftszene auf. Die Kerle, die die Schutzgelder kassieren, sprechen akzentuiertes Englisch, und manchmal verliert der eine oder andere einen Einwurf auf russisch. Sieht aus, als würde Tschertschenkow seine Hände nach Harlem ausstrecken, um dort das ziemlich lukrative Geschäft an sich zu reißen.“
„Und wenn er dort etabliert genug ist, so dass ihm keiner mehr die Butter vom Brot nimmt, dann expandiert er.“
Ich spürte Zorn in mir. Es war immer dasselbe. Die kriminelle Energie dieser Mafiabosse war unerschütterlich und grenzenlos. Stadtteil um Stadtteil wurde kassiert und mit Verbrechen überschwemmt. Das endete erst, wenn die Schufte entweder uns in die Fänge gerieten, oder wenn einer kam, der das Geschäft mit dem Tod noch besser beherrschte und noch ein Ende skrupelloser war. Das Wort Verbrechen kennt eine Steigerung …
„Okay, okay“, murmelte Milo. „Wir werden also nicht nur Schreibtischkram wälzen, wir werden uns auch Iwan den Schrecklichen vorknöpfen.“
„Das war‘s.“ Mr. McKee klatschte mit der flachen Hand auf den Schreibtisch. „Ich werde von hier aus meine Ermittlungen betreiben und euch auf dem Laufenden halten. Jesse, Milo, trinkt euren Kaffee aus, ihr könnt auch gerne noch eine zweite Tasse bekommen, doch dann lasst Taten sprechen.“
Mr. McKee grinste in der ihm eigenen Art. Es erinnerte mich immer an das Lächeln eines weisen Mannes, der dem Geheimnis der menschlichen Natur auf die Schliche gekommen ist.
Als wir draußen waren, meinte Milo: „Jetzt weiß ich auch, weshalb der Chef bis zum Nachmittag gewartet hat, um uns mit diesem Auftrag zu versorgen. Er …“
„… hat bereits von sich aus recherchiert und für uns die Spur gelegt“, fuhr ich ihm in die Parade.
„Ich bin stolz auf dich, Jesse“, lobte Milo mit süffisantem Gegrinse. „Der alte Spruch, dass irgendwann auch Hackstöcke blüh‘n, bewahrheitet sich bei dir mal wieder auf geradezu frappierende Weise.“
„Danke für die Blumen“, sagte ich und deutete grinsend einen rechten Haken an.
7
Wir fuhren in die Upper East Side, Second Avenue, und fanden die Galerie Tschertschenkows auf Anhieb. Es war ein vierstöckiger Bau, rosafarben angestrichen, mit Jugendstilornamenten um die hohen, schmalen Fenstern und riesigen Schaufenstern im Erdgeschoss.
In den Schaufenstern sahen wir Bilder – Bilder moderner Künstler und richtige Gemälde, die die Patina vergangener Jahrhunderte aufwiesen. Da waren auch Skulpturen und und einige Kunstwerke, von denen ich beim besten Willen nicht sagen konnte, was sie darstellten. Manche sahen aus wie aus Metall geformte, verbogene Kleiderständer.
Wir betrachteten kurz die Auslage, Milo zuckte vielsagend mit den Schultern, dann betraten wir das Geschäft.
Eine schwarzhaarige Dame, zwischen 40 und 45, mit Brille und in einem dunklen Kleid, unter dem sie eine weiße Bluse trug, empfing uns. Sie war nicht gerade eine Schönheit, so wie sich präsentierte, aber sie hatte etwas an sich, dem ich mich nicht zu entziehen vermochte. Sagen wir mal, sie war eine herbe, wenn auch schon etwas verblühende Schönheit. Wenn man ihr die Brille abnahm und die strenge Frisur auflockerte – konnte man sie vielleicht sogar zur gehobenen Mittelklasse der Schönen des Landes zählen. So dachte zumindest ich.
„Gentleman“, sagte sie, nachdem wir einen Gruß ausgetauscht hatten, „was kann ich für Sie tun? Interessieren Sie sich für Bilder oder Skulpturen, oder darf ich Ihnen unsere Ausstellung zeigen, die für jeden Geschmack …“
„Weder noch“, unterbrach Milo nicht gerade zuvorkommend ihren Redefluss. Er zückte seine ID-Card. „FBI, Ma‘am, ich bin G-man Tucker, mein Kollege heißt Trevellian. Wir hätten gerne Mr. Iwan Tschertschenkow gesprochen. Er wohnt doch hier.“
Ihre braunen Augen schienen sich noch um eine Idee zu verdunkeln. Prüfend musterte sie Milo, dann schaute sie auf die Karte mit seinem Bild und den Angaben zu seiner Person, die ihn als Spezial Agent des FBI auswies, und schließlich sagte sie kühl: „Ja, Mr. Tschertschenkow wohnt hier. Seine Wohnung befindet sich in der ersten Etage. Es – es wird Mr. Tschertschenkow aber gewiss nicht gefallen, dass Polizei so einfach in seinen Laden kommt. Wir führen hier ein sauberes Geschäft, G-men.“
„Davon bin ich überzeugt“, versetzte Milo trocken und hintergründig. Er schob seinen Ausweis wieder ein. „Alles legal hier. Es gibt für jedes Kunstwerk sicherlich ein Zertifikat. Legaler kann es gar nicht zugeh‘n.“
„Sie können sich jederzeit davon selbst überzeugen, Gentleman“, versetzte die Lady in Schwarz etwas spitz und einen Ton zu laut.
In eine Tür, die wahrscheinlich zu einem Ausstellungsraum führte, trat ein blonder Mann, ein Brocken von einem Mann, der das Türrechteck geradezu ausfüllte.
„Gibt‘s ein Problem, Sarah?“, fragte er mit dem harten Akzent des Osteuropäers.
„Die beiden Gentleman sind vom FBI, Igor“, klärte ihn die Lady auf. „Sie möchten mit Iwan sprechen.“
Seine linke Augenbraue zuckte hoch. „Mr. Tschertschenkow ist oben. Wen darf ich melden, und in welcher Angelegenheit?“
„Melden Sie ihm die G-men Tucker und Trevellian“, sagte ich, „und in welcher Angelegenheit wir mit ihm reden wollen, dass würden wir ihm gerne selber sagen.“
Seine Brauen schoben sich über der Nasenwurzel zusammen. Seine Kiefer mahlten. „Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?“, fragte er plötzlich.
„Ist das nötig, in einem Haus, in dem alles seine Ordnung hat?“, kam es etwas spöttisch von Milo.
„War nur so eine Frage. „‘n Augenblick. Ich melde Sie beim Boss an.“
Der Bulle zog sich zurück.
Milo und ich schauten uns an. Und ohne ein Wort zu verlieren, waren wir uns einig: Der Goliath war alles andere als ein Bilderverkäufer. Das war ein Bodyguard, ein Gorilla, einer von der Sorte, mit der sich nicht nur Politiker und bekannte Künstler umgaben, sondern auch Gangsterbosse.
Die schwarz gewandete Lady ließ uns stehen, begab sich hinter einen Verkaufstresen mit der Computerkasse und dokumentierte Geschäftigkeit. In Wirklichkeit aber beobachtete sie uns intensiv und pausenlos.
Fünf Minuten später kam der Russe, dem unser Besuch galt. Er war etwa eins-achtzig, rotblond, schlank und von sportlicher Figur. In seinem Maßanzug, der passenden Seidenkrawatte und mit seinem jovialen Lächeln präsentierte er sich als Mann von Format.
Der blonde, stiernackige Kleiderschrank ließ sich nicht mehr blicken.
Iwan Tschertschenkow schüttelte uns die Hand, dirigierte uns in einen Nebenraum zu seiner Sitzgruppe mit einem Glastisch in der Mitte, fragte, ob wir was zu trinken haben möchten, und als wir verneinten, richtete sich sein fragender Blick auf mich.
„Sie kommen doch nicht von ungefähr zu mir, G-men? In was für einer Mission sind Sie unterwegs. Wenn ich Ihnen helfen kann – seien Sie versichert, dass ich es tun werde. Ich stehe mit aller gebotenen Loyalität hinter dem amerikanischen Rechtssystem, denn es schützt die Demokratie und jeden einzelnen Bürger. Ich habe schon andere Systeme kennengelernt, ehe ich vor fünfzehn Jahren …“
Er brach ab.
„Meine Vergangenheit in Russland wird Sie sicherlich kaum interessieren, Gentleman.“
Wenn du uns helfen willst, Mister, dachte ich, dann erzähl uns von deinen Aktivitäten, die du neben deiner Galerie so an den Tag legst. Damit wäre uns mit Sicherheit geholfen.
Aber das war wohl ein wenig zu viel verlangt. Ich musste fast grinsen.
Milo fiel in seiner unnachahmlichen, direkten Art sofort mit der Tür ins Haus. „Man munkelt, Sir, dass Sie drauf und dran sind, in Harlem den Rauschgifthandel zu kontrollieren und dass Sie Ihr Einkommen mit der Erpressung von Schutzgeld immens aufbessern. Können Sie sich vorstellen, wer solche Ungeheuerlichkeiten in die Welt setzt?“
Milos letzter Satz war an Sarkasmus kaum zu überbieten.
Wir beobachteten den Galeristen, warteten darauf, dass er irgendeine Reaktion zeigte – eine verräterische Reaktion.
Sie bestand darin, dass seine Mundwinkel fast belustigt zu zucken anfingen, seine blassblauen Augen zeigten ein strahlendes Grinsen, und schließlich erwiderte er mit einem seichten Lächeln, das seine Lippen kräuselte: „Ja, darauf werde ich öfter mal angesprochen, Gents. Das kommt daher, dass irgend welche Leute aus Russland in Harlem in der Szene mitzumischen versuchen, und ich eben ein sehr bekannter Russe hier in New York bin. Vielleicht werden diese Gerüchte bewusst gestreut, G-men, um von den wirklichen Übeltätern abzulenken. Ich weiß es nicht, und es interessiert mich auch nicht, denn ich stehe darüber. Meine Weste ist weiß, und sie bleibt weiß, denn ich will irgendwann amerikanischer Staatsbürger werden. Das gelingt mir aber nur, wenn ich einen lupenreinen Leumund vorzuweisen habe.“
„Sie sind schon fünfzehn Jahre hier und haben noch immer nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft“, wunderte sich Milo.
„Schon etliche Male beantragt, G-men. Meine Anträge werden immer wieder abgelehnt. Die Gründe sind mir unerklärlich. Aber ich lasse nicht locker.“
Ich hätte es ihm sagen können, weshalb er keine Chance hatte. Aber das hätte wohl zu weit geführt.
„Sie wissen also, dass Ihr Name im Police Departement und beim FBI kein unbekannter ist?“ Ich legte meine Ellenbogen auf die Oberschenkel und ließ die Hände zwischen den Knien baumeln. Dieser Mister war aalglatt und clever. Das sagte mir der untrügliche Instinkt, den ich mir im Laufe vieler Jahre als Kämpfer für Recht und Ordnung angeeignet hatte.
„Das weiß ich natürlich, G-man. Aber wie ich schon sagte: Jedes noch so kleine Geschäft, das ich tätige, ist dokumentiert. Ich rechne jeden Cent meiner Einnahmen mit dem Finanzamt ab, lege meine Bücher zur Nachprüfung vor, und kann anhand meiner Kontoauszüge beweisen, dass ich keinen Nickel mehr besitze, als ich es dem Fiskus offenbare. – Sonst noch etwas, Gentleman?“
„Vergangene Nacht wurde in Harlem ein schwarzer Dealer erschossen“, kam es von Milo. „Floyd Tanner sein Name, zweiundzwanzig Jahre sein Alter. Man fand Ihren Namen in seinem Notizbuch, Mr. Tschertschenkow. Was sagen Sie dazu?“
Milo schlug eiskalt auf den Busch.
Floyd Tanner hatte kein Notizbuch besessen. Außer einem Packen Geld hatte man nichts in seinen Taschen gefunden.
„Vielleicht war er ein Kunstliebhaber“, lächelte der Russe schmalzig. „Es gibt viele Gangster, die im Angesicht der Kunst dahinschmelzen wie Schnee in der Sonne. Warum auch nicht ein schwarzer Rauschgiftdealer?“
Mein Blick begegnete sich mit seinem, und ich hatte plötzlich das Gefühl, einer Kobra in die Augen zu sehen, die mir jeden Moment ihren Giftzahn ins Fleisch treiben würde.
„So wird‘s wohl sein“, murmelte ich und stand auf. „Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit uns zusammenzuarbeiten, Mr. Tschertschenkow. Sollten wir irgend wann weitere Fragen haben, dann dürfen wir uns doch vertrauensvoll an Sie wenden. Bei soviel Loyalität …“
Auch Milo erhob sich.
Tschertschenkow war der Hohn in meinem Tonfall natürlich nicht entgangen. Er schaute mich an, als nähme er Maß. Die Kobra in ihm schien noch einen Deut stärker durchzubrechen. „Jederzeit, Mr. Trevellian. Es wird mir eine Ehre sein, Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.“
Er reichte erst mir, dann Milo zum Abschied die Hand.
Als wir wieder auf der Straße standen, fühlten wir uns beobachtet. Milo brummte: „Das ist ein Wolf im Schafspelz, Jesse. Den sollten wir so schnell nicht wieder aus den Augen lassen.“
„Worauf du einen lassen kannst“, antwortete ich.
Wir gingen zum Sportwagen. „Was jetzt?“ Ich schaute auf die Uhr. Es war 16 Uhr vorbei. „Um sich in Harlem ein wenig umzusehen, ist es noch zu früh. Dort kommen die Ratten erst bei Nacht aus ihren Löchern.“
„Zum Field Office“, meinte Milo. „Dort nehmen wir zunächst mal Kontakt mit den Narcs auf, um eine Liste der Rauschgiftopfer der vergangenen Monate zu bekommen. Und dann sehen wir weiter.“
Also fuhren wir zurück zur Federal Plaza, um uns an die Arbeit zu machen.
8
Die Liste war lang – endlos lang. Wir begannen, den Computer mit Namen zu füttern. Eine Reihe der Namen konnten wir streichen. Es waren oftmals die Namen von Frauen, wenn die Toten, die auf das Konto der gewissenlosen Rauschgifthändler gingen, keinen Vater mehr besessen hatten. Eine weitere Reihe von Namen strichen wir, das waren jene Angehörigen, die weitab von New York lebten.
Zuletzt blieben etwa noch 30 Einträge übrig.
30 Adressen, die es abzuklappern galt.
Ich rief die Mordkommission an und ließ mir eine Beschreibung von dem Mann durchgeben, der in der Nacht als Mitglied der „Initiative rauschgiftgefährdete Jugendliche“ in Erscheinung getreten war und in dem wir den Mörder Floyd Tanners vermuteten.
„Wir haben ein Phantombild von dem Mister angefertigt, Trevellian“, erklärte mein Gesprächspartner. „Soll ich‘s Ihnen mit ‘ner Email schicken?“
„Es wäre mir sehr viel daran gelegen“, erwiderte ich. „Danke.“
Ich legte auf.
Es war jetzt draußen schon finster. Der Feierabend war wieder mal im … Na, Sie wissen schon. Der Drucker lief und spuckte die Liste der verbliebenen Namen samt den dazugehörigen Adressen aus, die wir im Laufe der nächsten Tage zu überprüfen haben würden.
Nach einigen Minuten gab mein Computer einen Ton von sich, der sich anhörte wie ein Maschinengewehrstakkato, was anzeigte, dass eine Email eingegangen war. Das Geräusch mutet vielleicht ein wenig makaber an, wenn man bedenkt, dass wir in der rauen Wirklichkeit schon genug mit dem Krachen von Schüssen zu tun hatten – aber hin und wieder hat auch ein G-man seine verspielten Augenblicke. Und er PC ist halt nicht nur Arbeitsgerät, man kann damit auch spielen.
Ich öffnete das Mail, speicherte den Anhang in einen Ordner und öffnete die Bilddatei. Das Konterfei, das sich auf dem Bildschirm zeigte, war ein Allerweltsgesicht. Der Hut saß tief in der Stirn, das Gesicht war schmal, verfügte über ein eckiges Kinn und schmale Lippen. So sahen mindestens eine Million Amerikaner aus. Nichtsdestotrotz druckte ich das Bild, und zwar in doppelter Ausfertigung. Einen Ausdruck überließ ich Milo. Er nagelte ihn mit Reißzwecken an die Pinnwand hinter seinem Schreibtisch.
„Nun denn“, gab er zum Besten. „Bei diesem Gesicht ist uns der Bursche sicher. Lass uns gleich auf die Straße gehen und ihn aus der grauen Masse herauspicken.“
„Fahren wir lieber nach Harlem und seh‘n wir uns dort ein wenig um. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, wo wir anfangen, wie?“
„Beim Maxim, denke ich.“
„Genau.“
Wir fuhren mit dem Aufzug hinunter in die Tiefgarage, und schon wenig später waren wir auf dem Weg nach Norden, wo um diese Zeit in Harlem Lasterhaftigkeit und Sünde zum verruchten Leben erwachten.
Ich stellte den XKR unter einer Laterne in einer Hauptstraße ab. Schließlich wollte ich nicht, dass ich am Ende unseres Einsatzes nur noch ein ausgeschlachtetes Wrack oder gar nichts mehr von meinem fahrbaren Untersatz vorfand.
Wir fanden das „Maxim“ und trennten uns. Das war eine Taktik an besonders zwielichtigen Orten, für den Fall, dass einer von uns in eine Klemme geriet, was auch einem G-men passieren kann, damit der andere einschreiten konnte.
Gruppen von Passanten zogen lärmend und lachend durch die Straßen und Gassen. So mancher schien nicht mehr ganz nüchtern zu sein. Die Leuchtreklamen und Straßenlaternen sorgten für Licht. Die Seitenstraßen und Gassen hingegen, in denen die Wohnungen und Handwerksbetriebe lagen, waren teilweise ausgesprochen finster. Es hatte leicht zu nieseln angefangen. Der Wind trieb das Herbstlaub die Fahrbahn entlang.
Eine Gruppe Jugendlicher – Mädchen und Jungs –, drängten ins „Maxim“.
Während Milo sich einen trockenen Platz irgendwo im Schatten suchte, von wo aus er den Eingang der Bar im Auge behalten konnte, ging ich hinein.
Hinter der Tür war nur ein trübes Licht, das einen schweren, braunen Samtvorhang erkennen ließ, der von einer halbkreisförmigen Metallstange hing. Dumpfes Stimmengebrodel empfing mich. In das verworrene Gemurmel hinein drang leise Musik. Durch einen Spalt, dort, wo die beiden Teile des Vorhanges zusammenliefen, konnte ich ebenso diffuses Licht schimmern sehen, wie es in dem Vorraum auf mich herunter schien.
Ich ahnte, dass ich eine Rauschgifthölle par excellence betrat.
Ich schob die Vorhänge auf die Seite und trat ein. Im unwirklichen Licht sah ich vollbesetzte Tische und einen Tresen, an dem sich die Kids und auch einige ältere Semester in Zweierreihe drängten. Tabakqualm hing in der Luft und nahm mir fast den Atem. Die dezente Musik kam aus der Box neben der Tür zur Toilette.
Ich ging langsam durch die Tischreihen. Kaum jemand beachtete mich.
Das Publikum war gemischt. Ich sah Schwarze, Weiße, eine Handvoll Puertoricaner, sogar drei Chinesen waren da.
Ich näherte mich der Toilettentür. Sie befand sich neben dem Ende der Theke. Ich hatte sie fast erreicht, als plötzlich an einem der Tische jemand aufsprang und brüllte: „Himmel! Das ist der Bursche von gestern Nacht – der von dieser Initiative …“
Ich war stehengeblieben. Der Halbstarke, der soeben seine vermeintliche Entdeckung mit kippender Stimme kundgetan hatte, deutete auf mich.
Sofort sprangen weitere Gäste auf. Um mich bildete sich eine Mauer aus Körpern, ich spürte die Drohung, die von den Kerlen rings um mich herum ausging.
Ich nahm meinen Hut ab. „Meinst du mich?“, fragte ich den Boy, der jetzt in vorderster Front stand.
Er starrte mich an. „Verdammt“, stieß er schließlich hervor. „Der war viel älter. Aber der Hut, Ihr Mantel, Mister, das Licht hier … Ich habe Sie verwechselt. Tut mir leid.“
Die Meute um mich herum verzog sich wieder. Einige murrten enttäuscht. Das waren die Helden, jene, die irgendeinem Mädchen imponieren wollten. Wäre ich wirklich der Mann von vergangener Nacht gewesen, ob sie wohl daran gedacht hätten, dass er eine großkalibrige Waffen mit sich herumschleppte?
Ich legte dem etwa 17-jährigen Schwarzen, der mich verwechselt hatte, die Hand auf die Schulter. „Warte.“
„Ich hab mich entschuldigt, Mister. Ich dachte wirklich, Sie sind der Kil- äh, Prediger.“
„Schon gut, Junge. Entschuldigung angenommen.“ Ich grinste ihm ins Gesicht. „Wie sieht‘s aus mit ‘nem kurzen Smalltalk? Hätte dir gerne ein paar Fragen gestellt.“
Er fixierte mich argwöhnisch. „Sind Sie ‘n Cop?“
„FBI“, erwiderte ich leise. „Ich kann dir meinen Ausweis zeigen, falls du Wert drauf legst. Bist du bereit?“
„Ich – ich kann Ihnen nicht viel sagen, Mister. Eigentlich gar nichts. Ich sah nur den Mörder – den Mann, der behauptete, von einer Initiative zu kommen. Mehr weiß ich nicht – wirklich.“
Ich drängte den Knaben jetzt einfach hinaus. Er stemmte sich anfangs dagegen, schließlich aber gab er nach. Auf der Straße machte ich erst mal meine Lungen frei vom Tabaksqualm, dann begann ich: „Warst du auch einer von Tanners Kunden?“
„Ich – ich nehme kein Rauschgift“, stotterte der Kleine. „Mein einziges Laster sind die Zigaretten. Das müssen Sie mir schon glauben, Mister. – Heh, sind Sie wirklich vom FBI?“
Ich hielt ihm meinen Ausweis unter die Nase.
In dem Moment kam ein Kerl heraus. Er schoss mir einen scheuen Blick zu, dann entfernte er sich schnell und verschwand um eine Ecke. Es war ein Schwarzer, das war aber auch alles, worauf ich geachtet hatte.
„Okay“, sagte ich zu dem Zigarettenbürschchen. „Dieser Tanner, er hat doch in dieser Bar, respektive hier auf der Straße seinen Stoff an den Mann gebracht. Seit vergangener Nacht ist er tot. Ist jemand an seiner Stelle heute Abend hier erschienen?“
Der Knabe druckste herum, trat plötzlich von einem Bein auf das andere. Er konnte meinem Blick nicht standhalten, schaute zu der Stelle, an der der Schwarze von eben in der Finsternis verschwunden war, und dann hinunter auf die Spitzen seiner ehemals weißen Turnschuhe. Und da wusste ich, dass er mich im nächsten Moment anlügen würde.
Da würgte er auch schon hervor: „Darum kümmere ich mich viel zu wenig. Wie gesagt, ich brauche das weiße Teufelszeug nicht. Keine Ahnung, G-men. Ich weiß es nicht, ob Floyd Tanners Stelle heute ein anderer eingenommen hat.“
Und wieder irrte sein Blick dorthin ab, wo sich vorhin der Schwarze um die Ecke verdrückt hatte.
Mit einem Schlag glaubte ich die wiederholten Blicke zu dieser Stelle richtig deuten können.
Ich flitzte los, legte mich in die Kurve, rutschte fast aus auf dem glitschigen Pflaster, und war um das Hauseck herum. Der Bursche aber, den ich suchte, war verschwunden. Ich rannte ein Stück in die Gasse hinein, lauschte. Nichts. Er war fort, als hätte ihn die Erde verschluckt.
Blindlings loszurennen und nach dem Burschen zu suchen wäre vergeudete Zeit gewesen.
Ich kehrte um.
Der Jugendliche, mit dem ich gesprochen hatte, war verschwunden. Ich brauchte ihn im Moment auch gar nicht mehr.
Ich überquerte die Straße, fand Milo und sagte: „Es ist bereits Ersatz für den unglücklichen Floyd hier angesetzt. Allerdings scheint mir der Bursche durch die Lappen gegangen zu sein. Wahrscheinlich haftet uns Bullen ein Geruch an, den diese Sorte sofort erkennt und der sie warnt. Der Knabe hat jedenfalls das Weite gesucht, während ich dem Jungen ein paar Fragen stellte. Was mich am meisten wurmt, ist die Tatsache, dass er mir sozusagen vor der Nase vorbeispaziert ist.“
„Er kommt wieder“, kam es von Milo. „Darauf verwette ich einen Monatslohn. Denn er muss sein Gift umsetzen, und das hier ist der ihm zugeordnete Platz.“
„Dann stellen wir uns mal auf eine längere Wartezeit ein“, murmelte ich und bereitete mich darauf vor, mir die Beine in den Bauch zu stehen.
Hätten wir geahnt, dass wir, während wir auf die Rückkehr des Dealers warteten, mit Argusaugen beobachtet wurden, wären wir sicher weniger ruhig geblieben.
9
In einer leerstehenden Wohnung, ganz in unserer Nähe, flüsterte ein Mann in sein Walkie-Talkie: „Zwei Kerle, Hüte, Trenchcoats, über sechs Fuß groß, und einer von ihnen zückte vorhin vor der Bar einem Nigger gegenüber so etwas wie einen Ausweis. Ich denke es sind Bullen. Bezeichnend ist auch, dass das Wiesel abgehau‘n ist. Einer der Kerle folgte ihm ein Stück. Was sollen wir tun?“
„Ich frage den Boss“, kam es vom anderen Ende. „In ein paar Minuten ruf ich dich zurück.“
Der Bursche in der Finsternis stellte das Walkie-Talkie auf Empfang.
Nach fünf Minuten kam die Stimme: „Andrej, hörst du mich? – Okay. Wahrscheinlich sind es die beiden FBI-Bullen, die heute da waren. Legt die beiden Schnüffler um. Und dann verschwindet wie der Blitz. Denn innerhalb weniger Minuten wird es dort von Cops nur so wimmeln. Das wird auch den Henker abhalten, dort seine Nasenspitze zu zeigen.“
„Roger!“, zischte der Bursche ins Gerät.
Er stellte eine Frequenz ein. Das war trotz der Finsternis möglich, denn das Display des Sprechfunkgeräts war beleuchtet. Dann flüsterte er ins Mikrophon: „Grünes Licht, Leute. Putzt die beiden Halbaffen aus ihren Schuhen.“
Vier – fünf Kerle schlichen aus verschiedenen Richtungen heran. Sie hatten uns in der Zange, hatten uns regelrecht umzingelt.
Als ich schräg gegenüber im Schlagschatten eine huschende Bewegung ausmachte, schlugen in mir die Alarmglocken an. Und da blitzte es auch schon auf. Ich sprang Milo an und riss ihn nieder. Noch im Fallen zerrte ich die SIG Sauer aus dem Holster.
Eine MP-Salve harkte über uns in die Hauswand. Querschläger jaulten trommelfellbetäubend, Putz, Mauerwerk und Kaltstaub regneten auf uns hernieder.
Meine Waffe brüllte auf. Ich zielte mitten in die zuckenden Lichtgarben hinein, die auf der anderen Seite die pechige Finsternis zerhieben und den Schützen wie ein Irrlicht aus der Nacht zerrten.
Jetzt donnerte es auch von rechts, und gleich darauf von links. Diese Kerle aber hatten nur Pistolen wie wir auch. Ich hörte Milos SIG peitschen. Ich schoss wieder auf die Stelle, wo ich den MP-Schützen zuletzt gesehen hatte. Die MP schwieg jetzt. Ich sah den Kerl geduckt durch den Lichtschein einer Leuchtreklame hetzen und drückte ab. Er stolperte und stürzte.
Pistolenkugeln pfiffen heran. Ich war von der Hauswand weggerollt. Ich konzentrierte mich auf das Feuer von rechts. Milo kroch schießend auf die Haustür zu, hob den Arm und versuchte, sie zu öffnen. Mein unmittelbarer Gegner sprang in Deckung, ich warf mich herum und nahm das Mündungslicht aufs Korn, das linker Hand aus einer Einfahrt stieß.
Eine Kugel zischte dicht über meinen Kopf hinweg und wahrscheinlich hatte ich jetzt ein Loch im Hut.
Ununterbrochen warf ich mich hin und her, um den Kerlen kein sicheres Ziel zu bieten.
Milo hatte Pech. Die Haustür ließ sich nicht öffnen. Er rollte auf den Rücken und trat mit beiden Beinen dagegen. Schließlich jagte er zwei Schüsse ins Schloss. Ein letzter wuchtiger Tritt, und die Tür flog krachend auf.
Ich feuerte nach allen Seiten und zwang unsere Gegner, die Köpfe einzuziehen. Drüben rappelte sich wieder der Bursche mit der MP hoch. Er lag auf den Knien und suchte den Boden nach seiner Waffe ab. Ich schickte ihm eine Kugel. Er warf sich wieder auf den Bauch.
Milo war schon im dunklen Hausflur in Sicherheit. Er verballerte seine letzten Kugeln, um mir Feuerschutz zu geben. Dann drückten wir die Tür zu. Schließen ließ sie sich nicht mehr, denn Milos Geschosse hatten ganze Arbeit geleistet. Dann rannten wir den stockfinsteren Flur ein Stück entlang, rechts zeigte sich das helle Rechteck einer weißlackierten Tür, ich riss sie auf und zog Milo hinter mir her in den Raum hinein.
Im letzten Augenblick.
Denn drüben begann wieder das Rattern der MP. Ein wahrer Kugelhagel zerfetzte die Haustür und warf sie auf. Wie giftige Insekten pfiffen die blauen Bohnen durch den Korridor und meißelten an seinem Ende faustgroße Löcher in die Wand.
Dann trat Ruhe ein.
Diese jähe, lastende Stille wurde schon zwei Sekunden später gesprengt vom Heulen der Polizeisirenen.
Auf der Straße entstand Geschrei.
„Bist du in Ordnung?“, fragte ich meinen Freund und Kollegen, und meine Stimme klang rau wie ein Reibeisen.
„Yeah. Und du?“ Milo Organ klang ebenfalls belegt und rasselnd.
„Alles Bestens“, knurrte ich. „Sieht ganz so aus, als hätte der Ersatz für Floyd Tanner eine Köderfunktion wahrzunehmen. Er sollte den Kerl von vergangener Nacht anlocken, und dann wären die Schießhunde von eben in Erscheinung getreten und hätten ihm das Höllentor aufgestoßen.“
„Das würde bedeuten, dass der Mörder schon mit dem Chef der Dealer Verbindung aufgenommen hat und ihm eine böse Verheißung zukommen ließ.“
„Ja“, bestätigte ich, „das scheint so. Denn wie sonst sollte er wissen, dass der Anschlag auf Tanner nicht allein diesem gegolten hat, sondern den Beginn eines Rachefeldzuges gegen Dealer und Hintermänner darstellte?“
„Das vermuten wir“, konterte Milo.
„Ich bin überzeugt davon“, behauptete ich. „Gehen wir hinaus.“
Alles, was sich in der Bar befunden hatte und zwei Beine hatte, war nach der Schießerei auf die Straße gestürmt. Überall in den Häusern ringsum brannte jetzt Licht. Menschen lehnten sich aus den Fenstern oder kamen aus ihren Behausungen.
Eine Kolonne Polizeifahrzeuge kam mit Hurra die Straße herauf. Die Lichtleisten auf den Dächern warfen rote und blaue Lichtreflexe auf den Asphalt und gegen die Fassaden. Die Sirenen heulten Zeter und Mordio.
Das Aufgebot hielt am Straßenrand. Reifen quietschten, die Cars schaukelten, als sie heftig abgebremst wurden. Autotüren flogen auf, die Besatzungen der Wagen sprangen mit gezückten Pistolen heraus.
Ein scharfer Befehl erschallte. Sofort wurden die Neugierigen zurückgedrängt. Milo und ich näherten uns einem der Cops, jenem, der lautstark seine Anordnungen hinausschrie. Bei Licht betrachtet sahen mein Partner und ich nicht gerade vertrauenerweckend auf. Wir hatten zwar unsere Kanonen, nachdem wir sie mit neuen Magazinen versorgt hatten, geholstert, aber wir waren dreckig von oben bis unten. Mein Mantel wies einen großen Triangel am Oberschenkel auf, mein heller Hut ein kleines, schwarzes Loch.
Sofort waren wir von einem halben Dutzend Cops umringt und starrten in genauso viele Pistolenmündungen. Die Burschen waren nervös, und die Situation war ausgesprochen explosiv. Eine falsche Bewegung, und die Ballermänner in ihren Fäusten konnten losgehen.
Der Einsatzleiter taxierte uns mit gerunzelter Stirn. „Euch kenne ich doch“, murmelte er, und sein Blick schien sich nach innen zu verkehren, als kramte er mit allem, was ihm zur Verfügung stand, in seinem Gedächtnis.
„Trevellian und Tucker vom FBI“, klärte ich ihn auf. „Und jetzt, Gentleman, besitzen Sie die Güte, und nehmen Sie Ihre Kugelspritzen von unseren Bodys.“
„Richtig!“, entfuhr es dem Captain. Er gab seinen Leuten einen Wink. Wir konnten aufatmen. Die Gefahr, die von den eigenen Kollegen ausging, war gebannt.
„Was war hier los?“, fragte der Captain. „Wir erhielten den Einsatzbefehl, weil hier geschossen worden sein soll. Wer …“
„Sein soll!“, echote Milo grimmig. „Es wurde, Captain. Und zwar auf uns. Wir beschatteten diese Bar, weil hier gedealt wird. Vergangene Nacht wurde ein Dealer, dem diese Bar zugeteilt war, von einem Unbekannten umgenietet. Wahrscheinlich passt es einem gewissen Herrn oder einer Gruppe nicht, dass wir plötzlich unsere Nase hier reinstecken. Jedenfalls sollten wir, wenn es planmäßig abgelaufen wäre, jetzt kalt und starr dort auf dem Gehsteig liegen.“
Ich nahm Milo am Ärmel und zog ihn fort.
Zu dem Captain sagte ich über die Schulter: „Wir schreiben morgen einen Bericht über den Vorfall und schicken ihn ins Police Departement. In Ordnung?“
Er nickte.
„Das neugierige Pack soll endlich verschwinden!“, hörten wir den Captain schreien. „Und dann sichert Spuren, soweit das überhaupt noch möglich ist.“
Ich flüsterte Milo ins Ohr: „Wir sollten uns auf den Heimweg machen. Schau dich mal an, wie du aussiehst. Mit dir muss man sich ja schämen.“
Er blieb stehen und schaute mich groß an. „Hast du das auch gehört, Partner? Ich glaube, mir hat soeben eine Vogelscheuche was ins Ohr geflüstert.“
10
Der Killer schlug in dieser Nacht wieder zu. Weit weg vom Geschehen vor dem „Maxim“. Er tauchte am McNair Place in East Harlem auf, als Jimmy Rourke gerade ein paar Gramm Heroin gegen ein Bündel Geldscheine tauschte. Die Käufer waren zwei Kerle um die 40. Sie standen in einer dunklen Passage, der Deal war nur mit Hilfe einer Taschenlampe möglich gewesen.
Als sich der Mann im Trenchcoat und dem Hut auf dem Kopf näherte, ließ Jimmy Rourke das Geld schnell in der Tasche seines grünen Anoraks verschwinden. Er glaubte, einen prächtigen Deal gemacht zu haben.
Mit zielsicheren, langen Schritten kam der Mann heran.