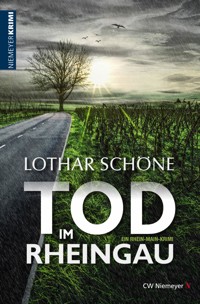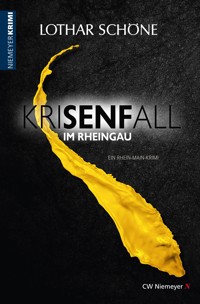
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
EIN NEUER FALL FÜR FRAU WUNDER UND HERRN SPYRIDAKIS Rosalie, die sich mit Senf verwirklichen will, ist komisch und ungewöhnlich zugleich. Sie, die Katholikin, hat an ihrer Seite Dani und Hamed, einen Juden und einen Moslem. Spielt das etwa eine Rolle bei ihrer Geschäftsidee, ungewöhnliche Senfsorten zu entwickeln und zu verkaufen? Nein! Doch Dani wird tot in einem Senfbottich aufgefunden. Handelt es sich um einen Religionsmord? Unser Wiesbadener Kommissar-Duo Julia Wunder und Vlassi Spyridakis ermittelt, und auch in diesem Fall führen Spuren nach Mainz, wo der Kollege Lustig sich über den grotesken Mord wundert. Bringt er Julia und Vlassi auf die richtige Spur oder nur alle in Gefahr? Mit Witz und Humor knackt das ungewöhnliche Trio auch diesen Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Lothar SchöneKri(senf)all im Rheingau
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Handlungen und Charaktere sind frei erfunden. Tatsächlich existierende Personen haben ihre Zustimmung erteilt.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2018 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8344-6
Lothar Schöne
Kri(senf)all im RheingauEin Rhein-Main-Krimi
Lothar Schöne, geb. in Herrnhut, arbeitete als Journalist, Hochschullehrer, Drehbuchautor und veröffentlichte Romane, Erzählungen und Sachbücher. Er erhielt eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen, unter anderem das Villa-Massimo-Stipendium in Rom, den Stadtschreiber-Preis von Klagenfurt/Österreich und den von Erfurt, den Literaturpreis der Stadt Offenbach a.M., zuletzt 2015 den Kulturpreis des Rheingau-Taunus-Kreises. Sein Roman „Der blaue Geschmack der Welt“ wurde von den Lesern der Tageszeitung „Die Welt“ zum „Buch des Jahres“ gekürt, der Roman „Das jüdische Begräbnis“ in sechs Sprachen übersetzt. Derzeit wird die Verfilmung vorbereitet.
Für Gert Ueding(„Der Krimi ist der Gesellschaftsroman unserer Zeit“)
„Senf ist ein Lebenselixier. Sie müssen nur von meinem Tiger-Mostrich naschen – dann wissen Sie, was ich meine.“Rosalie Weisenbach
1 Ein grotesker Mord
Vlassopolous Spyridakis griff gierig nach dem Döner, den ihm Adil eben über den Tresen gereicht hatte. Es war kurz nach zehn am Morgen, er hatte noch nicht gefrühstückt, sein Kühlschrank war wie üblich leer gewesen, und ihn plagte der Hunger.
„Heute noch nichts gegessen, Commissario?“, fragte der türkische Imbissbudenchef.
„Unsereiner ist Tag und Nacht im Dienst, gegessen wird praktisch nie …“
„Gegessen wird nie, da könnten Sie recht haben“, fiel ihm Adil ins Wort, „wenn ich so Ihre Figur ansehe. Frühstücken Sie denn nicht wenigstens?“
„Niemals, ich trinke nur einen Kaffee.“
Vlassi biss in den Döner und schnitt ein seliges Gesicht, dann setzte er seinen Satz fort: „… nur bei Ihnen mache ich eine Ausnahme und greife mal zu was Essbarem. Sie wissen, was das bedeutet?“
Adil setzte eine nachdenkliche Miene auf, um sich schließlich zu einem „Nö“ durchzuringen.
„Es ist ein Kompliment für Sie“, erklärte Vlassi gravitätisch.
„Ach so. Sonst nehmen Sie doch immer Lahmacun.“
„Abwechslung! Abwechslung tut not“, erwiderte Vlassi und aß frohgemut weiter.
„Tut not?“, fragte Adil, dem diese Redewendung etwas seltsam, wenn nicht altmodisch und unverständlich erschien.
„Da haben Sie schon wieder was Neues gelernt“, erklärte Vlassi kauend, „prägen Sie sich diesen idiomatischen Ausdruck ein, und Sie werden bald zur feinen Wiesbadener Gesellschaft gehören.“
„So wie Sie“, stellte Adil mit ernster Miene fest.
„So wie ich“, bestätigte Kommissar Spyridakis. „Manche halten mich zwar für einen Griechen, aber in Wirklichkeit bin ich deutscher als viele Natural-Deutsche.“
„Natural-Deutsche?“
„Das sind die, die hier geboren sind und Müller, Meier oder Schmidt heißen“, antwortete Vlassi, „jetzt hab’ ich Lust auf einen Kaffee, geben Sie mir bitte einen türkischen.“
Adil drehte sich nach hinten und machte sich an seiner Kaffeemaschine zu schaffen, die bald vor sich hinspruzzelte und eine schwarze Flüssigkeit ausspuckte. Und während der türkische Gastronom schnell einen Becher darunterstellte, sprach er weiter: „Ah ja … dann kann ich kein Natural-Deutscher werden, ich heiß’ doch Adil?“
„Das wird schwer. So ein Name klingt undeutsch. Besser wäre es mit Adolf. Her mit dem Kaffee!“
„Adolf?“, fragte Adil grübelnd.
Vlassi nippte am Becher, dann fasste er sich nachdenklich an den Kopf: „Besser doch nicht. Der Name Adolf ist vorbelastet, den hört man hierzulande nicht so furchtbar gern.“
„Bleib’ ich also bei Adil, aber das ist undeutsch.“
„Es ginge auch Alfred, Alfons, Alexander, Aaron.“
„Aaron?“, fragte Adil und reckte den Kopf vor.
„Sie haben recht“, korrigierte sich Vlassi, „das klingt jüdisch, das geht auch nicht.“
„Aaron will ich auf keinen Fall heißen“, erklärte Adil mit fester Stimme.
„Brauchen Sie auch nicht“, beruhigte ihn Vlassi, „am besten ist’s, wir bleiben bei Adil. So ist Ihre Identität gewahrt.“
„Identität gewahrt?“
„Sie bleiben der, der Sie sind, und können doch deutsch sein.“
„Meinen Sie?“, fragte Adil und fuhr gleich fort: „Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen?“
„Vlassopolous.“
„Dann sind Sie ja wirklich Grieche?“
„Nur mein Name verrät mich. Ich bin hier in Deutschland zur Schule gegangen und hatte nie Lust, mich anders zu nennen.“
„Sie könnten Vlassopolous-Adolf heißen“, grinste der Türke.
„Bitte, bitte, Adil, wir wollen doch keine Sprachverhunzung betreiben!“
„War nur so eine Idee.“
„Schlechte Idee, ganz schlechte Idee.“
Adil buchstabierte laut vor sich hin: „Sprach-ver-hunzung. Das Wort gefällt mir.“
Vlassi biss wieder in seinen Döner und murmelte mit vollem Mund: „Denken Sie immer daran, dass Sie keine Sprachverhunzung betreiben.“
„Keine Verhunzung“, bestätigte Adil, um gleich darauf festzustellen: „Also, Sie sind eigentlich Natural-Grieche, ich bin Natural-Türke, da müssten wir uns doch die Köpfe einschlagen?“
Vlassi nahm einen Schluck aus dem Becher: „Aber warum denn? Ihr Döner schmeckt mir, Ihr Kaffee auch, und Sie lernen von mir, dass Sie keine Verhunzung betreiben dürfen. Weshalb sollten wir uns nicht mögen?“
„Haben Sie auch wieder recht.“
„Natürlich hab’ ich recht. Aufs Individuelle kommt’s an!“
„Aber der Erdogan sagt was anderes, wenn ich den so in unserem Fernsehen hör’, der ist auch auf Natural-Deutsche schlecht zu sprechen.“
„Adil, hören Sie etwa auf Politiker?“
„Na ja, manchmal schon.“
„Hören Sie immer weniger drauf. Politiker haben eigene Interessen. Das sind nicht unsere Interessen. Adil und Vlassi haben andere Interessen. Wir zwei wollen uns gut verstehen, ganz egal, was Erdogan oder irgendein anderer Politiker im Fernsehen sagt.“
„Vlassi? Sind Sie das?“, fragte Adil.
„Ja, es ist die Abkürzung von Vlassopolous.“
„Gefällt mir besser, dieses Vlassi, da haben wir fast gleich lange Namen.“
Vlassi aß genussvoll den Rest seines Döners auf, dann sagte er: „Na, das ist doch ein Anfang für unsere individuelle griechisch-türkische Freundschaft.“
Adil nickte bedächtig, es leuchtete ihm ein, was sein Stammkunde da sagte, aber er hatte doch einen Einwand: „Meine Religion, meine ganze Kultur, die passt doch eigentlich nicht so richtig zu Europa.“
Vlassi hob den Kopf und dachte nach, schließlich sagte er: „Vielleicht haben Sie da gar nicht so unrecht.“ Er griff nach seinem Kaffeebecher: „Aber ich glaube, dass man sich individuell trotzdem gut verstehen kann. Das sieht man doch an uns, oder?“
„Haben Sie auch wieder recht.“
„Ich komm’ jetzt schon so lange zu Ihnen, und wir haben uns noch nie auf den Kopf gehauen“, teilte ihm Kommissar Spyridakis grinsend mit, „nennen Sie mich Vlassi.“
„Sehr gern, Commissario … ääh, vielmehr Vlassi“, erwiderte der Türke, „wenn Sie mich Adil nennen.“
In dem Moment ertönte aus heiterem Himmel eine Sambamusik. Kommissar Spyridakis griff in die Seitentasche seines Jacketts und zog sein Handy hervor.
„Der Samba ist mein Klingelton, ich fühle mich da wie in Rio“, erklärte er dem verdutzten Adil.
Am Telefon ertönte die Stimme von Kriminalrat Robert Feuer: „Herr Spyridakis, wo stecken Sie?“
„Im Dienst. Ich observiere gerade ein verdächtiges Essen.“
Vlassi zwinkerte bei diesen Worten Adil zu.
„Was reden Sie da für einen Blödsinn? Verdächtiges Essen – unglaublich!“
„Natürlich bei einem Hochverdächtigen“, fügte Kommissar Spyridakis an und zwinkerte wieder Adil zu.
Der zeigte Humor und zwinkerte zurück.
„Herr Spyridakis“, erscholl die dienstliche Stimme Kriminalrat Feuers, „lassen Sie Ihr verdächtiges Essen sausen. Wir haben einen Mord!“
„Weiß Frau Wunder schon davon?“
„Ich hab’ sie nicht erreicht. Die kümmert sich wahrscheinlich um ihren verdächtigen Vater in Eltville und hat das Handy abgestellt“, knurrte Feuer ins Telefon und schob nach: „Sie müssen die Vorhut bilden.“
„Verstehe, bei Mord vergesse ich alles andere. Wo soll ich denn hin?“
„In die Taunusstraße, in den Senf-Palast. Da wartet ein grotesker Mord auf Sie. Die Spurensicherung hab’ ich schon losgeschickt.“
„Ein grotesker Mord?“, fragte Vlassi erstaunt, doch Robert Feuer hatte schon aufgelegt.
Adil sah seinen Stammgast, den Commissario, mit großen Augen an und wiederholte: „Ein grotesker Mord?“
Vlassi nahm seinen Becher zur Hand und trank den Kaffee seelenruhig und mit Genuss aus. Beim Abstellen sagte er zu Adil: „Da hören Sie, womit ich mich rumschlage. Mit grotesken Morden.“
Mit diesen Worten verabschiedete sich Vlassi, drehte sich aber an der Tür noch einmal herum: „Bei grotesken Morden liegt Körperverhunzung vor, keine Sprachverhunzung.“
2 Die Göttin im scharfen Rheingauer
Einen Monat zuvor geschah in dem kleinen Ort Walluf im Rheingau etwas sehr Normales und doch Ungewöhnliches. Eine Frau namens Rosalie führte einen Löffel zum Mund und kostete vorsichtig. Auf den ersten Blick schien es, als würde sie dem Inhalt des Löffels nicht ganz über den Weg trauen. War es eine sauer gewordene Suppe? Doch nach einem Moment und bei genauerem Hinsehen bemerkte man, dass sich eine schwelgerische Note in ihr Gesicht schlich.
Rosalie legte den Kopf nach hinten und schmeckte nach. Jetzt bestand kein Zweifel mehr: Sie genoss, was sie gerade ausprobierte. Nur die Umgebung schien nicht ganz passend für eine so offenkundige Feinschmeckerin. Denn Rosalie befand sich in einem Hinterhof, und vor ihr stand ein Bottich mit einer unansehnlichen gelben Masse. Sie war nicht fest, aber auch nicht flüssig, besaß eher eine Konsistenz, die zum Streichen geeignet schien.
In dem Moment hörte sie eine Stimme hinter der offenen Tür, die zum überdachten Hof führte: „Ist denn hier überhaupt niemand da?“ Sogleich legte Rosalie den Löffel ab, ging zur Tür und streifte einen Vorhang zur Seite: „Natürlich ist hier jemand da! Was darf es sein?“
Vor dem Tresen stand ein Mann in mittleren Jahren mit Windjacke und offenem Hemd: „Eine Bratwurst bitte. Mit Bratkartoffeln, wenn’s geht. Ich setz’ mich schon mal.“
„Kommt sofort.“
Rosalie begab sich zur Grillstation ihres kleinen Lokals Zum scharfen Rheingauer, dort lagen noch einige Bratwürste, von denen sie eine schnell in eine knusprige Form brachte. Der Gast war zufrieden, als er die kümmerliche Bratwurst und einige Bratkartoffeln auf seinem Teller sah – doch Rosalie musterte ihn mitleidig.
„Fehlt hier nicht noch was?“, fragte sie.
„Was soll hier fehlen? Ich hab’ doch nur das bestellt.“ Aber gleich kam dem Gast eine Idee: „Ein Bier noch, bitte!“
„Es fehlt noch was“, beharrte Rosalie eigensinnig auf ihrer Diagnose.
„Sagen Sie’s mir“, knurrte der Unbekannte.
„Sie wollen doch mit Niveau essen. Hier fehlt Senf!“, klärte ihn Rosalie auf.
„Wenn Sie’s glücklich macht, dann bringen Sie mir den halt noch.“
Rosalie eilte hinter den Tresen, doch der Gast hatte es sich schon anders überlegt, er wollte sie doch nicht glücklich machen: „Ach, lassen Sie mal, ich brauch gar keinen Senf. Ist mir zu scharf.“
„Schade“, murmelte Rosalie, „ich hätte Ihnen auch eine andere Sorte anbieten können.“
Der Mann gab keine Antwort. Während er ein paar Bratkartoffeln mit der Gabel aufspießte und sich in den Mund steckte, hatte er das Rheingau-Echo hervorgezogen und sich schon in die Zeitung vertieft.
*
Zur gleichen Zeit saß ein Mann namens Dani Birnbaum in seinem Büro im Wiesbadener Vorort Schierstein und studierte die letzten Zahlen seines Immobilien- und Bauunternehmens. Er ächzte leise auf, das sah überhaupt nicht gut aus. Und wenn er auf die linke Seite seines Schreibtischs schaute, erblickte er nur Rechnungen. Er fasste mit spitzen Fingern nach ihnen und blätterte sie durch. Das war ja ungeheuerlich, was sich da angesammelt hatte! Beschäftigte er überhaupt so viele Handwerker? Konnte man so viele Rechnungen je begleichen? Er lehnte sich zurück und sah sinnend hinauf zur Decke. Ihm pochte ein wenig das Herz, und er wollte mit seinem Blick auf keinen Fall zurück auf den Schreibtisch.
Im Grunde war er pleite, wenn er’s recht bedachte – aber das durfte niemand erfahren. Wenn doch, ging er mit seiner Firma sofort den Bach runter und zwar mit Karacho. Dani erhob sich nachdenklich und machte ein paar Schritte zum Fenster. Durch sein Hirn schossen einige Ideen – aber keine teilte ihm mit, wie er einen Konkurs abwenden könnte. Vielleicht sollte er einen Happen essen, fiel ihm ein, manchmal flog ihm beim Essen eine rettende Idee zu. Er streifte sich in jähem Entschluss sein Jackett über. Natürlich musste er in seiner Situation die Nobelherbergen der Stadt meiden, aber ganz in der Nähe am Rhein gab es ein Lokal, das harmlos und billig aussah und dessen Name es ihm beim Vorbeifahren angetan hatte, Zum scharfen Rheingauer hieß es.
Eine knappe halbe Stunde später betrat er das Lokal von Rosalie Weisenbach, es war schon später Nachmittag, und der Scharfe Rheingauer litt keineswegs an Überfüllung. Zwei Männer erhoben sich gerade vom Tisch, es waren die letzten, sie zahlten und warfen der Chefin ein achtloses „Tschüss“ zu, dann verließen sie die Herberge. Dani nahm in der Nähe des Tresens Platz, gleich darauf näherte sich ihm Rosalie.
„Was kann ich denn bei Ihnen im Scharfen Rheingauer essen?“, fragte Dani.
„Eine gute Bratwurst“, war die Antwort.
„Na, dann nehm‘ ich die doch.“
Im gleichen Moment tauchte Danis Mutter im Hintergrund auf – allerdings nur in seiner Fantasie. Sie näherte sich ihm, drückte ihre Hände in die Hüften und fragte: Was hast du da gerade bestellt? Eine Bratwurst! Hat mein Sohn alles vergessen, isst er jetzt unkoscher? Vom Schwein!
Dani musste sich nicht rechtfertigen, denn das Trugbild seiner Gedanken war gleich wieder verschwunden, machte ihm aber doch etwas zu schaffen. Es dauerte nicht lange und Rosalie brachte ihm das Gewünschte. Diesmal jedoch hatte sie neben der Bratwurst einen Klacks Senf deponiert.
„Ein Bier dazu?“, munterte sie ihn fragend auf.
„Warum nicht?“
Während Rosalie das Pils zapfte, schnitt sich Dani ein Stück von der Bratwurst ab, führte es zum Mund und kaute nachdenklich darauf herum. Die Wurst schmeckte nach nichts, er hätte auch in ein Stück Pappe beißen kön-nen. Er stippte in den Senf, seine Gedanken flogen zu den unbezahlten Rechnungen auf seinem Schreibtisch. Doch kaum spürte er den Senf auf der Zunge, heiterte sich seine Miene auf. Das schmeckte ja … also, das war ein ganz ungewöhnlicher …
Er warf einen Blick zu der Wirtin, die am Zapfhahn schwer an einem Fünf-Minuten-Bier arbeitete. Sie musste Mitte dreißig sein, sah gar nicht übel aus mit ihrem blonden halblangen Haar, der Stupsnase und den keck hervorblitzenden Sommersprossen auf den Wangen.
„Sagen Sie mal!“, rief er der Wirtin zu, „was ist denn das für ein Senf?“
Sie schaute erstaunt auf: „Schmeckt er Ihnen?“
Dani nickte: „Ziemlich gut sogar.“
Rosalie hielt inne, so was hatte ihr noch niemand gesagt. Konnte es sein, dass sich ein Feinschmecker in ihren Scharfen Rheingauer verirrt hatte? Oder hörte sie etwa Spott in seiner Stimme, wollte sie der Mann veruzen? Das Bier war gezapft, und sie brachte es zum Tisch des Gastes. Der Bursche vor ihr sah sie interessiert an, er konnte nicht älter als Anfang vierzig sein, besaß volles dunkles Haar, das ungebärdig nach allen Seiten strebte, sein Hemd stand oben offen, er wirkte wie ein Taxi-Unternehmer, der mal Pause machte, nur sein Sakko verriet einen guten Geschmack.
„Er schmeckt Ihnen?“, fragte sie noch einmal.
Dani räusperte sich: „Der hat was … Ungewöhnliches. Was man von der Bratwurst nicht gerade behaupten kann.“
„Die Bratwürste kaufe ich ein …“
„Den Senf nicht?“, fiel ihr Dani ins Wort.
Rosalie schürzte die Lippen: „Nein, den stelle ich selber her.“
„Interessant. Ich dachte, so etwas wie Senf kommt aus einer Fabrik.“
„Es spricht für Sie, dass Sie den Unterschied bemerkt haben“, erwiderte Rosalie mit Charme in der Stimme.
Dani nickte: „Sagen Sie mal, wenn Sie ihn selber machen, haben Sie vielleicht noch andere Sorten?“
Auf diese Frage hatte Rosalie gehofft, endlich mal einer, der die Qualität ihres Mostrichs erkannte und sogar mehr wollte.
„Aber natürlich habe ich noch andere Sorten.“
„Kann ich da mal probieren?“, fragte Dani vorsichtig.
„Warum nicht, Sie scheinen mir ein Feinschmecker zu sein.“
Dani machte eine wegwerfende Bewegung: „So weit würde ich nicht gehen, aber wenn mir was schmeckt, werde ich neugierig.“
Rosalie drehte sich auf dem Absatz um und ging nach hinten, um nach kurzer Zeit wiederzukommen. Sie hielt einen Teller in der Hand, auf dem drei Häufchen Senf lagen und ein Löffelchen.
„Senf solo. Nur für Sie“, sagte sie und stellte den Teller vor Dani auf den Tisch. Dani Birnbaum nahm den Löffel und probierte von einem der Senfkleckse.
„Ausgezeichnet“, murmelte er und teilte mit: „Hier ist viel Meerrettich verwendet.“
Rosalie nickte: „Probieren Sie weiter.“
Dani führte das Löffelchen mit der nächsten Probe zum Mund.
„Oh“, sagte er und legte den Kopf ein wenig nach hinten, „der schmeckt nach Sekt.“
„Ihr Geschmackssinn funktioniert. Das ist mein Champagner-Senf.“
„Der prickelt fast auf der Zunge“, lobte Dani.
„Eine angenehme Säure hat er, aber ich sollte ihn noch etwas verfeinern“, hörte er von der verkannten Senfherstellerin.
„Bin gespannt auf den nächsten“, sagte Dani und stippte schon in den dritten Senfklecks.
Rosalie sah ihm neugierig zu, als er den Löffel abschleckte.
„Der schmeckt gar nicht nach Senf, aber irgendwie auch gut“, kommentierte Dani.
„Das ist mein Bananen-Senf, muss man sich erst dran gewöhnen, passt sehr gut zu Meeresfrüchten und Fischgerichten“, erläuterte die Inhaberin des Scharfen Rheingauers. Sie war in den letzten Minuten regelrecht aufgeblüht und höchst angetan von diesem Gast, konnte sich nicht zügeln und fuhr begeistert fort: „Ich arbeite ständig an neuen Kreationen, jetzt habe ich einen Tango- und einen Lakritz-Senf entwickelt. Aber meinen normalen Gästen kann ich sie nicht vorsetzen, die haben keinen Sinn dafür.“
Die können ihre Kreationen nicht würdigen, dachte Dani Birnbaum im Stillen. Er schaute zu ihr auf, sagte nichts, doch man konnte ein wenig Bewunderung in seinem Blick erkennen. Diese Frau in diesem armseligen Lokal, ging es ihm durch den Kopf, ist kein armes Würstchen, mit Würsten hat die überhaupt nichts am Hut, die ist eine Besessene – eine Senfbesessene. In seinem Oberstübchen klickte es. Wenn das keine Geschäftsidee ist! Und vor seinen Augen verwandelte sich plötzlich das unscheinbare und ärmliche Lokal namens Zum scharfen Rheingauer in einen Goldpalast. Er saß nicht mehr auf einem harten Holzstuhl, sondern in einem Sessel aus Samt und Seide, und an seinem Gürtel baumelten kleine Senfbottiche aus Gold, aus purem Gold. Ja, ja, überlegte er, während er die kleinen Goldbottiche in Gedanken streichelte, diese Person vor mir hat nicht nur eine Geschäftsidee – die Frau ist eine Geschäfts-idee.
Er räusperte sich: „Sagen Sie, Frau … wie war doch noch mal Ihr Name?“
„Weisenbach, Rosalie Weisenbach.“
„Ich heiße Dani Birnbaum“, erklärte er, „wissen Sie, Frau Weisenbach, dass Sie ein Talent haben?“
„Meinen Sie? Bisher hat das noch niemand bemerkt.“
„Das sollte Sie nicht stören. Es liegt auch an der Umgebung hier.“
Dani erhob sich und rückte kavaliersmäßig einen Stuhl: „Nehmen Sie doch bei mir Platz.“
Rosalie sah ihn verwundert an und setzte sich. Dani nahm ihr gegenüber Platz, schnitt eine geheimnisvolle Miene und sprach: „Darf ich offen zu Ihnen reden?“
Rosalie nickte stumm.
„Sie haben ein Talent, ich möchte sogar sagen, ein enormes Talent. Und aus Ihrem Talent könnte man eine Marke machen.“
„Wirklich?“, staunte Rosalie.
„Eine Schlemmer-Marke könnte man daraus machen“, bestätigte Dani und hob dabei die Stimme etwas, um seinem Satz die volle Geltung zu geben.
„Aber … das ist bisher noch niemandem aufgefallen“, wagte Rosalie zu zweifeln.
„Weil noch niemand wie ich hier war“, erklärte Dani und dachte daran, dass es eine Fügung von oben war – schließlich hatte ihn eine Eingebung in den Scharfen Rheingauer geführt. Sofort sprach er weiter: „Sie und Ihr Senf, das ist eine grandiose Kombination. Ohne Übertreibung möchte ich sagen: Sie scheinen mir eine Senfgöttin zu sein!“
„Ja, vielleicht“, murmelte Rosalie – eine Göttin zu sein war ihr sehr recht, nur war es bisher niemandem aufgefallen.
„Aber was sind Sie?“, wollte sie von ihrem Gast wissen.
„Eine berechtigte Frage“, erwiderte Dani, „Sie sind eine Senfgöttin, ich bin ein Finanzgenie! Zusammen werden wir ein Senfimperium schaffen!“
Rosalie kam mit dem Staunen nicht nach, sie wollte gerade fragen, womit sich das Finanzgenie vor ihr denn so beschäftige, kam aber nicht dazu, denn vor der Tür klingelte es. Es klingelte nicht an der Tür, sondern wahrhaftig vor der Tür, und Rosalie erkannte das Klingeln sofort. Es war eine Fahrradklingel, eine Ankündigung gewissermaßen. Tatsächlich ging im nächsten Moment die Tür auf und ein mittelgroßer Mann trat ein, er musste Mitte dreißig sein, war unrasiert, trug ausgeleierte Jeans und ein blau-schwarz kariertes Holzfällerhemd.
„Hallo Rosalie“, rief er, „ich hab’s gerade noch geschafft.“
Die Chefin des Scharfen Rheingauers sah ihm missmutig entgegen, dieser Bursche kam ihr im Moment sehr ungelegen, gerade jetzt, wo es um sie als Göttin ging. Sie kannte den Unrasierten, er kam nahezu täglich, trank ein Bier und bestellte meist einen kleinen Käseteller. Die Bratwurst verschmähte er – und sie wusste auch warum. Der Mann in den ausgeleierten Jeans war ihr nicht unsympathisch, sie hatten sich sogar durch den Dauerbesuch ein wenig angefreundet, aber jetzt war er ihr ausgesprochen unerwünscht.
„Hallo Hamed. Ich bin hier gerade … also in einem wichtigen …“
„Ich kann warten“, erklärte der ungebetene Gast.
Rosalie fühlte sich gegenüber dem Finanzgenie an ihrem Tisch bemüßigt, eine kurze Erklärung abzugeben: „Ein Stammgast, Herr … Birnbaum“, Und leise fügte sie hinzu: „Mein Lokal hat leider noch geöffnet.“
„Widmen Sie sich Ihrem Stammgast“, beschied ihr Dani großzügig, „ich kann ebenfalls warten.“ Und er setzte mit einem gewinnenden Lächeln hinzu: „Vor allem, wenn es um eine Göttin geht.“
Rosalie lächelte zurück und erhob sich, um sich dem Fahrradklingler zu nähern, der zwei Tische weiter Platz genommen hatte.
„Ein Bier wie üblich?“, fragte sie.
Hamed, der offenbar gute Ohren besaß, grinste sie an: „Eine Göttin sind Sie? Das wusste ich ja noch gar nicht.“
„Weil Sie keine Bratwurst essen. Und deshalb nicht meinen vorzüglichen Senf kennen.“
„Da hab’ ich offenbar was verpasst.“
Rosalie nickte: „Also ein Bier?“
„Und etwas Senf“, erklärte Hamed, „da, wo ich herkomme, ist Senf zwar unbekannt, aber man soll immer mal was Neues ausprobieren. Vielleicht werde ich zum Liebhaber.“
Rosalie zog die Augenbrauen hoch, dieser Hamed überschätzte sich. Aber was an einem kurzen Nachmittag so alles passieren konnte! Zuerst dieser Birnbaum, jetzt Hamed, der mit seinem rostigen Fahrrad fast täglich zu ihr geradelt kam und auf einmal ihren Mostrich probieren wollte. Aber was soll’s? Sie würde ihm zwei Kleckse Senf bringen, und er würde sie angewidert von sich schieben. Sie verschwand nach hinten in der Küche, und die beiden Männer im Gastraum musterten sich neugierig.
Schließlich sagte Dani: „Sie kommen öfter hierher?“
„Ja, ja, Döner sind mir ein Graus, Bratwürste allerdings auch …“
„Da haben Sie nicht viel verpasst mit der Bratwurst hier“, kommentierte Dani, „sind Sie etwa Vegetarier?“
„Nein, nein, nur diese Würste interessieren mich nicht. Hier gibt’s ein gutes Bier, aber den Senf von Rosalie hab’ ich noch nie probiert.“
„Da wiederum haben Sie was verpasst.“
„Hol’ ich jetzt nach. Wissen Sie, es interessiert mich auch beruflich.“
„Beruflich?“, fragte Dani, „haben Sie beruflich was mit Senf zu tun?“
„Überhaupt nicht, ich bin PR-Mann.“
„PR-Mann?“
Hamed lehnte sich zurück: „PR-Mann von hohen Graden. Aber im Moment trete ich etwas kürzer.“
Dem geht’s so wie mir, dachte Dani, ich trete demnächst nicht nur kürzer, sondern überhaupt nicht mehr. Laut sagte er: „Ah ja, und was machen Sie im Moment, wenn ich fragen darf?“
„Ich verdiene derzeit meine Brötchen als Anzeigenchef.“
„Anzeigenchef sind Sie?“
„Anzeigenchef vom Rheingau-Echo.“
Von diesem Blatt hatte Dani noch nie gehört, tat aber so, als wüsste er Bescheid: „Ah, das Rheingau-Echo.“
Der ungebetene Gast namens Hamed sah sich vorsichtig um, als wolle er gleich ein enormes Geheimnis verraten, dann sagte er leise: „Ich hoffe, dass mir Rosalie für die nächste Ausgabe unseres Weltblatts eine Anzeige gibt.“
In dem Moment tauchte Rosalie von hinten mit einem Bierglas und einem Teller auf. Hamed verstummte sofort.
„So, hier ist Ihr Bier und eine Kostprobe meines Senfs“, sagte sie.
Hamed nahm einen tiefen Schluck vom Gerstengetränk, um dann von einem der Senfkleckse zu kosten. Kaum hatte er ihn auf der Zunge, teilte er mit: „Oh, der ist ja … also wirklich, ich muss sagen …“
„Sagen Sie nichts, Hamed“, erklärte Rosalie, die die schlecht gespielte Szene sofort durchschaute, „sagen Sie lediglich, dass Sie eine Anzeige für Ihr Blättchen von mir wollen.“ Sie warf ihm einen scharfen Blick zu: „Ach, sa-gen Sie auch das nicht! Ich gebe Ihnen gleich die Antwort. Sie lautet Ja. Sie haben Ihre Anzeige.“
„Das ging aber schnell“, wunderte sich Hamed.
„Sie heißen Hamed?“, fragte Dani, „sind Sie Moslem?“
Hamed nickte.
„Dann dürfen Sie doch eigentlich kein Bier trinken.“
„Bei Rosalie mache ich eine Ausnahme, wenn Sie gestatten“, erwiderte Hamed.
„Die Herren haben sich schon kennengelernt?“, wollte Rosalie wissen.
„Nur paar Worte miteinander gewechselt“, erklärte Dani, „dieser Mann kam mir etwas einsam vor, ich wollte ihn nicht so sitzen lassen.“
„Sie scheinen ein ausgesprochen liebenswürdiger Zeitgenosse zu sein“, sagte Hamed pikiert, „Herr … wie war noch Ihr Name?“
„Dani Birnbaum“, sagte Dani.
„Birnbaum, das klingt jüdisch“, erwiderte Hamed, „sind Sie Jude?“
„Ich gestehe es, ja. Und ich bin froh, dass Sie nicht gefragt haben: Sind Sie etwa Jude?“
„Man weiß doch, was sich gehört“, erwiderte Hamed großmütig.
Rosalie hielt es für angebracht, jetzt einzugreifen: „Was ist los hier? Soll das ein Religionsgespräch werden?“ Und zu Hamed gewandt, sprach sie energisch: „Ich bin mit Herrn Birnbaum in einem Senfgespräch. Um nichts anderes geht es. Hamed, bitte verzehren Sie den Senf oder auch nicht, den ich Ihnen gebracht habe, und halten Sie sich aus allem andern raus.“
Dani schaute zu ihr auf: „Ein kluges Wort. Ich liebe Frauen mit Tatkraft.“
Rosalie sah auf ihn hinab: „Bitte kein Süßholzgeraspel. Kommen wir zum Wesentlichen.“
Hamed schien etwas beleidigt von Rosalies ruppiger Art. Was Frauen sich in Deutschland herausnahmen – unglaublich! Zufrieden war er aber über die Anzeige, die er ergattert hatte. Er schaute betrübt auf den Teller vor ihm und widmete sich dem anderen Senfklecks, doch wenn man genauer hinsah, konnte man bemerken, dass auch dieser Mostrich nicht gerade seine Geschmacksnerven traf. Rosalie nahm wieder Platz bei Dani und wollte das gewissermaßen dienstliche Gespräch fortsetzen. Sie beugte sich etwas zu ihm vor und sagte leise: „Also bin ich eine Senfgöttin und Sie sind ein Finanzgenie?“
Dani nickte.
„Was haben Sie denn auf Ihrem Gebiet Geniales zustande gebracht?“
Dani hörte einen ironischen Unterton in ihrer Frage heraus, jetzt musste er den Chef rauskehren: „Ich bin Unternehmer. Im Bausektor. Da ist finanziell allerhand zu stemmen.“
Rosalie reagierte wie erwartet: „Oh, das hört sich ja gut an, wenn auch nicht gerade genial.“
Doch da rief Hamed mit seinen guten Ohren zu ihnen herüber: „Bauunternehmer! Da bin ich doch Ihr Mann!“
Rosalie wurde es jetzt zu bunt, sie stand abrupt auf: „Kommen Sie, Herr Birnbaum, wir müssen nach hinten gehen.“ Und mit einem grimmigem Seitenblick auf Hamed stellte sie fest: „Ständige Störungen kann eine Senfgöttin nicht ausstehen.“
3 Scheintot oder Senfleiche?
Kommissar Spyridakis machte einen kleinen Fußmarsch von Adils Imbiss in der Dreililiengasse zur Taunusstraße, wo ihn Kriminalrat Feuer hinbeordert hatte. Mit dem Auto zu fahren wäre Unsinn gewesen, Vlassi hätte doch keinen Parkplatz auf der Antiquitätenmeile der Stadt ergattert. Feuer hatte von einem Senf-Palast geredet – Vlassi wusste gar nicht, dass es in der Taunusstraße so etwas wie einen Palast gab, noch dazu aus Senf. Was sollte das sein? Ein Laden, in dem man sich eine Krone aus Mostrich aufsetzen konnte? Oder durfte man dort auf einem Thron sitzen und sich Senf reichen lassen? Er selbst war senfabstinent, die gelbgrüne Pampe konnte er nicht ausstehen, vor allem nicht die scharfe, die einem den Gaumen verbrannte.
Als er vor dem Senf-Palast ankam, erkannte er den Wagen der Spurensicherung, der halb auf dem Bürgersteig stand. Der sogenannte Palast war ein ganz normales Ladengeschäft. Kommissar Spyridakis ging hinein, begrüßte die Kollegen und sah sich um. In feinen Regalen standen eine Menge Gläser mit unterschiedlich farbigem Inhalt, da war ein schmaler Tresen und eine Kasse. Aber wo war die Leiche? Etwa zerstückelt in jenen Gläsern? Das wäre wirklich ein grotesker Mord, und der Mörder hätte Feinarbeit leisten müssen. Er wollte gerade fragen, als ihn ein Kollege der Spurensicherung nach hinten winkte. Ah ja, da befand sich ein weiterer Raum. Vlassi ging durch die Tür, und vor ihm erstreckte sich … so etwas wie ein Labor. Töpfe und Bottiche, Teller und Tiegel und alles in Weiß. Eine Frau in ebenfalls weißem Kittel kam auf ihn zu, ihr standen Tränen im Gesicht, die Haare waren aufgelöst, sie musste sich zusammenreißen, als sie fragte: „Sind Sie der Kommissar?“
„Ja, Spyridakis ist mein Name.“
„Hier ist etwas Schreckliches geschehen.“
Vlassi wollte nicht unhöflich und auch nicht zu direkt sein, aber er musste endlich erfahren, was geschehen und wo die Leiche war.
„Ein Mord?“, fragte er, „wo ist denn die Leiche? Und wer sind Sie?“
„Ein Mord, ja! Ich bin Rosalie Weisenbach.“
Die Frau deutete auf eine Ecke des Raums, Vlassis Blick folgte ihrem ausgestreckten Finger und sah hinter einem Bottich eine Person am Boden liegen. Die Leiche? Aber grotesk sah die gar nicht aus. Er wollte sich eben an die Kollegen von der Spurensicherung wenden, ob die jene Person am Boden schon inspiziert hatten, als von der Tür her eine bekannte Stimme erschallte: „Herr Spyridakis, wo sind Sie?“
„Hier, Frau Wunder, hier!“
Hauptkommissarin Julia Wunder kam ihm durch den Verkaufsraum entgegen.
„Tach, Herr Spyridakis. Haben Sie sich schon die Leiche angesehen?“
„War gerade dabei, als ich Ihre Stimme hörte.“
Julia sah Rosalie Weisenbach, die einen Schritt hinter Vlassi stand. Sie erkannte sofort, dass diese Frau mitgenommen war, stellte sich kurz vor und fragte mitfühlend: „Ein Kollege von Ihnen, der Tote?“
Rosalie Weisenbach nickte und nannte ebenfalls ihren Namen: „Mehr als ein Kollege, ein Partner.“
Julia hatte längst den Mann am Boden in der Ecke entdeckt, sie sagte zu Frau Weisenbach: „Sie haben nichts angerührt oder verändert hier?“
Rosalie verneinte: „Nein, ich habe nur einen Blick auf Dani geworfen, im Knien.“
„Bitte bleiben Sie da“, wies sie Julia an, „wir müssen uns zuerst die Leiche ansehen, dann habe ich einige Fragen.“
Sie ging mit Vlassi zu der Ecke des Raumes, wo die Person bäuchlings dalag.
„Vielleicht ist er gar nicht tot“, mutmaßte Kommissar Spyridakis, „vielleicht hat sie uns einen Scheintoten gemeldet.“
Julia zog sich bereits Latexhandschuhe über und forderte Vlassi per Blickanweisung auf, dasselbe zu tun. Nachdem der seine offenbar zu kleinen Handschuhe mühsam übergestreift hatte, forderte sie ihn auf: „Jetzt können Sie Ihren Scheintoten mal rumdrehen.“
„Ich?“, entsetzte sich Vlassi.
„Sie wollen mir, einer zarten Dame, doch nicht diese Schwerarbeit überlassen“, wies ihn Julia an.
Vlassi ließ sich auf die Knie nieder, dann senkte er seinen Kopf. Der Tote oder Scheintote lag mit dem Gesicht am Boden, er musste wohl oder übel den Burschen umdrehen, damit man mehr von ihm sah. Vorsichtig fasste ihn Vlassi an der Schulter und drehte ihn um, sodass man das Gesicht sehen konnte. Sofort wich er zurück. Das sah ja schrecklich aus, was seine Augen da erblickten.
„Was hat er im Gesicht?“, fragte Julia von oben.
„Ich … weiß nicht“, stammelte Vlassi und rutschte auf den Knien etwas von der reglos daliegenden Person weg, als könnte das, was er da sah, eventuell ansteckend sein.
Julia rief: „Frau Weisenbach, kommen Sie doch mal her!“
Rosalie kam näher, und als sie das erblickte, was man vom Gesicht des Toten sehen konnte, schluchzte sie leise auf, dann sagte sie: „Ja, das ist er.“
„Womit ist denn sein Gesicht so verunstaltet?“, fragte Julia.
„Senf, das ist Senf.“
„Senf?“
„Na ja, das ist hier eine Senfmanufaktur.“
„Verstehe“, entgegnete Julia, „dann ist das, was ihm im Gesicht klebt, nichts anderes als Senf. Aber woran haben Sie denn Ihren Kollegen erkannt, er lag doch auf dem Bauch.“
„An seinem Anzug, er trug gern diesen dunkelblau gestreiften.“
Jetzt kniete sich Julia neben den Leichnam und fasste ihm an die Halsschlagader. Da schlug kein Leben mehr, dieser Mann war wahrhaftig tot. Sie erhob sich und wandte sich an Kommissar Spyridakis: „Der Leichnam muss zu Doktor Hauswaldt, veranlassen Sie das bitte.“
Vlassi erwiderte: „Eine Senfleiche. Ich wusste gar nicht, dass man mit Senf Leute umbringen kann.“
„Deshalb soll dieser Mann ja zu Frau Doktor Hauswaldt.“ Und Julia fügte leise hinzu, damit Rosalie Weisenbach es nicht hören konnte: „Sie wird uns Aufschluss geben über die wahre Todesursache.“
Sie drehte sich zu Frau Weisenbach: „Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen, gehen wir doch nach vorn und schließen Sie die Tür zum Geschäftsraum. Das ist ein Tatort hier.“
Die beiden Frauen verließen den laborähnlichen Raum und begaben sich nach vorn, Rosalie Weisenbach verriegelte die Tür zur Straße, dann sagte sie: „Wir können uns an das Tischchen dort setzen.“
Tatsächlich stand ein kleiner runder Tisch mit drei Stühlen in einer Ecke. Auf ihm befanden sich weiße Näpfe. Rosalie erklärte: „Unsere Probierecke.“
Die Damen setzten sich, und Rosalie wischte sich mit der Hand eine Träne von der Wange. Julia beobachtete sie genau, sie wusste, dass die unmittelbaren Reaktionen von Beteiligten sehr wichtig waren. Hatte diese Frau Weisenbach ein paar Tränen verdrückt, um mitleidig zu erscheinen? Und wischte sie sich jetzt so dekorativ über die Wange, um zu zeigen, wie die Angelegenheit sie mitgenommen hatte? Frauen konnten sehr erfinderisch in diesen Dingen sein.
„Frau Weisenbach, Sie stellen hier Senf her, und der Tote war Ihr Partner, habe ich das richtig verstanden?“
„Ja, es ist Dani Birnbaum, und wir waren Partner.“ Rosalie machte eine kleine Pause: „Eigentlich hat er sogar mein Talent entdeckt, und er hatte die Idee für diesen Senf-Palast.“
„Sie stellen den Senf selber her?“
„Ja, und auch ungewöhnliche Sorten.“
„Gibt es denn dafür genug Kunden?“
„Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber es gibt mehr als genug.“
„Ich muss gestehen“, sagte Julia, „dass ich bisher nichts von diesem Senf-Palast gehört habe.“
„Wenn die Umstände andere wären, würde ich Ihnen etwas zum Probieren geben.“
„Danke“, erwiderte Julia, „das holen wir vielleicht nach.“ Sie überlegte einen Moment, um dann zu sagen: „Haben Sie einen besonders scharfen Senf? Einen, der so aussieht, wie ihn der Tote im Gesicht trägt?“
„Ja, natürlich.“
„Dann geben Sie mir mal einen Klecks in so ein Näpfchen hier.“
Rosalie Weisenbach erhob sich, nahm ein weißes Näpfchen und verschwand nach hinten, um kurz darauf zurückzukehren. Sie stellte das gefüllte Näpfchen auf den Tisch und setzte sich wieder. Hauptkommissarin Wunder rief: „Herr Spyridakis, kommen Sie doch mal bitte her!“
Vlassi erschien mit fragendem Gesicht auf der Bildfläche, Julia deutete auf das Näpfchen und sagte: „Probieren Sie mal.“
Sie wusste genau, dass Vlassopolous Spyridakis senfabstinent war, wollte sich aber doch einen kleinen Scherz mit ihm erlauben.
„Ist da Senf drin?“, fragte Vlassi.
„Ja, wir müssen überprüfen, ob er vergiftet ist“, erklärte Julia ungerührt.
„Aber mein Senf ist doch nicht vergiftet!“, empörte sich Rosalie Weisenbach.
„Das müssen wir herausfinden – per Test“, teilte Julia mit.
„Und ich soll das Versuchskaninchen sein?“, wollte Vlassi wissen.
„Nur mal eine Stichprobe mit dem kleinen Finger nehmen“, erläuterte Julia und unterdrückte ein Schmunzeln, „möglicherweise bekommen Sie ein paar kleine Krämpfe, mehr wird’s nicht sein.“
Vlassi sah seine Chefin nachdenklich an, ihm war klar, dass das eine Prüfung war, und er reagierte richtig: „Mach ich sofort; falls ich tot umfalle, gehe ich schon mal nach hinten zu der anderen Leiche. Da reduziere ich die Arbeit für die Kollegen.“
Julia grinste ihn an: „Machen Sie das. So ist’s genau richtig.“
Vlassi nahm das Näpfchen auf dem Tisch und verschwand. Rosalie Weisenbach schaute ihm nachdenklich hinterher.
„Macht der das wirklich?“, wandte sie sich an Julia, „das scheint ja für den ein Todeskommando zu sein.“
„Ist es das?“, fragte die zurück.
Rosalie sah sie erschrocken an: „Aber nein, mein Senf ist doch nicht vergiftet, ich probiere ihn ja selbst oft.“
„Herr Spyridakis, kommen Sie zurück!“, rief Julia.
Sofort stand Vlassi wieder im Verkaufsraum.
„Frau Weisenbach hat sich angeboten, die Verkostung selbst vorzunehmen. Geben Sie ihr das Näpfchen.“
Vlassi hatte schon geahnt, dass es so kommen würde, natürlich hatte er vom Senf nicht gekostet, er hatte nicht mal eine Fingerkuppe in ihn gestippt. Sein hypochondrisches Wesen verhinderte derlei gefährliche Abenteuer. Mit weit ausgestreckter Hand reichte er das Näpfchen der Senfdame.
Frau Weisenbach nahm das Näpfchen entgegen, griff sich ein Löffelchen aus einem Behälter auf dem Tisch, stippte mit ihm in den Senf und ließ es sich schmecken.
„Wunderbar“, sagte sie, „es handelt sich um den Rheingauer Riesling-Senf.“
Julia hatte sie beobachtet, die Dame hatte keinen Moment gezögert – das sprach für sie.
„Danke“, sagte sie in Richtung Vlassi, „dass Sie noch nicht selbst die Probe gemacht haben.“
„Ich lasse Damen immer gern den Vortritt“, teilte Vlassi mit und verschwand wieder nach hinten.
„Frau Weisenbach“, wandte sich Julia an Rosalie, „erzählen Sie doch mal, wie es zu diesem … äh, Senf-Palast kam und wie lange Sie mit Ihrem Partner schon gearbeitet haben.“
„Eigentlich hatte ich ein kleines Lokal in Walluf, es war ehrlich gesagt eher eine Art Imbissbude, als eines Tages Dani Birnbaum bei mir erschien. Er erkannte sofort, dass mein Senf was Besonderes ist, was vorher niemand bemerkt hat. Er ist eben ein Feinschmecker und hat mir die Idee mit dem Senf-Palast schmackhaft gemacht. Er wollte sich auch um einen Kredit kümmern …“
„Sie haben den Kredit bekommen, wie ich sehe“, fiel ihr Julia ins Wort.
„Ja, und er hat sich auch mit Hamed ziemlich gut verstanden.“
„Wer ist Hamed?“, fragte Julia.
„Der dritte Partner, wir sind drei“, antwortete Rosalie.
„Wo ist er denn? Ich sehe keinen Hamed.“
„Der ist unterwegs, Hamed ist unser Marketingmann.“
„Ich brauche seine Adresse, geben Sie sie mir am besten gleich.“
Frau Weisenbach notierte sie auf einem Zettel und reichte ihn Julia.
Die Hauptkommissarin warf einen Blick darauf: „In Walluf wohnt der Mann.“
Frau Weisenbach nickte.
„Also gut“, murmelte Julia und steckte den Zettel in ihre Manteltasche, um dann Rosalie aufzufordern: „Erzählen Sie bitte weiter, Sie hatten also Ihr Lokal ursprünglich in Walluf.“
„Ja, Dani kam eines Tages, und schon war die Idee geboren …“
4 Beelzemädchen statt Beelzebub
Nach dem ersten Besuch erschien Dani Birnbaum bereits am nächsten Tag wieder in Rosalies kleinem Bratwurst-Imbiss am Wallufer Rheinufer. Er hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, aber wenn die Hose brennt, muss man die Jacke retten. Und mit Rettungsaktionen kannte er sich aus. Diesmal saßen noch einige Gäste im Scharfen Rheingauer, und Dani nahm an einem Seitentisch Platz. Doch kaum hatte ihn Rosalie erspäht, kam sie auf ihn zu. Nur ein Wort verließ ihren Mund: „Und?“
Dani schmunzelte überlegen: „Ich sagte Ihnen doch, dass ich ein Finanzgenie bin. Natürlich hat es geklappt.“
„Wir haben den Kredit?“, fragte Rosalie überrascht und musste sich setzen.
Dani hob die Hände wie ein Großmogul: „Selbstverständlich.“
Natürlich erzählte er ihr nicht, wie er kämpfen musste. Die Bank kannte seine finanzielle Lage, erhoffte sich aber, durch eine Finanzspritze doch noch etwas für sich selbst retten zu können. Dani hatte letzten Endes einen Kredit herausgeschlagen für ein Unternehmen, das sensationell war, wie er den Bankleuten glaubhaft vermittelte. Und das gelang ihm nur, weil er selbst daran glaubte.
Er ließ die flachen Hände auf den Tisch sinken: „Rosalies Gourmet-Senf. Die Spezialität für Genießer. Wie gefällt Ihnen das?“
Rosalie staunte ihn an: „Nicht schlecht.“
„Ich sagte Ihnen doch, dass Sie ein Genie vor sich haben.“
„Allmählich bin ich geneigt, das zu glauben. Ich hätte nie gedacht, dass Sie einen Kredit besorgen können.“
Dani hob den Kopf: „Wir müssen raus aus dieser Bude hier. Nichts für ungut, aber das ist kein Ort für unser Produkt.“
„Unser Produkt?“
„Ja, ja, ich weiß, es ist Ihr Produkt, aber da dürfen wir in Zukunft nicht pingelig sein. Wir wollen doch eine gemeinsame Firma gründen.“
„Hallo Rosalie“, ertönte eine Stimme von einem hinteren Tisch, „ein Bier noch und eine Bratwurst, aber ohne diesen Senf.“
„Da hören Sie’s“, sagte Dani mit geneigtem Kopf, „Ihre Kunden verstehen gar nicht, was sie hier Außergewöhnliches vorgesetzt bekommen, die sind ungeeignet für lukullische Höhenflüge.“
„Ich komm’ gleich wieder“, beschied ihm Rosalie und verschwand, um ein Bier zu zapfen. Als sie zu Dani zurückkam, teilte sie ihm leise mit: „Sie haben recht, diese Leute hier sind lukullische Neandertaler …“
„Sie zeigen Einsicht“, fiel ihr Dani Birnbaum ins Wort, „das gefällt mir, und jetzt, wo wir den Kredit in der Tasche haben, können wir großzügig planen. Setzen Sie sich doch!“
„Eigentlich macht man so was nicht, die Wirtin sollte sich nicht zu einem Gast setzen.“
„Ach, hören Sie auf. Wirtin – das ist bald Schnee von gestern. Wir denken ab sofort in gewaltigeren Dimensionen.“
Rosalie schaute kurz in die Runde, bevor sie bei Dani Platz nahm. Aber es lümmelten sich nur drei Gäste in ihrem Scharfen Rheingauer, die konnte sie vernachlässigen.
„Gewaltigere Dimensionen – das gefällt mir“, wiederholte sie Danis Worte.
„Sie müssen von jetzt an wie eine Senfgöttin denken, nicht wie ein Senf-Beelzebub“, ermahnte sie Dani.
Sie sah ihn scheel an: „Da haben Sie sich in der Wortwahl vergriffen. Beelzebub ist ein theologischer Begriff, mit Gott hat der nichts zu tun.“
„Wir wollen doch nicht ins Religiöse abgleiten“, erwiderte Dani, „sind Sie eigentlich katholisch?“
„Ausgesprochen katholisch!“
„Aber Sie können mit einem Juden was anfangen.“
„Natürlich, warum nicht? Ich hab’ mich nur an Ihrer Wortwahl gestört.“
„Und ich will Sie auf keinen Fall als Beelzebub bezeichnen. Sie sind ja überhaupt kein Bub.“
Rosalie sah ihn spöttisch an: „Da bin ich aber froh, dass Sie das gemerkt haben.“
„Sie sind höchstens ein Beelzemädchen“, zwinkerte ihr Dani zu.
Rosalie verstand den Spott, lächelte und sagte: „Bleiben wir doch bei der Göttin, das gefällt mir viel besser. Und schon jetzt kann ich Ihnen zusagen, dass ich in Zukunft auch wie eine Göttin handeln werde.“
„Wunderbar, da sind wir uns schon mal einig.“ Dani machte eine kleine Pause: „Warum lassen Sie mich eigentlich hier verdursten? Bekomme ich kein aufschäumendes Gerstengetränk?“
„Ein Bier wollen Sie? Können Sie denn auch zahlen?“
Dani stöhnte auf: „Sie haben vergessen, dass ich ein Finanzgenie bin.“
Rosalie stand lächelnd auf, ging hinter die Theke, zapfte ein Bier und brachte es Dani. Für sich hatte sie eine Cola samt einem Glas mitgebracht.
„Ist es eigentlich angemessen, dass ich als Göttin Ihnen ein Bier bringe?“, wollte sie von Dani wissen.
Der korrigierte sie: „Senfgöttin bitte! Eine Senfgöttin kann auch mal ein Bier bringen.“
Rosalie grinste ihn an: „Da haben Sie gerade noch mal die Kurve gekriegt. Also, wir müssen gewaltiger denken …“
„Wir müssen umziehen“, fiel ihr Dani ins Wort, „darauf sollten wir anstoßen.“ Er nahm sein Bierglas in die Hand, Rosalie goss sich etwas Cola ein, dann klangen die Gläser, wenn auch etwas verhalten.
„Wir müssen umziehen“, wiederholte Dani, „am besten nach Wiesbaden. Wir können nicht länger hier unten am Rhein rumlungern.“
„Da haben Sie recht“, bestätigte Rosalie und warf einen Blick zu den restlichen Gästen, „das ist kein Ort für Senfgöttinnen.“
Dani nickte ihr zu: „Wohl gesprochen, Frau Göttin.“
„Wir müssen einen Genießerladen eröffnen, ein Fachgeschäft für mein Produkt …“
„Einen Gourmet-Tempel!“, bestätigte ihr Dani, „für unser Produkt. Und zwar in einer feinen Gegend.“
Rosalie sah ihn zweiflerisch an: „Aber wer wird davon erfahren? Vielleicht sitzen wir wochenlang auf dem Trockenen?“
„Sie haben recht, Frau Göttin“, erklärte Dani, „mit anderen Worten: Wir brauchen Werbung.“
„Aber woher nehmen und nicht stehlen?“
„Jeder muss von unserem Senf sprechen und sich die Finger vor Verlangen lecken“, sinnierte Dani und schaute auf sein Bierglas.
In dem Moment hörte man ein Klingeln, es war das bekannte Fahrradgeklingel und kam von außerhalb. Es vergingen nur Sekunden und Hamed stand in der Tür.
„Hallo Rosalie“, rief er, „Ihre Anzeige ist schon platziert.“
Die Senfgöttin sah ihm mit großen Augen entgegen, dann schaute sie zu Dani. Der las sofort ihre Gedanken und fragte leise: „Meinen Sie wirklich?“
Sie nickte und antwortete ebenso leise: „Er ist wenigstens billig, wir können nicht den ganzen Kredit mit Werbung verpulvern.“
Hamed machte zwei Schritte in den Gastraum und fragte gekränkt in Richtung Rosalie: „Werde ich jetzt schon nicht mehr begrüßt? Nur weil Herr Birnbaum da ist?“
„So sind sie, die Moslems“, flüsterte Dani, „immer gleich beleidigt.“
Rosalie jedoch stand auf und begrüßte Hamed wie einen alten Freund: „Ich heiße Sie herzlich willkommen in meiner bescheidenen Hütte, Hamed, auch wenn Sie sich als Senfverächter verdächtig gemacht haben. Ein Bier?“
Hamed nickte verwundert, das schien ihm etwas zu viel an Begrüßung. Er blieb unschlüssig stehen.
„Kommen Sie doch an unseren Tisch!“, rief ihm Rosalie zu, die hinter die Theke gegangen war.
Dani machte eine einladende Bewegung, was Hamed mit einer kritischen Frage quittierte: „Warum so freundlich auf einmal?“
„Wir sind doch immer freundlich, wir Morgenländer“, erwiderte Dani.
„Meinen Sie, Herr Birnbaum?“
„Sie können mich ruhig Dani nennen. Darf ich Hamed sagen?“
Hamed rückte sich den Stuhl zurecht und nahm endlich Platz.
„Klar können Sie Hamed zu mir sagen, Dani.“
„Das ist doch ein Wort.“
Rosalie näherte sich den beiden von der Theke her: „Hier kommt ein Bier und noch ein Bier. Für gute Gäste.“
„Bei mir versteh’ ich, was Sie sagen“, erklärte Hamed gravitätisch, „ich komm’ ja schon ewig, aber bei dem Herrn hier habe ich Verständnisschwierigkeiten.“
„Der Herr heißt Dani“, erklärte Dani in versöhnlichem Ton.
Rosalie stellte die Gläser auf den Tisch, setzte sich zu den beiden und sagte zu dem, der ewig schon zu ihr kam: „Gleich werden wir sie ausräumen, die Verständnisschwierigkeiten.“
Sie machte eine bedeutungsvolle Pause, Hamed sah sie neugierig an.
„Zunächst einmal: Ich brauche keine Anzeige mehr im Rheingau-Echo.“
„Was!“, empörte sich Hamed, „sie ist doch schon fest eingeplant, da ist nichts mehr zu machen!“
„Bezahlen tu’ ich sie ja auch“, sagte Rosalie, „machen Sie sich keine Sorgen. Aber ich brauch’ sie eigentlich nicht mehr.“