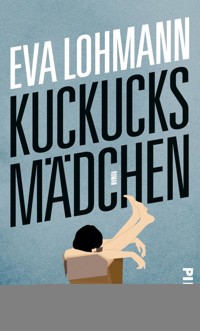
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sich endlich im eigenen Leben einrichten? Ein Nest zu bauen wie ihre Freunde? Alles könnte so einfach sein – Wanda bräuchte nur ja zu sagen undmit Jonathan in die Altbauwohnung ihrer verstorbenen Großeltern zu ziehen.Aber Wanda kann nicht. Schon deshalb nicht, weil sie professionelle Haushaltsauflöserinist und somit vom Ende aller Beziehungen lebt. Außerdemquält sie die Frage: Wie wäre das Leben mit einem anderen Mann verlaufen? Wanda muss Gewissheit haben und setzt sich in die gemachten Nester ihrer Exfreunde: In Max' buntes Bullerbü mit Anouk und in Philips lauwarmes Spießervergnügen mit Larissa. Doch spätestens beim Testsex mit ihrer Jugendliebe Ilja stellt das Kuckucksmädchen ernüchtert fest: Die Antwort liegt nicht bei den anderen – sondern ganz allein bei ihr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Ana und die Ameise
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-95848-6
© 2012 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Mediabureau di Stefano, Berlin
Umschlagmotiv: David et Myrtille/Trevillion Images
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
»Wie komme ich auf den richtigen Weg?«, fragte Alice den Hasen. »Das kommt darauf an, wo du hinwillst.«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Alice.
»Ja dann«, sagte der Hase, »ist es ganz einfach. Du kannst den einen oder den anderen Weg wählen. Wenn du das Ziel nicht kennst, ist die Wahl des Weges unwichtig.«
Lewis Caroll, Alice im Wunderland
1
»In der Liebe gibt es immer einen Anfang und ein Ende. So ist das eben.«»Aber was ist mit der Zeit dazwischen?«»In der Zeit dazwischen trauert man dem Anfang nach und wartet auf das Ende.«
Catherine Deneuve in Die Männer, die ich liebte
Es ist sieben Uhr achtunddreißig, ich liege im Bett und bin noch nicht mal richtig wach, als mein Herz plötzlich und unvorhergesehen den ersten Satz seines Lebens sagt.
Das Bett setzt sich zusammen aus einem hochglanzweiß lackierten verschnörkelten Metallgestell, einer wollweißen Matratze, schneeweißer Bettwäsche und riesigen weißen Federkissen. Es steht vor einer kalkweißen Wand, und unter dem Bett, auf dem Parkett, liegt ein weicher, elfenbeinweißer Teppich, der jeden Morgen zuverlässig meine ersten drei Schritte nach dem Aufstehen dämpft. Der Rest des Schlafzimmers ist ebenfalls weiß. Wollweiß, kalkweiß, birkenweiß – der Raum sieht aus wie ein unbeschriebenes Blatt.
Ich mag das Gefühl, morgens in einem Berg aus frisch geschlagener Sahne aufzuwachen. Nur hin und wieder stelle ich eine Vase mit einer einzelnen gelben oder pinken Tulpe auf die marmorweiße Platte meines Nachttischchens, komme mir dabei wahnsinnig mutig vor und bin froh, wenn sie nach vier Tagen langsam den Kopf hängen lässt und ich sie endlich wegschmeißen darf.
Mein Schlafzimmer ist im Gegensatz zur restlichen Wohnung weiß und weich und sehr ordentlich. Es gibt nur einen einzigen Tag in der Woche, an dem ich für ein paar Stunden das Chaos einziehen lasse. Am Sonntagmorgen stehe ich kurz auf, kaufe mir am Bahnhof die Zeit und lege mich damit wieder ins Bett. Dann lese ich mich kreuz und quer durch die Seiten, wobei ich die einzelnen Blätter auseinanderrupfe und gedankenverloren links, rechts, vor und hinter mir verteile, bis ich irgendwann in einem Berg von Zeitungsseiten sitze. Wenn alles so ist, wie es sein soll, kommt in diesem Moment Jonathan mit einem Frühstückstablett aus der Küche und spricht die zwei immer gleichen Sätze, die er unbeirrt seit sechsunddreißig Monaten bei diesem Anblick sagt: »O wie schön. Ein ganzes Bett voller Zeit.«
Ich liebe mein Bett. Es ist der wichtigste Gegenstand in meinem Leben. Ich brauche es zum Schlafen und Wachsein, Lesen und Nachdenken, zum Essen, Vögeln und Weinen, zum Telefonieren, zum Kranksein und Abschotten, zum Glücklich- und Unglücklichsein. Nur vor einem kann mich auch mein Bett nicht retten: diesem Montagmorgen.
Ich bin liegen geblieben, als um sieben Uhr dreißig der Wecker geklingelt hat. Aus Angst vor dem, was heute kommen würde, habe ich die Augen geschlossen gehalten und versucht, mir vorzustellen, der Tag hätte noch nicht begonnen. Dann kam um sieben Uhr achtunddreißig die Sache mit dem Herzen dazwischen.
Der erste Satz, den mein Herz zu mir sagt, lautet:
– Schade, das mit den Brüsten.
Seltsamerweise bin ich weder erschrocken noch empört. Ich mag diese Stimme, ich erkenne den Beat, und ich antworte im Stillen und ohne nachzudenken:
– Ist mir auch schon aufgefallen. Früher sahen sie irgendwie besser aus.
Ich schlage die Bettdecke zurück, bin plötzlich gar nicht mehr müde, stehe auf und laufe auf nackten Füßen zum Schlafzimmerspiegel. Dort hebe ich mein durchgescheuertes I-love-Brooklyn-T-Shirt hoch und starre die Brüste an. Es ist wie mit alten Bekannten, die man lange nicht gesehen hat und bei denen man sich nicht ganz sicher ist, ob sie es wirklich sind. Meine Brüste starren zurück. Wenigstens schauen sie nicht zu Boden.
Ich nehme sie in beide Hände und presse sie nach oben. Meine Silhouette verbessert sich schlagartig. Sie haben weniger ihre Form verändert, sondern sind eher im Ganzen zwei Zentimeter nach unten gewandert. Vorsichtig nehme ich die Hände wieder weg.
– Es geht schon, antwortet das Herz. Ein paar Jahre halten sie bestimmt noch durch. Und irgendwann sind sie ja auch nicht mehr nur dazu da, anderen zu gefallen.
O rücksichtsloses kleines Herz! Nach all den Jahren der Selbstgespräche ist es zwar schön, dass endlich jemand antwortet, aber leider scheint es dabei wenig einfühlsam vorzugehen. Ich lasse das T-Shirt wieder sinken und merke, wie ich anfange zu zittern.
Sieben Uhr fünfundvierzig. An einem normalen Arbeitstag müsste ich in einer halben Stunde das Haus verlassen und jetzt schnell ins Bad. Aber das hier ist kein normaler Arbeitstag, ab heute wird alles ein bisschen anders, alles ein bisschen komplizierter sein. Abgesehen davon, hat vor sieben Minuten mein Herz angefangen zu sprechen, ich habe also definitiv das Recht auf noch ein wenig Ruhe und gehe lieber wieder ins Bett, vorsichtig lauschend, um nichts von dem zu verpassen, was als Nächstes kommt.
Als Nächstes kommt – eine Beleidigung:
– Ich beobachte dich seit einer ganzen Weile, Mädchen. Das mit den Brüsten ist schade. Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist? Ich langweile mich. Du langweilst mich. Bis auf die paar heimlichen SMS mit Max ist bei dir seit Jahren nichts Aufregendes mehr passiert.
Das Herz ist gut informiert, was habe ich erwartet? Max und ich hatten angefangen, uns Nachrichten zu schreiben, erst durch irgendeinen Zufall, ganz ungeplant, er war nur ein Ex von vielen. Dann machten wir weiter, irgendwie hörte keiner von uns auf, auf jede SMS folgte eine Antwort, und plötzlich wurden diese Antworten immer anzüglicher. Da weder Max noch ich unseren Partnern diese SMS gerne vorgelesen hätten, kann man wohl davon sprechen, dass es ein Geheimnis war. Vielleicht war es auch ein ganz kleines bisschen mehr – ich bin mir nicht sicher, in welche Kategorie SMS-Sex fällt –, aber am Ende war es doch nur ein Telefon, das ich in meinen nassen Händen hielt. Es war die leichteste Form von Betrug, manchmal war es viel, manchmal war es nichts. Auf keinen Fall war es etwas, für das Jonathan mich ernsthaft würde verlassen können.
Ich bin seit drei Jahren mit dem gleichen Mann zusammen. Das grenzt für mich an ein Wunder. Einer der Gründe für dieses Wunder ist wohl Jonathans Gespür für perfekt abgepasste Zeitpunkte. Fast exakt acht Monate nachdem wir uns kennengelernt hatten, sagte er das erste Mal, dass er mich liebt. Man darf das Timing solcher Sätze nicht unterschätzen, sechs Wochen vorher hätte ich ihm vielleicht noch nicht geglaubt, zwei Monate später hätte ich ihm sein Zögern vielleicht übel genommen. Aber Jonathan sagte seinen Satz zu genau der richtigen Zeit und in genau der richtigen Tonlage. Er sagte ihn leise und ohne Pathos, während ich gerade einen Einkaufszettel schrieb und ihn fragte, ob ich ihm etwas vom Drogeriemarkt mitbringen solle. Fast hätte ich es überhört, so nebensächlich ließ er seinen Satz neben mir fallen, aber meine Ohren fingen ihn gerade so noch auf, und ich lächelte in mich hinein und schrieb sehr langsam und mit größter Sorgfalt das Wort »Nagellackentferner« auf meinen Zettel.
Ein halbes Jahr später stellte er mich seinen Eltern vor, und auch hier bewies er ein gutes Timing, indem er verdammte zwei Stunden lang meine Hand unter dem elterlichen Biedermeiertisch hielt und sie erst dann wieder losließ, als seine Mutter begann, von ihrer Hochzeit zu erzählen.
Ja, man kann sagen, dass Jonathan ein gutes Gefühl für das richtige Tempo hatte. Ich fühlte mich weder überfahren noch gelangweilt, und ganz langsam fingen wir an, den gleichen Rhythmus anzunehmen. Zwei Jahre lang tanzten wir so vor uns hin, und alles war irgendwie gut und okay – bis Jonathan fand, man könne doch jetzt mal zusammenziehen, und das war der Moment, in dem der Beziehungsbeat ins Stocken kam.
Ich wollte nicht mitziehen. Ich wollte nicht zusammenziehen. Ich wollte die Zeit anhalten. Und irgendwie habe ich das sogar geschafft.
Seit einem Jahr ist es im besten Fall gemütlich, im schlechtesten Fall langweilig. Früher wäre genau das der Zeitpunkt gewesen, an dem ich abgesprungen wäre. Ich wäre mit ihm an einem Sonntagnachmittag in ein unverfängliches Café gegangen, nach einer Samstagnacht, die ich längst mit einem anderen verbracht hätte. Ich hätte ihm ernst in die Augen geschaut und gesagt: »Danke, das war nett, aber ich muss jetzt weiter. Irgendwann ist es immer vorbei, das verstehst du sicher, wir wollen ja schließlich noch was erleben, wir beide. Ich würd gern jetzt und hier Schluss machen, dann tut es nicht unnötig lange weh, wir sind doch Profis. Tschüs, und viel Spaß mit der Neuen, sie kommt sicher bald.«
Ich wäre aufgestanden, das wäre der härteste Teil der Geschichte gewesen, und dann hätte ich mich langsam von ihm entfernt, weg vom Tisch, raus aus dem Café, durch die Straßen bis in ein Zuhause, das ich wohl wissend nicht mit ihm teilte. Den ganzen Weg hätte ich ein unsichtbares Gummiband um meinen Bauch gespürt, das mich zurückzieht, eine Melancholie, die sich immer weiter zwischen uns ausgedehnt hätte. Circa zwei Wochen hätte man dieses Band aushalten müssen, ich hätte ein bisschen geweint und mich gefragt, ob diese Trennung ein Fehler war. Später hätte sich das Band gedehnt, wäre rissig geworden, irgendwann hätte ich es nicht mehr wahrgenommen. Eine Weile wäre ich noch der festen Überzeugung gewesen, dass wir irgendwann, in zehn Jahren, wenn wir uns ausgelebt hätten, wieder zusammenkommen und vielleicht sogar Kinder haben würden. Zwei Jahre später hätte ich den Mann auf einer Party wiedergetroffen und mir auch das nicht mehr vorstellen können.
Das wäre der natürliche Ablauf gewesen, doch seit ich mit Jonathan zusammen bin, ist dieser Ablauf irgendwie gestört. Ich komme nicht weiter, ich komme nicht los, vielleicht weil Jonathan wirklich ganz nett ist, vielleicht weil er nicht so nervt wie die anderen, vielleicht weil er mich so schön liebt. So richtig entschieden habe ich mich nicht für ihn. Nur eben auch nicht gegen ihn. Ab und zu gehen wir ins Café, ich kenne meine Sätze, aber ich sage sie nicht, und nach zwei Latte Macchiato sind wir noch immer zusammen, und er ahnt noch nicht mal, wie knapp es wieder war. Und so passt es ganz gut, dass wenigstens Max ab und zu eine SMS schreibt, in der er mich fragt, ob ich gerade ein Höschen trage.
– Ich war übrigens noch nicht fertig. Dein Leben langweilt mich, und wenn du mich fragst, hast du genau zwei Möglichkeiten, um das zu ändern.
– Ich kann mich nicht erinnern, irgendjemanden irgendwas gefragt zu haben.
Eine kurze Pause erfüllt den Raum, das Herz windet sich verlegen in meiner Brust.
– Ähm … Du hörst mich aber jetzt, das reicht. Das … werte ich einfach mal als Frage.
– Angenommen, ich hätte dich gefragt: Was würdest du denn vorschlagen?
– Du könntest dir ein Kind machen lassen, dann bekommen die Brüste einen anderen Sinn.
– Und die andere Möglichkeit?
– Oder du gibt deine Brüste einfach in ein neues Paar Männerhände. Das würde mal wieder ein bisschen Aufregung ins Leben bringen.
Bei der Erwähnung eines neuen Paars Männerhände hüpft das Herz in meiner Brust leicht auf. Kurz nur, aber auffällig genug, um sich zu verraten. Wenigstens hat mein Körper endlich aufgehört zu zittern. Ich stehe auf und ziehe mein T-Shirt aus, diesmal ohne in den Spiegel zu sehen. Zum Duschen ist es jetzt zu spät. Mechanisch gehe ich zum Schrank, nehme das oberste Höschen vom Montagsstapel, greife zum passenden BH und ziehe mich langsam an. Ich binde die Haare zusammen und versuche im Bad, mein verschrecktes Gesicht für die Arbeit zu schminken. Dann erst antworte ich:
– Du verstehst aber schon, dass ich darüber noch nachdenken muss?
– …
– Hallo, Herz?!
– Genau das meine ich. Du willst immer erst nachdenken. Immer erst planen. Dauernd schaust du dir selbst beim Leben zu. Je älter du wirst, desto langweiliger wird es für mich.
Das Herz hat recht. Vor sieben Tagen habe ich meinen dreißigsten Geburtstag gefeiert. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob »gefeiert« das richtige Wort dafür ist, wenn man nach Feierabend fünf Freunde zum Italiener einlädt, ausschließlich Wellnessgutscheine geschenkt bekommt und um kurz nach zehn froh ist, wieder zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Ich habe die Sätze gehört, die alle Menschen an ihrem dreißigsten Geburtstag gesagt bekommen: »Herzlichen Glückwunsch, Wanda. Und, wie fühlst du dich so, mit dreißig? Auch nicht anders als mit neunundzwanzig, oder?«
Ich hatte genickt und dabei noch nicht mal gelogen. Es war schon der dritte Geburtstag in Folge ohne große Party gewesen, der vierte ohne Fremdknutschen, und seit erschreckenden fünf Jahren hatte ich am nächsten Morgen nicht mehr über der Kloschüssel gehangen. Nein, es hatte sich nicht viel verändert. Ich war nicht schlagartig dreißig geworden. Ich hatte schon mit siebenundzwanzig damit angefangen.
Ich packe meine Tasche für den Tag und überschlage dabei die Entwicklungen der letzten halben Stunde: ein sprechendes Herz. Die Entdeckung meiner nicht mehr taufrischen Brüste. Ein steckengebliebenes Leben. Und zwei Vorschläge, die sich gegenseitig ausschließen. Kein leichter Stoff für einen Montagmorgen, an dem ich sowieso schon spät dran bin.
Etwas benommen schließe ich die Haustür hinter mir. Das Herz in mir schweigt. Gemeinsam hängen wir unserem seltsamen Wortwechsel nach, der sich anfühlt wie der erste von vielen. Doch für den Moment will keiner das nächste Wort haben, und so lauschen wir stumm vor uns hin, während ich auf Zehenspitzen zur Arbeit laufe.
Der Teppichboden meiner Großeltern ist seit zwanzig Jahren moosgrün und pflegeleicht. Trotzdem durfte niemand ihn jemals mit Schuhen betreten. Dreißig Jahre lang habe ich im gekachelten Vorflur meine Schuhe ausziehen und gegen die doppelt gestrickten Wintersocken tauschen müssen, die meine Großmutter in den verschiedensten Größen in einer Kiste bereithielt. Und obwohl es nun wirklich überhaupt keinen Grund mehr gibt, den Boden zu schonen, stehe ich auch jetzt noch in dicken Socken auf dem Teppich im Wohnzimmer.
Der Teppichboden ist so etwas wie der letzte Vorhang einer gelungenen Wohnungsauflösung. Nach unserem Gastspiel in fremden Häusern und Wohnungen ziehen wir ihn ab, wenn alles andere getan ist, und schmeißen ihn in großen Rollen ganz oben auf die überfüllten Container. Vielleicht deswegen will ich ihn noch eine Weile schonen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Geschichte meiner Großeltern zu Ende sein soll. Wenn der Teppich weiterhin gepflegt aussieht, wenn ich mich weiterhin an die Regeln halte, die in diesem Haushalt in den letzten dreißig Jahren gegolten haben, dann ist vielleicht noch nicht alles vorbei. Auch wenn dieser Haushalt nun seit dreieinhalb Monaten von niemandem mehr geführt wird.
Die Wohnung verstorbener Verwandter aufzulösen ist das Unprofessionellste, was man in meiner Branche machen kann. Von dieser Idee werden einem auch die härtesten Abrissunternehmer abraten. »Geh rein, hol dir die Sachen raus, an denen dein Herz hängt, und lass den Rest die anderen machen«, sagen selbst die Jungs mit dem Vorschlaghammer. »Die abgerissene Schrankwand deiner eigenen Großmutter hinterlässt fast immer fiese Splitter in der Seele.« Trotzdem werde ich gefragt, immer wieder. Wie ein Computerfachmann den Rechner seiner Nichte reparieren soll und eine Physiotherapeutin die Wirbelsäule ihrer Eltern befühlen muss, werde ich regelmäßig gebeten, mich um die Wohnungen verstorbener Verwandter zu kümmern. Viele Jahre habe ich es erfolgreich abwehren können. Ich weiß nicht, warum ich bei meinen Großeltern nicht Nein sagen konnte. Vielleicht, weil es dieses Mal mein eigener Vater war, der mich darum gebeten hat. Und weil ich, wie die meisten Töchter und Söhne, darauf brenne, meinem Vater endlich mal zu zeigen, was ich kann.
Seine Eltern starben kurz hintereinander. Als Erstes starb mein Großvater. Er hatte es lange gewusst und kurz vorher angekündigt, hatte Abschiedsbriefe geschrieben, Nachlässe geordnet, letzte Besuche empfangen. Dann hatte er sich ins Bett gelegt, die Hände überm Bauch gefaltet und gewartet, bis der Krebs unter diesen Händen ihn auffraß. Sein Tod hatte etwas Organisiertes. Zögerlich, aber doch zeitnah starb meine Großmutter. Sie war nicht ganz so resolut, sie haderte ein wenig, aber schließlich strickte auch sie ihr letztes Paar Socken zu Ende, brauchte die wenigen Vorräte aus dem Keller auf und folgte ihrem Mann, so, wie sie es immer getan hatte.
Frauen sind in meiner Branche selten. Haushaltsauflösungen sind ein hartes, ein raues Gewerbe. Oft wird es von unfreundlichen, groben Männern betrieben, die kaugummikauend und mit einem billigen Plastikkugelschreiber in der Hand durch die Räume der Verstorbenen schlendern, abschätzig den Kopf schütteln und immer wieder das Gleiche sagen: »Hier ist nix mehr zu holen«, »Das alte Ding will doch keiner mehr haben« oder »Da müssen Sie mir aber was draufzahlen, dass ich den Schrott noch hier abhole«.
Diese Sätze sprechen sie schulterzuckend in die Gesichter von Menschen, denen wahlweise gerade die Eltern gestorben sind oder deren Partner sie nach Jahren verlassen haben. Manchmal stecken sie auch mitten in einer finanziellen Pleite. Die Gründe für Haushaltsauflösungen sind nicht besonders vielfältig. Aber sie sind fast immer traurig. Und dann werden diese Menschen auch noch von groben Männern beiseitegedrängt und müssen zusehen, wie die Schrankwand, einst der ganze Stolz der Mutter, mit dem Vorschlaghammer in Stücke gehauen wird. Wie sich fremde, lieblose Hände auf der Suche nach einem möglicherweise vergessenen Sparstrumpf durch sorgsam gebügelte Kleider wühlen. Und wie all die ein Leben lang angesammelten Dinge, all die langjährige Mühe, all das ausgegebene Geld ganz plötzlich seinen Wert verliert.
Mein Chef hatte mich noch während des Studiums eingestellt. Eigentlich brauchte er jemanden, der seinen rauen Jungs beibrachte, kostbare japanische Vasen von billigen chinesischen Kopien zu unterscheiden. Jemanden, der einschätzen konnte, wie viel ein Schmuckkästchen noch wert war oder eine Sofagarnitur.
Eine Zeit lang arbeitete ich auf Provisionsbasis, fand die handelsüblichen Preise von Gegenständen heraus und vermittelte sie an Händler weiter. Es war ein etwas ungewöhnlicher Job, meine Kommilitoninnen beäugten ihn skeptisch. Sie selbst arbeiteten aushilfsweise in teuren Möbeldesignläden oder zogen die ersten Jobs bei kleinen Innenarchitekten an Land. Aber ich mochte die Arbeit und ich mochte den Chef, und schließlich sollte es nur etwas Geld bringen, bis ich mit dem Studium fertig wäre.
Wenn ich die Kunden zum ersten Termin in den Wohnungen ihrer verstorbenen Verwandten traf, bewegte ich mich dort anders als die harten Männer von der Konkurrenz. Ich strich respektvoll über alte Glasvitrinen, betrachtete wertschätzend die über Jahre zusammengetragene Puppensammlung und nickte anerkennend über das vierundzwanzigteilige Rosenthalgeschirr. Ich ließ mir erzählen, auf welchen Reisen die Fotografien an den Wänden und auf Kommoden entstanden waren, fragte nach, in der wievielten Generation die schwere Eichentruhe vererbt worden war, und wurde nicht ungeduldig, wenn ein Kunde sekundenlang mit starrem Blick verharrte, weil er eine vergessene Zuckerdose aus seiner Kindheit gefunden hatte.
Ohne es zu wissen, nahm ich meinen Kunden das fiese, leichenfleddrige Gefühl, das normalerweise über Wohnungsauflösungen liegt. Ich machte ihnen nichts vor, auch bei uns kommen irgendwann die Jungs mit dem Vorschlaghammer. Aber seitdem ich in der Firma arbeitete, sorgte ich eben dafür, dass sie für die Augen der Kunden unsichtbar waren. Und plötzlich passierte etwas, womit keiner gerechnet hatte. Die Kunden fühlten sich wohl mit mir. Sie empfahlen die Firma weiter. Wir waren auf eine Marktlücke gestoßen, von der wir nicht gewusst hatten, dass es sie gibt.
Mein Chef war glücklich. Er stellte mich fest ein, er bezahlte mich gut, ich ging nur noch ab und zu zur Uni. Dann immer seltener. Das letzte Mal war ich mittlerweile vor eineinhalb Jahren dort. In diesen eineinhalb Jahren habe ich genau achtzehn Häuser und dreiundzwanzig Wohnungen ausgeräumt. Die Wohnung meiner Großeltern ist Nummer vierundzwanzig.
Wenn meine Arbeit hier getan ist, wenn ich die Schubladen und Schränke ausgeräumt, die Bilder abgenommen, die Familienerbstücke aussortiert und die noch brauchbaren Kleinmöbel verschenkt habe, wenn die Jungs alle Einbauschränke kaputt geschlagen, den alten Röhrenfernseher auf den Sondermüll gebracht und den restlichen Schutt in die großen Container vorm Haus geworfen haben, dann werde ich in der leeren Wohnung knien und den moosgrünen Teppich herausziehen. Ich werde sehen, mit welchem Klebstoff die Raumausstatter in den Neunzigern gearbeitet haben, und vielleicht das ein oder andere damals noch nicht graue Haar meiner Großmutter finden, das zwischen Dielen, Klebstoff und Teppichboden konserviert zwanzig Jahre lang auf mich gewartet hat wie ein erstarrter Käfer im Bernsteintropfen.
Ich werde so tun, als hätte ich es nicht gesehen. Ich werde den Teppich in großen Rollen auf die riesigen, übervollen Container schmeißen – ganz, wie ich es immer tue. Ich werde meinen Vater in Köln anrufen und ihm mitteilen, dass alles erledigt sei. Er wird erleichtert klingen, wenn er sich bedankt. Und dann wird er mich fragen, ob Jonathan und ich sein Geschenk denn nun annehmen wollen.
Erst drei Tage später meldet sich das Herz wieder, und es scheint keinen Anstoß daran zu nehmen, dass ich nicht allein bin. Jonathan steht in der Küche und bereitet den Knoblauch fürs Curryhuhn vor. Sorgsam schält er die dünne Haut ab, schneidet die Zehe mit einer engelsgleichen Geduld in immer gleiche Scheiben und macht mich damit traurig.
Wann genau haben wir eigentlich damit angefangen, abends zu kochen statt zu vögeln? In den ersten Monaten einer Beziehung musste man früher aufpassen, dass man sich zwecks Nahrungsaufnahme zweimal am Tag voneinander löste. Körperlich an den Grenzen der Leistungsfähigkeit und schon mit leicht schwirrendem Gefühl im Kopf rief man den Pizzaservice an, duschte sich einmal kurz ab und wickelte den nackten, ausgezehrten Körper nachlässig in ein Handtuch. Wenn es klingelte, öffnete man die Tür, immer noch leicht erhitzt, und sah dem Lieferanten entschuldigend in die traurigen wissenden Augen. Man schlug die Tür zu, teilte sich die Pizza Margherita im Stehen und machte sich sofort daran, sie wieder abzutrainieren.
Seit ungefähr einem Jahr ist Essen unser Sex. Wir pflücken stundenlang Steinpilze im Wald, reiben Hühnerbeine liebevoll mit Olivenöl ein und seufzen mit dem Mund voll Trüffelravioli. Danach sitzen wir mit vollen Bäuchen am Tisch, denken verstohlen an das, was früher war, und sind froh, wenn einer den Fernseher einschaltet.
»Bleibt das jetzt eigentlich für immer so?«, frage ich Jonathan beim Essen möglichst neutral.
»Was meinst du?«
»Na, du und ich und das Thaihuhn. Ist das jetzt für immer?«
Er starrt mich an. Er weiß genau, was ich sagen will. Trotzdem wählt er den einfacheren Weg: »Na ja, ein bisschen Abwechslung auf dem Speiseplan ab und zu wäre schon nett.«
»Du weißt, was ich meine.«
Ende der Leseprobe




























