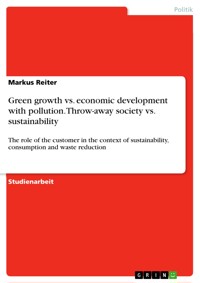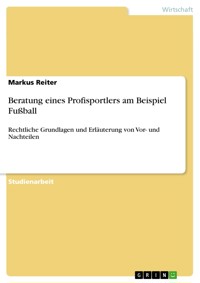7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie unterscheidet sich gute Popmusik von Kommerzmüll? Was ist so schön an Opernarien? Wieso kostet eine mit Farbklecksen überzogene Leinwand so unglaublich viel? Und warum hätte man die nicht mal eben selber und schöner hinbekommen? ObTheater, Philosophie, Ballett, Architektur oder Film, nach dieser Lektüre bleibt keine Frage zu kulturellen Themen unserer Zeit mehr offen. Eine Top-Ten-Liste der wichtigsten Vertreter und Werke sorgt zusätzlich für Überblick, durch die Fülle praktischer Tipps lässt sich jede Diskussion meistern. Und das Schönste daran: Dieses E-Book sorgt nicht nur für ein besseres Verstehen, sondern weckt wahre Kulturbegeisterung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Markus Reiter Tim Schleider
KULTUR FÜR BANAUSEN
Alles was Sie wissen müssen, um mitreden zu können
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2010 by Bastei Lübbe AG, Köln Textredaktion: Kerstin Windisch Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin Umschlagmotiv: © SuchBild E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-0392-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
INHALT
VORWORTBildende KunstARCHITEKTURWas sagt Architektur aus?Was beschränkt Architektur?An den Säulen sollt ihr sie erkennen – die AntikeErdverbunden oder himmelstrebend – das europäische MittelalterZurück zu den Wurzeln – die RenaissanceDie Rückkehr der Antike II: der KlassizismusDie Architektur der ModerneMALEREIGiotto entdeckt die MalereiMasaccio entdeckt die PerspektiveJan van Eyck entdeckt die ÖlmalereiBotticelli entdeckt die AllegorieMichelangelo entdeckt den KörperAlbrecht Dürer entdeckt den KünstlerPieter Brueghel entdeckt die einfachen LeuteCaravaggio entdeckt das LichtRembrandt entdeckt die DramatikTurner entdeckt die (wilde) NaturMonet entdeckt die FlüchtigkeitPicasso entdeckt die FormKandinsky entdeckt die AbstraktionMODERNE KUNSTKasimir Malewitsch malt ein schwarzes QuadratMarcel Duchamp stellt ein Pissoir ausJackson Pollock spritzt mit FarbeAndy Warhol multipliziert UnfallbilderGeorg Baselitz übt den KopfstandBILDHAUEREIWas die alten Griechen auf die Beine stelltenWer reitet da im Bamberger Dom?Zweimal David – die Höhepunkte der RenaissanceWas verzückt die heilige Theresa?Der Weg in die ModerneFOTOGRAFIEZwei Richtungen: Kunst und DokumentationFotografie als KunstFotografie als DokumentationZwei SonderwegeWas macht ein gutes Foto aus?Darstellende KunstFILMMehr wissen – mehr sehen!Warum das Kino immer nach dem Neuen suchtDie Sternstunden des KinosDie Stars des KinosZwei spannende Sonderfälle: Doku und TrickFilmkunst als EntdeckungsreiseOPERVorbereitung auf den OpernabendOhne Orpheus wär’ das nicht passiertOuvertüre, Arie, Finale – was eine Oper alles zu bieten hatDie großen vier des Spielplans: Mozart, Wagner, Verdi, PucciniPlatz für Oper ist nur in den großen HüttenKleine Verhaltenstipps für die OperAuf den Geschmack gekommen?MUSICAL UND OPERETTEWas bei Musical und Operette geboten wirdDarf ich bitten? Vom Charme der OperetteLet’s dance! Von der Energie des MusicalsImmer diese Katzen: das Musical als UnterhaltungsproduktAuf der verzweifelten Suche nach dem PublikumsgeschmackVorbereitung auf den MusicalabendTANZWarum der Tanz an jedes Theater gehörtEine kleine Geschichte des TanzesWo Tanz zu sehen istWie sich Tanz besser verstehen lässtTHEATEREin bisschen außerirdisch: Warum das Theater ein besonderer Ort istZiemlich antik: Wo das Theater seine Wurzeln hatNur kein falscher Respekt vor dem TheaterEin kleiner Streifzug durch den SchauspielplanWer hat das Zeug zum Klassiker?Immer diese Regisseure: der ewige Streit um die InszenierungVorbereitung auf den TheaterabendMusikKLASSISCHE MUSIKDas klassische Konzert – anstrengend und genussvollMit einer Flöte fing alles an: Musik als UrbedürfnisWie die Musik in den Konzertsaal kamDie Wahl des passenden KonzertsDie großen Namen des KonzertbetriebsUnd was wird aus der Neuen Musik?Vorbereitung auf den KonzertabendPOPPopmusik – viel mehr als ein OhrwurmWas den Pop zum Pop machtEin kurzer Streifzug durch die StilePopmusik für AnfängerJAZZJazz – Musik für IndividualistenWarum der Jazz ganz anders istDer Ursprung des JazzDie Stilformen des JazzWie man Jazz am besten hörtLiteraturLITERATURWas ist gute Literatur?Was macht gute Literatur aus?Warum sich Gedichte nicht immer reimenWas alles zur Epik gehörtDie großen RussenDie großen FranzosenDie großen EngländerDie großen AmerikanerDie großen DeutschenDrei Romane – ein ThemaKultur plusFERNSEHENWarum auch Fernsehen zur Kultur gehörtDie Geschichte eines MassenmediumsDie Zukunft des FernsehensTV-KulturMUSEUMDie Faszination des MuseumsWelches ist das wichtigste Kunstmuseum der Welt?Die Entstehung der KunstmuseenKunsterlebnis außerhalb der SpitzenhäuserWas ist eigentlich ein Museum?Informationen vor und während des BesuchsPHILOSOPHIEDie vier Grundfragen Immanuel KantsErste Frage: Was soll ich tun?Zweite und dritte Frage: Was darf ich hoffen? Was kann ich wissen?Vierte Frage: Was ist der Mensch?HIRNFORSCHUNGDie Hirnforschung im FeuilletonRehabilitiert die Hirnforschung den Determinismus?Wie viel freien Willen hat ein Finger?RELIGIONKann man Gott beweisen?Die Religionskritiker Feuerbach, Freud und MarxGlauben oder nicht glauben – das ist hier die FrageARCHÄOLOGIEAus einer Zeit vor unserer ZeitEdle Einfalt, stille Größe – Johann Joachim WinckelmannHeinrich Schliemann und der Schatz des PriamosHoward Carter und der Fluch des TutanchamunSCHLUSSWORTBILDNACHWEISVORWORT
Wer möchte schon gern ein Banause sein … Allein, wer sich völlig unvorbereitet ins Kulturleben stürzt, wird leider schnell dazu gemacht. Im Theater mal wieder den Faden verloren? Im Konzert vor Langeweile an die Decke gestarrt? Aus der Ausstellung der Neuen Wilden ratlos heimgekehrt? Im Kino vor lauter Verwirrung eingenickt? Wer Erlebnisse dieser Art kennt und sie den wahren Kulturfreunden gesteht, der bekommt prompt an den Kopf geworfen: »Mann, bist du ein Kulturbanause!«
Solche Szenen sind bedauerlich. Denn erstens sorgen sie beim Angesprochenen für Missstimmung und womöglich für Minderwertigkeitsgefühle – dabei wäre es viel netter und interessanter gewesen, der Kulturfreund hätte klar und verständlich erklärt, was denn der sogenannte Banause in Theater, Konzert oder Museum Spannendes übersehen hat. Und zweitens entsteht dabei bei vielen Menschen das Gefühl, Kultur sei nur etwas für Eingeweihte, das zu verstehen furchtbar viel Arbeit und Anstrengungen koste und sie mit ihrem anscheinend banalen Geschmack ganz bestimmt überfordern werde.
Diesen Irrtum wollen wir gleich zuallererst ausräumen: Nein, Kultur ist nicht bloß etwas für Eingeweihte! Kultur ist eines der spannendsten Themen überhaupt! Ob es nun die Welt von Oper oder Schauspiel, Musik oder Literatur, Film oder Kunst ist – durch nichts wird der Mensch reicher beschenkt als durch kulturelle Genüsse. Die Bilder und Geschichten, die Fragen und Antworten, die Töne und Thesen der Künstler können uns ganz unmittelbar berühren, können uns treffen, können unsere Gefühle in Wallung bringen, im Guten wie im Schlechten.
Bildung und Kultur sind die beiden Schlüsselressourcen des modernen Menschen, und beide sind ganz eng miteinander verzahnt. Um in diesen beiden Bereichen auf Entdeckungsreise zu gehen, braucht man gute Lehrer und die richtigen Anregungen. Die sind natürlich nicht immer zur Hand – im Gegensatz zu diesem Buch: ein Kulturbuch für all jene, die eintauchen wollen in die Welt der Kultur, auf Expedition gehen wollen im Reich der Bildung und sich auf ihrer Reise für keine ihrer Fragen schämen sollen.
In diesem Buch stellen wir Ihnen die meisten Bereiche der Kultur vor – und erklären, wie Sie sich am besten an den Kulturorten verhalten sollten. Dabei werden alle Zusammenhänge – so hoffen wir doch – leicht verständlich und ohne komplizierte Fachbegriffe dargestellt, sodass wirklich jeder, der sich für ein bestimmtes Gebiet der Kultur interessiert, es ohne Probleme erkunden kann. Und mit unseren Top-Ten-Listen am Ende jedes Kapitels möchten wir Ihnen einen Überblick geben, welche Theaterstücke, Bücher, Bilder oder Filme am besten für den Einstieg geeignet sind, um den richtigen Zugang zu den Schätzen aus Kunst und Kultur zu finden, und welche Namen es sich zu kennen lohnt.
Denn das ist ja das Wunderbare an der Kultur: Sie brauchen wirklich nur ein wenig Starthilfe, sozusagen ein wenig Gepäck und einen kleinen Schubs. Wer sich erst mal auf die Reise gemacht hat, wird schnell merken, wie nach und nach eins zum anderen kommt, wie ein Bild auf das nächste verweist, wie sich eine Geschichte zur nächsten fügt. Kulturinteresse ist das einzig wirklich funktionierende Perpetuum mobile der Welt, also der einzige Motor, der sich selbst anzutreiben vermag. In Sachen Kunst und Kultur ist es ein wenig wie mit Geld auf einem Sparkonto: Beides vermehrt sich wie von selbst. Nur dass Kunst und Kultur wesentlich höhere Zinsen abwerfen – und Sie auch bei einem geringen Startkapital schnell sehr reich werden können. Mehr noch: Die Welt der Kultur ist unendlich – und immer dann, wenn wir glauben, an ihre und unsere Grenze gestoßen zu sein, machen wir dahinter auch schon die nächste Entdeckung.
Uns ist es mit den nötigen Anschüben übrigens nicht anders ergangen. Und den angeblich wahren Kulturkennern auch nicht. Wir alle haben irgendwann in unserem Leben eine Art Starthilfe gebraucht, um uns auf unseren ganz persönlichen Kulturweg zu begeben. Mit anstrengender Arbeit hat das nicht viel zu tun. Gut, manchmal ist es mit Anstrengungen verbunden, ein dickes Buch zu lesen, ein langes Theaterstück anzusehen oder ein ungewöhnliches Bild zu betrachten. Aber wenn es gut ist – und ob es das für Sie ist, entscheidet kein fremder Kritiker dieser Welt, sondern entscheiden immer nur Sie selbst! –, dann werden Sie wahrscheinlich feststellen, wie dieses anstrengende Stück Kultur Ihre Welt verändert hat – und sei es nur ein kleines bisschen.
Also, seien Sie ein unternehmungslustiger Banause! Denn es ist einfach wunderbar, zwar nicht unbedarft, aber unbelastet von allen Geschmacksdebatten, all die schönen Künste zu entdecken und zu erleben. Blättern und schmökern Sie in diesem Buch, lassen Sie sich treiben, oder suchen Sie gezielt nach jenen Informationen, die für den nächsten Kulturtermin am Abend oder am Wochenende gerade nötig sind. Und eines können wir Ihnen versichern: Gerade die scheinbar größten Kulturkenner sind oftmals diejenigen, die das überraschend Neue anfangs völlig verkennen – wofür es auf den folgenden Seiten jede Menge Beispiele aus der Geschichte gibt. Dort, wo Sie als Kulturentdecker in Bewegung sind, da sind andere längst erstarrt. Und darum werden sich auch erst ganz am Ende die wahren Kulturbanausen entpuppen …
Bildende Kunst
ARCHITEKTUR
Wer es darauf anlegt, kann den meisten Erscheinungen von Kunst und Kultur, die wir Ihnen in diesem Buch schmackhaft machen wollen, aus dem Weg gehen. Man vermag problemlos Museum, Theater und Oper zu meiden, Romane und Gedichtbände links liegen zu lassen und Konzertsäle zu scheuen. Einer Form der Kultur lässt sich aber nur schwerlich entkommen: der Architektur. Wir leben darin. Und sobald wir auch nur zum Fenster hinausschauen, werden wir mit Architektur konfrontiert. Wenn wir in die Stadt fahren: Architektur. In die Kirche gehen: Architektur. Uns an unseren Arbeitsplatz begeben: Architektur.
Die Wissenschaft definiert Architektur in einem weiten Sinne als planmäßige Herstellung einer künstlichen Umhüllung von Raum. Nun kann man natürlich zu Recht fragen: Mag ja sein, dass alles, was gebaut wird, Architektur ist. Aber ist jede Art von Architektur zugleich Kunst und Kultur? Die Frage ist nicht so eindeutig und leicht zu beantworten, wie man vielleicht meinen möchte.
Nehmen wir als Beispiel den Wohnungsbau: Bevor meine Familie während meiner Kindheit Ende der 70er-Jahre in ein eigenes Häuschen umzog, wuchs ich in einem Mietshaus auf, das aussah wie ein übergroßer Schuhkarton, den man mit Fenstern, Türen und Balkonen versehen hatte. Dieser Art von tristem Mehrfamilien-Wohngebäude bin ich später in vielen deutschen Städten begegnet. Offenbar handelte es sich um einen bundesweit verbreiteten Einheitsstil. Ich würde ihm keinen Wert als architektonische Kunst zuordnen. Warum? Nun, hinter diesen Häusern steckt keine schöpferische Idee – das wesentliche Merkmal für Kunst. Diese Wohnhäuser verhalten sich zur Architektur als Kunst wie eine Gebrauchsanweisung zu einem Roman.
Wenden wir unseren Blick nun auf ein Hochhausviertel im Berliner Bezirk Neukölln mit dem Namen Gropius-Stadt. Die Gegend ist als sozialer Brennpunkt bekannt. Armut, Arbeitslosigkeit und eine hohe Kriminalitätsrate prägen das Viertel. Die Mehrheit der Menschen, wohl auch der Bewohner, würde Gropius-Stadt nicht unbedingt als »schön« bezeichnen. Schönheit, jedenfalls im herkömmlichen Sinne, ist aber in der Moderne und Postmoderne keine Beurteilungskategorie mehr. Danach lässt sich der Wert der Architektur nicht bemessen.
Was hingegen entscheidend ist: Hinter den Hochhäusern der Gropius-Stadt steckt eine, wenngleich gescheiterte, gestalterische Idee. Sie wurde vom Chefplaner des Wohngebietes, dem deutsch-amerikanischen Architekten Walter Gropius (1883–1969), in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts formuliert und geht zurück auf den französischen Stadtplaner und Architekten Le Corbusier (1887–1965). Dessen Vorstellung war es schon seit den 1920er-Jahren gewesen, wirtschaftlich, zweckmäßig und funktional zu bauen. Man sprach vom »Neuen Bauen«, um sich vom wilhelminischen Neoklassizismus abzugrenzen. Bei der Gropius-Stadt legte der Architekt Wert auf grüne Achsen, und er achtete darauf, dass die Formen und Höhen der Gebäude ein harmonisches Ganzes ergeben. Wir kommen später noch einmal auf die Prinzipien dieses Baustils zurück. An dieser Stelle begnügen wir uns damit, als erste Erkenntnis festzuhalten: Unabhängig davon, ob wir das Ergebnis als dem Auge gefällig empfinden oder nicht, zeichnet sich Architektur als Kunst dadurch aus, dass ein Gestaltungswille dahintersteht.
Was sagt Architektur aus?
Dass Gropius und seine Kollegen so großen Wert auf Wohnarchitektur für breite Bevölkerungsschichten legten, war ein neues Phänomen in der Baugeschichte. Man kümmerte sich um die einfachen Leute und wollte deren elende Wohnverhältnisse verbessern. Ebenso wie beim Neuen Bauen lässt sich mithin eine ganze Menge über das Menschenbild einer Epoche erfahren, wenn man sich anschaut, welcher Art von Gebäuden die Baumeister ihre größte Aufmerksamkeit gewidmet haben.
Im alten Ägypten waren die aufwendigsten Gebäude die Pyramiden. Sie haben, im Gegensatz zu den damaligen Wohnsiedlungen, Jahrtausende überdauert. Bei den Pyramiden handelt es sich um Grabmale für die Pharaonen. Daraus lässt sich ablesen: Nichts war den alten Ägyptern (zumindest denen, die etwas zu bestimmen hatten) so wichtig, wie dem toten Pharao mit all seinen Schätzen die von Grabräubern ungestörte Reise in die Unterwelt des Gottes Osiris zu ermöglichen – in den meisten Fällen leider vergebens. Vielfach fanden die Grabräuber trotz aller Vorkehrungen einen Weg ins Innere der Pyramiden.
Unser Bild des antiken Griechenland wird hingegen von seinen Tempeln geprägt. Die der Göttin Athene geweihte Akropolis in Athen – wir werden sie noch näher vorstellen – gilt manchen Architekten gar als das vollkommenste Bauwerk der Welt. Das antike Rom stellt sich uns als der Mittelpunkt eines Weltreiches dar, mit Palästen der Macht, wie dem Kapitol, und Orten der Belustigung der Massen, wie der Kampfarena Kolosseum. Außerdem ist die Stadt voller Triumphbögen – den architektonischen Zeichen militärischer Überlegenheit.
Im christlichen Mittelalter wiederum konzentrierte sich die ganze Gestaltungskraft auf das Jenseits. Es entstanden herrliche Sakralbauten, also Kirchen und Klöster. Man denke nur an die romanischen Basiliken und die gotischen Kathedralen. Burgen erscheinen dagegen eher als plumpe Trutzbauten. Frühestens in der spätmittelalterlichen Gotik, eigentlich aber erst in der Renaissance entwickelten die Architekten einen neuen Sinn für Profanbauten, vor allem bei den Palästen für die reichen Adeligen der norditalienischen Städte. Der Barock brachte zwar auch prachtvolle Kirchen hervor, aber die gewaltige Größe der Paläste (Versailles!) beweist, dass der absolutistische Herrscher mindestens so sehr im Mittelpunkt der Baukunst stand wie Gott. Selbst Fürsten, die ihr Ländchen an einem Tag zu Fuß durchschreiten konnten, wollten bei den barocken Prachtbauten nicht zurückstehen.
Und so finden wir heute überall in Deutschland und Europa Barockschlösser, etwa im sächsischen Delitzsch (der Herzöge von Sachsen-Merseburg), im hessischen Fulda (der örtlichen Fürstäbte), im thüringischen Rudolstadt (die Heidecksburg der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt) oder im mecklenburgischen Ludwigslust (der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin).
Was den Herrschern im Barock recht war, war dem Bürgertum der folgenden Epoche billig (wenngleich nicht im Sinne von kostengünstig). Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden prachtvolle klassizistische Repräsentationsbauten unter der Regie des Bürgertums: Opernhäuser, Museen, Ruhmeshallen, Rathäuser – vom Panthéon in Paris, der Ruhmeshalle Frankreichs, gleichsam dem ersten weltlichen Sakralbau (der ursprünglich noch als Kirche geplant war), über das British Museum in London bis hin zum Kapitol in Washington, geschaffen nach dem Vorbild ebenjenes antiken Kapitols in Rom. Man glaubte im Geiste der Aufklärung an den Sieg der Vernunft über Unwissen und Tyrannei – und vermeinte sich dabei auf das alte Griechenland berufen zu können.
Diese Architektur des selbstbewusst gewordenen Bürgertums wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgelöst von etwas wirklich Neuem: den Repräsentationsbauten des Kapitalismus – Hochhäuser und beeindruckende Industrieanlagen. Zunächst dienten die Wolkenkratzer als Firmensitze und wurden von den Konzernen in Auftrag gegeben: Home Insurance, US Steel, Chrysler, Singer, Woolworth waren die Bauherren in Chicago und New York.
Und heute: Im globalen Finanzkapitalismus ist Architektur nicht selten Investitionsobjekt von Spekulanten, was sich erneut in den Wolkenkratzern widerspiegelt, diesmal in Dubai, China, Taiwan und Malaysia. So lässt sich jede Zeit durch ihre Bauten verstehen.
Was beschränkt Architektur?
Bauen ist heute in vielen Fällen zu einem Investitionsgeschäft geworden, an dessen Ende der Profit stehen muss. Dadurch werden die Beschränkungen besonders bewusst, die der Architektur, weit mehr als jeder anderen Kunst, auferlegt sind. Als die drei wesentlichsten Beschränkungen sind zu nennen:
1. der Zweck. Architektur darf den Zweck dessen, was sie schafft, nicht aus dem Auge verlieren. Eine Burg musste ihrer Aufgabe als Schutz vor Invasoren gerecht werden. Eine Kathedrale diente sicherlich in erster Linie der Verherrlichung Gottes, sonst wäre ein so gewaltiger Aufwand überflüssig gewesen, dennoch mussten die Gläubigen darin beten können. Ein Palast sollte von außen Reichtum und Macht verkörpern, aber man sollte auch einigermaßen bequem darin leben können. In einem Museum erwartet man Platz für die Ausstellungsobjekte.
2. die finanziellen Mittel. Selbst wenn sich der eine oder andere Bauherr bis über die Halskrause verschulden mag, ist irgendwann die Grenze des Finanzierbaren erreicht. Da Bauen in der Regel teurer ist als Malen, Theater spielen oder Romane schreiben, spüren die Architekten diese Beschränkung am stärksten.
3. die Statik. Die hochfliegenden Pläne der Architekten müssen heute stets von Statikern überprüft werden, damit wir es am Ende nicht mit einstürzenden Neubauten zu tun haben – was in früheren Zeiten der Fall war: Die Kuppel der Hagia Sophia in Byzanz stürzte zweimal ein, bevor der Statiker Isidores von Milet (der Jüngere) sie 562 so umgebaut hatte, dass sie heute noch hält.
An den Säulen sollt ihr sie erkennen – die Antike
Wenn Sie vor einer Kirche, einem Rathaus, einem Schloss, einem Tempel (oder seinen Resten) aus der Antike oder einem anderen Gebäude stehen, mögen Sie sich als Erstes fragen: Wo lässt es sich in der Baugeschichte verorten? Die Antwort auf diese Frage hilft, die Idee, die dem Bauwerk zugrunde liegt, zu verstehen. Auf diese Weise werden Sie sicherlich viele Details entdecken, in denen sich diese Idee widerspiegelt. So können Sie am leichtesten eine Entdeckungstour durch die Architektur starten. Auf den folgenden Seiten machen wir Sie deshalb mit den wichtigsten Stilmerkmalen der jeweiligen Epochen vertraut. Wir beginnen in der Antike.
Ich erinnere mich noch lebhaft an meinen ersten Besuch in Athen. Ich war damals Volontär einer regionalen Tageszeitung, und bei der Fahrt handelte sich um eine Pressereise, die von der griechischen Regierung organisiert war. Einer unserer Ausflüge führte uns mit dem Bus auf die Akropolis, was wörtlich »Oberstadt von Athen« heißt. Ich weiß noch, dass ich mir zwischen den Säulen des Parthenons, des der Göttin Athene geweihten Haupttempels, verloren vorkam. Ich bewunderte schon damals die technische Leistung der Baumeister. Aber erst später wurde mir bewusst, was der Architekt Iktinos (2. Hälfte des 5. Jhr. v. Chr.) und seine Kollegen hier wirklich geleistet haben.
Der Parthenon wird als der perfekteste dorische Tempel angesehen, der je errichtet wurde. Man kann an ihm das wichtigste Prinzip der antiken griechischen Architektur ablesen: die Harmonie der Maße. So finden wir zum Beispiel an vielen Stellen den Goldenen Schnitt. Er gilt als Ausdruck größter Harmonie – und wird von den meisten Menschen auch so empfunden. Bei ihm stehen zwei Strecken in einem solchen Verhältnis zueinander, dass sich der kleinere Abschnitt zum größeren verhält wie der größere zur gesamten Strecke. Breite und Gesamthöhe, Höhe bis zum Architrav (auf den Säulen ruhender Querbalken) zu Resthöhe, Höhe über den Kapitellen (Säulenköpfe) zu Giebelhöhe, Säulenbreite zu Säulenzwischenraum, Metopenhöhe zu Architravhöhe – all diese Maßverhältnisse entsprechen dem Goldenen Schnitt. Metopen sind übrigens die rechteckigen Platten oberhalb des Architravs, also des Querbalkens.
Womit wir schon bei den Stilmerkmalen wären. Der Parthenon entspricht der dorischen Bauweise, einer von drei wesentlichen Säulenordnungen. Die anderen beiden heißen ionisch und korinthisch. Säulenordnung bedeutet: Die Art der Säulen gibt Aufschluss über die Entstehungszeit und die Proportionen des Baus. Man kann die drei Hauptrichtungen am besten an den Säulen selbst und ihren Aufsätzen, den Kapitellen, unterscheiden. Das trifft sich nicht zuletzt deshalb gut, weil von vielen antiken Tempeln nur noch die Säulen erhalten sind.
x Die dorische Säule, die älteste Form, steht ohne Basis direkt auf dem Boden und verdickt sich nach unten. Sie hat 16 bis 20 längsförmige Vertiefungen (Kanneluren) sowie ein schmuckloses, wulstförmiges Kapitell.
x Die ionische Säule ist schlanker, steht auf einer Basis und verfügt über 20 bis 24 Kanneluren. Das flache Kapitell endet in zwei schneckenförmigen Verzierungen (sogenannten Voluten).
x Die korinthische Säule, die jüngste Variante, ist ähnlich schlank wie die ionische, verjüngt sich leicht nach oben und endet in einem kunstvollen Kapitell, bei dem zwischen Säulenende und Voluten ein oder zwei Kränze aus Akanthusblättern mit eingerollten Spitzen zu sehen sind. Einer Anekdote des antiken Architektur-Theoretikers Vitruv zufolge schuf der Bildhauer Kallimachos das korinthische Säulenkapitell, nachdem er bei einer Wanderung auf dem Grab einer Jungfrau einen Korb gesehen hatte, der mit einer Steinplatte bedeckt war. An dem Korb rankten sich Akanthusblätter empor.
Die Griechen hatten die Baukunst zu einer Vollendung geführt, die in Europa über viele Jahrhunderte hinweg nicht mehr erreicht wurde. Kein Wunder also, dass ihre Werke in späteren Epochen kopiert wurden, manchmal nur einige Elemente, etwa die Voluten im Barock, manchmal der gesamte Stil, so im antiken Rom, in der Renaissance, im Klassizismus und im Neoklassizismus. Die Kenntnisse über die griechische Säulenordnung lassen sich auch auf jüngere Gebäude in mitteleuropäischen Breiten anwenden – und sogar in der Neuen Welt (etwa beim Weißen Haus in Washington!).
Übrigens: Der einflussreiche deutsche Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) hat seit dem 18. Jahrhundert unsere Vorstellung von der Kunst der Antike enorm geprägt (siehe auch das Kapitel Archäologie). Er bewunderte die schlichte Eleganz der Architektur und der griechischen Skulpturen, die sich in ihrem weißen, glatten Marmor zeige. »So wird auch ein schöner Körper desto schöner sein, je weißer er ist«, schrieb Winckelmann 1764 in seiner »Geschichte der Kunst des Althertums«. Dumm nur, dass er dabei einem Irrtum aufgesessen ist. In Wirklichkeit war die griechische Kunst und Architektur knallbunt! Die Farbe ist über die Jahrhunderte abgeblättert.
Erdverbunden oder himmelstrebend – das europäische Mittelalter
So, wie sich die Architektur der Antike am besten an ihren Säulen ablesen lässt, können wir die Architektur des europäischen Mittelalters und der frühen Neuzeit an der Form der Fensterbögen bestimmen. Bevor wir uns diesen Formen zuwenden, sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass im Zentrum der mittelalterlichen Baukunst Kirchen und Klöster, also Sakralbauten, standen. Deshalb ist es hilfreich, sich mit einigen wenigen Fachbegriffen vertraut zu machen.
Grundsätzlich wird bei den Kirchenbauten seit der Spätantike zwischen Zentralbauten und Längsbauten unterschieden. Beim Zentralbau sind die Hauptachsen gleich lang, ein beliebtes Bauprinzip in der Antike. Das Pantheon in Rom zum Beispiel ist zwar seit dem 7. Jahrhundert eine Kirche, diente aber ursprünglich als römischer Tempel. Typisch für den europäischen Kirchenbau ist hingegen die Längsform. (Eine der Ausnahmen ist dummerweise die wichtigste Kirche des katholischen Christentums: der Petersdom in Rom.) Ein solcher Bau lässt sich ganz einfach errichten: als lang gestrecktes rechteckiges Gebäude, an dessen Kopf man – für den Altar – einen halbrunden Anbau, die Apsis, ansetzt. Genau so sieht die Konstantinbasilika in Trier aus. Sie stammt allerdings aus dem 4. Jahrhundert und diente zuvor als römischer Kaiserpalast.
Sakralarchitektur hat immer eine symbolische Komponente. Deshalb lag es nahe, christliche Kirchen in Kreuzform zu erbauen. Derart stellen sich uns die Kirchen seit dem Mittelalter dar: als dreischiffiger Längsbau mit einem Querhaus. Der Längsbau ist oftmals nach Osten ausgerichtet, Jerusalem und der aufgehenden Sonne (Symbol der Auferstehung) entgegen. Hinter dem Querhaus nimmt der Chor für den Kirchengesang Aufstellung – der Raum heißt deshalb naheliegenderweise »Chor«. Ihm schließt sich die Apsis an. Natürlich gibt es zahllose Varianten, aber die Grundform lässt sich bis in die Moderne stets wiederfinden.
Die Baumeister des Mittelalters hatten leider ein Problem: Sie mussten zittern, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt! In den Wirren der Völkerwanderung war das Wissen darüber verloren gegangen, große, statisch sichere Kuppeln und Rundgewölbe zu errichten. Eine Kuppel mit einem Durchmesser von über 43 Metern, wie beim Pantheon in Rom, lag weit außerhalb der Fähigkeiten der mittelalterlichen Baumeister. Um die erste Jahrtausendwende, mit Beginn der Epoche der Romanik, eigneten sie sich dieses Wissen nur sehr langsam wieder an. Aber so ganz trauten die Baumeister ihren eigenen statischen Fähigkeiten nicht. Deshalb sind romanische Kirchen erdverbunden, wuchtig, mit dicken Mauern und kleinen Fenstern. Die Bögen über den Fenstern sind rund. Achten Sie bei mittelalterlichen Gebäuden auf die Fenster und Tore: Rundbogen heißt Romanik.
Ab etwa 1150 wurden die Architekten zunächst in Frankreich, dann in Deutschland und England wagemutiger. Vor allem erkannten sie, dass es nicht der gesamten Wand bedurfte, um das Deckengewölbe abzustützen. Es reichten einige Stützpfeiler. Zwischen ihnen konnten die Wände wesentlich dünner gebaut und größere Fenster eingesetzt werden. Jetzt, in der neuen Zeit, der Gotik, strebte der ganze Bau in die Höhe, Gott entgegen – und er wurde filigraner. Deutlich wird das erneut an den Fenstern: Sie laufen spitz nach oben zu. Spitzbögen sind das eindeutigste Stilmerkmal der Gotik. An den filigranen Verstrebungen der Rosette, einem kreisrunden Fenster an der Frontseite über dem mittleren Portal, lässt sich erkennen, wie in der Gotik die Bauten ihre Leichtigkeit zurückgewannen. Man baute nun Kathedralen und nicht mehr – wie in der Romanik – Basiliken.
Das ging – wie stets in solchen Fällen – nicht ohne Schmerzen vonstatten. Wurden die Baumeister zu übermütig, krachte das Ganze zusammen. Die Architekten stützten deshalb die Kirche von außen mit Streben, sodass mancher gotischer Dom aussieht, als habe er Spinnenbeine.
Zahlreiche Kathedralen stürzten dennoch beim Bau ein, an anderen wurde jahrhundertelang gebaut, manche wurden nie fertig. Die Türme des Kölner Doms wurden erst im 19. Jahrhundert ergänzt. Doch das Mittelalter-trunkene 19. Jahrhundert neigte ohnehin dazu, Romanik und Gotik wiederzubeleben. Es war die Zeit der sogenannten Neo-Stile. In meiner Schulzeit ging ich lange jeden Donnerstag in die katholische Sankt-Bonifatius-Pfarrkirche in Horas, die ich – nachdem ich Fotos berühmter Kathedralen gesehen hatte – für gotisch hielt. Jahre später stellte ich tief enttäuscht fest, dass sie neogotisch war – Baujahr 1885. Ein Beispiel von vielen. Zehn Jahre nach dieser Bonifatius-Kirche war die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche im neoromanischen Stil fertiggestellt worden. Deshalb Vorsicht: Nicht alles, was so aussieht, ist mittelalterlich.
Zurück zu den Wurzeln – die Renaissance
Irgendwann zu Beginn der Neuzeit ging den Baumeistern, als erstes in Italien, die Gotik auf die Nerven. Wir stoßen auf ein Phänomen, das uns ab jetzt ständig begegnen wird: die Wiederbelebung der Antike. Zunächst in der Renaissance, die sich vorwiegend an der römischen Antike orientierte. Das antike Vorbild erkennt man daran, dass Kirchen wieder als Zentralbau geplant wurden. Das schönste Beispiel stammt von Donato Bramante (1444–1514): Es handelt sich um die Kapelle Tiempetto in der Kirche San Pietro in Montorio in Rom. Auch findet man in der Renaissance die Säulenordnung der Antike wieder und an den Fassaden der Pallazi deren Schlichtheit und Ebenmaß. Beispiele glänzender profaner Renaissance-Architektur befinden sich in Florenz. Den Namen des bedeutendsten Architekten der Renaissance sollte man sich merken: Andrea Palladio (1508–1580), Sohn eines Müllers aus Padua, hat durch seine Interpretation des römisch-antiken Erbes die Architektur bis ins 20. Jahrhundert geprägt.
Wobei Palladio, wie so viele bedeutende Künstler, bereits am Übergang zu einer neuen großen Stilepoche steht. Vom Beginn des 17. Jahrhunderts an breitete sich von Rom ausgehend der Barock über den ganzen Kontinent aus. Kein anderer Stil hat sich so selbstbewusst, zuweilen brutal, alle vorangegangenen Epochen unterworfen. Die Barockkünstler nahmen keine Rücksicht: Was nicht Barock war, wurde barock gemacht. In ganz Europa lassen sich auf Barock getrimmte romanische und gotische Kirchen sowie Renaissancekirchen entdecken.
Der Barock ist die künstlerische Speerspitze der Gegenreformation. Deshalb ist er fast nur in katholischen Gegenden zu finden (eine kleine Ausnahme ist die protestantische Frauenkirche in Dresden). Die Katholiken wussten das Theatralische und Dynamische, das Überbordende und Ornamentreiche dieses Stils zu würdigen. Die nüchternen Protestanten hielten sich jedoch fern von den Putten und Muscheln, von den Säulengruppen und Arabesken. Drei Beispiele für Barockbauten in Deutschland sind der Dresdner Zwinger von Matthias Daniel Pöppelmann, der Fuldaer Dom von Johann Dientzenhofer und die Würzburger Residenz von Balthasar Neumann.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatten Menschen auch den Barock gründlich satt, zumal er sich immer mehr verkünstelte (wir nennen ihn dann Rokoko). Die Leute verlangten nach Neuem und schlugen in einigen Fällen alles Barocke wieder ab. Außerdem wurde erst in dieser Zeit der Begriff für diesen Stil erfunden – der Barock selbst wusste also noch gar nicht, dass er barock war. »Baroque« meint eigentlich »regelwidrig, absonderlich«, kurz: »schlechter Geschmack«.
Die Rückkehr der Antike II: der Klassizismus
Der Barock war für die Zeitgenossen Ausdruck des Absolutismus, eines Herrschaftsverständnisses, bei dem alles auf den König oder Fürsten konzentriert ist. »L’État, c’est moi«, »der Staat bin ich« – der Satz, obgleich ihn Ludwig XIV. von Frankreich vermutlich nie gesagt hat, fasst den Absolutismus treffend zusammen. Ende des 18. Jahrhunderts kam diese Herrschaftsform auf recht blutige Weise aus der Mode. In Preußen regierte Friedrich der Große, der sich lieber als der erste Diener seines Staates sah, und in Paris machten die Revolutionäre den bekanntesten Vertreter des Absolutismus, den König von Frankreich, einen Kopf kürzer. Für die Philosophen wurde der Verstand das Maß aller Dinge. Kein Wunder, dass man sich erneut an die alten Griechen erinnerte, bei denen das Nachdenken über die Welt und ihre naturgemäßen Gesetze ihren ersten Höhepunkt erreicht hatte. Der deutsche Baumeister Leo von Klenze (1784–1864), der die Münchner Glyptothek und die Walhalla, die deutsche Ruhmeshalle bei Regensburg, geplant und gestaltet hatte, schrieb dazu: »Es gab und gibt nur Eine Baukunst und wird nur Eine Baukunst geben, nämlich diejenige, welche in der griechischen Geschichts- und Bildungsepoche ihre Vollendung gefunden hat.« Der Stil der neuen Zeit erhielt den Namen Klassizismus.
Drei Stichworte beschreiben den klassizistischen Stil: Ruhe, Strenge, Erhabenheit. Statt Schlösser baute man nun bürgerliche Repräsentationsgebäude, etwa Theater, Museen und Universitäten. Wenn man von »Tempeln der Bildung« oder »Kulturtempeln« zu sprechen begann, so kam das nicht von ungefähr. Die Architekten bedienten sich der Elemente der antik-griechischen Sakralbauten, allen voran der Säulenordnung und des Portikus, einer von Säulen getragenen Eingangshalle.
Mindestens einen Namen sollten Sie sich in diesem Zusammenhang merken, nicht zuletzt, weil halb Berlin von ihm geprägt ist: den des deutschen Architekten Karl Friedrich Schinkel (1781–1841). Zwar hat Schinkel auch neogotische und neoromanische Gebäude errichtet, aber seine schönsten Entwürfe sind klassizistisch. Dazu gehören in Berlin die Neue Wache, das Alte Museum und das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt.
Aber nochmals Vorsicht: In Deutschland haben wir es mit der besonders verwirrenden Situation zu tun, dass man um 1900 erneut anfing, im Stile des Klassizismus (also einer Epoche, die um 1840 zu Ende gegangen war) zu bauen. Der Neoklassizismus fiel ein bisschen gröber und ein bisschen monumentaler aus als sein Vorbild (das ja selbst schon ein Neo-Stil war). Ein klassizistischer und neoklassizistischer Bau lässt sich nicht zuletzt daran erkennen, dass er immer ein wenig wirkt, als sei er aus einem Baukasten der Antike zusammengestellt – anders als die meisten Renaissancegebäude, die dem Betrachter harmonischer erscheinen.
Die Architektur der Moderne
Nach dem Klassizismus wird es ziemlich unübersichtlich in Sachen Baustile. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde noch weitgehend beherrscht vom Historismus, dessen Motto sich einfach zusammenfassen lässt: von allen Stilen irgendwas. Hier ein Renaissancetürmchen, dort ein gotisches Fenster, hier ein paar antike Säulen – und das alles möglichst groß und beeindruckend. Der Reichstag in Berlin und das Londoner Houses of Parliament sind Beispiele für diese Stilrichtung.
Für die Zeit danach aber gerät man leicht in Gefahr, die Orientierung zu verlieren. Zwischen etwa 1890 und 1930 haben wir es gleichzeitig mit dem Pariser Jugendstil, dem Wiener Sezessionsstil, den amerikanischen Wolkenkratzern, dem russischen Konstruktivismus, dem italienischen Futurismus, dem holländischen Neoplastizismus (»De Stijl«), dem deutschen Bauhaus und dem deutschen Neoklassizismus zu tun. Wir greifen aus dieser Fülle nur zwei Beispiele heraus, um die Gegensätzlichkeit der Gleichzeitigkeit zu illustrieren: den Jugendstil und das Bauhaus.
Zu Ende des 19. Jahrhunderts glaubten viele Menschen, in einer Zeitenwende zu leben. Die Erkenntnisse der Physik brachten das bisherige Weltbild ins Wanken. Die sensibelsten unter den Künstlern spürten das Herannahen des Großen Krieges. Man sprach vom »Fin de Siècle«, was wörtlich übersetzt nur »Ende des Jahrhunderts« bedeutet. Aber dem Begriff haftete ein Hauch von Abschied und Untergangsstimmung an – und das Gefühl der Dekadenz, der Überfeinerung. Der Jugendstil (in Österreich heißt er Sezessionsstil, in Frankreich Art Nouveau) drückt diese Haltung aus. Er ist Ihnen vielleicht von vielen Pariser Metrostationen bekannt: feine, geschwungene Linien, verspielte Formen, florale Motive. Kein Wunder, dass er einem Dandy wie Oscar Wilde besonders zusagte. Der Jugendstil reichte bis weit in die 1920er-Jahre hinein.
1919 gründete der bereits erwähnte Architekt Walter Gropius in Weimar das sogenannte Bauhaus, eine Werk- und Lehrstätte (sechs Jahre später musste man von dort vor der Nazi-Landesregierung in Thüringen nach Dessau fliehen). Die Prinzipien des Bauhauses sind das Gegenteil des Jugendstils: Ornamentik und alles schmückende Beiwerk waren verpönt. Es lenke von der Schönheit und Kraft der klaren Linie ab, hieß es. Der österreichische Architekt Adolf Loos, der die Grundsätze des Bauhauses vorwegnahm, schrieb 1908 gar ein Manifest mit dem Titel »Ornament und Verbrechen«. Die Form fügte sich nun der Funktion (»form follows function«) – das war das Motto nicht nur von Architekten, sondern auch von Designern, die Alltagsgegenstände gestalteten. Vielen Menschen erschien dies kalt und seelenlos. Aber die Klarheit der Architektur hat eine ganz eigene Ästhetik – und die ist keineswegs eintönig. Wer einmal die Vielfalt der Formensprache dieses Neuen Bauens kennenlernen will, sollte die Weißenhofsiedlung in Stuttgart besuchen. 1927 errichteten hier 17 führende Architekten 63 Wohnhäuser. Viele große Namen der Klassischen Moderne sind hier vertreten: Ludwig Mies van der Rohe, Peter Behrens, Le Corbusier, Hans Scharon und Walter Gropius.
Je näher wir der Gegenwart kommen, desto schwieriger wird es, einen einheitlichen Stil zu benennen. Unter den heutigen Architekten versucht jeder für sich, eine Formensprache zu entwickeln. Die folgenden Listen der je fünf wichtigsten Architekten der Gegenwart und der Vergangenheit mögen Ihnen dabei helfen, ein Gefühl für neue und alte Baumeister und ihre Werke zu bekommen. Oder Sie halten einfach die Augen offen. Schließlich ist Architektur überall.
Fünf wichtige Architekten der Gegenwart
1. Sir Norman Foster (*1935). Eine Arbeit dieses britischen Vertreters einer sogenannten Hightech-Architektur (man kann sehen, welche Technik dahintersteckt) sehen die Deutschen fast jeden Tag in den Nachrichten: die moderne Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin.
2. Daniel Libeskind (*1946). Der als Kind jüdischer Eltern im polnischen Lodz geborene US-Amerikaner versucht mit seiner Architektur, Geschichten zu erzählen. Bekanntestes Objekt in Deutschland: das Jüdische Museum in Berlin.
3. Günter Behnisch (*1922–2010). Er stützte mit seinem Büro »Behnisch & Partner« den guten Ruf Stuttgarts in der Welt der zeitgenössischen Architektur. Bekanntester Bau: das Olympiastadion in München.
4. Zaha Hadid (*1950). Die Tochter irakischer Eltern hat heute die britische Staatsbürgerschaft. Ihr vom Konstruktivismus beeinflusster Stil gilt als Architektur des 21. Jahrhunderts. Beispiel in Deutschland: das Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburg, von der »Welt am Sonntag« als »Ufo aus Beton« bezeichnet.
5. Oscar Niemeyer (*1907). Wer darf schon mal eine ganze Hauptstadt planen? Der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer durfte: Seit den 1950er-Jahren war er für die Errichtung Brasilias, der Hauptstadt Brasiliens, verantwortlich. Die öffentlichen Gebäude entwarf der Sohn deutscher Einwanderer selbst. Die Kapitale ist inzwischen Weltkulturerbe. 2,5 Millionen Menschen leben in ihr und ihren Satelliten.
Fünf wichtige Architekten der Vergangenheit
1. Anthemios von Tralles. Er lebte im 6. Jh. n. Chr. und erbaute zusammen mit Isidores von Milet (dem Älteren) auf Befehl Kaiser Justinians die Hagia Sophia, das bedeutendste Bauwerk in Byzanz und eines der wichtigsten der Welt. Seine Kuppel machte allerdings Probleme: Sie stürzte 553 und 558 ein.
2. Filippo Brunelleschi (1377–1446). Seine Kuppel hält hingegen bis heute: Brunelleschi setzte sie dem Dom zu Florenz auf – ein technisches Meisterwerk, das die Florentiner staunen ließ, und ein Triumph der Renaissance. Außerdem gilt Brunelleschi als Erfinder der Perspektivzeichnung (siehe Kapitel Malerei).
3. Gian Lorenzo Bernini (1598–1680). Früher waren die Baumeister noch Universalgenies. Bernini begegnen wir auch im Kapitel Bildhauerei mit seiner »Verzückung der Heiligen Theresa«. Als Architekt arbeitete der Meister des Barock am Petersdom mit und gestaltete den Petersplatz davor.
4. Otto Wagner (1841–1918). Der Österreicher ist ein wichtiger Vertreter des Jugendstils, dessen Wiener Variante Sezession heißt. Zu seinen Hauptwerken gehören die Österreichische Postsparkasse in Wien und die sogenannten Wienzeilenhäuser, die um die Jahrhundertwende entstanden.
5. Frank Lloyd Wright (1869–1959). Der Amerikaner entwickelte das Konzept der »organischen Architektur«, das heißt, die Gebäude sollten sich in ihre Umwelt einpassen. Sein bekanntestes Werk: das Salomon-R.-Guggenheim-Museum in New York mit seinem berühmten spiralförmigen Aufgang im Innern (der genau genommen ein Abgang ist, weil ein Aufzug die Besucher nach oben transportiert, von wo aus sie die Spirale nach unten gehen und dabei die Bilder betrachten können).
MALEREI
Am 12. September 1940 tobten Marcel, Jacques, Georges und Simon, vier Jungen aus dem Dörfchen Montignac in Aquitanien, in einem Tal zwei Kilometer südlich ihres Heimatortes im Südwesten Frankreichs herum. Plötzlich war ihr kleiner Hund Robot verschwunden. Er schien wie vom Erdboden verschluckt. Die Kinder machten sich auf die Suche nach dem Tier und entdeckten dabei eine bislang unbekannte Höhle, die 140 Meter in das Innere eines Berges führte. Als sie in die Höhle krochen, entdeckten sie dort Hunderte von Wandzeichnungen: Bisons, Stiere, Hirsche, Bullen, Jäger mit Pfeil und Bogen in kräftigen Farben und kunstvollem Schwung. (Den kleinen Robot fanden sie übrigens auch wieder!)
Die herbeigerufenen Experten bestaunten in der Höhle von Lascaux mit offenen Mündern die insgesamt rund 2000 Figuren und Zeichen. Sie sind 15000 bis 17000 Jahre alt und damit noch immer nur etwa halb so alt wie die ältesten uns bekannten Höhlenzeichnungen.
Die steinzeitlichen Maler haben keineswegs unbeholfene Kritzeleien angefertigt. Sie waren keine tumben, Keulen schwingenden, fellbehangenen Jäger. Diese Menschen zeichneten beim Schein von Steinlämpchen mit den Fingern, mit Halmen oder Ästchen großartige Kunstwerke. Sie mischten die Farbe aus zermalmtem Stein (Eisenoxid), Manganerde und Tierfett. Der französische Schriftsteller Georges Batailles bezeichnete die Höhlenbilder von Lascaux einst als die »Geburt der Kunst«. Besonders den Tierbildern merkt man ihre Kraft und Wildheit an. Zum Beispiel einem Stier, der im Moment des Sprungs festgehalten wird: Seine Vorderbeine sind nach vorn gestreckt, die Hinterläufe drücken sich kraftvoll vom Boden ab. Sein ganzer Körper symbolisiert Spannung und Bewegung.
Wir wissen nicht, wozu diese Bilder den Menschen in der Steinzeit dienten. Erfüllten sie religiöse Zwecke, etwa um das Jagdglück zu beschwören? Oder waren sie bereits Ausdruck eines Sinnes für Schönheit an sich? Möglicherweise beides. Ebenso wie die Malerei in Europa vom Frühmittelalter bis zur Renaissance im 14. Jahrhundert nur als Verherrlichung Gottes denkbar war, aber gerade deshalb zugleich das Empfinden für Schönheit ansprechen sollte. Denn nur mit dem Schönsten konnte man Gott gebührend preisen.
In diesem Kapitel schildern wir die Geschichte der Malerei anhand von dreizehn Gemälden. Wir müssen dabei naturgemäß ungerecht sein, wollen wir den vorgegebenen Rahmen nicht sprengen. Also lassen wir gleich zu Beginn fast 30000 Jahre Kunstgeschichte unter den Tisch fallen.
Auf die Höhlenmaler folgten nämlich die frühen Hochkulturen. Von den Ägyptern kennen wir malerische Zeugnisse, die sich in ihren Gräbern erhalten haben. Viele sind es zwar nicht. Aber sie haben eine signifikante Anmutung, sodass man sie sofort wiedererkennt, sobald man einmal ägyptische Wandbilder gesehen hat. Vielleicht erinnern Sie sich an den Song »Walk Like an Egyptian« (»Gehen wie ein Ägypter«) von The Bangels, der 1986 ein Nummer-1-Hit war. In ihrem Video tanzte die Popgruppe dazu in einer seltsam verdrehten Körper- und Armhaltung, was einen solchen Boom auslöste, dass sich Mitte der 80er-Jahre Millionen von Menschen mit dem »Egyptian-Walk« auf den Tanzflächen der Diskotheken lächerlich machten. Dieser Bewegungsstil spielte auf die Perspektive an, in der die Ägypter auf den Grabwänden Menschen abbildeten. Sie zeichneten die Beine und Füße in der Seitenansicht, den Oberkörper in der Frontalsicht, den Kopf wieder im Profil. Anatomisch ist diese Haltung unmöglich. Auf diese Art kann kein Mensch stehen oder gehen, außer vielleicht einige Schlangenmenschen im Zirkus. Das dürfte auch den Künstlern klar gewesen sein. Offenbar legten sie aber wenig Wert auf Realismus. Die Darstellung diente allein der Dekoration und illustrierte den Rang, den der Verstorbene zu Lebzeiten eingenommen hatte. Sie war also so etwas wie eine Deko-Tapete des Grabmals. Und darauf sollte man von allen Körperteilen nur die Schokoladenseite sehen.
Noch seltener sind die Gemälde der alten Griechen und Römer erhalten. Von den Griechen kennen wir am ehesten die bemalten Vasen mit ihren oft freizügigen Motiven. Andere Werke der Malkunst sind weitgehend zerstört. So weiß zum Beispiel niemand, wie die Weintrauben des berühmten Malers Zeuxis aussahen. Vermutlich ziemlich realistisch, denn eine antike Anekdote, überliefert durch den Geschichtsschreiber Plinius, erzählt, dass Vögel versucht hätten, sie aufzupicken. Von den Römern sind uns die – teilweise pornografischen – Fresken von Pompeji bekannt, die beim Vulkanausbruch des Vesuvs zusammen mit den dort lebenden Menschen unter Asche und Lava verschüttet wurden.
Mit dem Untergang des Weströmischen Reiches im Jahre 476 fiel die Kunst in Europa in einen tiefen Schlaf. Dies hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass sich die Führer der nun einflussreichen christlichen Kirche nicht einig waren, ob Malerei überhaupt zulässig sei. Verbot nicht die Bibel im 2. und 5. Buch Mose des Alten Testaments, sich ein Bildnis zu machen von allem, was im Himmel, auf Erden und im Wasser ist? In der westlichen Kirche entschied man sich nach einigem Hin und Her dafür, Bildnisse trotzdem zu erlauben. Sie konnten schließlich dazu dienen, den Ungebildeten und Analphabeten die Geschichten der Bibel vor Augen zu führen, also eine Art mittelalterlicher Comic-Strip sein. In Byzanz, wo die Ostkirche ihren Sitz hatte, kam es hingegen mehrfach zu Bilderverboten, die mit der Zerstörung zahlreicher Kunstwerke endeten. Wie ein solches Verbot die Kunst um Jahrzehnte zurückwerfen und ihre Entwicklung behindern kann, sollten die Europäer während der Reformation im 16. Jahrhundert zu spüren bekommen. Damals setzten unter anderen die Anhänger des schweizerischen Reformators Johannes Calvin zum Bildersturm an, zertrümmerten Statuen, zerschlugen Kirchenfenster und verbrannten Bilder. Calvinistische Kirchen erkennt man noch heute an ihrer fast völligen Schmucklosigkeit.
Vorerst aber blieb es in Westeuropa erlaubt, Heilige, die Muttergottes und vor allen Dingen den Erlöser selbst abzubilden. Ein anderes Bildmotiv als die Heilsgeschichte konnte man sich im Mittelalter ohnehin nicht vorstellen.
Das Problem: Es gab nicht allzu viele Orte, an denen im Frühmittelalter die Kunstfertigkeit gepflegt wurde. Die Menschen waren mit anderen Dingen beschäftigt, zunächst mit Völkerwandern, dann mit Ernten, Säen, Beten, mit Kathedralenbauen und Kriegeführen. Die Einzigen, die Zeit und Muße hatten, sich der Kunst der Malerei zu widmen, waren die Mönche in den Klöstern.
Sie mussten sich allerdings in erster Linie in den Skriptorien darum kümmern, Bücher abzuschreiben. Bei dieser Gelegenheit malten sie ihre Bilder gleich in die Handschriften hinein. So entstanden wunderbar verschnörkelte Anfangsbuchstaben, sogenannte Initiale, und Miniaturen von Heiligen, Engeln, Christus und der Heiligen Familie. Wer einen kunstgeschichtlichen Bildband aufschlägt, wird dort bis zum Ende des 13. Jahrhunderts mit der Ausnahme byzantinischer Ikonen hauptsächlich solche Buchmalereien entdecken. Danach aber gewinnt die Geschichte der Malerei urplötzlich an Dynamik. In den folgenden rund 250 Jahren passierte so viel mehr Aufregendes als in den 1000 Jahren davor. Eine solche stürmische Entwicklung ist übrigens ein besonderes Merkmal der europäischen Kunst. In der traditionellen chinesischen Kunst zum Beispiel geht es nicht darum, dass der Künstler etwas Neues schafft, sondern um ein möglichst genaues Abbild der Vorlage eines berühmten Meisters.