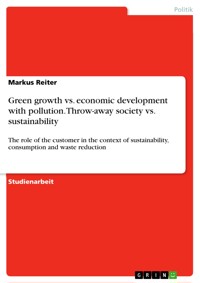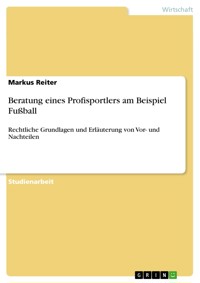Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von den Hochbegabten in der Grundschule bis zu den Exzellenzclustern an den Universitäten: Ständig ist von Elite die Rede, die es zu fördern gelte, um Deutschlands Platz an der Weltspitze zu sichern. Wer so laut nach den Besten ruft, übersieht, dass keine Gesellschaft allein von ihren Eliten lebt."Mittelmaß heißt nicht Stillstand, heißt nicht, sich treiben zu lassen. Auch das Mittelmaß bedarf steter Anstrengungen und eines gewissen Eifers. Es heißt aber sehr wohl, die Beschränktheit menschlicher Möglichkeiten zu erkennen - und anzuerkennen. Das Mittelmaß ist somit das menschengerechteste Maß." Markus Reiter
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Reiter
Lob des Mittelmaßes
Warum wir nicht alle Elite sein müssen
ClimatePartner
Dieses Buch wurde klimaneutral hergestellt. CO2-Emissionen vermeiden, reduzieren, kompensieren – nach diesem Grundsatz handelt der oekom verlag. Unvermeidbare Emissionen kompensiert der Verlag durch Investitionen in ein Gold-Standard-Projekt. Mehr Informationen finden Sie unter www.oekom.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2011 oekom verlag, München
Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH
Waltherstraße 29, 80337 München
Umschlaggestaltung + Umschlagillustration: Torge Stoffers, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten.
eISBN: 978-3-86581-372-5
Inhalt
Warum wir das Mittelmaß wertschätzen sollten
Eine kleine Philosophie des Mittelmaßes
Warum Mittelmaß nicht Mittelmäßigkeit bedeutet
Wie viel Elite braucht eine Gesellschaft?
Warum Politik ohne Mittelmaß scheitern muss
Schneller, höher, weiter? Mittelmaß und Sport
Mittelmaß, Ökologie und Ökonomie – das Geheimnis der Nachhaltigkeit
Mittelmaß – eine Verteidigung
Literatur
Warum wir das Mittelmaß wertschätzen sollten
Neun von zehn deutschen Führerscheinbesitzern sind laut Umfragen davon überzeugt, überdurchschnittlich gute Autofahrer zu sein. Diese Selbsteinschätzung kann – ungeachtet der individuellen Fahrkünste – schon aus rein ma thematischen Gründen nicht den Tatsachen entsprechen. Denn sonst müssten sich die restlichen zehn Pro zent als so abgrundtief schlechte Fahrer erweisen, dass sie es ohne Unfall kaum mehr als ein paar Meter aus der Garage schaffen würden. Insgesamt wäre es der Verkehrssicherheit am zuträglichsten, wenn unsere Straßen nicht von lauter Genies am Steuer bevölkert wären, sondern von überwiegend soliden, wenngleich mittelmäßigen Autofahrern: Wagenlenker, die um die Beschränktheit ihrer Fähigkeiten wissen, verhalten sich in der Regel umsichti ger als solche, die sich ohne Weiteres ein Autorennen auf dem Nürburgring zutrauen würden. Kurzum: Mit dem Mittelmaß wären wir alle auf der sicheren Seite.
Warum bezeichnet sich dennoch kaum jemand selbst als mittelmäßigen Autofahrer? Dies könnte neurobiologische Ursachen haben. Das menschliche Gehirn, so mutmaßt die britische Hirnforscherin Cordelia Fine in ihrem Buch A Mind of Its Own, setzt auf unsere Eitelkeit. Es mag weder sich selbst noch anderen eingestehen: »Ich bin nur mittelmäßig«. Stattdessen bediene sich das Gehirn eines Tricks, vor allem die für Emotionen und emotionale Bewertungen zuständigen Teile. Es sucht sich aus unseren fahrerischen Fähigkeiten jene aus, die wir tatsächlich gut beherrschen, zum Beispiel rückwärts einzuparken oder rasant zu überholen. Genau diese wird dann als Messlatte für erstklassige Fahrleistungen definiert, während das, worin wir weniger geschickt sind, nebensächlich erscheint. Und siehe da: In irgendetwas sind wir hinter dem Steuer immer gut. So kann jeder von uns in der Illusion leben, ein überdurchschnittlich guter Fahrer zu sein.
Das Muster erscheint vertraut. So war mein Chemielehrer etwa davon überzeugt, dass die genaue Kenntnis des Gärungsprozesses von Bier unabdingbarer Bestandteil der Allgemeinbildung sei. Da er sich mit diesem chemischen Vorgang gut auskannte, hielt er große Stücke auf seine herausragende Allgemeinbildung. Mein Deutschlehrer hingegen bestand darauf, allgemeingebildet könne nur genannt werden, wer wisse, wer den Gebrüdern Grimm die Märchen für ihre Sammlung erzählt hat – ein Wissen, über das er selbstredend verfügte.
Die Schule ist auch der Ort, an dem uns schon früh eine gewisse Missachtung des Mittelmaßes mit auf den Weg gegeben wird. Wer ein Zeugnis mit lauter Dreiern nach Hause bringt, erntet dafür selten Lob und Anerkennung, obgleich er durchweg befriedigende Leistungen erbracht hat. Wer dagegen mit einer Reihe von Einsen aufwarten kann, dem verzeiht man auch den einen oder anderen Ausreißer nach unten in anderen Fächern.
Das Mittelmaß hat es schwer. Ihm wird – nicht nur beim Autofahren und in der Schule – Verachtung und Spott zuteil. Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier lässt in seinem Roman Abendland dessen Protagonisten, den Mathematikprofessor Carl Jakob Candoris, resümieren: »Das Genie reißt eine Vermutung auf! Und anschließend kommen die Ameisen. Mittelmaß ist nicht einfach nur ein bisschen weniger, es ist gar nichts – in der Mathematik nichts, in der Musik nichts, in allen Künsten nichts.« Dieser Professor Candoris huldigt einem Geniekult, der dem 19. Jahrhundert entstammt.
Johann Wolfgang Goethe, der sich selbst im Ruhm sonnte, als größtes Genie seiner Epoche zu gelten, klagte in den Xenien, die er gemeinsam mit dem nicht minder genialen Friedrich Schiller verfasste: »Mittelmäßigkeit ist von allen Gegnern der schlimmste. Deine Verirrung, Genie, schreibt sie als Tugend sich an.«
Die Vertreter des Sturm und Drang betrachteten das Mittelmaß als Ausdruck von Spießigkeit und Philistertum. Dem Genie hingegen gestanden sie zu, bürgerliche Grenzen überschreiten zu dürfen. Anders in der Antike, im europäischen Mittelalter sowie in vielen asiatischen Religionen und Denkschulen. Sie wussten das Mittelmaß zu schätzen – ja, sie hielten es sogar für erstrebenswert. Es verlangte nämlich von den Menschen die Zügelung ihrer Leidenschaften, die Mäßigung also. Der römische Dichter Horaz zum Beispiel sprach in Anlehnung an die Ethik des Aristoteles von der »goldenen Mitte«, der aureas mediocritas.
Das fortschrittstrunkene 19. Jahrhundert konnte mit der Mäßigung – dem Versuch, die Leidenschaften zu bändigen und ihnen ein Maß zu geben – nicht viel anfangen. Friedrich Nietzsche hat die Vorstellung eines über das Mittelmaß hinausragenden Übermenschen sogar zu einem biologistischen Weltbild verdichtet, das einem selbst dann unheimlich vorkommt, wenn man ihm sein Nachhallen in der nationalsozialistischen Rassenideologie nicht vorwirft.
Ein Nachklang der Genieverehrung des Sturm und Drang findet sich in Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit, einer Sammlung historischer Miniaturen aus dem Jahr 1927. Eine der historischen Skizzen darin heißt Genie einer Nacht und erzählt, wie der junge Gardehauptmann Claude Joseph Rouget de Lisle in übernächtigtem Zustand und in einem Anfall von Geistesgröße in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1792 die spätere französische Nationalhymne, die Marseillaise, zu Papier bringt. »Der Genius der Stunde«, schreibt Zweig, habe »für diese einzige Nacht Hausung genommen in seinem sterblichen Leib«. Der Dichter gesteht einem mittelmäßigen Komponisten also nicht zu, ein gelungenes Gesellenstück abliefern zu können – ein flüchtiges Genie muss sich des Hauptmanns bemächtigen und nach vollbrachter Tat sogleich entschwinden.
Das Verschwinden des Genies
Solche Vorstellungen von Genie sind uns heute fremd geworden. Wer Menschen auf der Straße nach einem Genie fragt, wird Namen aus vergangenen Jahrhunderten hören, zum Beispiel Leonardo da Vinci, Goethe, Albert Einstein oder Ähnliche. Das auf ökonomischen Erfolg fo kus sierte ausgehende 20. und das beginnende 21. Jahrhundert haben Abschied vom Geniekult genommen. In der Wissenschaft, in der sich globalisierte Netzwerke aus Forscherteams durch kleinteilige, hoch spezialisierte Aufgaben pflügen, begegnet man ihm kaum noch; selbst in der Kunst ist er selten geworden, wo wir einem Maler oder Autor zwar des Öfteren Brillanz zugestehen, aber kaum Genie. Lediglich kultisch verehrten Firmengründern wie Steve Jobs von Apple wird hin und wieder noch Genialisches zugesprochen. Doch selbst hier wagen es die meisten nur mit ironischem Unterton. »Steve Jobs ist ein Genie. Ein absolutes Genie«, schreibt etwa der Journalist David Derbyshire in einem Blog für die englische Tageszeitung The Telegraph und fährt ironisierend fort: »Nicht weil er der Welt das iPod, iTunes und den iMac gebracht hat, sondern wegen seiner erstaunlichen Fähigkeit, in Menschen das Verlangen nach Dingen auszulösen, die sie gar nicht benötigen.« Platz für ein echtes, ernst genommenes Genie hat unsere heutige Welt nicht.
An die Stelle des Geniegedankens ist die Idee von einer Elite getreten. Was zugleich bedeutet, dass es nicht mehr um den Einzelnen geht, sondern um ein Kollektiv. Anders als das Genie stehen die Angehörigen der Elite zudem nicht mehr außerhalb des Maßstabs der bürgerlichen Gesellschaft, sie stehen an ihrer Spitze oder – um es pointierter zu formulieren – sie sind der Maßstab der bürgerlichen Gesellschaft.
In einem wichtigen Punkt unterscheiden sich Genies und Elite: Einem Genie nachzueifern oder sich gar ins Zeug zu legen, um eines zu werden, wäre Unsinn, zumal wenn einem die dazu notwendige Genialität fehlt. Zum Genie wird man geboren und beginnt seine entsprechende Karriere am besten als »Wunderkind«. Anders der Aufstieg in die Elite: In Zeiten, in denen auch die Gesellschaft sich demokratisch legitimieren muss, werden Eliten – anders als das von der Natur verliehene Genie – meritokratisch definiert. Das bedeutet, Verdienst, Leistung und eigene Anstrengung, nicht Geburt, Genetik oder Privileg erlauben den Zugang zum Kreis der Elite. So jedenfalls will es der Mythos, der gerade von den Eliten selbst gepflegt wird. Der Darmstädter Soziologe Michael Hartmann hat diese Selbstsicht in empirischen Studien als Täuschung entlarvt. Wirkmächtig ist das meritokratische Verständnis von Elite dennoch, denn es bestimmt in weiten Teilen die politische und gesellschaftliche Debatte, etwa wenn es um die Integration von Migranten geht.
Nachdem der Begriff der Elite in den 1960er- und 1970er-Jahren durch die gesellschaftlichen Umbrüche als diskreditiert galt, ist er heute wieder allgemein akzeptiert. Zwar behaupten einige Konservative noch immer, die »Elitenfeindlichkeit« halte an, doch dabei handelt es sich um den Nachhall einer längst entschiedenen Debatte. Nahezu 60 Prozent der Deutschen geben in Umfragen an, dass die Bundesrepublik einer Elite in Politik, Wirtschaft und Kultur bedürfe. Es mag ja sein, dass die herrschenden Eliten nicht zuletzt in der Finanzkrise und dem daraus folgenden Debakel an Ansehen verloren haben. Aber selbst dann dreht sich die Diskussion höchstens um ihre Selbstreinigung, manchmal – bei den ganz Radikalen – um einen Austausch. Ihre völlige Verzichtbarkeit postulieren nur wenige Unentwegte.
Warum die Elitendebatte eine Ressourcendebatte ist
Darüber ist zunächst einmal gar nicht zu klagen. Es sprechen durchaus gute, noch zu erläuternde Gründe dafür, dass die Gesellschaft eine Elite benötigt. Eine