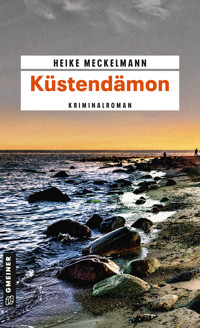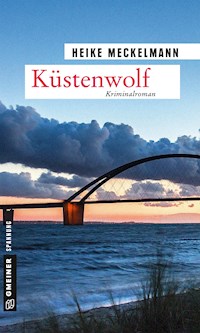Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Westermann und Hartwig
- Sprache: Deutsch
Die ruhige See täuscht. Als vor Fehmarn ein Boot im Belt explodiert, offenbart sich schnell: Das war kein Unfall, sondern Mord. Doch wer hatte es auf den Schiffseigner abgesehen und warum? Hat die Tat etwas mit dem Bau des Fehmarnbelttunnels zu tun? Seit Jahren stehen sich Gegner und Befürworter des Projekts unversöhnlich gegenüber. Als eine weitere Explosion die Insel erschüttert und Bewohner und Gäste in Panik versetzt, fordern die Kommissare Westermann und Hartwig Unterstützung beim LKA Kiel an. Die gemeinsame Jagd auf ein Phantom beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike Meckelmann
Küstengruft
Kriminalroman
Zum Buch
Tödliche Welle Die Kommissare Westermann und Hartwig werden zu einem Bootsunfall gerufen. Ein Fischkutter ist vor der Insel im Belt explodiert. Schnell offenbart sich: Das war kein Unfall, sondern ein Mordanschlag. Doch wer hatte es auf den Schiffseigner abgesehen und warum? Hat die Tat etwas mit dem Bau des Fehmarnbelttunnels zu tun? Seit Jahren stehen sich Gegner und Befürworter des Großprojekts unversöhnlich gegenüber. Während die einen den Bau für zukunftsorientiertes Handeln halten, fürchten die anderen tiefgreifende Folgen für die Natur, Tier, -und Pflanzenwelt. Als eine zweite Detonation die Insel erschüttert, geraten die Insulaner und Besucher in Panik. Der Täter droht mit weiteren Anschlägen. Westermann und Hartwig, mit den Geschehnissen überfordert, bitten das LKA Kiel um Unterstützung. Die gemeinsame Jagd auf ein Phantom beginnt.
Heike Meckelmann wurde in der Nähe von Elmshorn geboren und zog vor mehr als 30 Jahren auf die Insel Fehmarn. Sie betrieb nach dem Studium der Betriebswirtschaft auf der Insel lange Zeit einen Friseursalon und eine Hochzeitsagentur. Viele Jahre arbeitete sie als Fotografin und nahm als Sängerin ein eigenes maritimes Album auf, bevor sie mit ihrer Familie eine Pension auf der Insel übernahm, die sie jetzt aufgaben, damit sich Heike Meckelmann nur noch dem Schreiben widmen kann. Seit 2016 arbeitet sie als freie Autorin auf Fehmarn und schreibt Kriminalromane, die überwiegend auf der Insel spielen, sowie Reiseliteratur. Über 20 Jahre mit einem Fehmaraner verheiratet, bezeichnet sie sich durch und durch als Insulanerin, die ihre Insel genauso liebt wie die Geschichten, die sie auf der Sonneninsel schreibt.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Heike Meckelmann und Denny Franzkowiak / Pixabay
Motiv im Innenteil: © Gerd Kirsch
ISBN 978-3-8392-7636-5
Vorwort
Die Fehmarnbeltquerung, das längste Tunnelbauwerk dieser Art weltweit, bei der es sich nach heutigem Kenntnisstand um einen 18 Kilometer langen Absenktunnel in der Ostsee handelt, der von Puttgarden auf Fehmarn bis nach Rødby in Dänemark führen wird, erhitzt die Gemüter.
Der Tunnel verkürzt nach Aussagen der Beltbefürworter Europas Wirtschaftswege und südlicher gelegene Länder mit Skandinavien und bringt deren Interessen näher zusammen. Führender Motor dieser gigantischen Beltquerung ist die dänische Regierung, die den Bau forciert und die Arbeiten aufgenommen hatte, bevor von deutscher Seite aus die Gesetzmäßigkeiten vorlagen.
Die Befürworter sprechen von einer Vision, einer durchgehenden Verkehrsverbindung vom Mittelmeer bis nach Finnland. Sie sprechen von einem maßgeblichen EU-Vorhaben, welches zur weiteren Entwicklung des Binnenmarktes und zur Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in Europa immens wichtig wäre.
Der Belttunnel würde laut Befürwortern durch Wiederaufnahme des 1998 eingestellten Schienengüterverkehrs auf der Vogelfluglinie Einsparung von 160 Kilometern und Chancen für eine Stärkung des europäischen Klimaschutzes bieten. Sie sprechen von der Klimaschutzwirksamkeit, die eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene mit sich bringen würde, und sinkenden Energiekosten.
Die Natur würde nur wenig beeinträchtigt, im Gegenteil. Neue Schutzräume durch abgesenkte Tunnelbauteile könnten entstehen. Pflanzen und Tiere hätten neuen geschützten Raum, in dem sie sich wieder entwickeln würden. Dies sind einige der Vorteile, die eine Beltquerung in der angeführten Größenordnung mit sich führe. Befürworter und Gegner schenken sich in der Debatte um die Querung nichts und jede der Parteien kämpft seit Anbeginn lautstark um ihre Rechte.
Zu den Gegnern des Tunnelbauprojektes, das bereits seit Jahrzehnten Thema politischer Interessen war und ist, gehören Bewohner der Insel Fehmarn, Beltretter, Naturschützer und Aktivisten umliegender Küstengebiete im gesamten Ostseeraum. Deren fundierte Argumente wurden immer wieder verworfen oder mit fadenscheinigen Argumenten, so scheint es, unter den Teppich gekehrt.
Die Gegner demonstrieren eine andere Seite der Querung, die kaum jemandem bewusst ist: Was hat es tatsächlich mit der Umwelt und seinen daraus resultierenden Folgen auf sich? Sterben von Flora und Fauna hätten fatale Auswirkungen, die in ihren Dimensionen nicht berechenbar wären. Die Aufschüttung der Sedimente, um die Tunnelelemente im Meeresboden zu versenken, verändern das Bild über Jahrzehnte. Über sehr lange Zeit würden die Insel und die gesamte Küstenregion mit den Folgen zu kämpfen haben. Der Fisch verschwindet bereits aus der Ostsee, aber wird er sich von den Folgen des Tunnelbaus überhaupt noch mal erholen können?
Was mit der Zukunft der Insel, ebenso der gesamten Küstenregion und des Landes passiert, kann niemand vorhersehen. Wird die Insel zum Brückenpfeiler nach Skandinavien? Was ist mit den Naturkatastrophen, die dieser Bau unweigerlich in Gang setzt, und was mit den Kosten, die dieser Bau verursachen wird? Argumente und zahlreiche Hinweise von Tunnelgegnern wurden bisher außer Acht gelassen, ignoriert und zum Teil wissentlich ignoriert.
Die ausführende Politik der am meisten betroffenen Insel Fehmarn scheint machtlos gegen strategische Ambitionen um das kolossale Werk und zog sich aus ihrer Gegenwehr zurück. Der Bürgermeister der Insel resignierte und begab sich mitsamt seiner Inselgemeinde in die Hände zukunftsorientierter Machtbündnisse, wenngleich die immer größer werdende Gruppe Menschen sich diesen Gesetzmäßigkeiten nicht unterordnet. »Man sollte das Beste daraus ziehen und sich abfinden.« Ist es so? Sämtliche eingereichte Klagen wurden mit einem Handstreich fortgewischt und abgelehnt. Die Beltretter kämpfen, demonstrieren und lehnen sich gegen ein Bauwerk auf, dessen Sinnhaftigkeit für Bevölkerung und Umwelt nicht gegeben ist.
Wie verhält es sich mit der Erweiterung der Autobahn von Hamburg nach Fehmarn, die quer über die Insel bis hin nach Puttgarden verlaufen wird? Zusätzliche Lärmbelästigungen, die die Urlaubsregion belasten, und deren Kosten sind nicht absehbar. Genau wie die Schienenanbindung, deren Trasse entlang der gesamten Küstenlinie von Puttgarden bis Travemünde verläuft. Sie sprechen derzeit von 40 bis 80 Güterzügen pro Tag! Auch deren Lärmbelästigungen sowie Kosten sind nicht im Geringsten einzuschätzen. Dies alles bewegt sich um den Belttunnel. Doch damit ist es nicht getan! Selbst wenn Dänemark das Gros an Aufwendungen der Querung übernimmt, bleiben dennoch genügend Schulden auf unserer Seite abzuarbeiten.
Die Anbindung der Sundquerung, die sich mit einem ebenfalls neu erbauten Tunnel auf bisher geschätzte drei Milliarden Euro beziffert, birgt große Bedenken und gleicht einem Fass ohne Boden, das am Ende der deutsche Steuerzahler, das heißt, wir alle zahlen müssen! Ein Ende der Kontroversen scheint nicht in Sicht. Die Aushebungen werden auch hier für Jahre die Natur zerstören.
Dieses sind nur einige Aspekte im politisch gewobenen Netz der Beltquerung. In heutiger Zeit, wo fast jeder von Umweltschutz, CO2 und Erwärmung des Weltklimas und Kostenexplosion redet, stellt sich die Frage, ob ein derartiges Projekt in diese Zeit passt.
Welche Ansichten sind richtig, welche falsch? Wird Fehmarn zum Brückenpfeiler perfider Machtspiele und politischer, wirtschaftlicher Interessen? Verliert die Insel am Ende ihren Status als Ferieninsel?
Nach unzähligen ergebnislosen Anstrengungen haben Gegner dieses Mammutprojektes bisher keinen Erfolg verbuchen können, und alle Möglichkeiten scheinen ausgeschöpft. Ein Kampf David gegen Goliath zermürbt über Jahre die große Gemeinde der Beltretter.
Als schenkte ihnen jemand einen letzten Rettungsanker, entdeckten Naturschützer kurz vor Start des Tunnelbauprojektes unentdeckte Riffe, die sämtliche Vorhaben kippen könnten. Die Beltgegner hofften, damit das Projekt doch noch stoppen zu können. Der Kampf zweier ungleicher Parteien, einer riesigen Maschinerie der Macht, schien aussichtslos, bis ein Tag im Dezember alles veränderte.
Leises, ächzendes Stöhnen jaulte durch den zugigen Raum. Es schien direkt aus den Tiefen der Hölle emporzusteigen. Die Klänge unterstrichen den modrigen Geruch, der durch das Gewölbe waberte. Als er die Augen schloss, die Arme hob, um die berauschende Musik in seinem Kopf zu dirigieren, wusste er, dass er nicht mehr aufzuhalten war.
Kapitel 1
Samstag
Felix stand in klirrender Kälte bis zu den Hüften in der eiskalten Ostsee. Die klare Sicht ließ den Angler die Windkrafträder im Windpark Rødby, selbst auf die Entfernung von fast 20 Kilometern, erkennen. Der 42-jährige, hochgewachsene Petrijünger stand wie ein Fels in der Brandung und sog den scharfen Ostwind tief in seine Lungen. Der Angler blinzelte, um den glitzernden Reflexionen der Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche auszuweichen. Er gähnte und nahm in der Ferne Richtung Dänemark einen weißen Kutter wahr, der, etwa eine halbe Seemeile entfernt, seine Kreise durchs Wasser zog. Felix Kroll wunderte sich zwar über die eigensinnige Fahrweise des Kutters, behielt aber gelassen seine Rute im Auge. Es war eine günstige Zeit, um eine der begehrten Forellen zu fangen. Bei der Kälte schwammen die Fische näher im küstennahen Gewässer, das wusste der Sportangler aufgrund seiner Erfahrungen. Seine Beharrlichkeit könnte sich heute auszahlen. Dennoch warf er zwischendurch immer wieder einen Blick auf das kreisende Boot. Seit über einer Stunde verharrte der dunkelhaarige Mann mit dem ebenso dunklen Vollbart, der an Rübezahl erinnerte, mittlerweile in der zwei Grad kalten Ostsee. Langsam registrierte er die Minusgrade, die durch seine Wathose drangen. Es war gleich 11 Uhr. Felix gähnte erneut und warf einen kurzen Blick zur linken Seite. Edda kam von ihrem Spazierweg zurück. Wenn er vom Strand aus angelte, begleitete seine zierliche Frau ihn ab und zu und suchte im Sand nach Steinen. Ihn amüsierte ihre Sammelleidenschaft. Das ganze Haus war mittlerweile voll von kleinformatigen Donnerkeilen, Hühnergöttern, Ostseejaden, Feuersteinen und kleinen Bernsteinkrümeln. Er ließ ihr freien Lauf bei ihren Ausflügen und warf beruhigt seine Angel aus. Edda hob den Blick, als sie ihn erreichte.
»Hast du gesehen, dass das Boot da draußen nur im Kreis fährt?«, fragte sie und deutete auf das Fischerboot. Sie schob ihre Strickmütze zurück und starrte ihren Mann fragend an.
»Das ist ein Kutter, und der wird seine Netze einholen«, rief er schroffer als beabsichtigt. Er durfte die Forellen nicht verscheuchen und presste augenblicklich die Lippen zusammen. Edda sah ihn mit Enttäuschung im Blick an und empfand durch seine brüske Art, er sei ihr über den Mund gefahren. Beleidigt zog sie Felix’ Rucksack, der vor ihr im Sand stand, zu sich und öffnete ihn mit zittrigen Fingern. Ihre Wangen und die Nasenspitze waren von der Kälte rot gefroren, ihre Hände dagegen vom Steinesuchen ohne Handschuhe blau und steif. Sie pustete warme Luft in ihre Handflächen, zog das Fernglas ihres Mannes aus dem Rucksack und stellte sich aufrecht hin.
»Und es fährt doch im Kreis«, murrte sie, kniff die katzengrün leuchtenden Augen zusammen und lugte durch die Gläser. Felix vernahm ihre Worte, schwieg und schüttelte den Blinker vom Kraut frei. Mit einer Hand kratzte er sich den Schädel unter seiner dunkelblauen Dockermütze und brummte leise vor sich hin.
»Ja, ich geb dir recht. Ich finde es auch merkwürdig. Ich beobachte den Kahn schon eine ganze Weile«, versuchte er, die Wogen zu glätten, und rückte die Mütze zurecht. Seine Haut war von der Kälte gerötet und spannte. Er gähnte. Sein Hundeblick durchdrang sie für einen Moment. Er wollte seine Frau nicht zur Weißglut bringen, spulte die Sehne zurück auf die Rolle, kontrollierte den Blinker und warf die Angel erneut aus. Kein Wind störte seine Leidenschaft. Die Ostsee lag wie ein Spiegel vor ihm und entlockte ihm ein Seufzen. Der algengesättigte Geruch in der Luft zog in seine Nase, und er schloss für einen Moment die Augen. Felix und Edda liebten den Nordstrand kurz vor der Grenze Richtung Dänemark, den weitreichenden Blick auf den Hafen und die ein- und ausfahrenden Fährschiffe. Er schnaufte und sah einer hereinfahrenden Fähre nach, die in diesem Moment die Hafeneinfahrt passierte. Da passt kaum eine Hand dazwischen, stellte er fest. Wenn man am Ende der Mole steht, kann man die Fähren fast berühren, so nah sind sie, dachte er und erinnerte sich daran, dass es in der schmalen Einfahrt vor einigen Jahren tatsächlich zu einer Kollision am östlichen Molenkopf gekommen war. Eine dänische Fähre rammte aufgrund eines Defektes an der Ruderanlage die Mole. Er stand damals wie jetzt im Wasser und angelte, als er dieses ohrenbetäubende metallische Geräusch wahrgenommen hatte, das ihm immer noch eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Er schüttelte den Kopf und sah die Fähre ins Hafenbecken einfahren. Was passiert, wenn die Flotte der weißen Schiffe eines Tages aus dem Bild der Insel verschwinden würde? Nicht auszudenken, überlegte er, schüttelte erneut den Kopf und schleuderte ein weiteres Mal den Blinker weit auf die Ostsee hinaus. Mit Bedenken hatte er in den letzten Jahren im abonnierten Tageblatt von der Entwicklung seiner Lieblingsinsel gelesen. Er sprach sich ohne Frage gegen einen Tunnel aus, wollte nicht, dass sich irgendetwas auf ihrer Trauminsel veränderte. Es war doch alles bestens, wie es war! Was würde aus der Idylle werden? Wenn Leute ihm dann damit kamen, dass schließlich auch die Brücke gebaut wurde und dagegen viele Insulaner gewettert hatten, stimmte ihn dies wütend. Für ihn waren es völlig andere Zeiten und andere Gründe. Was jetzt hier passierte, würde alles verändern! Was sie hier mit der Natur anrichteten, würde sich nur schwer reparieren lassen. Was passierte mit den Fischen, die jetzt schon kaum noch vorhanden waren, was mit den Schweinswalen und Robben, die er beim Angeln entdeckt hatte und liebte? In letzter Zeit gab es immer weniger von ihnen im Belt. Felix schüttelte abermals den Kopf. Er spürte jedes Mal den Druck auf seiner Brust, wenn er die Bilder wahrnahm, die sich vor seinem inneren Auge auftaten. Er sah die riesigen Bagger, die den Grund im Belt aufwühlten und eine milchtrübe Masse hinterließen. Die Tunnelelemente vernichteten für viele Jahre die Umwelt, dessen war er sich sicher. Hier wird’s bald keinen Fisch mehr geben. Der Sand wird für lange Zeit aufgespült sein und weder Pflanzen noch Tieren die Möglichkeit geben, da draußen zu überleben, schnaufte er plötzlich und sagte: »Unfassbar!«
Edda schluckte, sah ihren Mann entgeistert von der Seite an. Ihre rote Wollmütze rutschte hoch, sodass ihre Ohren glühend hervorstachen. Dunkle Locken umrahmten ihr schmales Gesicht, und ihre Augen guckten durch das Fernglas, als könnte sie nicht begreifen, was sie entdeckt hatte.
»Ich bin sicher, da hängt ein Mensch am Boot«, behauptete sie mit zitternder Stimme und hoffte, dass Felix sein Interesse auf das Gesagte lenken würde.
»Was du dir immer zusammenspinnst – da hängt einer am Boot«, lachte er. »Du tüddelst!«, er presste seine Lippen aufeinander, als er sich seiner Worte bewusst wurde. Der 42-Jährige schüttelte den Kopf und drillte seinen Köder.
»Da ist jemand am Bug angekettet!«, schrie sie, wobei sich ihre Stimme überschlug.
*
Die Leuchtstoffröhre pendelte leise quietschend über dem betagten Holztisch und verbreitete flackerndes Licht in dem etwa zehn Quadratmeter großen Raum. Es roch muffig. Eiseskälte durchzog seinen Körper, als er auf den Salpeter starrte, der aus der Wand vor ihm quoll. Dieser Ort war, wie das gesamte Gebäude, weit über 140 Jahre alt. Er ließ seinen Blick wieder auf seine Hände gleiten und nestelte am Kabel, das er mit einem anderen in Verbindung brachte. Angestrengt nagte er auf seiner Unterlippe. Seine Augenlider zuckten. Dann warf er einen kurzen Blick in die hintere Ecke des Kellerraumes. Dort lief seit Stunden ein Heizstrahler, der nur begrenzte Wärme im zwei Meter hohen, milchweiß gekalkten Gewölbe verbreitete. Ihm schien es egal zu sein. Das Einzige, was ihm Kopfzerbrechen bereitete, war der austretende Salpeter, diese rosafarbenen kristallinen Ablagerungen, die seit Jahren immer stärker aus den Wänden traten. Die Gebilde zeigten ihm auf unmissverständliche Weise, wie feucht das Mauerwerk tatsächlich war. Zwischen seinen Augenbrauen stach eine Falte hervor. Der Mann im schwarzen Hoodie, der auf dem Holzstuhl saß, zuckte die Schultern. Sie hatte ihn immer wieder aufgefordert, die Probleme endlich zu beseitigen. Aber es gab so viel Wichtigeres zu tun. Jetzt war es zu spät. Seufzend ließ er die Hände sinken und warf einen Blick auf die Metallregale, auf denen unzählige unterschiedlich große Farbdosen, Eimer und Werkzeuge, fein säuberlich gestapelt und akkurat angeordnet, lagen oder standen. In einem Weckglas steckten Pinsel, und es roch auffällig nach Terpentin. Ordnung war ihm wichtig. Selbst in diesem … Kellerloch. Er saß auf dem Stuhl und zog eine Atemschutzmaske aus der Hosentasche. Bedeutsam zog er die Gummibänder hinter die Ohren und beugte sich erneut konzentriert über das Metallgefäß. Seine schlanken Finger arbeiteten zügig und wussten offensichtlich genau, was sie taten. Was in dieser Umgebung befremdlich auffiel, waren die beiden Computermonitore, deren Bildschirme vor seinen Augen flimmerten. Jeder von ihnen maß 32 Zoll. Es hatte den Anschein, als würde er ein Rezept von der flimmernden Scheibe ablesen. Immer wieder schielte er auf die Rezeptur der dort angegebenen Mengen. Vorsichtig bewegte er den kantigen Metallbehälter vor sich auf dem Tisch, der in einer noch größeren Schale auf einem Berg von Eiswürfeln stand, die er erst vor wenigen Minuten in einer Plastiktüte aus einer Truhe gezogen hatte. Vorsichtig nahm er vier schneeweiße Tabletten, die neben ihm auf dem Tisch ausgebreitet lagen, und gab sie in den Eisbehälter. Mit einem Mörser aus dunklem Granit zerstieß er den Trockenbrennstoff zu feinem Pulver. Diese Arbeit war denkbar einfach. Er warf einen Blick auf das Pulver und griff zu einer der drei Flaschen, die akkurat hinter dem Eiskübel aufgereiht waren und auf ihren Einsatz warteten. Mit präziser Genauigkeit füllte der Mann die auf dem Bildschirm angegebene Menge in ein Glasgefäß. Er öffnete die zweite Flasche, das gleiche Prozedere. Kleine Schweißperlen benetzten seine Stirn. Das Zucken seiner Lider verstärkte sich, während er den Atem anhielt, um die Prozedur nicht zu unterbrechen. Immer wieder schluckte er, holte tief Luft und fuhr mit der Arbeit fort. Als Letztes kam die Flüssigkeit aus dem dritten Behältnis zum Einsatz. Er verengte die Augen. Seine Finger fingen an zu zittern, als er den Inhalt aus den Gefäßen zu den zerstoßenen Brennstofftabletten träufelte. Langsam fügte er die Mischungen zusammen. Die Oberarme presste er an den Körper, um nicht zu zittern. Eine unachtsame Bewegung – und es würde böse enden. Im Raum verbreiteten sich innerhalb weniger Sekunden übelriechende Ausdünstungen! Seine Hand umkrampfte den Glasstab und führte kreisende Bewegungen aus. Er musste die Flüssigkeiten, die in diesen Sekunden eine nebelartige Verbindung eingingen, herunterkühlen, damit sie sich nicht entzündeten. Kalter Schweiß lief seine Schläfen hinunter, auch das Shirt war innerhalb weniger Sekunden durchnässt. Er hielt inne, atmete tief und hielt erneut die Luft an. Konzentriert verfolgte der Mann, wie die Lösungsmittel sich miteinander vereinigten. Der Gestank drang selbst durch die schwarze Atemschutzmaske, die seine Atemwege schützen sollte. Egal, wie lange diese Prozedur dauern würde, es gab keinen Weg zurück. Mechanisch rührte er weiter und versuchte, so flach wie möglich zu atmen. Das Zucken seiner Lider verstärkte sich, als die heraustretende Feuchtigkeit von der Stirn ins Auge tropfte. Nicht bewegen, nur nicht bewegen, dachte er. Gott sei Dank hat sich wenigstens der Geruch der fiesen Mischung verzogen, stellte er fest, als er für den Moment die Maske von Mund und Nase zog. Angewidert rümpfte er die Nase, als er dafür seinen eigenen penetranten Geruch wahrnahm. Ich muss das Zeug weiter runterkühlen, damit es kristallisiert, schnaufte er und warf immer wieder einen Blick auf den Monitor. Die Hand bewegte sich weiter. Der Mann, dessen Shirt klatschnass auf dem Rücken klebte, atmete kaum. Seine Blicke jagten von der Schüssel zum Bildschirm und zurück. Der Vorgang dauerte fast die ganze Nacht. Seine Arme rührten so lange im Gemisch, bis es nach endlosen Stunden endlich geschafft war. Er atmete erleichtert auf, ließ den Glasstab im Behältnis und streckte befreit die Arme in die Luft. Seine Augen brannten, als hätte jemand Chilipulver hineingestreut. Völlig übermüdet stand er auf und reckte sich. In seinem Kopf hämmerte es. Sämtliche Knochen fühlten sich betäubt an. Noch allerdings war es nicht vorbei. Im letzten Schritt musste er das kristallisierte Pulver durch einen Trichter in die bereitgestellte PET-Flasche rieseln lassen. Er wusste, dass er extrem vorsichtig vorgehen musste. Ein harter Schlag, eine Unachtsamkeit, dann wäre es vorbei und er würde selbst … Erneut glänzten winzige Perlen der Anstrengung auf seiner Stirn. Er wagte kaum zu atmen und versuchte, die Hände trotz aller Anstrengungen so ruhig wie möglich zu halten. Letzte Krümel des hergestellten Pulvers glitten in die Flasche. Dann war es vorbei. Er lehnte sich laut ausatmend und völlig erschöpft gegen die Stuhllehne. Seine Gesichtszüge entspannten sich. Ein Lächeln, das frostiger war als die Eiswürfel vor ihm, glitt über sein Gesicht.
Erleichtert lehnte er sich auf dem Stuhl zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Er registrierte, dass seine Haare im Nacken an der Haut klebten. Das erste Mal seit Stunden atmete er so tief in seine Lungen, dass sein Brustkorb sich wie ein Luftballon aufblähte. Wenig später entspannte sein Körper und fing unkontrolliert an zu zittern. Der Puls hämmerte durch den gesamten Leib, Blut rauschte durch seinen Kopf. Er hielt die Augen geschlossen. Seine Rechnung war bis zu diesem Moment aufgegangen, sodass er die nächsten Schritte einleiten konnte. Die Befreiung jagte einen Schauer über seinen Rücken. Das Zucken seiner Augenlider ließ nach. Dann wurde er ruhig. Bis das Pulver in der Flasche anfing zu qualmen.
*
Beleidigt entfernte sich Edda ein paar Schritte von ihrem angelnden Ehemann und suchte durch das Fernglas erneut angestrengt nach dem Fischkutter. Sie war sicher, dass am Bug des Schiffes ein Mensch gehangen hatte. Dann entdeckte sie den Kutter, der sich im gleichen Radius bewegte. Sie veränderte die Schärfentiefe am Feldstecher und nahm deutlich die Umrisse einer menschlichen Gestalt wahr. Sie stapfte in ihren Gummistiefeln tiefer in die Ostsee, bis auf einmal Wasser in ihre Stiefel schwappte. Edda schrie auf.
»Ja, sag mal. Kannst du endlich Ruhe geben? Du verscheuchst mir auch noch die letzten Fische.« Felix Krolls Laune sank gen null. »Geh spazieren, sammel Steine und verjag mir die Forellen nicht!«, fluchte er und warf ihr einen wutentbrannten Blick zu. Der Angler war mit seiner Geduld am Ende. Ein weiteres Mal schnellte die Angelsehne über die glasklare See. Er knurrte wie ein böser Hund, als er anfing zu drillen. Um ihn herum war es auf einmal wieder still. Die Eiseskälte biss sich in seinem Gesicht fest. Ihm war es egal. Er wollte endlich eine Forelle an Land ziehen. Edda pustete und stapfte ohne ein weiteres Wort aus der See. Felix sah über die Ostsee und beobachtete die Rute, während Edda versuchte, das eiskalte Wasser aus ihren Gummistiefeln zu entfernen. In nassen Socken stand sie am Strand und bibberte. Beide konzentrierten sich auf ihre Aktionen.
Pchhhh … Wumm! Ein wuchtiger, dumpfer Knall unterbrach die Stille und riss die beiden Strandbesucher aus ihren Tätigkeiten. Wie vom Schlag getroffen, zuckten beide zusammen. Edda ließ ihren Gummistiefel fallen, drehte sich um und guckte in die Richtung, aus der der Knall gekommen war. Eine atompilzähnliche Wolke stieg genau dort in die Luft, wo sie vorher den Fischkutter wahrgenommen hatten. Felix blieb wie versteinert stehen und erstarrte in seiner Bewegung. Edda presste geschockt die Hand vor ihren Mund. Ihre weit aufgerissenen Augen verfolgten die dicken Rauchwolken, die weiter anschwollen und den Himmel verdunkelten.
»Das war das Fischerboot! Der Fischkutter ist explodiert«, krächzte Felix Kroll. »Ruf die Wasserschutzpolizei, sofort!«
Edda zog ihr Handy aus der Tasche. »Wie ist die Nummer? Ich kenne die Nummer nicht«, rief sie bleich.
»Verdammt, die ist gespeichert!«, fluchte er.
»Aber nicht in meinem Handy!«, jammerte sie.
Wenige Meter weiter entfernte sich ein Mann, der hinter einem Hügel verharrte und, ohne sich einmal umzublicken, den Strand verließ.
Kapitel 2
Samstag
Charlotte Hagedorn rührte mit ihrem Löffel den Kandis im Becher. Sie lauschte, was der attraktive Mittfünfziger Hendrik Martin, seiner Frau Nele mitzuteilen hatte, während er im gleichen Atemzug die Winterjacke überstreifte und sich nervös mit den Händen durch seine grau melierten kurzen Haare strich.
»Nele, ich muss los. Wir haben eine Explosion im Belt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber wie es scheint, ist ein Kutter in die Luft geflogen.« Die Pensionsbetreiberin Nele Martin, eine der besten Freundinnen Charlotte Hagedorns, stand vor der Keramikspüle und trocknete die Hände an den Hosenbeinen ihrer Jeans. Die quirlige Frau Mitte 50 schüttelte ihre blonden Locken und warf ihrem Mann einen erstaunten Blick zu.
»Kutter? Einer der Fischer?«, fragte die adrette Pensionswirtin und wischte sich mit dem Handrücken eine ihrer störrischen Locken aus dem Gesicht.
»Sagte ich doch, ich kann es dir nicht sagen! Ich muss los. Mein Pieper ist angesprungen.« Überstürzt stieg der schlanke Mann, der eben noch über der Tageszeitung gesessen hatte, im Flur in die Winterstiefel und verließ ohne ein weiteres Wort das Haus. Die Tür schlug lautstark ins Schloss. Zurück blieb Nele mit ihrer Freundin Charlotte, die auf der Eckbank saß und mit spitzen Lippen heißen Ingwertee schlürfte.
»Das ist interessant«, murmelte die taffe Künstlerin, die auf der Insel nicht nur wegen ihrer malerischen und musikalischen Talente für Unterhaltung sorgte, sondern ebenso für ihren exzellenten Spürsinn bekannt war und sofort überall dort ein Verbrechen witterte, wo es nicht mit rechten Dingen zuging. Nicht umsonst trug sie hinter vorgehaltener Hand bei den Insulanern den Namen Miss Marple wie ein Brandmal mit sich. Sie war die Frau, die mit ihrem roten Fahrrad und ihrer Kamera jedem Mord auf die Schliche kam. »Explodiert, soso.«
»Das muss überhaupt nicht interessant sein, das ist nur traurig, wenn einer der Fischkutter tatsächlich in die Luft gegangen ist. Weißt du eigentlich, was los ist, falls einer der Fischer … Ich mag überhaupt nicht daran denken«, flüsterte Nele. Sie schwieg und wandte sich wieder ihrer Hausarbeit zu. Charlotte nippte am Tee, stand auf und sagte:
»Ich muss los. Hab ganz vergessen, dass ich noch einen Termin habe.« Sie guckte auf den Terrazzoboden. Nele sah sie entgeistert an.
»Das glaube ich jetzt nicht. Du tüddelst deine Freundin an, ohne rot zu werden?« Ihr war klar, dass Charlottes Worte gelogen waren, und sie erkannte sofort, was sie vorhatte. »Du brauchst da gar nicht hinzufahren. Dir wird niemand erzählen, was genau passiert ist. Und überhaupt. Ich dachte, wir wollten Tee trinken.«
Charlotte überhörte den Vortrag, stand längst im Flur, schlang ihren Schal um den Hals und stülpte die meerblaue Pudelmütze mit dem aufgestickten Delphin über ihre ungebändigten grauen Locken. Ohne der Freundin eine Antwort zu geben, stieg sie in ihre dunkelbraunen Stiefel und zog die Handschuhe an.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst«, murrte Nele und sah ihre Freundin an. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Charlotte!«
»Und ob! Tschüss, Nele. Ich kann nicht anders. Ich denke, wir haben einen neuen Fall.«
*
Der Seenotrettungskreuzer sowie das Schiff der Wasserschutzpolizei eilten von ihren Standorten zur angegebenen Unglücksstelle. Von der Feuerwehrwache der Burger Innenstadt rasten zeitgleich zwei Löschfahrzeuge auf direktem Weg zum Fährhafen nach Puttgarden. Ein Wagen der ansässigen Polizeidienststelle mit Dienststellenleiter Olaf Schütt und Hauptmeister Jan Becker fuhr direkt zum Strand, um die Befragung der Anrufer aufzunehmen, die die Explosion gemeldet hatten. Der Hauptkommissar hatte sie gebeten, vor Ort zu bleiben. Schütt stoppte den Wagen neben etlichen Mülltonnen, die auf dem Parkplatz direkt hinterm Deich standen, und stieg aus. Er zog seine Dienstmütze weit über die Ohren und den Reißverschluss seiner Uniformjacke bis zum Hals. Es war mittlerweile Mittag, als er den hartgefrorenen Deich hinaufstapfte. Eisiger Ostwind durchbohrte die Haut in seinem Gesicht. Der hagere Jan Becker lief bibbernd hinter ihm her und vergrub seine Hände tief in den Jackentaschen. Schon von Weitem entdeckte Schütt die einzigen Personen am steinigen Strand von Puttgarden. Edda und Felix Kroll verharrten frierend am Küstensaum. Die Sonne war hinter der dichter werdenden, aschgrauen Wolkendecke verschwunden. Die 40-Jährige hatte Handschuhe übergestreift und wippte von einem Fuß auf den anderen. Sie hatte die Gummistiefel gegen anderes Schuhwerk getauscht und versuchte, die Füße zu wärmen. Felix stand wie ein Baum neben seiner zierlichen Frau und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Seine Angelruten hatte er längst in der Tasche verstaut. An Meerforellen war überhaupt nicht mehr zu denken. Beim Ausatmen wurde eine weiße, nebelartige Fahne sichtbar.
»Moin, Schütt, ich bin der Leiter der Burger Polizeidienststelle. Haben Sie auf der Wache angerufen?« Er sah beide unverwandt an. Edda nickte.
»Ja, ich war das. Wir wussten nicht, wen wir sonst hätten informieren sollen.« Ihre Stimme klang brüchig. Sie schien den Tränen nahe.
»Ja, meine Frau hat …«
»Ist in Ordnung. Passt schon. Die Seenotrettung und die Wasserschutzpolizei sind auf’m Weg zur Unfallstelle, wie Sie unschwer erkennen können.« Olaf Schütt deutete auf die Stelle, an der der Kutter nach wie vor brannte und auf den die beiden Schiffe zusteuerten. Ein weiterer Tanker, der sich auf der stark befahrenen Schifffahrtsstraße bewegte, hatte, wie es aussah, ebenfalls aufgestoppt. Olaf wandte sich wieder dem Ehepaar zu. »Nun erzählen Sie mir mal, was Sie beobachtet haben. Und lassen Sie nichts aus. Was genau ist passiert?«
Felix holte aus und gab bereitwillig Auskunft: »Also, ich stand im Wasser und habe geangelt. Meine Frau suchte die ganze Zeit über nach Steinen. Wir haben den Fischkutter entdeckt, weil er ein merkwürdiges Fahrverhalten an den Tag gelegt hat.« Felix schluckte.
»Merkwürdiges Fahrverhalten? Wie meinen Sie das?«, fragte Schütt und rieb sein Ohrläppchen. Der kräftig gebaute Polizeibeamte mit der sonoren Stimme verschränkte seine Arme vor der Brust, schob die Mütze zurück und kratzte sich die kurz geschorenen Haare.
»Ja, der fuhr die ganze Zeit nur im Kreis«, antwortete Edda und nagte an ihrer Unterlippe. Ihre Augenlider zuckten. Fortwährend deutete sie mit einer Hand auf die Stelle, an der das Boot brannte und dichte dunkle Rauchschwaden in den Himmel zogen. Sie hielt Olaf Schütt das Fernglas entgegen, das sie mit ihrer anderen Hand fest umklammerte. Der Leiter der Burger Dienststelle griff danach und äugte angestrengt hindurch. Dann schnaufte er und kratzte sich mit einer Hand am Kopf.
»Hm, da kann ich rein gar nichts mehr erkennen. Dat qualmt alles.« Schütt nahm das Glas herunter und reichte es Jan Becker. »Kuck du mal. Vielleicht siehst du ja mehr als ich.«
Jan griff nach dem Feldstecher, sah hindurch und schüttelte den Kopf. »Ich kann da gar nichts erkennen! Nur Rauch und Flammen, vom Kutter, ne. Alles viel zu verqualmt.« Er nahm das Fernglas herunter. »Haben Sie gesehen, dass es ein Fischkutter war?«, wollte er von dem Pärchen wissen.
»Ja, das haben wir genau beobachtet. War sonst kein anderes Boot weit und breit auf dem Wasser. Nur die Fähre, die jetzt da hinten im Hafen liegt.« Felix deutete auf den Puttgardener Fährhafen, schnaufte ununterbrochen und kratzte seinen ausladenden Bart. Ihm war die ganze Sache nicht geheuer.
»Ja, und da war jemand am Bug angekettet«, krächzte Edda, und es klang, als hätte sie einen dicken Kloß in der Kehle.
»Da war jemand am Bug angekettet? Und das konnten Sie aus dieser Entfernung erkennen? Das klingt unglaublich. Erklären Sie mir das bitte genauer.« Der baumstarke Felix Kroll warf seiner Frau einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Ach, sie tüddelt. Da war nichts. Sie hat mir das auch schon erzählt. Ich konnte nichts erkennen. Sie hat manchmal eine rege Fantasie«, schüttelte er missbilligend den Kopf und fuhr erneut mit der Hand durch seinen dichten Vollbart.
»Aber ich habe es gesehen! Was du immer redest. Du weißt genau, dass ich gute Augen habe.« Edda wurde rot und ballte fuchsteufelswild ihre Hände zu Fäusten.
»So, nun mal Klartext. Was genau ist passiert, Frau …?«
»Kroll, Edda Kroll. Also, ich habe beobachtet, dass ein weißer Kutter da rumkurvte. Der fuhr, wie schon gesagt, ständig im Kreis. Felix, das hast du auch gesehen, oder nicht?« Der Angler nickte. »Ja, und dann habe ich das Fernglas aus dem Rucksack gezogen und versucht, das Boot dichter auszumachen. Und entdeckt, dass da jemand am Bug des Schiffes hing.«
»Wie hing?«, wollte Schütt wissen und sah sie durch Augenschlitze an.
»Angekettet. Er war angekettet!«
»Ach, du spinnst, sagte ich doch schon. Da kann niemand angekettet gewesen sein. Das kann man aus der Entfernung überhaupt nicht erkennen. Du spinnst wirklich!« Felix Kroll tippte seinen Finger gegen die Stirn. Er rückte seine Dockermütze zurecht und guckte den Polizeibeamten kopfschüttelnd an, während er gleichzeitig mit den Augen rollte. Becker drehte unablässig an dem kleinen schwarzen Rädchen, um die Schärfe nachjustieren zu können, und wirkte dabei nicht sehr professionell. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte er, etwas anderes außer dunklen Rauch und züngelnde Flammen auszumachen.
»Na gut, was ist dann passiert?«, führte Schütt seine Befragung weiter.
»Ich bin ins Wasser gegangen, um dichter ranzukommen. Dabei bin ich zu tief reingeraten und mir sind die Gummistiefel vollgelaufen. Ich bin dann sofort raus, um das Wasser loszuwerden. Deswegen habe ich nichts weiter beobachten können. Und dann, dann war da plötzlich dieser fürchterliche Knall.«
»Und Sie?«, er blickte auf den Mann, der ihn entfernt an Rübezahl erinnerte, und langsam schwand seine Hoffnung, eine adäquate Beschreibung der Explosion zu erhalten.
»Ich habe mich auf meine Angel konzentriert, als es diesen dumpfen Bums gab. Erst da haben wir mitgekriegt, dass eine riesige Feuerwalze in die Luft schoss. Es sah aus wie der Pilz einer Atombombe.« Felix Kroll deutete mit beiden Händen einen überdimensionalen Pilz an. »Na ja, ein bisschen zumindest. Das konnte nur der Kutter gewesen sein. Und dann haben wir sofort Ihre Nummer gewählt.« Der Bär von Mann zuckte die Schultern. Olaf Schütt guckte über den Belt und erkannte die Schiffe, die sich in Nähe des brennenden Kutters eingefunden hatten.
»Jan, nimm du bitte die Daten der beiden auf.« An den Angler und seine Frau gewandt, sagte er: »Sie müssten bitte noch einmal zur Wache kommen, damit wir Ihre Aussage protokollieren können.« Felix und Edda Kroll nickten.
»Dürfen wir dann endlich gehen? Mir ist schlecht und ich friere«, bekundete die zitternde Frau mit den dunklen Locken und deutete auf ihre Füße. »Können Sie. Wenn Herr Becker Ihre Daten hat, können Sie los. Gib ihnen unsere Karte.« Die verstörten Eheleute gaben dem Hauptmeister die nötigen Informationen und verschwanden, ohne sich umzudrehen, als ein erneuter Knall die Stille durchbrach.
*
Für eine Weile beobachteten die Polizeibeamten das Geschehen der Schiffe aus der Ferne, dann begaben sie sich zügig auf den Weg Richtung Fährhafen. Nach einem kurzen Telefonat besaß Olaf Schütt die Information, dass es auf dem Kutter eine weitere Detonation gegeben hatte und, sobald das Feuer gelöscht war, das Boot in den Hafen von Puttgarden geschleppt werden würde. Dieses könnte nach Aussage der Wasserschutzpolizei einige Zeit in Anspruch nehmen.
»Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Schiff im Belt brennt. Erinnerst du dich an die Fähre im Oktober 2010?« Becker schüttelte den Kopf.
»Vage. War das nicht ein Schiff aus Litauen?« Schütt nickte.
»Ja, die Lisco Gloria, die wollte damals nach Klaipeda. Wenn ich mich recht erinnere, haben sich damals über 240 Menschen an Bord aufgehalten, als es auf dem Oberdeck zur Explosion kam. Große Teile des Schiffes standen in Flammen. Mann, das war eine fürchterliche Katastrophe. Gott sei Dank konnten alle Passagiere die brennende Fähre verlassen. Ich weiß noch, sie trieben in Rettungsbooten und kleineren Rettungsinseln bei Windstärke fünf auf dem Belt, als wir mit dem Polizeischlauchboot rausfuhren. Das Feuer hat richtig heftig gewütet.« Schütt schüttelte fortwährend den Kopf, als könnte er bis heute nicht fassen, was vor über 13 Jahren passiert war. »Das kam mir vor wie ein Sturm im Wasserglas. Alle waren voller Anspannung und höchst aufgeregt. Das Löschen gestaltete sich, soweit ich mich erinnere, extrem problematisch. Ja, auf dem Belt war schon immer nicht alles so rosig«, sinnierte Schütt und nickte. »Ja, und ’ne zweite Explosion hatte den Brand verstärkt. Irgendwie haben sie die Fähre dann nach Langeland geschleppt. Erinnere mich gar nicht, was daraus geworden ist.«
Sie gelangten mit ihrem Wagen in das Hafengelände des Fährbetriebes und stellten ihn direkt vor dem Eingang zum Bahnhofsgebäude ab. Schweigend bewegten sie sich zum Anleger. »Wenn der Tunnel erst da ist, wird das alles hier eine Nummer kleiner, falls das Ding dem Fährhafenbetrieb nicht sogar richtig das Genick bricht und die irgendwann komplett verschwunden sind«, murmelte Jan Becker und seufzte. »Das war alles so schön. Man konnte mit dem Zug auf die Fähre und dann weiter nach Kopenhagen. Die Zugverbindungen waren selbst für uns Insulaner wunderbar. Wer braucht diesen blöden Tunnel? Ich jedenfalls nicht. Die glauben doch nicht ernsthaft, dass ich durch einen 18 Kilometer langen Tunnel unter dem Wasser durchfahre. Nicht mit mir, und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der da nicht durchfährt«, knurrte Becker weiter und zog die Mütze weit über seine Ohren.
»Langsam geht die ganze Gemütlichkeit den Bach runter«, erwiderte Olaf Schütt und schüttelte erneut seinen Kopf.
Der Dienststellenleiter erreichte als Erster den Kutter, der mittlerweile am Kai des Hafenbeckens festgezurrt war. Er starrte auf das, was davon übrig geblieben war. Ein Rumpf aus Eiche, von dem das oberste Drittel allerdings verkohlt war. Das komplette Oberdeck aus GFK samt Führerhaus war durch die beiden Explosionen zerstört worden. Die Reling lag schwarz verrußt vor ihm, aber der Rumpf hatte zumindest gehalten. Das Holz hatte sich mit Wasser vollgesogen, was in diesem Fall einen Vorteil gegenüber heutigen GFK-Booten aufwies.
»Ein Schiff, das komplett aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht, hätte diese Explosion sicher nicht überlebt«, murmelte Olaf Schütt, zog die Mütze vom Kopf und kratzte sich den Schädel. Er begutachtete den Schaden und suchte nach Antworten. Ein Kommissar der Wasserschutzpolizei sprang von der Reling des Polizeischiffes und bewegte sich direkt auf Olaf und Jan zu.
»Moin, Schütt, was machst du hier?«, zwinkerte der uniformierte kurz geratene Beamte ihm zu.
»Was glaubst du, Stefan?«, fragte der Burger Dienststellenleiter, und man sah, dass ihm die Frage des Kollegen nicht behagte. »Ich suche Pilze, oder was glaubst du? Ich muss natürlich wissen, was hier passiert ist.« Schütt deutete auf das heruntergebrannte Schiff.
»Das willst du, glaube ich, gar nicht«, antwortete Stefan Hörmann, der zum väterlich wirkenden Hauptkommissar aus Burg aufsah. Mit seinen 1,65 Metern war er kaum einer der Größten, konnte sich allerdings durch seine Art und sein erstaunliches Wissen im Job behaupten. Er war durchsetzungsfähig und gleichzeitig ein durch und durch positiver Mensch, der meistens zu Späßen aufgelegt war. In seinen Augen lag der Schalk. Olaf Schütt konnte seinem Humor nicht immer etwas abgewinnen, aber er nahm es hin.
»Nun red schon, was ist los? War jemand an Bord?«, wollte der Hauptkommissar wissen und warf Hörmann einen Blick zu, der ihn zurückweichen ließ. Becker hauchte ununterbrochen warmen Atem in seine Hände und rieb sich die kalten Ohren. Gespannt wartete auch der spindeldürre Polizeibeamte auf eine Antwort.
»An Bord ja, aber nicht so, wie du es dir vorstellst.«
»Was heißt das?« Olafs Blick fixierte ihn. Seine Stimme klang auf einmal rau. »Dass zwar jemand an Bord war, aber nicht dort, wo wir ihn normalerweise vermutet hätten.«
»Klär mich auf.«
»Wir haben, nachdem die Löscharbeiten beendet waren, eine gruselige Entdeckung gemacht.« Hörmann schluckte, und es schien ihm schwerzufallen weiterzusprechen.
»Bedeutet was?«, forderte Schütt ungeduldig. Jan Becker wurde augenblicklich rot und tänzelte von einem Bein auf das andere. »Bedeutet, dass wir eine Leiche gefunden haben oder sagen wir besser, Teile davon, und die waren nicht auf Deck und nicht darunter! Komm mit.«
»Nun lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen«, knurrte Olaf Schütt. Jan spürte, dass die Geduld seines Chefs am Ende war.
»Da hängt ein wahrscheinlich von der Explosion abgerissener Arm am Bug. Das Makabre daran ist, dass dieser Teil des Körpers angekettet war. Reicht dir das?« Stefan Hörmann sah die Kollegen der Burger Dienststelle an. Jan Becker schluckte und blieb stehen. Olaf Schütt fiel die Kinnlade herunter.
»Wie ist das möglich?«, fragte er, als könnte er die Zusammenhänge nicht zuordnen.
»Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist auf jeden Fall eine Sache für die Mordkommission.«
Auf einmal fielen ihm die Worte der Frau wieder ein. »Sie hatte recht«, murmelte er und kratzte sich den Kopf.
Kapitel 3
Samstag Dienststelle Oldenburg
Kommissar Thomas Hartwig öffnete die Tür zum Büro, als der Leiter der Mordkommission nach seinem beharrlich klingelnden Mobiltelefon griff. Der Erste Hauptkommissar nahm das Gespräch entgegen.
»Jo, Moin, Olaf, wo geit? Na, was gibt es? Ich hoffe nicht, dass du schlechte Nachrichten übermittelst?«, sagte Westermann und lachte.
Sein Kollege Thomas Hartwig ließ seinen tschechoslowakischen Wolfshund Watson von der Leine und setzte sich Dirk wortlos gegenüber. Der Blick seines Kollegen veränderte sich zusehends und verwirrte den jüngeren Kommissar. Der Polizeibeamte, der seit Jahren mit seinem Vorgesetzten zusammenarbeitete, kannte diesen Gesichtsausdruck, der meistens nichts Positives zu bedeuten hatte. Augenblicklich verschwand die zuversichtliche Ausstrahlung aus dem Gesicht seines Chefs. Der Kommissar aus Lütjenbrode klopfte dem Hund die Flanke und erforschte Dirks Mimik, die unergründliche Formen annahm. Was immer Schütt am anderen Ende der Leitung verkündete, waren keine guten Nachrichten.
»Hm, ja, wir sind auf dem Weg. Bleibt ihr im Hafen, oder? Ah, ja, das ist perfekt. Wir fahren sofort. Bis später.« Dirk Westermann, ein attraktiver Endfünfziger, beendete das Gespräch und kratzte seinen Fünftagebart. Nachdenklich erhob sich der 1,90 Meter große Leiter der Oldenburger Polizeidienststelle und guckte Thomas kopfschüttelnd an, während er die schwarz gerahmte Brille zurechtrückte. Er schnaubte, schob die Brille auf den Kopf und rieb sich die Augen.
»Wir müssen auf die Insel«, sagte er und warf seinem Kollegen einen vielsagenden Blick zu. »Eine Leiche auf einem Fischkutter. Oder sagen wir besser: Teile davon.«
»Muss ich das jetzt verstehen?«, fragte Hartwig, rieb die Handflächen auf den abgewetzten Jeans und richtete sich auf.
»Ob du das verstehst, kann ich nicht beantworten. Aber so, wie es aussieht, haben wir einen neuen Mordfall.«
»Woher weißt du, dass es sich um Mord handelt?«, fragte der Beamte, der nur wenig größer als sein Vorgesetzter war und ihn durch huskyblaue Augen ansah.
»Weil die Kollegen einen abgerissenen Arm am Bug eines explodierten Kutters gefunden haben und wir herausfinden müssen, wie er dort hingekommen ist und wem er gehört.«
»Am Bug? Hat der sich verheddert? Oder wie soll ich das deuten?«
»Angekettet, er war am Bug angekettet, wenn ich Olaf richtig verstanden habe.«
Der sportliche Polizeibeamte verstummte und hörte auf, den Hund zu kraulen. »Dann haben wir einen neuen Fall?«
»Haben wir – und jetzt los!«, forderte Dirk Westermann, griff nach seinem dunkelblauen Caban und seiner Dockermütze.
Eine halbe Stunde später befuhren sie den Parkplatz am Fährhafen Puttgarden.
Dirk Westermann öffnete die Tür des Wagens und stieg aus. Der Ostwind, der über den Parkplatz fegte, versetzte seiner Haut feine Nadelstiche. Er atmete in seine Lungen und steckte die obligatorische Pfeife zwischen die Lippen. Bedächtig entzündete er sie. Eine milchig-weiße Rauchschwade stieg auf und verwehte sekundenschnell in alle Himmelsrichtungen. Thomas Hartwig sprang ebenfalls aus dem Wagen und ließ Watson, den markant grau, weiß, schwarz gezeichneten Wolfshund aus dem Fond. Er fiepte und lief zum erstbesten Baum.
»Dann mal los«, ordnete Westermann an und überquerte mit knirschenden Schritten die Parkfläche. Eilig trat er mit seinem Gefolge in die ehemalige Bahnhofshalle. Sie wurden bereits erwartet. Jan Becker reichte den Kollegen aus Oldenburg die Hand und führte sie zum Hafenbecken, in dem der desolate Fischkutter befestigt lag. Eine Gruppe Polizeibeamter und Feuerwehrleute wartete.
»Moin, na, was habt ihr für uns?«, fragte Westermann und warf einen Blick in die Runde. Der eisige Wind pfiff durch den Hafen, als er Hörmann begutachtete, der auf ihn zutrat.
»Ja, auch Moin. Hörmann, Leiter der Wasserschutzpolizei Neustadt. Wir waren zeitgleich mit der DGzRS als Erste an der Unglücksstelle.« Der kleinwüchsige Beamte stand direkt vor dem Schiff der Küstenwache, verschränkte die Arme vor der Brust und sah die Männer der Mordkommission mit ernster Miene an. »Nach ersten Erkenntnissen ist dies ein Fischkutter aus Heiligenhafen, was aufgrund der Kennung Heil mit der dazugehörigen Nummer zugeordnet werden konnte. Der Kutter gehörte einem Ingenieur Enno Hagelstein aus Heiligenhafen.«
Westermann und Hartwig sahen den Kommissar erstaunt an.
»Und woher haben Sie Ihre Informationen?«, wollte der Leiter der Mordkommission wissen.
»Ich habe als Erstes im Hafenmeisterbüro Heiligenhafen angerufen und die Kennung sowie Klassifizierung von der See-BG durchgegeben. Die konnten mir sofort erklären, wem der Kutter gehört. Ich habe mich gewundert, dass der Kutter noch angemeldet war. Ist doch in privater Hand. War schon merkwürdig.«
»Was ist See-BG?«, wollte Hartwig wissen und nestelte an seiner Dockermütze herum.
»Das ist die See-Berufsgenossenschaft. Soll ich auch noch erklären, was der Begriff bedeutet, oder finden Sie das selbst heraus?«, schwappte die knappe Antwort zurück.
»Ne, ne, schon klar. Aber man wird ja mal fragen dürfen.«
Thomas Hartwig zog die Augenbrauen hoch. Ihm war der Kommissar vom ersten Augenblick an ein Dorn im Auge. Seine flapsige Art gefiel ihm nicht sonderlich.
»Na, das ist doch schon mal ein Anfang«, entgegnete Westermann und trat an den verkohlten Kutter. Er rückte seine Brille zurecht und begutachtete den nicht zu übersehenden Schaden. »Sieht übel aus. Wir wissen bisher nicht, was die Explosion verursacht hat. Das ist dann Ihre Aufgabe, denke ich.«
Einer der Feuerwehrmänner, Hendrik Martin, trat einen Schritt näher.
»Moin, die Herren! Wir haben, nachdem wir das Körperteil gesichtet haben, sofort Abstand gehalten, um keine Spuren zu verwischen. Eine Abordnung bleibt hier, falls sich Glutnester unter Deck des Kutters ausbreiten sollten, aber das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich denke, das Feuer ist gelöscht. Sie können jederzeit mit Ihren Untersuchungen anfangen. Ich lasse den kleinen Löschzug mit zwei meiner Kollegen vor Ort.« Hendrik sah Dirk Westermann an. Sie kannten sich aus der Pension, in der die Kommissare aus Oldenburg mehr als einmal untergekommen waren. Der nickte. »Ja, das ist hervorragend. Ich denke, wenn die Kollegen den Kutter inspiziert haben, werden wir wissen, ob weiter Gefahr in Verzug ist. Dann können Ihre Leute abrücken.«
Dirk Westermann streifte Handschuhe über und schlüpfte in Füßlinge. Dann setzte er einen Fuß auf das verkohlte Deck.
»Ich frage mich nur, was die Explosion ausgelöst hat. Kann es sein, dass eine Gasflasche hochgegangen ist? Davon habe ich schon des Öfteren gehört.« Er warf dem Feuerwehrmann, der in leuchtend roter Jacke und dicken Gummistiefeln vor ihm stand, einen fragenden Blick zu. »Das ist tatsächlich schon vorgekommen, da gebe ich Ihnen recht. Aber das entsteht meist dadurch, dass eine Leckage an einem Schlauch oder im zu betreibenden Gerät vorhanden war und Gas austreten konnte. Gas sinkt ab, sammelt sich im unteren Bereich, und ein Funke genügt dann, um eine Explosion unter Deck auszulösen. Nur, dass in unserem Fall der Teil einer Leiche am Bug klebt und das gesamte Oberdeck in die Luft gegangen ist. Das haben wir so noch nie erlebt! Ist eigentlich unmöglich. Wir fragen uns die ganze Zeit, wie das passiert sein könnte und warum der Arm in einer Niro-Kette hängt.«
Thomas Hartwig schluckte. »Verstehe ich genauso wenig.« Hendrik Martin holte Luft und stand immer noch fassungslos mit dem Helm in der Hand vor dem Fischkutter. Dann sagte er:
»Nehmen wir mal an, einer der Schläuche im Innenschiff hatte ein Leck und es entweicht permanent Gas. Das würde reichen, um ein komplettes Schiff in die Luft zu jagen. Das geht schneller, als man denkt. Aber in unserem Fall ist der Aufbau in die Luft gegangen. Das ist äußerst kurios«, entgegnete Hendrik Martin in seiner betont wortgewandten Ausführung.
»Dann ist ein Schiff saugefährlich«, sagte Hartwig.
»Ja, kann man so sagen. Aber was mich irritiert, ist der Arm am Bug. Nicht nur, dass er durch den Brand am Bug haftet, sondern die Frage, wie ist er dahin gekommen, und warum klemmt der hinter einer Niro-Kette?« Hendrik Martin sah die Männer an und zuckte die Schultern.
»Sehen Sie sich das am besten selbst an«, übernahm Stefan Hörmann das Wort mit seiner hohen, kichernd klingenden Stimme. Er betrat das Deck, bewegte sich zum Bug des Kutters und deutete auf den Fleischklumpen, der wie eine Galionsfigur unter besagter Kette am Holz des Vorderschiffes festklebte und mit ihm verschmolzen zu sein schien. Dirk Westermann richtete seinen Blick auf die Stelle. Er inspizierte den Unterarm, dessen Haut oberhalb des Ellenbogens abgerissen worden war und verkohlte Adern und Muskelfasern offenbarte. Dann lenkte er seinen Blick zur Hand, an der drei Finger fehlten, die restlichen Stumpen abstanden und kaum mehr als solche erkennbar waren. Alles erschien wie ein dicker schwarzroter Klumpen.
»Vielleicht finden wir ja an Arm oder Kette irgendwelche DNA-Spuren, die für uns brauchbar sind. Wir müssen als Erstes die Personalien des Opfers eindeutig feststellen, bevor wir was lostreten«, sagte Thomas Hartwig, blieb stehen und betrachtete das Teilstück des Körpers aus sicherer Entfernung vom Land aus. Er schluckte, und es schien, als musste er würgen. Westermann griff zum Handy. Er wählte die Nummer der Spurensicherung und forderte einen Rechtsmediziner sowie die Kriminaltechnik an.
»Das war eindeutig kein Unfall!«, murmelte er. An die Kollegen der Wasserschutzpolizei gerichtet: »Meine Herren. Sie können sich zurückziehen, wir übernehmen.«
»Brauchst du uns noch?«, fragte Schütt, und Westermann sah ihm an, dass er den Hafen am liebsten schnellstens verlassen würde.
»Nein, ihr könnt los. Wir bleiben vor Ort und kommen später in die Dienststelle. Richtet uns schon mal ein Plätzchen ein.«
Olaf Schütt und Jan Becker verzogen sich. Die Kollegen der Wasserschutzpolizei starteten ihre Motoren und fuhren aus dem Hafenbecken, ebenso der Leiter der Feuerwehr. Nur ein Zwei-Mann-Team der heimischen Wehr verblieb in der Hafenanlage der Fährreederei. Die eisige Luft fegte weiterhin durch das Hafengelände und hinterließ ein gespenstisches Bild vom Ort eines Verbrechens. Und über dem verkohlten Kutter kreiste eine penetrant kreischende Möwe.
*
Charlotte Hagedorn strampelte auf dem Fahrradweg die Eisenbahnbrücke vor Puttgarden hinauf. Mann, was war das früher anstrengend, überlegte sie und hielt für einen Moment auf dem höchsten Punkt der Brücke an, um zu verschnaufen. Die Straße neben ihr war, bis auf einen einzigen Löschwagen der Feuerwehr, menschenleer. Sie rückte ihren Fahrradhelm zurecht und stieß sich vom Geländer ab. Energisch schaltete sie den kleinen Bordcomputer auf kleinste Stufe und versuchte, unfallfrei den Hügel runterzufahren. Die Stadtarbeiter hatten zwar gestreut, aber sicher war sicher. Wie gut wäre jetzt ein Auto, dachte sie und strampelte weiter. Zehn Minuten später rollte sie auf ihrem erdbeerroten E-Bike auf das Gelände des Fährbetriebes zu. Sie stellte das Rad direkt vor dem Bahnhofsgebäude ab und verschloss es zweifach. Auch wenn hier niemand herumlief, wollte sie keinem Dieb die Möglichkeit geben, sich erneut an einem ihrer Fahrräder zu vergreifen. Zumal dies ein Elektrofahrrad war, dazu in einer auffälligen Farbe. Für sie besaß es eindeutige Signalwirkung. Sie hatte zur Sicherheit ihren Namen in das Rad eingravieren lassen, damit kein Zweifel an den Besitzverhältnissen aufkommen konnte. ›Tante Charlotte‹, stand da unverkennbar in schwarzen geschwungenen Buchstaben. Charlotte nickte, rückte ihre Wollmütze zurecht und betrat das einstige Bahnhofsgebäude, das verwaist dalag. Was war hier immer los, dachte sie und schüttelte den Kopf. Sie stapfte über das Geländer und war keine 50 Meter weiter am Ziel. Charlotte Hagedorn fror und rieb sich die Hände. Von Weitem erkannte sie Dirk, Thomas und Watson, der sie als Erster wahrnahm und auf sie zustürmte.
»Na, mein Jung. Das ist aber fein, dass du mich so herzlich empfängst«, sagte sie und kraulte den Hund hinter seinen Ohren. Sie wusste, dass Thomas es nicht guthieß, dass ein ausgebildeter Polizeihund dermaßen viele Menschen freundlich in Beschlag nahm. Auf der anderen Seite gehörte Charlotte Hagedorn auf eine besondere Weise zur Truppe der Ermittler.
»Ich glaub’s ja nicht«, knurrte Hartwig, als er sie ebenfalls entdeckte.
»Was denn?«, fragte Westermann und folgte dem Finger seines Kollegen.
»Charlottchen, woher … ich hätte es mir denken können«, lachte der Ermittler trotz der prekären Situation von Bord des Kutters.
»Moin, Jungs, na, haben wir einen neuen Fall?«, wollte die Künstlerin in ihrem winterlich bunten Mantel wissen und taxierte die Beamten.
»Sieht so aus«, seufzte Dirk. »Der Kutter ist in die Luft geflogen und der Arm einer wahrscheinlich männlichen Person klebt angekettet am Bug. Ich denke, das reicht vorerst für die Vermutung eines Tötungsdeliktes.« Dirk Westermann sah die Tante seiner Verlobten mit ernster Miene an. Die Künstlerin zog ihre Kamera aus dem Rucksack und knipste, bevor sie von den Beamten aufgehalten werden konnte. Die patente Kriminalistin hatte nun die Gewissheit, dass sie gemeinschaftlich einen neuen Fall aufzuklären hatten. Sie trat näher an den teils verkohlten Fischkutter heran.
»Wisst ihr schon, wer?«
»Wir wissen nur, dass der Kutter einem Mann aus Heiligenhafen gehörte. Ob er derjenige ist, dessen Arm am Bug klemmt, wird sich nach der DNA-Analyse herausstellen.« Westermann zeigte auf den Rechtsmediziner und das Team der Spurensicherung, die zu sechst ihre Arbeit aufgenommen hatten. Henning war dabei, den Arm samt Kette mit einem Spatel vom verkohlten Bug zu lösen. Das Fleisch des abgerissenen Körperteils hatte sich durch die Hitze mit der geschmolzenen Farbe des gestrichenen Holzes verbunden und musste heruntergeschabt werden. Einer seiner Kollegen hing über der Reling und hielt eine geöffnete Metallkiste unter das zerfetzte Körperteil. Langsam ließ der Kriminaltechniker Henning es hineingleiten.
»Wir müssen den Arm sofort in die Rechtsmedizin bringen. Verdammte Sauerei. Wir müssen zuerst herausfinden, um wen es sich bei dem Toten handelt.« Henning richtete sich auf und guckte Westermann an. Im gleichen Augenblick kam ein Kollege der Spurensicherung an Deck. In seiner Hand hielt er einen Gegenstand. »Die größte Sauerei habe ich hier. Das war keine Leckage!«
»Spann uns nicht auf die Folter«, knurrte Westermann. Alle Augen waren auf den 44-jährigen Jochen Hintz gerichtet.
»Was hast du da in der Hand?«, wollte Hartwig wissen. Der Kriminaltechniker und Sprengstoffexperte hielt ihm die offene Handfläche entgegen. Thomas stierte auf die unscheinbaren Gegenstände und zuckte die Schultern. »Und, was soll das sein?«
»Wenn du genau hinsiehst, erkennst du kleine Splitter einer PET-Flasche und den Rest eines Glühfadens.«
»Ich verstehe nicht«, meldete sich Westermann zu Wort. »Das sind Teile einer Plastikflasche, und dieser Glühfaden gibt mir zu denken. Lass es mich anders erklären. In diesem Behälter, dessen Reste wir unter einer Metallkiste fanden, wurde mit ziemlicher Sicherheit Sprengstoff verwahrt. Der Glühfaden diente sehr wahrscheinlich mithilfe eines Streichholzkopfes dazu, das Gemisch zu entzünden. Wir fanden zwei winzige Teile eines Handys, und ich vermute, dass mit diesem der Sprengsatz gezündet wurde. Das, was diesen Kutter zerfetzt hat, war ganz offensichtlich eine Bombe! Dies war ein Anschlag, da bin ich mir sicher. Hier ist keine Gasflasche in die Luft gegangen.«
Charlotte Hagedorn stand nur wenige Meter entfernt und presste die Hand gegen ihren rasenden Herzschlag.
Jetzt muss ich mir einen Plan zurechtlegen. Dann werde ich Hinweise suchen. Oh, mein Gott. Das klingt wie die Berichte, die man über Terroranschläge liest.
*
Am späten Nachmittag fand das erste Zusammentreffen der Kollegen der Burger Polizeidienststelle statt. Westermann schenkte sich Kaffee ein und wollte sich gerade setzen, als sein Handy klingelte.
»Das ist Henning«, murmelte er und nahm das Gespräch entgegen. »Moin, Herr Kollege. Na, was hast du für mich?« Dirk Westermann trat angespannt ans Fenster und betrachtete die leeren Straßen. »Hm, du hast Sprengstoffhunde eingesetzt. Okay, und die haben deine Vermutungen eindeutig bestätigt. Ah, der Sprengsatz ist im Führerhaus hinter einer Lautsprecherbox angebracht gewesen. Das habt ihr noch herausgefunden? Da war doch überhaupt kein Aufbau mehr – sagenhaft.« Westermann schabte mit der Spitze seines Stiefels auf dem Boden und stellte das Handy laut, damit die Kollegen das Gespräch verfolgen konnten. »Okay. Es handelt sich beim Sprengstoff um TATP? Was zur Hölle ist das genau?« Westermann lauschte der Stimme am anderen Ende.
»Das ist Acetonperoxid oder kurz TATP genannt. Der Täter hat den Sprengsatz hinter dem Lautsprecher postiert. Wir haben Reste der Box gefunden. Zum einen sicherlich, um ihn versteckt zu halten, und zum anderen, damit niemand vorher das Gemisch in die Luft jagt. Das ist Sprengstoff, der auf Schläge oder Reibung äußerst empfindlich reagiert, was bedeutet, dass man normalerweise keinen Zünder benötigt, um eine Explosion auszulösen, es sei denn, man will sichergehen. Der Stoff zerfällt sehr leicht und kann zu heftigen Detonationen führen. Da wollte jemand unbedingt, dass der Kahn in die Luft fliegt!«
»Wurde der Zünder vom Schiff aus betätigt?«
»Ihr denkt an Selbstmord? Nein, vom Land aus, vermute ich. Das war kein Selbstmordattentat. Das hätte man wesentlich leichter haben können. Der Sprengsatz konnte somit von überall gezündet worden sein. Eventuell vom Strand aus. Die Entfernung spielte dabei keine Rolle. Könnte sein, dass wer immer das getan hat, zusehen wollte, wie der Kutter in die Luft geht.«
»Ja, könnte möglich sein. Hintz, ich danke dir und warte auf die DNA-Ergebnisse. Das klingt nach einem unangenehmen Morgen.« Der Leiter der Mordkommission beendete das Gespräch. Sein Gefühl hatte ihn nicht getrogen. Schütt hatte vorsorglich mehrere Tische im Büro zusammenstellen lassen. Westermann, Becker, Veit, Hansen, Hartwig und er saßen schweigend um den Konferenztisch. Im Raum herrschten frostige 18 Grad. Schütt goss Kaffee in seinen Becher, und die einzige weibliche Kollegin im Raum rührte den klirrenden Kandis in ihrem Tee. Dirk Westermann erhob sich und stellte sich vor den Flipchart. In Gedanken versunken, fertigte er Notizen an. Ein erster Name stand verloren auf der Plexiglasscheibe: Enno Hagelstein.
»Was wissen wir? Wir wissen bisher, dass der Kutter einem 46 Jahre alten Ingenieur aus Heiligenhafen gehörte. Den Fischkutter hatte er sich laut Aussage des Hafenmeisters vor exakt drei Jahren gekauft. Diese Info haben wir vom Hafenmeisterbüro in Heiligenhafen. Er lag seitdem immer auf demselben Liegeplatz und er nutzte den gut 40 Jahre alten Kutter für sein Privatvergnügen und zur Erforschung der westlichen Ostsee. Was genau er dort geforscht hat, wissen wir nicht. Gefischt hat er nicht, weil der Vorbesitzer den Kutter abgemeldet hat und er keine Genehmigung besaß. Nur das Kennzeichen war noch nicht entfernt. Warum nicht, wissen wir nicht. Das sind die Fakten, die wir bisher herausgefunden haben. Enno Hagelstein ist verheiratet, hat eine Frau und zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren. Wir werden im Anschluss an dieses Gespräch die genannte Adresse aufsuchen, um Näheres zu erfahren.« Westermann schrieb »Heiligenhafen« und »Wildkoppelweg« dazu. Kennzeichen? »Das liegt unmittelbar am dortigen Binnensee. Die ersten Fragen, die wir uns stellen müssen: Wer besaß einen Grund, den Kutter in die Luft zu jagen und gezielt einen Menschen zu töten? Und warum? Einen Selbstmord schließen wir durch die Herangehensweise an die Aktion und erste Ergebnisse aus. Mit wem stand Enno Hagelstein in Kontakt und ist er das Opfer, dessen Arm wir sichergestellt haben?« Dirk umrahmte mit seinem Stift den Namen des Schiffseigners. »Thomas und meine Wenigkeit werden jetzt zu dieser Adresse fahren und hoffen, dort weitere Hinweise zu bekommen. Wir müssen herausfinden, ob der Bootseigner das Opfer sein könnte. Ihr wisst ja, dass die DNA-Untersuchungen dauern. Das war’s fürs Erste. Ihr kümmert euch bitte darum, was der Kutter im Belt wollte. Vielleicht bekommt ihr vom Hafenmeister noch etwas raus. Olaf, könntest du diese beiden Angler noch einmal befragen, um herauszufinden, ob sie jemanden am Strand gesehen haben, der in irgendeiner Form verdächtig wirkte?« Westermann legte den Stift beiseite und forderte Hartwig auf, mit ihm und dem Hund den Raum zu verlassen. Die Polizeibeamten, die zurückblieben, sahen sich an.
»Sollen das doch die Kollegen in Heiligenhafen übernehmen«, knurrte Jasper Veit, der seit Anbeginn seiner Tätigkeit in der Burger Dienststelle kritisch beäugt wurde. »Das ist keine Inselsache!«
»Sag mal, du spinnst wohl. Hier geht es um ein Verbrechen, und du weigerst dich, die Anordnung deines Vorgesetzten umzusetzen? Sei bloß still! Du bringst das ganze Revier in Schwierigkeiten mit deinem dämlichen Gehabe. Überhaupt ist diese Überheblichkeit in keinster Weise mehr nachvollziehbar. Verdammt. Du nervst richtig!« Sina Hansen sprang auf. Wut überzog ihr Gesicht. Olaf Schütt sah die junge Kollegin erstaunt von der Seite an und warf Jasper Veit gleich darauf einen vernichtenden Blick zu.
»Du hast es gehört. Willst du keinen Riesenärger, dann halte dich an die Vorgaben, sonst … sonst …«
»Sonst was?«, entgegnete Veit mit gefährlich leiser Stimme und kniff die Augen zusammen. Sein kantiges Kinn stach hart hervor.
»Ansonsten suspendiere ich dich – und zwar umgehend!«
Jasper Veit brach in Gelächter aus.
»Ihr mich suspendieren? Dass ich nicht lache. Vorher lasse ich mich versetzen. Hier geht’s doch zu wie in einem Dorfladen. Langsam hab ich echt die Schnauze voll!« Der Polizeibeamte mit dem neun Millimeter kurzen Maschinenhaarschnitt und dem hageren Gesicht warf einen Bierdeckel in die Mitte des Tisches, sprang vom Stuhl und verließ das Büro. Die Tür fiel hinter ihm knallend ins Schloss.
»Was ist denn mit dem los?«, fragte Jan Becker und kratzte sich die mager behaarte Schädeldecke.