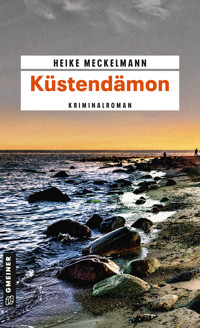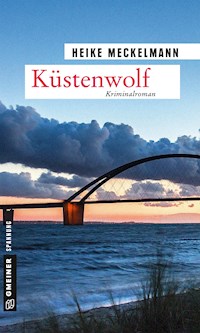
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Westermann und Hartwig
- Sprache: Deutsch
Im Sommeridyll der Insel Fehmarn wird von zwei Kindern eine furchtbar zugerichtete Leiche im Wald aufgefunden. Die Kommissare Dirk Westermann und Thomas Hartwig ermitteln und finden an der Leiche die DNA eines Tieres. Zur gleichen Zeit beobachtet eine Spaziergängerin einen Wolf auf dem Deich. Treibt er sein Unwesen auf der Sonneninsel und tötet nicht nur Schafe? Als ein weiterer Toter im Bürgermeister-Wald entdeckt wird, ist das Rätsel um die Toten genauso bedrückend wie die Schwüle auf der Insel ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Heike Meckelmann
Küstenwolf
Kriminalroman
Zum Buch
Bedrückend Ein gerissenes Schaf auf einem Deich gibt Rätsel auf. Ein wilder Hund, ein Wolf? Als kurz darauf im Sommeridyll der Insel Fehmarn eine furchtbar zugerichtete männliche Leiche im Wald aufgefunden wird, verlassen aufgeschreckte Urlauber panisch die Insel. Bald stellt sich heraus, dass es sich bei dem Toten um einen Jäger handelt, der bereits seit Tagen vermisst wird. Alles weist auf den Tod durch einen Tierangriff hin. Doch ist wirklich ein Wolf, der anscheinend weitere Schafe gerissen hat, der Täter? Eine erbarmungslose Jagd auf den Beutegreifer beginnt, der immer wieder in den Waldgebieten auf Fehmarn gesichtet wird. Aber irgendetwas stimmt nicht. Dirk Westermann, der eigentlich Urlaub hat, und Thomas Hartwig ermitteln auf der Insel. Und auch Charlotte Hagedorn ist aufgeschreckt. Mit ihrem Fahrrad begibt sie sich auf Spurensuche. Als wenig später ein weiterer Toter von einem Biker aufgefunden wird – ebenfalls ein Jäger – geraten auch die Inselbewohner in Panik …
Heike Meckelmann wurde in der Nähe von Elmshorn geboren und zog vor fast genau 30 Jahren auf die Insel Fehmarn. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft führte sie auf der Insel viele Jahre einen Friseurbetrieb und eine Hochzeitsagentur, arbeitete als Fotografin und nahm als Sängerin ein eigenes maritimes Album auf, bevor sie mit ihrer Familie eine Pension übernahm. Seit 2016 arbeitet Meckelmann als freie Autorin auf Fehmarn, schreibt Kriminalromane und Reiseliteratur. Bald 17 Jahre mit einem Fehmaraner verheiratet, bezeichnet sie sich durch und durch als Insulanerin, die ihre Insel genauso liebt wie die Geschichten, die sie auf der Sonneninsel schreibt.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Küstendämon (2018)
Fehmarn (2017)
Küstenschatten (2017)
Küstenschrei (2016)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
2. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Zeichnungen Kapiteltrenner im Buch: © Miriam Lange
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Jens / fotolia.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-5970-2
Vorspiel
Der Vollmond warf seinen silbernen Schatten auf die schlafend daliegende Ostsee. Im Schein des Trabanten glänzte die Wasseroberfläche wie ein riesiger Spiegel. Kein Windhauch regte sich, und die gespenstische Stille ließ das Bild um ihn herum wie ein Stillleben erscheinen. Die Fahrbahndecke, die über die Brücke führte und das Festland mit der Insel verband, glänzte vom Regen, der noch vor einer halben Stunde wie aus Kübeln aus schweren dunklen Wolken unaufhörlich heruntergeprasselt war.
Den Blick zielgerichtet nach vorn, lief er über den nassen Seitenweg. Sein ausgemergelter Körper zitterte. Durchnässt und frierend bewegte er sich weiter. Am höchsten Punkt der Brückenführung verminderte er das Tempo und blieb auf dem schmalen Pfad stehen. Wachsam spähte er nach allen Seiten, ob von irgendwo Gefahr drohte. Kein Auto in Sicht, kein Zug, keine Menschenseele, die zu dieser nachtschlafenden Zeit den Weg über die Stahlkonstruktion suchte.
Ermattet von der endlos langen Strecke, die er bisher hinter sich gelassen hatte, setzte er sich.
Er japste gierig nach Luft, starrte mit hoffnungsvollem Blick auf den tief stehenden Erdbegleiter, der ihm wie ein stummer Freund wochenlang nicht von der Seite gewichen war. Dann legte er den Kopf in den Nacken und heulte, als müsste er die Qualen der letzten Monate aus seinem ausgezehrten Körper hinausschreien …
Prolog
Lauernd beobachtete er den Mann, der mit einem Jagdgewehr im Anschlag unmittelbar vor ihm stand. Im Wald war es stockdunkel, aber dank seiner ausgezeichneten Augen war es für ihn ein Leichtes, ihn genauestens zu taxieren, ohne dass der es bemerkte. Er wartete auf den richtigen Moment. Eine Eule schickte ihren gespenstischen Ruf durch die mondlose Nacht. Das Geschrei hallte durch den Forst, als käme es aus einer großen Halle. Er reckte die Nase und inhalierte gierig die unzähligen Gerüche des Waldes. Sein Riechorgan war empfindsam und nahm selbst feinste Nuancen jedweder Ausdünstung in seinem Umfeld wahr.
Die mit Salz und Algen behaftete Meeresluft, die trotz windstiller Nacht von der Seeseite zu ihm herüberwehte, weckte sein unstillbares Verlangen.
Er registrierte den herbsüßen, schweren Duft der Rapsblüten, der betäubend auf den Lungenflügeln lag, und erfasste herumstreunende Tiere, die sich ängstlich hinter Büschen und Bäumen versteckt hielten, um nicht entdeckt zu werden.
Der stattliche Mann, der direkt vor ihm unkontrolliert mit der Waffe herumhantierte, verströmte das Aroma von Schweiß und Alkohol in hoher Konzentration. Er taumelte und man sah ihm an, dass er kaum noch Herr seiner Sinne war. Fleischige Hände schwenkten die Büchse von einer Seite zur anderen. Den Zeigefinger hielt der Mann wie festgewachsen am Abzug.
Die Eule schrie erneut, und entfernt war das Kreischen einer Möwe auszumachen. Der Wind trug die Geräusche der Brandung bis zu diesem düsteren Ort. Unter die Laute mischte sich der lang gezogene Ton eines Nebelhorns. Alles schien perfekt.
Er selbst musste nur auf den passenden Moment warten, auf die richtige Gelegenheit.
Der Jäger streunte weiterhin unkonzentriert und wankend durch das dunkle Gestrüpp des Waldes. Bei jedem Schritt knackten Holzstücke unter seinen Schuhsohlen. Der Mann bemühte sich, keinen Lärm zu erzeugen, und legte sich zwischendurch laut grunzend selbst den Finger über die Lippen, wenn erneut ein Ast am Boden zerbarst.
Ein paar Meter weiter blieb er stehen, hielt inne und blickte sich um, obwohl er genau wusste, dass außer ihm niemand im Gehölz war. Er taumelte, als er seinen Körper der Lichtung zudrehte. Langsam sicherte er die Büchse und lehnte sie mit dem Lauf nach oben gegen den dicken Stamm einer alten Eiche. Ein weiterer Blick, dann zog er fahrig den Schiebergriff des Reißverschlusses seiner Hose herunter und öffnete den Hosenschlitz. Er holte sein bestes Stück heraus, um sich in freier Wildbahn zu erleichtern. Befreites Stöhnen entrang der Kehle und unterbrach für einen Augenblick die Geräuschkulisse des Waldes.
Der Jäger war für einen kurzen Moment beschäftigt. Das Gewehr lehnte gesichert einen halben Meter neben ihm an dem Baumstamm, dessen Rinde er begoss. Jetzt hielt der Beobachter seine Chance für gekommen.
Mit einem gekonnten Satz sprang er aus dem sicheren Versteck und hechtete ohne jeden unnötigen Laut auf den stattlichen Mann zu. Er warf ihn mit ungeheurer Wucht zu Boden. Der Jäger wusste nicht, wie ihm geschah, und lag geschockt auf dem Waldboden. Wortlos stellte der Angreifer sich über den hilflos auf der Erde Liegenden und sah ihm in die glasigen, schreckgeweiteten Augen, die ganz offensichtlich nicht begreifen konnten, was gerade geschah. Es war der Moment, als seinen Gegner unbändige Gier überkam. Ein letzter erhabener Blick aus glühenden Augen, dann packte er seine Kehle.
Sechs Wochen vorher
Marina hatte die wetterfeste Jacke fest verschlossen und stapfte in Turnschuhen und Sportkleidung auf dem Sandweg Richtung Niobe-Denkmal. Sie genoss die einsamen Deichspaziergänge am Abend, wenn kein Tourist mehr unterwegs war. Nur die Natur des Naturschutzgebietes Grüner Brink, der Wind und die endlose Ostsee. Sie liebte den Bodennebel, der langsam von der Seeseite über den Deich kroch, um sich auf dem Wall und dem umliegenden Gelände allmählich auszubreiten. Es klang kitschig, gab ihr dennoch das Gefühl von Freiheit, nachdem sie sich, fest eingebunden im Gewühl des Großstadtdschungels Berlin, ein Leben lang gesehnt hatte.
Es dauerte zwar eine Ewigkeit, aber nach endlosem Abwägen hatte sie die Zelte der lauten Hauptstadt hinter sich abgebrochen, um einen neuen, gemächlicheren Lebensabschnitt auf der Insel ihrer Träume auszuleben. Die ausgiebigen Wanderungen auf den endlosen Deichen und meist einsamen Stränden gehörten dazu. »Das ist alles, was ich will«, sagte sie ihrer Freundin immer wieder und guckte über die blaugrüne Ostsee. Sie fuhr sich mit der Hand durch die kurzen braunen Haare. Der Deichabschnitt, gesäumt von Linden, Birken und Tannen, glich einem Wäldchen. Die Gegend erinnerte durch die Birkenansammlung auf der rechten Seite ein wenig an die Lüneburger Heide. Lächelnd lief sie weiter.
Gerne würde sie jetzt Schuhe und Strümpfe ausziehen, um barfuß auf dem feuchten Untergrund zu laufen.
Aber sie hatte Angst, sich am Ende wieder zu erkälten. Dann würde ein Rückschlag sie von Neuem für Tage ans Bett fesseln.Nein danke,dachte sie und schüttelte den Kopf. Die letzte Grippe lag nicht lange zurück und hatte sie für geschlagene drei Wochen komplett außer Gefecht gesetzt. Sie schleppte sich noch immer ein wenig schlapp voran und stapfte weiter, angespornt vom milden Klima des Aprils. Am Ende des Deichstückes, das durch die Bäume dunkler, aber nicht unheimlich wirkte, sah sie die Lichtung, an der die letzten Sonnenstrahlen an diesem Abend festzukleben schienen.
Was für eine faszinierende Insel.Marina blieb stehen, bückte sich und hob einen Zapfen auf, der direkt vor ihren Füßen lag.
Sie wunderte sich, wie er dorthin gelangt war. Langsam drehte sie sich um und schaute zurück. Sie spürte das unangenehme Gefühl im Nacken, als wenn jemand sie beobachten würde. Aber da war niemand außer ihr. Weit und breit keine Menschenseele. Gedankenverloren steckte die 44-Jährige den Zapfen in die Jackentasche des blauen Anoraks, ohne ihn jedoch loszulassen. Es war ein angenehmes Gefühl in ihrer Hand. Ein Schmeichler, der ihre Sinne beruhigte. Kreischende Möwen und jede Menge Vögel, die sie keiner Gattung zuzuordnen in der Lage war, begleiteten ihren Spaziergang. Abgelenkt betrachtete sie die Umgebung, die sie vollends einnahm und nicht nach vorn schauen ließ.
Doch das ungute Gefühl in ihrer Magengegend verbesserte sich nicht.
Da ist jemand zwischen den Bäumen, mutmaßte sie und schaute sich irritiert immer wieder um. Vielleicht ist es besser, ich mach mich auf den Rückweg, überlegte sie. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Erneut blieb sie für einen Moment stehen. Dann schüttelte sie den Kopf und setzte weiterhin einen Fuß vor den anderen. Ich bin doch kein Gör, das Angst vor einer Wahrnehmung hat, lächerlich. Die schrill schreienden Möwen begleiteten sie und gaben ihr das Gefühl, nicht allein zu sein. Andächtig schaute sie den beiden Vögeln nach. Die Schatten der Bäume hatten die Mitte des Schutzdammes erreicht und streckten ihre dunklen Fühler aus. Sie lenkte den Blick wieder geradeaus und sah etwa 50 Meter vor sich etwas auf dem Deich stehen. Ein Schaf? Sie blinzelte, schärfte ihren Fokus, obwohl keine Sonne blendete.
Zögernd stiefelte sie weiter. Es war, als zöge das Objekt am anderen Ende sie an.Es ist an der Zeit umzukehren, grübelte sie, wollte abdrehen, aber die Füße bewegten sich von allein vorwärts. Solange es kein Hund ist,schluckte sie und verzog die Mundwinkel. Sie näherte sich dem Tier, und ihre Schritte wurden zögerlicher. Dafür beschleunigte sich ihr Herzschlag. Das sieht aus wie ein Hund, überlegte sie und blieb stehen. Diese Vierbeiner jedoch konnte sie nur an der Leine ihrer Besitzer leiden und das definitiv auch nur mittelprächtig. Sie wollte kein Feigling sein und marschierte mutig weiter.
»Man sollte sich seiner Angst stellen«, murmelte die zierliche Frau. Es schien, als suchte sie eine Formel gegen ihr mulmiges Gefühl.
Irgendwo muss sich der Besitzer des Köters schließlich aufhalten. Denn dass es ein Hund war, war mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Abermals überlegte sie, umzukehren und das Weite zu suchen. Doch einem Tier den Rücken zuzukehren, erschien ihr wenig sinnvoll. Ich könnte den Rückwärtsgang einlegen.Zögerlich trat sie einige Schritte zurück. Dann blieb sie abermals stehen. Marina besann sich, atmete tief durch und schlich klopfenden Herzens weiter Richtung Niobe-Denkmal. Sie wusste, dass wenige Meter weiter ein Weg durch das Naturschutzgebiet an den Strand führte. So musste sie nicht an dem Tier vorbei. Sie hatte vor, den Deich zu verlassen, sobald der Weg in Sichtweite war.Da wird schon jemand sein, der das Viech zurückruft.
Der vermeintliche Hund bewegte sich nicht einen Millimeter von der Stelle und starrte sie unentwegt an.
Es war kein Blick, der Angst einflößte, kein Knurren, das sie erschreckte. Das brenzlige Gefühl in ihrer Magengegend ergriff ohne ihr Zutun Besitz vom gesamten Körper. Was mache ich jetzt? Wenn ich umkehre, folgt der mir 100-prozentig und fällt mich womöglich an … Sie blieb unentschlossen stehen, knetete ihre schweißnassen Hände, die tief in den Taschen steckten. Sie kannte die richtigen Verhaltensregeln nicht. Ihr Puls beschleunigte sich. Da war keine Menschenseele, zu der das Tier zu gehören schien.
Niemand rief oder pfiff nach dem Hund, der ihr riesengroß erschien. Marinas Herz schlug bis zum Hals. Der Bodennebel, der schleichend über die Deichkrone gekrochen kam, verdichtete sich und das Tier stand, wie in einen Weichzeichner gehüllt, immer noch stocksteif da. Die Entfernung betrug jetzt allerhöchstens 30 Meter. Angewurzelt blieb sie stehen und bewegte sich keinen Zentimeter weiter. Ihre Blicke suchten den Ausweg, den schmalen Pfad zum Strand, während ihre Hand den Zapfen fest umklammerte, deren glatte Schuppen sich warm und weich anfühlten. Was, wenn das Tier sich nähert? Warum ist da niemand? Für einen Schäferhund ist der viel zu mächtig, dachte sie und schluckte. Ihr Hals war ausgetrocknet. Tränen traten in ihre Augen, als sie nach einem Fluchtplan Ausschau hielt.
Die dunkelgraue Zeichnung des Vierbeiners ängstigte sie noch mehr. Sie setzte erneut ihre Füße zurück, schaute nach hinten und suchte nach einem Weg. Zitternd erinnerte sie sich auf einmal an eine Sendung im Fernsehen, die sie auf einem Sender verfolgt hatte. Dort lief ein Bericht über einen Wolf, der auf der Suche nach einem eigenen Rudel unendlich lange Strecken in der Wildnis Alaskas zurücklegte.
Fasziniert war sie damals den Ausführungen gefolgt und hatte sich einige Merkmale des Tieres eingeprägt. Hohe Beine, kleine, dreieckige Ohren. Die hellen Flecken seiner Lefzen fielen ihr sofort ins Auge. Die Angst breitete sich wie ein Virus weiter in ihrem Körper aus.
Wenn das tatsächlich ein Wolf war, dann hatte sie nur wenige Möglichkeiten, sich aus der Gefahrenzone zu bewegen.
Die einzige Frage, die sie sich stellte, war: Wie kommt ein Wolf auf diese Insel? Automatisch machte sie weitere Schritte rückwärts. Adrenalin durchspülte ihren Körper und setzte sie in Alarmbereitschaft. Sie spannte sämtliche Muskeln an. Jetzt spinn nicht, Marina, dachte sie und blieb erneut stehen. Das ist nur ein Hund!
Sie suchte trotz der misslichen Lage nach einem Ast, um im Notfall eine Waffe in ihren Händen zu halten, mit der sie sich zumindest verteidigen konnte. Denn dass der Tannenzapfen in ihrer Jackentasche keineswegs weiterhelfen würde, war ihr in diesem Augenblick klar. Sie entdeckte ein Holzstück am Rande des Deiches, schlich langsam dorthin, um ihn aufzuheben. In dem Moment hörte sie einen lauten Knall. Erstaunt richtete sie sich auf und trat zurück auf die Deichnarbe. Sie wandte den Blick wieder in die Richtung, in der sie das Tier wahrgenommen hatte. Ihr Atem stockte …
*
Der Zigarettenqualm zog in dicken Nebelschwaden durch die Scheune. Laute Schlagermusik tönte vom Plattenteller des DJs. Die Stimmung wirkte ausgelassen. Marina betrat am gleichen Abend Bauer Falks Holzscheune in Albertsdorf.
Sie bemerkte, dass die Bewohner des gesamten Dorfes hier heute ihr Stelldichein gaben. Jeder Platz an den langen Holztischen war besetzt. Lautes Gelächter und gut gelaunte Gespräche erfüllten die musikgeschwängerte Atmosphäre. Marina hasste diese Menschenansammlungen, aber sich hier auszuschließen, zeugte nicht unbedingt von Dorfgemeinschaft. Letztendlich musste sie sich anpassen, wenn sie den Anschluss nicht verlieren wollte. Sie war schließlich keine gebürtige Insulanerin, sondern eine Zugereiste aus der Großstadt. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als sich selbst darum zu bemühen, wenigstens ein paar Kontakte für die dunkle kalte Jahreszeit auf der Insel zu knüpfen.
Seufzend stellte sie sich an den Tresen, der, aus massivem Eichenholz gezimmert, am Ende der Halle aufgebaut war. Die zarte Frau bestellte laut rufend ein Wasser. Die Kellnerin platzierte ein Glas und eine Wasserflasche direkt vor ihrer Nase. Marina drehte sich um und lehnte mit dem Rücken gegen das Holz. Ihre Ohren schmerzten bereits, dabei stand sie keine Viertelstunde im Gewühl.Jägerfest – was für ein Müll, dachte sie, blickte verächtlich in die Runde und schenkte lustlos Wasser ins Glas.
Obendrein zerrte sie fortwährend an ihrer Kleidung. Sie fühlte sich völlig deplatziert, was man ihrem grimmigen Gesichtsausdruck ansah. Marina trug eine schwarze Hose und dazu eine weiße Bluse. Jägerball, darunter hatte sie sich so etwas wie ein Fest mit nett gekleideten Menschen vorgestellt. Dass alle Anwesenden, außer der männlichen Jäger und ihr selbst, in Jeans und legeren Oberteilen erschienen waren, missfiel ihr zunehmend. Mit heruntergezogenen Mundwinkeln leerte sie das Glas. Ein Mann mittleren Alters stellte sich unverfroren neben sie. Er wankte bedrohlich und hatte eindeutig zu viel getrunken.
»Na Deern, so einsam?«, lallte er. »Da woll’n wir mal nicht so sein.«
Der Kerl in Jägerhemd und olivgrünem Pullover gekleidet, griff nach ihrem Glas, stellte es ohne eine Antwort abzuwarten, polternd auf der Tresenfläche ab. Mit festem Griff packte er sie an ihrem Handgelenk und zerrte Marina hinter sich her auf die Tanzfläche. Willenlos ließ sie es geschehen. Sie versuchte mit den ungelenken Bewegungen des Mannes Schritt zu halten und schaute auf den Boden.
Mitten in der Scheune hatten sie den Betonboden freigemacht, Sägespäne ausgeworfen, und jetzt tummelten sich hier etliche Leute, um nach Wolfgang Petrys Musik über das Parkett zu schweben. Oder eher zu fegen, weil sie bei jeder Drehung Unmengen Späne aufwirbelten.
Marina bewegte sich mitten in einem Déjà-vu. Wolfgang Petry, Tanzboden samt Sägespänen in einer Dorfscheune, umgeben von Spritköpfen und Schürzenjägern.
Sie lachte, obwohl ihr in dieser Situation nicht zum Lachen zumute war.
Das alles hatte sie in ihrer Jugend auf kleinen Dorffesten in den Ferien bei ihren Großeltern, die in einem Dorf nahe Berlin lebten, kennengelernt. Aber das war so lange her.
Ihr Gegenüber trat ihr, so oft er den akkuraten Schritt verpasste, auf die Füße, und sie hatte Not, ihren Schmerz zu unterdrücken. Es wurde geschwoft, geschubst und gedrängelt. Der Tänzer, der sie wie ein Holzstück im Schraubstock seiner Arme gefangen hielt, schleuderte sie über den rutschigen Tanzboden, dass ihr schwindelig wurde.
Seufzend ließ sie das Gezerre über sich ergehen und war erleichtert, als das Lied endlich zu Ende war. »Mädchen, wir trinken nun noch einen, sollst mal sehen, das macht bessere Laune. Du machst ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter, bist doch wohl keine Spaßbremse, oder? Aber das haben wir gleich.«
Erneut zerrte er sie, dieses Mal Richtung Sekttresen, der am anderen Ende der Scheune, direkt neben dem Eingangstor aufgebaut war. Die Leute in der riesigen Halle schienen allesamt in Bestlaune zu sein. Alle, außer ihr …
Es kam ihr vor, als hätte sie als Einzige nicht den geringsten Spaß an dieser Veranstaltung. Sie war eben doch eher ein Stadtmensch und kein Landmädel. Eine Traube gut gelaunter Männer und Frauen drängte sich um den Sektstand. Die Gespräche dröhnten in ihren Ohren, und sie schüttelte den Kopf, als schwirrte ein riesiger Bienenschwarm um sie herum.
Schweißnass drückte ihr der Unbekannte, der sich ihr als Arne Olsen vorgestellt hatte, das Sektglas in die schmale Hand. Die Frau hinter dem Ausschank schien ihn zu kennen. Er war offensichtlich bekannt, denn es dauerte keine zehn Sekunden, da perlte der Schaumwein auf ihrer Zunge. Andere Gäste dagegen warteten bereits geraume Zeit auf ihre Drinks. Ihr war es egal. Hastig ließ sie das lauwarme Getränk die Kehle hinunterlaufen. Sie genoss das Prickeln im Mund, die Wärme, die sich in ihrem Magen ausbreitete. Das Glas war kaum leer, da hielt sie das nächste bereits in der Hand. Eine zarte Röte stieg ihr ins Gesicht, und sie spürte das Kribbeln, das der Alkohol in ihrem Blut verursachte.
Auf einmal fand sie es gar nicht mehr so schrecklich in dieser laut lärmenden, verrauchten Scheune auf dem Jägerfest und ließ sich nicht zweimal bitten, als ihr ein weiteres Glas von einem herb aussehenden Mann gereicht wurde. Der etwa 50-Jährige trug eine Sonnenbrille auf dem Kopf, und sein Bart besaß eine eigentümliche Form, die einschüchternd wirkte. Er erinnerte sie an einen Rocker, der seiner Zeit hinterherhinkte. Selbstbewusst griente er und prostete ihr zu. Marina lächelte ebenfalls, was der unangenehme Kerl sofort als Einladung deutete. Er zog sie mit sich auf die Tanzfläche und wiegte sie nach einem langsamen Jazz-Song über den Tanzboden.
Dieses Mal bewegte sie sich wie eine Feder. Selbstsicher führte der Landwirt sie über den Betonboden. Der Alkohol benebelte ihre Sinne. Sie lehnte zufrieden gegen den Mann, der sie wie selbstverständlich an sich drückte. Den Arm fordernd um ihre Hüfte gelegt, dirigierte er sie zurück an den Tresen. Er schien es für normal zu halten, sie wie einen Besitz festzuhalten. Marina schob ihn sanft von sich, rückte einen halben Meter zur Seite und versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, damit er abgelenkt war.
»Ich glaube, ich habe heute einen Wolf gesehen«, sagte sie mit weicher Stimme.
»Du hast was?«, lachte er so laut, dass die Umstehenden jedes weitere Wort verstehen mussten.
»Ich habe einen Wolf … oder zumindest etwas Ähnliches gesehen, als ich auf dem Deich nach Niobe spazieren gegangen bin«, rief sie wesentlich lauter und bereute gleichzeitig ihren Satz. Sie fuhr sich nervös mit der Hand durch die kurzen, verschwitzten Haare. Ungläubig guckte der Mann, der sich ihr als Michael Bruns vorgestellt hatte, sie an und tippte mit dem Finger gegen seine Stirn.
»Blödsinn«, rief er und sah sie abschätzend von oben herab an. »Es gibt auf der Insel keine Wölfe. Das war irgendein Schäferhund von einem Touri oder was weiß ich. Aber ein Wolf – nee, die gibt es hier nicht«, erwiderte er in einem abfälligen Ton, der ihr eine Gänsehaut über den Rücken laufen ließ. Marina spürte, dass er augenblicklich das Interesse an ihr verlor. Die Leute, die sich links und rechts der beiden drängelten, drehten unaufgefordert ihre Köpfe in Marinas Richtung.
Dieses Thema, das seit Jahren in der Presse immer weiter hochkochte und die Gemüter der Bevölkerung ziemlich entzweite, war bisher auf der Insel nicht als ernst zu nehmend angekommen.
Hier gab es weder Luchse noch Waschbären, geschweige denn Wölfe, die in Deutschland zum Leidwesen vieler Menschen vermehrt auftraten.
Einzig ein paar Maulwürfe hatten bislang den Weg auf die Insel geschafft. Und vereinzelt tauchten seit geraumer Zeit wie von Zauberhand Wildschweine auf dem Eiland auf. Aber Wölfe. »Du bist doch betrunken«, rief einer, der unmittelbar neben Bruns sein Bierglas leerte.
»Bin ich überhaupt nicht. Er war urplötzlich wieder verschwunden. Aber es kann euch ja auch egal sein.«
»Da machen wir kurzen Prozess. Die ballern wir gleich ab! Die haben hier null Komma nichts zu suchen, die Biester.« Damit war die Ansage des Bauern Arne Olsen erledigt. Er hob die Hände und deutete eine Waffe an. »Pch … pch … so geht das bei uns.« Lachend drehte er sich wieder seiner Begleitung zu, die in schrilles Gelächter einstimmte. »Das ist absolut verboten, das sollten Sie als Jäger doch wissen.« Aufgebracht hielt sie die Luft an.
»Ist egal«, flüsterte sie. »Ich weiß, was ich gesehen habe.« Marina hatte genug. Sie war wütend und würde diese ominöse Jägerparade auf der Stelle verlassen.
»He, Mädchen, musst ja nicht gleich beleidigte Leberwurst spielen.« Bruns packte ihren Arm und riss sie zu sich herum. »Komm, wir trinken einen! Und dann bring ich dich Schätzchen nach Hause«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Wir sollten das Thema noch mal alleine unter vier Augen besprechen«, sagte er leise und sah sie mit forderndem Blick und einem überheblichen Grinsen an. »Oder?«
»Ich will aber nicht!«, antwortete sie aufgebracht und riss ihren Arm zurück, den er noch immer fest umklammert hielt.
»Lass sie jetzt in Ruhe«, entgegnete ein Mann Ende 20 in Jeans und T-Shirt und stieß die Hand des Bauern von ihrem Arm.
»Du hast gar nichts zu melden. Einer vom Festland sollte lieber die Klappe halten, sonst …«, starrte Bruns den jungen Mann missbilligend an.
»Was sonst?«, baute sich der schlanke Mann, der fast einen Kopf kleiner war, vor dem Bauern auf. »Willst du mich dann auch erschießen?«
Bruns hob die Faust und fuchtelte damit vor der Nase des jungen Mannes herum. »Halt die Fresse!«
Marina hielt es für klüger, umgehend die Veranstaltung zu verlassen, bevor die Geschichte weiter hochkochte. Wenn genügend Alkohol im Spiel war, konnte die Stimmung schnell kippen, das hatte sie auf vorherigen Feiern erlebt. Sie wandte sich ab und wollte zum Ausgang marschieren, als ihr jemand mit dem Finger auf die Schulter tippte.
»Warte, sag mal, ist das wahr?«, fragte der smarte dunkelhaarige Mann, der dem vorangegangenen Gespräch zugehört hatte. Marina drehte sich ihm zu und sah ihn forschend an.
»Ja, aber ich will nicht mehr darüber reden. Das glaubt mir sowieso niemand.« Sie würde aufbrechen, zu Hause ein Buch lesen und sich auf der Couch gemütlich unter eine Decke kuscheln.
»Doch, ich glaube es dir!«
»Ne, lass man. Ich will los.« Sie ließ ihn stehen und suchte den Weg nach draußen. Im weit geöffneten Scheunentor atmete sie tief durch und begab sich auf den Weg nach Hause.
Der junge Mann kehrte zurück an den Tresen und schaute Marina hinterher, bis sie im Dunkeln verschwunden war.
Seine Gedanken fingen an zu rotieren, als ihm Bruns auf die Schulter klopfte und rief: »Du solltest hier auch besser verschwinden. Solche wie dich brauchen wir nicht.«
»Du hast gar nichts zu melden«, antwortete Dietrich. Er drehte sich um. Ohne Vorwarnung riss der Landwirt ihn zurück.
Der Schlag auf seine Nase ließ Dietrich taumeln, und der stechende Schmerz nahm ihm die Luft zum Atmen. Dann ging er zu Boden.
»So, das reicht mir jetzt, Michael, es ist genug. Du hast sie doch nicht alle. Sieh zu, dass du nach Hause kommst! Es reicht – oder muss ich dir Beine machen?« Arne Olsen sah Michael Bruns an. »Du entschuldigst dich augenblicklich und dann gehst du!«
Wortlos half der Landwirt dem am Boden liegenden Dietrich Jensen wieder auf die Beine.
»Verschwinde, ich will dich heute Abend nicht mehr sehen.«
Bruns drehte sich wutschnaubend um und verließ wortlos das Jägerfest.
Aus sicherer Entfernung beobachtete der Bauer und Mitglied der Jägergruppe Walter Jacobsen die Szene und grinste.Das läuft ja besser, als ich dachte. Wenn der Bruns so weiter macht, ist mein Weg bald frei.
»Jensen, lass uns nun mal auch Schluss machen, ist schon aasig spät«, sagte Olsen zum jungen Dietrich Jensen. Er blickte auf seine Armbanduhr und winkte die Kellnerin heran, um zu zahlen.
»Ja, aber wenn das stimmt, was die Frau vorhin erzählt hat, dann … dann sollten wir vielleicht die Ersten sein, die ihn zu fassen kriegen, oder was meinst du?« Der Landwirt blickte ihn lange aus glasigen Augen an.
»Keine Ahnung«, sagte er leise. »Du könntest recht haben.« Jensen spürte, dass es in dem Bauern arbeitete. »Weißt du was? Du fährst nach Hause und ich mach mir mal ein paar Gedanken.« Er stand auf, ging zum Tresen und beglich die Rechnung. »Und du hältst dein Maul, hast du verstanden?«
Jensen nickte und sie verließen das Fest.
Fünf Tage später
Die ersten Sonnenstrahlen brachen durch die dichte Wolkendecke. Es wäre eine Frage der nächsten Minuten, dann setzten sie sich durch und die Wolken verschwanden.
Hanno Albers lief in Gummistiefeln über die Weide und genoss die morgendliche Ruhe. Die Hände hatte er in die Taschen seiner grünen Wachsjacke gesteckt. Es war kurz nach 7 Uhr morgens, als er durch das feuchte Gras stapfte. Den Blick zum Himmel gerichtet, lauschte er dem Möwengeschrei. Er gähnte, obwohl er ausgeschlafen hatte. Um diese Zeit sah er auf dem Deich nach dem Rechten. Die Durchgänge hatte er zu kontrollieren. Seine Schafherde graste seit Wochen unweit des Leuchtturms von Westermarkelsdorf. Hanno stiefelte über den Parkplatz und begab sich auf die Anhöhe. Das grüne Holztor war wie immer mit einem Riegel verschlossen. Er öffnete das quietschende Gatter und schloss es sorgfältig wieder, nachdem er durchgegangen war.Nicht auszudenken, wenn die Tiere ausbüxen. Aber irgendetwas gefiel Hanno heute Morgen nicht. Er nahm die Stille wahr, die ihn umgab, und stiefelte den schmalen ausgetretenen Pfad auf der Deichkrone entlang. Der Schafbauer suchte die Herde, die um diese Uhrzeit normalerweise hier im Umfeld des vanillefarbenen Turms mit der roten Haube graste. Die Wellen rollten hinter dem Deich gemächlich heran und brachen sich knisternd am Strand.
»Wo sind die?«, murmelte er leise. Er entdeckte keines der 60 Tiere. Seine Hände fingen an zu schwitzen. In immer schneller werdendem Tempo eilte er in großen Schritten voran und pfiff lauthals durch die Zähne.
Vor dem Leuchtturm floss ein breiter Graben, in dem sich nichts rührte. Langsam wurde er nervös. Er flötete und rief nach seinen Schafen.
Vielleicht sind die im Schilf,überlegte er und wanderte, mit einem Blick das Gelände erfassend, zwischen den Halmen hindurch, die sich bis zu den Dünen erstreckten. Aber nicht ein einziges der Tiere war in Sichtweite. Langsam breitete sich in Hanno ein mulmiges Gefühl aus. Die Tore waren verschlossen.
Keines der Schafe konnte das Areal verlassen. »Geklaut, die haben mir meine Hammel …«, murrte er, als er etwas Rotes auf dem Gras liegen sah. »Mann, jetzt lassen die ihren Müll sogar auf dem Deich rumliegen.« Wütend wetzte er weiter. Der Schafbauer Mitte 40 kratzte sich den dunkelblonden Haarschopf. Nach fast 30 Metern blieb er wie angewurzelt stehen.
Erschreckt legte er eine Hand über den Mund und bekam Atemnot. Das war kein Müll! Vor ihm lag eines seiner Schafe. Tot! Es sah aus, als hätte jemand es aufgeschlitzt. Der gesamte Bauchraum war geöffnet. Hanno trat näher, sein Herzschlag fing an zu stolpern. So etwas hatte er vorher noch nie gesehen. Alle Farbe wich aus seinem Gesicht, als er sich zu dem Jungtier herunterbeugte. Eine ekelerregende Offenbarung war das, was sich ihm zeigte. Der Bauer fiel auf die Knie und starrte auf das tote Tier. Der weit aufklaffende Bauchraum sah wie gewaschen aus. Das Muskelfleisch der Keulen war angefressen. Hanno würgte. Er hatte vieles gesehen, aber darauf war er nicht vorbereitet.
»Was zum Teufel?«, schrie er. Der Bauer sprang auf, pfiff laut nach seinen Schafen. Er rief lautstark, während er zeitgleich das Handy aus der Hosentasche zog.
Leise hörte Hanno Albers eines der Jungtiere blöken. Es klang verängstigt. Hastig lief er ein paar Meter weiter und wartete, dass am anderen Ende der Leitung endlich jemand den Hörer abnahm.
Er rutschte die Deichnarbe hinunter und zwängte sich in das Schilfgras. Die grüne Deichpforte war geöffnet. Das Holz gebrochen, der Pfahl aus der Erde gerissen.Was war hier los?, fragte er sich und schlängelte sich durch die Öffnung. Dann entdeckte er seine Herde versteckt zwischen dem Schilf. Die Tiere kauerten eng aneinander und fingen gemeinschaftlich an zu plärren, als sie den Bauern erkannten.
»Ja, Karl. Gut, dass du rangehst. Du musst sofort kommen! Wir haben, wenn ich mich nicht täusche, einen Riss auf dem Deich. Eines der Jungschafe … ja, das sieht nicht gut aus … ich weiß nicht. Merkwürdig. Vielleicht ein wilder Hund! So etwas habe ich überhaupt noch nie gesehen.«
Hanno versuchte, sich um die Herde herumzuschlängeln, die keine Anstalten unternahm, ihr sicheres Versteck nur einen Meter zu verlassen. Behutsam zog er eines der Mutterschafe mit einer Schlinge hinter sich her, in der Hoffnung, die anderen würden ihm folgen. Stur verharrten sie in ihrer Haltung und ließen sich nicht locken. Hanno seufzte und ließ sie in ihrem Zufluchtsort.
Er musste sie später mit Karl zurück auf den Deich holen. Angespannt trottete er zurück zu dem gerissenen Schaf. Hannos Blick wanderte über die Ostsee. Er steckte die Hände in die Taschen seiner Wachsjacke. Ihn fröstelte, obwohl die Sonne die letzten Wolken mittlerweile verdrängt hatte und wärmend auf ihn herabstrahlte.
Das kann nicht sein … nein, das gibt es nicht. Was für ein Viech hat das angerichtet? Zum Teufel! Von Weitem sah er Karl in Gummistiefeln auf sich zusteuern. Keuchend erreichte der Mann mittleren Alters Hanno.
»Na, nun zeig mal, was du da entdeckt hast.« Der Landwirt deutete schweigend auf das gerissene Schaf am Boden und hielt sich bestürzt die Hand vor den Mund. »Mann oh Mann, was für eine Sauerei.« Karl hockte sich hinunter, stützte die Hände auf seinen von der Feldarbeit verschmutzten Jeans ab und sah sich den Kadaver genauer an. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass es ein wilder Hund war«, sagte der Betriebshelfer. Er schüttelte den Kopf und öffnete mit den Händen die aufgebrochenen Rippen. Karl untersuchte den Bauchraum, der fast leer gefressen war.
»Wenn das ein Hund war, fresse ich einen Besen.«
»Da sind nur der Pansen und der Magen drin.«
»Wie, der Pansen und Magen?« Hanno schaute ihn entsetzt an.
»Mensch Hanno, das müsstest du als Jäger eigentlich wissen. Wilde Hunde fressen Pansen. Aber ein … du wirst mich sicher für verrückt halten … ein Wolf nicht.«
»Natürlich weiß ich das, aber …«
»Nichts aber. Wenn du mich fragst, dann haben wir ein Riesenproblem auf der Insel. Lass das nicht wahr sein. Denn dann gnade uns Gott.«
»Nun mach nicht gleich die Pferde scheu«, sagte Hanno Albers. »Das behalten wir erst mal für uns. Wir packen das Tier ein, und ich rufe den Wendt an. Der soll sich das Schaf genauer ansehen. Hol mal die Plane aus dem Auto, dann … ach ja, die restlichen Tiere sind im Schilf. Die holen wir im Anschluss da raus.«
Hanno zeigte mit dem Finger auf die Stelle, an der die anderen Schafe kauerten.
»Jo, machen wir. Wie sind die denn da runtergekommen?«
»Das kann ich dir nicht sagen. Das Tor ist zerstört. Die müssen fürchterlich Panik gehabt haben und durch das Gatter gedrängt sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der gesamte Pfahl ist rausgerissen.« Karl sah ihn irritiert an. »Das bestätigt meine Vermutung nur. Die Tiere haben vor irgendetwas eine Heidenangst bekommen. Und ich bin mir sicher, wir haben ein Problem! Die Schafe müssen hier unbedingt weg, sonst …«
»Was sonst?«, fragte Hanno entsetzt und raufte sich die Haare.
Eine Stunde später hatten die Männer das tote Tier im blauen Ford Ranger auf den Hof gebracht und hinter der Absperrung für die Ponys abgelegt. Hanno telefonierte und wartete auf den Tierarzt.
*
»So, meine Herren, ich bin dann mal weg.« Hauptkommissar Dirk Westermann schob die Schreibtischschublade zu, verschloss sie und erhob sich von seinem Stuhl. Drei der anwesenden Kollegen nickten und verabschiedeten sich mit einem »schönen Urlaub und ruh dich endlich mal aus!« von ihm und wandten sich wieder ihrer Arbeit zu.
Die Fenster im Büro waren weit geöffnet, und ein Hauch feuchtwarmer Luft strömte in den ohnehin stickigen Raum. Westermann stellte sich kurz vor die Fensteröffnung und schaute versonnen hinaus. Ein graues Wolkenband zog über den Himmel, und es hatte den Anschein, als würde es Gewitter geben. Ein leises Seufzen entrang seiner Kehle, und er drehte sich um, bereit, dieses Büro für wenigstens sieben Tage den Mitarbeitern zu überlassen.
Die letzten Wochen und Monate hatten am Nervenkostüm gezerrt, und er war, im wahrsten Sinne, reif für die Insel. Sein graues Haar schien seitdem noch eine Nuance weißer geworden zu sein. Die schwierigen Fälle, die er und sein Team seit fast drei Jahren bearbeiteten, hatten sie alle verändert. Die Leichtigkeit war einer zum Teil melancholischen Stimmung gewichen. Jedem im Kollegenkreis war mittlerweile klar, dass es selbst im ländlichen Raum mehr böse Begebenheiten gab, als mancher sich vorzustellen in der Lage war. Geschichten, die tief in den Abgrund zerstörerischer Seelen blicken ließen.
Westermann schüttelte sich unmerklich. Langsam schob er die rechte Hand in die Tasche der Jeans.
»Ja, so gut möchte ich es auch mal haben«, feixte Thomas Hartwig, der ebenfalls vom Schreibtisch aufstand, nach der Jeansjacke griff und seinen Vorgesetzten aus der Grübelei riss. Er fächerte sich Luft zu und stieß die Tür zum Flur auf.
»Wieso, Jungchen? Du hast doch Feierabend.«
»Aber keine Woche frei«, murmelte er.
»Du wirst es überleben«, lachte Westermann, zog die Hand aus der Tasche und schlug sie seinem Kollegen auf die Schulter. »Kannst ja am Wochenende nach Fehmarn kommen, dann surfen wir!«
»Wir?«, lachte Thomas laut und stellte sich dem Chef gegenüber.
»Du siehst gut aus, aber ob du jemals das Surfen lernst?«, bemerkte Hartwig und betrachtete seinen Vorgesetzten, der in graublauem kurzärmligen Shirt, das er leger über die Jeans trug, vor ihm stand.
Die Bräune an Armen und Gesicht stand ihm und verstärkte den Kontrast der weißen Haarpracht und des grau melierten Dreitagebartes. Thomas Hartwig fuhr sich mit der Hand durch die verschwitzten Haare. »Du kannst dich doch gar nicht auf dem Brett halten. Das dauert ewig. Lass mal gut sein. Fahr du mal zu deiner Katrin. Aber ich komme euch gern einen Tag auf der Insel besuchen.« Hartwig grinste und drehte sich zur Tür. Gemeinsam verließen sie das Büro.
Westermann schwenkte die dunkelbraune Lederaktentasche und marschierte Richtung Parkplatz.
»Und was willst du ganze zwei Wochen auf Fehmarn? Ich meine, außer Katrin zu beglücken?«
»Faul sein und einfach nur ausspannen, ein wenig schlafen«, entgegnete Dirk und sah Thomas an. Hartwig registrierte, wie müde Dirk Westermann trotz der Bräune um die Augen herum aussah. Tief liegende Schatten hatten sich wie Brandmale in die Haut geprägt. »Du solltest dich mal richtig ausschlafen. Rund um die Uhr. Mit ein bisschen schlafen ist es bei dir nicht getan.« Thomas zwinkerte.
»Na dann – viel Spaß. Erhol dich gut. Meld dich, wenn dir zu langweilig wird. Dann machen wir zwei mal ein richtiges Fass auf, auf deiner Insel.«
Hartwig schob die Ärmel des verwaschenen grauen Shirts hoch und stieg in den Wagen. »Und dir auch ein erholsames Wochenende. Sieh zu, dass alle Verbrecher hinter Schloss und Riegel kommen.«
Dirk Westermann setzte sich ebenfalls in seinen Wagen, warf die Ledermappe neben sich auf den Beifahrersitz und öffnete das Seitenfenster. Dann startete er den Motor und rollte vom Parkplatz der Dienststelle in Oldenburg.
*
Das verendete und ausgeweidete Tier lag immer noch auf der gleichen Plane ausgebreitet auf dem Hof von Hanno Albers. Um ihn herum standen seine Frau Annerose, die nur Anne gerufen wurde, und sein Sohn Finn, der vor wenigen Minuten vom Fußballtraining nach Hause gekommen war.
»Das ist ja ’ne echte Sauerei«, rief der Schüler und steckte die Hände in die Hosentaschen seiner Jeans. »Das war sicher ein wilder Köter.«
»Ich weiß nicht«, entgegnete Hanno, »das sieht merkwürdig aus. Und Karl meinte …«, Hanno stöhnte, verschränkte die Arme vor der Brust und stoppte mitten im Satz.
Er hielt nichts davon, sich von der Schwarzmalerei eines Mitarbeiters anstecken zu lassen, der mittlerweile wieder bei der Arbeit auf dem Feld war.
Der Landwirt lief verunsichert vor der Plane auf und ab. Er nahm einen Finger in den Mund und kaute auf dem Nagel herum.
Immer wieder schaute er auf die Armbanduhr, während er auf den Viehdoktor Wendt wartete. Er war ein alter Freund der Familie und versorgte nach der Übernahme des Hofes durch Hanno weiterhin die Tiere. Ein paar Gästekinder standen unweit des Zaunes und versuchten einen Blick auf das tote Schaf zu werfen. Viel zu sehen gab es nicht, der Landwirt hatte den Kadaver hinter die Absperrung gelegt, sodass Holzbalken die Sicht behinderten.
In diesem Moment kam Armin Wendt mit seinem Jeep auf den Hof gefahren. Der grauhaarige Mann parkte den Wagen direkt vor dem Holzzaun, stellte den Motor aus und stieg aus.
»Moin Hanno, na, was gibt’s so Dringendes?«
»Das musst du dir selbst ansehen! Ich bin ein wenig sprachlos. Eines meiner Schafe ist gerissen worden. So etwas habe ich vorher nie gesehen. Karl meinte, es wäre ein … aber sieh es dir an.«
Armin Wendt gelangte gleichzeitig mit Hanno durch ein Tor in die Absperrung. Stirnrunzelnd beugte er sich über das Tier. Er zog sich Gummihandschuhe an, hockte sich hin und wurde blass.
»Was ist? Kannst du mir sagen, wer oder was das gemacht hat?« Angespannt sah er den Tierarzt an, der das gerissene Schaf eingehend betrachtete.
Dieser zog die Augenbrauen hoch und sah Hanno Albers an. »Du weißt, dass du das Tier nicht vom Fundort hättest wegbringen dürfen?«
»Nein, woher soll ich das denn wissen? Und warum hätte ich es liegen lassen sollen?«
»Damit sie alle Spuren sichern können.«
»Was für Spuren? Das Schaf ist gerissen worden, dafür brauche ich keine Spurensicherung! Und wer ist sie?«
»Mal langsam, Hanno. Das hier ist ein Riss – wer auch immer das getan hat. Ein wilder Hund, oder ein …« Er schüttelte den Kopf. »Dem muss nachgegangen werden. Du hättest es liegen lassen müssen, damit ein Rissgutachter nach Hinweisen suchen kann. Wenn das hier kein Hund war, brauchen wir Beweise. Du hast sehr wahrscheinlich wichtige Spuren verwischt. Habt ihr das Tier angefasst?«
»Ja, was glaubst du denn. Wie meinst du, haben wir das Schaf hierher befördert?«
»Hattest du Handschuhe an?«
»Nein, natürlich nicht!«
»Hast du den Fundort abgesperrt, ich meine abgesichert, damit dort niemand umherläuft und …«
»Ach, du spinnst doch wohl! Wir sind hier nicht beim Tatort! Mann, Armin. Das war irgendein biestiger Köter.« Hanno schnaubte und stemmte die Hände in die Hüfte.
Der Veterinär seufzte. Ihm war klar, dass niemand auf die Idee kommen würde, hier auf der Insel etwas anderes als einen wilden Hund zu vermuten.
»Aber zur Absicherung müssen Tier und Fundort auf jeden Fall untersucht und begutachtet werden! Du kommst nicht drum herum. Dein Schaf muss augenblicklich in die Tierpathologie. Wenn das etwas anderes als ein Hund war, dann prost Mahlzeit! Ich habe da eine Vermutung aber … Ich telefoniere und wir schauen, was wir machen sollen.«
»Was für eine Vermutung?« Hanno trat von einem Fuß auf den anderen. Armin Wendt hob abwinkend die Hand. »Später. Ich muss das erst klären.«
»Ja, und was machen die mit meinem Tier? Kannst du mir das wenigstens erklären?«
»Das Tier wird eingehend untersucht! DNA-Untersuchung, Bissspuren. Ich denke, das Fell muss runter.«
»Wieso muss das Fell runter?« Hanno wurde bleich.
»Wenn ich mich nicht irre … und ich irre mich selten, dann hat das hier«, er deutete auf das tote Tier, »ein Wolf angerichtet.«
»Jetzt fängst du auch noch an. Mann, wir haben keine Wölfe! Ihr habt sie doch nicht alle. Es gab hier nie auch nur einen Wolf!«, schrie Hanno.
»Aber so, wie das hier aussieht, war das kein Hund. Sieh mal.« Wendt griff vorsichtig in den Bauchraum und zeigte Hanno Magen und Darm des Tieres. »Ein Wolf frisst das meistens nicht und so sauber, wie das Schaf ausgeweidet wurde, deutet alles darauf hin. Die Keulen sind angefressen und weitere Spuren sind nicht sichtbar. Ein Hund richtet äußerlich wesentlich mehr Schaden an.« Unschlüssig stand Hanno neben dem Tierarzt. »Ich rufe jetzt an und erkundige mich, wen die schicken.«
»Mach bitte nicht die Pferde scheu. Hier streunt irgendein wilder Hund herum.« Hanno Albers war sämtliche Farbe aus dem Gesicht gewichen.
»Bleib ruhig, wenn das hier ein Wolf war, dann haben wir ein richtiges Problem und bald die ganzen Tierschützer und Wolfsberater vor Ort. Bete, dass du recht hast!«
»Lass das Tier und verschwinde sofort von meinem Hof!«
Hanno war kreidebleich, zerrte Armin Wendt am Kragen seiner Jacke zurück und stieß ihn aus der Absperrung.
Der Tierarzt wusste, was in Hanno vorging, und hielt es für besser, das Ganze sachlich abzuhandeln.
»Verpiss dich und lass mich fürs Erste in Ruhe, hörst du!«
»Aber vorher packe ich das Tier ins Auto!«
Einen Tag später
»Jette, so funktioniert das nicht! Ich habe keine Lust mehr, dich weiterhin mit dem beknackten Schwachmaten zu teilen. Dieser Kerl geht mir schon lange tierisch auf den Keks. Es wird Zeit, dass du dich für eine Seite entscheidest.«
Dietrich Jensen stand vor Jette Olsen, knetete die Hände und schaute unentwegt zu seinen Turnschuhen. Kleine Schweißperlen liefen die Schläfen hinunter und die Augenlider flackerten unkontrolliert. Er sah die junge Frau immer wieder kurz an, dann wanderte der Blick zurück zu den Schuhen. Sie spielte unablässig mit ihren blonden Locken, zog die Augenbrauen hoch und verzog den Mund. Wie süß sie aussieht, dachte er und schluckte. Er griff in ihre langen Haare und zog sie ruppig zu sich.
»Ich will dich, hörst du … aber ganz.« Damit stieß er sie wieder von sich.
Jette riss die Augen auf und schnaubte. Sie verabscheute es, wenn Männer so mit ihr umsprangen. Auf der anderen Seite schien es ihr zu gefallen, denn sie schlängelte sich an ihn und kokettierte: »Nun sei bitte wieder lieb.« Die 23-Jährige formte eine Schnute, der Dietrich normalerweise nicht widerstand. Sie war sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst. »Wir wollen doch nicht streiten.« Sie kippte die Hüfte nach vorn, was einer Aufforderung gleichkam. Dietrich betrachtete Jette, die ihm in enger Jeans und aufreizendem Top barfuß gegenüber stand und all ihre weiblichen Reize gegen seine schlechte Laune einsetzte.
»Ach, Didi, sei nicht sauer. Ich kann doch nichts dafür, dass der Alte mich nicht in Ruhe lässt. Glaubst du, ich hab Bock auf den ekelhaften Sack? Der könnte mein Vater sein.« Sie schmiegte sich an Dietrich Jensen, der stocksteif vor ihr stand.
Er spürte ihren erhitzten Körper durch sein Shirt und wollte sie abweisen, aber sie roch verdammt gut.
Sie nutzte die Gelegenheit und drängte ihn zurück, sodass er sich unweigerlich auf den hinter ihm liegenden Baumstamm setzen musste. Schnell setzte sie sich auf seinen Schoß. Bereitwillig presste sie ihren schlanken Körper an seinen.
»Ne, lass mal. Ich hab keinen Bock auf diese kleinen Techtelmechtel hier im Wald.« Er schob sie von sich und sprang auf.
»Nie treffen wir uns bei dir! Dauernd irgendwo im Wald oder Auto. Wenn wir nicht aufpassen, sieht uns jemand und dann ist es vorbei mit Didi. Verstehst du? Ich will dich, und zwar ganz!« Jette führte seine Hand unter ihr knappes Top. »Sei wieder lieb«, hauchte sie ihm ins Ohr und drückte seine Finger auf ihre Haut. Sie wusste, dass sie ihn dort hatte, wo sie ihn haben wollte. »Du weißt doch genau, dass ich mir das nicht ausgesucht habe, oder?«
Es war die Wahl ihres Vaters, der sie dazu gezwungen hatte, sich auf diese lächerliche Verlobung mit Michael Bruns einzulassen. Er sprach von wichtigen Beweisen, die sie nicht verstand und ihn unglücklich machen würden, wenn sie sich seinem Wunsch nicht fügte. Jette wehrte sich vehement, bis ihr Vater sie das erste Mal schlug. Die Ohrfeige, die Arne Olsen ihr verpasste, war so heftig, dass sie zu Boden fiel. Er hatte sie nie vorher geschlagen. Seit ihre Mutter vor mehr als zehn Jahren starb, waren sie ein Herz und eine Seele. Das änderte sich erst in dem Moment, als Michael Bruns in ihr Leben trat. Dieser unangenehme Mann musste schon tatkräftige Argumente in Händen halten, dass er, ein Jagdfreund ihres Vaters, dermaßen Einfluss auf ihre Zukunft nehmen konnte. Arne Olsen sperrte seine Tochter zu Hause ein und ließ sie nicht mehr aus den Augen, bis sie schließlich einwilligte, die Verlobung mit dem Mann einzugehen. Sie kam sich vor wie in einem schlechten Heimatroman. Weil sie ihren Vater abgöttisch liebte, überwand sie ihre Abneigung. Immer öfter ließ sie sich von dem Landwirt und leidenschaftlichem Jäger Michael Bruns zum Essen ausführen, in die Bars der Insel und auf Dorffeste begleiten. Sie trank mehr, als ihr guttat, wenn er sie anfasste, und irgendwann spaltete sie die Liebesdienste, wie sie sie nannte und die er einforderte, von ihrer Seele ab. Sie ließ es geschehen, in dem Gedanken, dass sie ihrem Vater half.
Nach über einem Jahr Beziehung mit Michael Bruns lernte sie auf einem Bauernfest den jungen, attraktiven und überaus schüchternen Dietrich Jensen kennen und verliebte sich augenblicklich in ihn. Es brauchte nicht viel. Einen Tanz, ein paar Blicke, und es war um sie geschehen. Vorerst verschwieg sie ihre Beziehung zu Bruns, aber schon nach kürzester Zeit fielen ihr keine Ausreden mehr ein, warum sie sich nicht ständig und überall treffen konnten. Sie erzählte ihm von dem Pakt, den sie mit ihrem Vater geschlossen hatte. Dietrich schwieg, aber hielt sich vorerst an die von ihr vorgegebenen Spielregeln. Wenngleich es ihm immer schwerer viel, diese abstruse Beziehung zu akzeptieren.
»Hörst du mir überhaupt zu?«, sagte er und streichelte mit den Fingern versöhnlich über ihre kleine Brust. »Ich rede mit deinem Vater.«
»Nein, das darfst du nicht«, schrie sie. »Niemals! Dann ist es aus mit uns!«
*
Wenig später schloss sich die Tür. Es war stockdunkel im Zimmer. Bei jedem Schritt knarrte der Dielenboden. Obwohl die Vorhänge nicht zugezogen waren, fiel keinerlei Licht in den Raum. Ich muss die Taschenlampe anschalten, sonst finde ich hier gar nichts. Der Lichtkegel der Lampe streifte ein riesiges Bücherregal, das sich über die gesamte linke Wand erstreckte.Alter, wie viele Bücher kann ein einzelner Mensch lesen?
Der antike, massive Schreibtisch stand mittig im großen Büro. Davor ein Ledersessel mit dem Rücken zum Fenster gerichtet. Beeindruckend! Die Hand tastete über das alte gegerbte Leder. Da spürt man die Kohle zwischen den Fingern. Teures Zeug! Hm … ihr werdet euch wundern.Um keinen Lärm zu verursachen, wurde eine Schublade nach der anderen vorsichtig geöffnet. Sämtliche Papiere herausgezogen, durchgeblättert und wieder an ihren Platz zurückgelegt. An irgendeiner Stelle muss dieser verdammte Vertrag sein, er ist da, ich weiß es! Das Dokument, der Beweis für all das geschehene Leid, war nicht aufzufinden. Das gibt es nicht. Er muss hier sein. Vielleicht hinter den Scheiß Büchern. Sie wurden hervorgezerrt, geschüttelt und lautlos wieder zurückgeschoben. Nichts. Verdammt! Überlege gut, wo würdest du so etwas verstecken?Der Blick senkte sich zum Boden. Lautes Schnauben erfüllte den Raum. Unter dem Teppich? Zu gefährlich, wenn die Putzfrau … Das kann nicht … Tresor?
Die Taschenlampe kreiste unruhig und leuchtete hastig jeden Zentimeter im Zimmer aus. Jedes Bild an der Wand wurde zur Seite geschoben.Die Person gab sich nicht einmal mehr die Mühe, sie wieder zurechtzurücken. Es gibt hier keinen Tresor. Das gibt’s doch nicht. Verdammt! Bei dieser Großkotzigkeit hat der niemals damit gerechnet, dass jemand hier irgendwas sucht. Es muss hier sein! Die Hand schlug auf die Schreibtischplatte. Ein Blick Richtung Tür. Alles blieb still. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich entdeckt werde, bin ich am Arsch.
Behutsam wurden sämtliche Schubladen erneut herausgezogen. Seite für Seite der Papiere durchgeblättert. Vor der Tür knarrte der Dielenboden. Es hörte sich an, als wenn jemand über den Flur schlich. Nicht bewegen. Lampe aus! Das Licht erlosch, der Herzschlag hämmerte bis zum Gehirn. Unter dem Türspalt war ein schmaler Lichtschein zu erkennen. Ich muss mich verstecken. Die dicken Vorhänge waren ein idealer Zufluchtsort. Ein Sprung, dann verschwand der Schatten dahinter. Erneut leise Schritte, die sich entfernten. Das Licht im Flur erlosch. Augenblicklich war es wieder ruhig. Ich sehe zu, dass ich hier rauskomme. Aber nicht ohne das Beweisstück. Die Gestalt kam hinter dem bodentiefen Vorhang hervor und schlich zurück zum Schreibtisch. Die Suche ging von vorn los.Überlege, wo würdest du so ein wichtiges Schriftstück verstecken. Alter, wo hast du es? Schlagartig eine Eingebung. Vielleicht ist es hinter einem Schrank oder unter eine der verdammten Laden geklebt.
Die Hand glitt, soweit es möglich war, an der Rückwand des riesigen Bücherregals entlang. Glatte Fläche, kein Hinweis auf ein Schriftstück. Enttäuschung kroch durch den Körper. Das Regal abzurücken, war unmöglich. Der Schreibtisch. Die Person schnippte mit den Fingern. Mit der Handfläche unter jedem der Holzböden tastend, in der Hoffnung … was ist das? Ein Hindernis, das gegen die Fingerspitzen stieß.
Unvermutet knisterte Papier zwischen den Fingern. Ich hab’s gewusst. Das muss es sein! Der Herzschlag wummerte in der Halsschlagader. Vorsichtig wurde der Umschlag gelöst. Der Lichtkegel der Taschenlampe fiel auf den Gegenstand. Es war ein brauner Papierumschlag, der mit Klebeband unter der Lade fixiert gewesen war. Du Aas! Bitte, lass es das sein, wonach ich suche. Hastig wurde die Lasche des Umschlages aufgerissen. Hm? Was ist das? Ein einziges, rechteckiges Blatt kam zum Vorschein. Im Licht der Funzel war es zuerst nicht zu entziffern. Es war mit Füller beschrieben. Die Gestalt hielt das vergilbte Papierstück direkt vor die Augen.Ein Schuldschein? Das ist ein ganz banaler Schuldschein. Du Schwein, du verdammtes Schwein …Der Blick fiel auf die zweite Unterschrift, die unter dem Wort Zeuge stand. Dort stand, klar und deutlich ein Name. »Das gibt’s doch nicht!«
Einen Tag später
»Moin Deern. Hast du Hunger? Ich hab frische Brötchen da! Und Kaffee ist fertig.« Charlotte Hagedorn stand in weißer Leinenhose und luftiger, mit Blüten bedruckter Bluse vor der Kaffeemaschine und nahm die Kanne von der Warmhalteplatte. Ihre wilde Mähne, von denen ihr einige Strähnen ins Gesicht fielen, hatte sie auf dem Oberkopf lässig mit einem Zopfband zusammengetüdelt.
»Guten Morgen, Tantchen! Hast du gut geschlafen? Und ja, ich hab einen Riesenhunger!«
Katrin sah ihre Tante müde an und tapste barfuß in die helle, freundlich eingerichtete Küche. Verschlafen drückte sie ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich hab geschlafen wie ein Bär.«
Charlotte Hagedorn fuhr ihrer Nichte durch die Haare, die wirr vom Kopf abstanden und weit über die Schulter fielen.
»Ich hole mal die Zeitung und dann machen wir es uns bei einem ausgiebigen Frühstück gemütlich.«
»Frühstück hört sich gut an, aber anschließend muss ich ins Büro. Heute ist Freitag und ich habe eine Hochzeit im Rathaus zu begleiten.« Sie lümmelte sich im Pyjama an den Esstisch.
Ihre Tante knurrte zwar, gab sich jedoch mit der Antwort zufrieden. »Nee, mein Deern, setz dich mal raus auf den Balkon, ist so schön draußen. Ich hab alles fein gedeckt.« Charlotte wies mit dem Kopf zur Tür, und Katrin schwang sich lustlos wieder hoch. Sie sah aus, als hätte sie eine kurze Nacht hinter sich gebracht. »Sag mal, war dein Dirk da?«, ulkte ihre Tante.
»Wieso?« Katrin schüttelte den Kopf. »Na, weil du so aussiehst, als hättest du die ganze Nacht kein Auge zugemacht.«
»Nein, der schläft in Oldenburg«, entgegnete sie. »Er wollte aber nachher vorbeikommen. Hat sich endlich mal Urlaub genommen. Mir geht es nur nicht besonders gut, weil ich tierische Migräne hab – das Wetter!«
Sie schleppte sich Richtung Wohnzimmer und schlich durch die weit geöffnete Terrassentür. Wie ein Schluck Wasser in der Kurve hangelte sie sich auf den nächstbesten Stuhl und setzte sich mit dem Rücken zur Sonne, die bereits die Fliesen der Terrasse erwärmt hatte.
»Na dann nimm halt eine Tablette«, mahnte ihre Tante.
»Du weißt doch, dass die bei mir nicht anschlagen. Ich brauch nur meine Ruhe … und Sonne? Ich weiß nicht so recht. Mir ist richtig übel.«