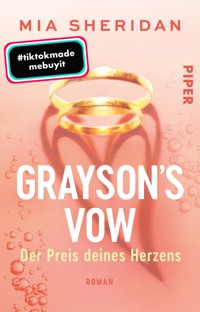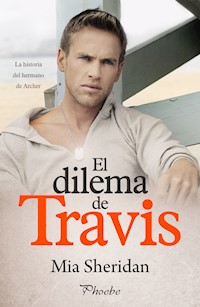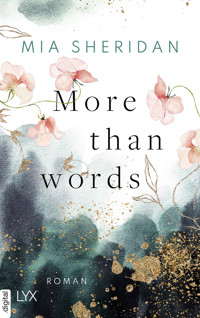5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Lesenachschub für alles Fans von »Archer´s Voice «: Smalltown-Romance der Tiktok-Bestsellerautorin. Großes Gefühlskino, das mitten ins Herz trifft »Verzweiflung und Hoffnung, Schmerz und Glück, mein Untergang und meine Rettung. Du bist alles für mich.« Tenleigh Falyn kämpft jeden Tag ums Überleben in der kleinen, verarmten Bergbaustadt, in der sie mit ihrer Schwester und ihrer kranken Mutter lebt. Ihr Traum, das jährliche Tyton Coal-Stipendium zu gewinnen, ist alles, was sie am Leben hält. Damit würde sie einen Freifahrtschein für ein College ihrer Wahl erhalten und endlich der Härte dieses Lebens entkommen. Sich eine Karriere sichern, die ihre Familie eines Tages aus Dennville herausbringen könnte. Aber Kyland Barrett hat ebenso unermüdlich gearbeitet, um dieses Stipendium zu gewinnen, um die Stadt hinter sich zu lassen, die ihm so viel Leid gebracht hat. Er lässt sich durch nichts aufhalten – schon gar nicht durch das Mädchen, das seine größte Konkurrentin ist. Dann ändert ein Moment alles. Tenleigh und Kyland werden von Fremden zu Freunden und kommen der Liebe gefährlich nahe. Beide sind fest entschlossen, keine dauerhafte Bindung einzugehen, aber je länger sie zusammen sind, desto aussichtsloser scheint es. Doch nur einer von ihnen kann gewinnen. Nur einer von ihnen kann gehen. Und wenn dieser Tag kommt, was passiert dann mit demjenigen, der zurückbleibt? »WOW!!! Mia Sheridan hat es wieder einmal geschafft. Ich liebe dieses Buch! Eine einzigartige, tief berührende, herzzerreißende und wunderschön geschriebene Geschichte über Hoffnung, Opfer, Mut und die Kraft der wahren Liebe. Mein Herz hat die ganze Zeit geklopft wie verrückt.« Aestas Book Blog
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Kyland. Im nächsten Leben vielleicht« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Dieses Buch enthält mögliche triggernde Inhalte
© Mia Sheridan 2015
© Piper Verlag GmbH, München 2024
© die deutsche Erstausgabe erschien erstmals 2017 unter dem Titel »Im nächsten Leben vielleicht« beim Piper Verlag GmbH, München
Titel der amerikanischen Originalausgabe »Kyland«, CreateSpace Independent Publishing Platform 2015
Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Uta Hege
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Mia Sheridan
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Die Legende von Taurus
1 – Tenleigh
2 – Tenleigh
3 – Kyland
4 – Tenleigh
5 – Tenleigh
6 – Kyland
7 – Tenleigh
8 – Tenleigh
9 – Kyland
10 – Tenleigh
11 – Kyland
12 – Tenleigh
13 – Tenleigh
14 – Tenleigh
15 – Tenleigh
16 – Kyland
17 – Tenleigh
18 – Kyland
19 – Tenleigh
20 – Tenleigh
21 – Tenleigh
22 – Tenleigh
23 – Tenleigh
24 – Tenleigh
25 – Kyland
26 – Tenleigh
27 – Kyland
28 – Tenleigh
29 – Kyland
Epilog – Kyland
Danksagungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Dieses Buch ist Shirley gewidmet.Danke, dass du als mein zweitgrößter Fan meinen größten Fan geboren hast.
Die Legende von Taurus
Es war einmal ein Stier mit Namen Cerus, der allein und einsam durch die Gegend zog. Obgleich er nicht unsterblich war, hielten ihn die Menschen wegen seiner unglaublichen Kraft dafür.
Cerus war ein unbezähmbares und wildes Tier, das niemandem gehörte. Eines Tages traf Persephone, die Frühlingsgöttin, Cerus an, als er gerade eine Blumenwiese zertrampelte, und strich sanft über sein Fell. Ihre Schönheit und Sanftmut beruhigten ihn, und er verliebte sich in sie. Die Göttin zähmte ihn, lehrte ihn Geduld und zeigte ihm, die Kräfte, die er hatte, weise einzusetzen, statt umherzuziehen und alles zu zerstören.
Wenn Persephone im Herbst hinunter in den Hades zieht, schwingt Cerus sich zum Himmel auf und bildet dort das Sternbild Stier. Und wenn Persephone im Frühjahr wieder auf die Erde kommt, kehrt Cerus ebenfalls dorthin zurück. Dann reitet sie auf ihm über die sonnenhellen Felder und bringt alle Pflanzen zum Erblühen.
1 – Tenleigh
17 Jahre alt
Zum ersten Mal war Kyland Barrett mir in unserer Schulcafeteria aufgefallen. Er hatte sich verstohlen die Reste eines fremden Frühstücks in den Mund geschoben, und um ihn nicht in seinem Stolz zu verletzen, hatte ich mich instinktiv so schnell wie möglich wieder abgewandt. Doch dann hatte ich, als er auf dem Weg zur Tür kauend direkt auf mich zumarschiert gekommen war, noch mal hingesehen. Als unsere Blicke sich getroffen hatten, hatte er die Augen aufgerissen, und errötend hatte ich so schnell es ging wieder woanders hingeschaut. Ich hatte das Gefühl gehabt, ihn in einem hochpeinlichen Moment erwischt zu haben. Und genau das hatte ich. Das war mir klar. Denn schließlich hatte ich auch selbst schon heimlich irgendwelche fremden Essensreste in mich reingestopft. Zwar hatte ich mich jedes Mal dafür geschämt, aber nach einem langen Wochenende ohne Essen hatte mir mein schmerzlich leerer Magen keine andere Wahl gelassen. Wie sein Magen ihm in jenem Augenblick.
Natürlich hatte ich ihn auch schon vorher ab und zu gesehen. Mit seinem fein gemeißelten Gesicht und seiner großen, kräftigen Gestalt zog er die Blicke aller Mädchen unserer Schule an. Doch es war das erste Mal gewesen, dass ich ihn als den erkannte, der er wirklich war. Dass ich etwas wie Mitgefühl empfand, obwohl ich seine gleichgültige Miene, die zum Ausdruck bringen sollte, dass ihn nichts und niemand auch nur ansatzweise interessierte, alles andere als anziehend fand. Solche Typen kannte ich zur Genüge. Sie machten nichts als Ärger, deshalb hielt ich mich von ihnen möglichst fern.
Aber offenbar hatten nicht alle Mädchen unserer Schule ein Problem mit dieser Art von Mann, denn wenn er überhaupt mal in Gesellschaft war, dann nie in der von anderen Jungs.
Da in unsere Schule Jugendliche aus drei Städten gingen, hatte ich in meiner ganzen, über dreijährigen Highschool-Zeit kaum einen Kurs mit ihm gehabt. Er wählte immer einen Platz ganz hinten und verfolgte schweigend das Geschehen, während ich mich immer in die erste Reihe setzte, damit ich die Tafel sah. Ich vermutete, dass ich kurzsichtig war, aber für eine Untersuchung meiner Augen oder gar für eine Brille hatten wir kein Geld. Ich wusste, dass er gute Noten hatte, also musste er trotz seiner aufgesetzten Gleichgültigkeit ziemlich clever sein.
Nach dem Tag in der Cafeteria sah ich ihn mit anderen Augen, und vor allem sah ich ihn von da an praktisch überall. Im überfüllten Flur inmitten unzähliger anderer Jungs und Mädchen, die wie eine Herde Rinder auf dem Weg zu einer neuen Weide gemächlich von einem Klassenzimmer in das nächste trotteten, in der Cafeteria, oder wenn er auf dem Heimweg plötzlich direkt vor mir lief. Meistens hatte er die Hände in den Taschen seiner Jeans vergraben, und sobald wir draußen waren, zog er seinen Kopf zum Schutz vor Wind und Kälte ein. Ich beobachtete gerne, wie er sich bewegte, ohne sich seiner Geschmeidigkeit bewusst zu sein. Vor allem aber war ich plötzlich neugierig auf ihn geworden. Und mit einem Mal kam sein Blick mir nicht mehr abweisend und distanziert, sondern misstrauisch und wachsam vor. Ich wusste nur sehr wenig über ihn. Er lebte oben in den Hügeln wie ich auch. Und anscheinend hatte er oft nicht genug zu essen, aber schließlich nagten in der Gegend zahlreiche Familien am Hungertuch.
Ich stamme aus dem Städtchen Dennville in Kentucky, das inmitten sanft wogender, grüner Hügel, leuchtend blauer Wasserfälle sowie malerischer, überdachter Brücken in den Appalachen liegt und jeden Großstadtslum problemlos in den Schatten stellt. Die Hoffnungslosigkeit ist so verbreitet wie die weiße Eiche, und Arbeitslosigkeit ist eher die Regel denn die Ausnahme.
Meine große Schwester Marlo hat einmal gesagt, der liebe Gott hätte sich gleich nach der Erschaffung unseres Fleckens Erde aus dem Staub gemacht. Ich glaube zwar, dass eher die Menschen Gott enttäuschen als er sie, aber was weiß ich schon von diesen Dingen? Um mich damit auszukennen, müsste ich vielleicht zumindest in die Kirche gehen.
Mit Bestimmtheit aber kann ich sagen, dass an einem Ort wie Dennville das Gesetz des Darwinismus gilt, dass nur der Stärkste überlebt. Dabei hatte es sich in der Gegend früher durchaus gut leben lassen. Zwar waren auch damals schon ein paar Leute auf Lebensmittelmarken angewiesen gewesen, weil ihr Lohn nicht ausreichte, die meisten aber hatten in der Kohlegrube durchaus ordentlich verdient. Es hatte eine Handvoll gut gehender Geschäfte in der Stadt gegeben, Jobs für die, die welche wollten, und die Leute hatten etwas Geld zum Ausgeben gehabt. Sogar die Ärmsten der Armen, die hoch oben auf dem Berg in einer jämmerlichen Ansammlung von kleinen Häusern, Wohnwagen und Bretterbuden hausten, hatten damals jeden Tag etwas zu essen auf dem Tisch gehabt. Vor der Grubenexplosion. Die Zeitungen hatten sie das schlimmste Grubenunglück seit 50 Jahren in ganz Amerika genannt. 62 Männer, hauptsächlich Familienväter, waren dabei umgekommen, und da Kylands Vater und sein großer Bruder zu den Opfern der Tragödie zählten, lebte er seither allein mit seiner Mutter, einer Invalidin, etwas unterhalb von uns in einem winzig kleinen Haus. Was seine Mutter genau hatte, wusste ich nicht.
Meine Mum, meine Schwester und ich selbst lebten in einem kleinen Wohnwagen am Rande eines Pinienhains. Im Winter drang der bitterkalte Wind durch alle Ritzen und schüttelte unseren Wohnwagen so kräftig hin und her, dass ich mir sicher war, er würde eines Tages einfach umfallen. Irgendwie hatte er es bisher jedoch geschafft, jedem Sturm zu trotzen. Und das hatten wir Bergbewohner auch.
Irgendwann im Spätherbst stapfte ich den Weg zu unserem Wohnwagen hinauf, hüllte mich wegen des kalten Winds, so gut es ging, in meinen dünnen Sommerpulli ein und stellte plötzlich fest, dass Kyland ein Stück entfernt vor mir lief. Plötzlich rannte Shelly Galvin an mir vorbei, um ihn einzuholen, und während sie gemeinsam weiterliefen, schien sie etwas zu erzählen, denn er nickte plötzlich mit dem Kopf. An der nächsten Kurve verlor ich die beiden aus den Augen und hing weiter meinen eigenen Gedanken nach, doch als ich wenig später eine Ansammlung von Nusssträuchern erreichte, hörte ich ein unterdrücktes Kichern und blieb stehen.
Ich spähte durch die Büsche, und dort presste Kyland Shelly gegen einen Baum und küsste sie, als wäre er ein wildes, ungezähmtes Tier. Shelly hatte mir den Rücken zugewandt, deshalb sah ich nur sein Gesicht. Ich weiß beim besten Willen nicht, weswegen ich nicht einfach weiterging, doch irgendetwas an der Art, wie er mit einem Ausdruck roher, gieriger Konzentration seinen Mund auf ihre Lippen presste, ließ das Blut in meinen Adern kochen, und ich presste meine Beine fest zusammen, weil das Kribbeln zwischen meinen Schenkeln nur auf diese Weise zu ertragen war. Da schob er die Hand auf ihre Brust, sie stieß ein raues Stöhnen aus, und meine eigenen Nippel wurden hart, als berühre er nicht Shelly, sondern mich. Meine Knie gaben nach und eilig hielt ich mich an einem Baumstamm fest. Dabei machte ich anscheinend ein Geräusch, denn Kyland riss die Augen auf und starrte mich durchdringend an. Trotzdem küsste er sie weiter, die Backen eingezogen, und während ich mir vorstellte, was er mit seiner Zunge tat, stieg mir die Schamesröte ins Gesicht. Trotzdem stand ich immer noch wie angewurzelt da, und erst als er die Augen argwöhnisch zusammenkniff, wurde mir klar, was ich da tat, und verlegen stolperte ich einen Schritt zurück.
Ich war zutiefst beschämt, aber vor allem empfand ich brennende Eifersucht. Obwohl ich ganz bestimmt nichts von ihm wollte. Nein – mit einem Kerl wie ihm, mit dem es sowieso nur Ärger gab, würde ich mich niemals einlassen.
Ich machte eilig kehrt, hastete den Rest des Bergs hinauf zu unserem Wohnwagen, riss die Metalltür auf, stürzte hinein, warf sie mit einem lauten Knall hinter mir zu, ließ mich aufs Sofa fallen und rang nach Luft.
»Meine Güte, Tenleigh«, hörte ich die singende Stimme meiner Mutter, die in unserer winzig kleinen Küche stand und etwas auf der Kochplatte erhitzte, das verdächtig nach Kartoffelsuppe roch. Als ich wieder Luft bekam, sah ich sie an und stöhnte innerlich, weil sie ein Nachthemd und darüber ihre ramponierte Miss-Kentucky-Schärpe trug. Offenbar war heute ein in jeder Hinsicht schlechter Tag.
»Hallo, Mum. Es ist heute ziemlich kalt.« Eine andere Erklärung dafür, dass ich derart außer Atem war, gab ich ihr nicht. »Kann ich was tun?«
»Nein, nein, ich komme gut allein zurecht. Ich dachte, ich bringe Eddie etwas Warmes in die Stadt. Er liebt meine Kartoffelsuppe, und wenn es heute Abend kalt wird, wird er sich darüber freuen.«
Ich verzog unglücklich das Gesicht. »Du kannst Eddie keine Suppe bringen, Mum. Er geht nach der Arbeit heim zu seiner Frau.«
Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, doch sofort fing sie wieder an zu strahlen und schüttelte den Kopf. »Nein, nein, er geht nicht mehr zu ihr zurück. Er wird sie verlassen, Tenleigh. Sie ist einfach nicht die Richtige für ihn. In Wahrheit liebt er mich. Und heute Abend wird es kalt. Dieser Wind …« Sie rührte weiter ihre Suppe um und summte lächelnd vor sich hin.
»Hast du deine Medizin heute genommen, Mum?«, fragte ich.
Sie riss den Kopf zurück und runzelte verwirrt die Stirn. »Meine Medizin? Oh nein, Baby, die brauche ich nicht mehr.« Sie schüttelte den Kopf. »Das Zeug macht mich immer so müde, und außerdem kriege ich davon immer so ein seltsames Gefühl.« Sie rümpfte ihre hübsche Stupsnase, als wäre das einfach zu dumm. »Nein, ich nehme meine Medizin nicht mehr. Und ich fühle mich wunderbar!«
»Mum, Marlo und ich haben dir schon hundertmal gesagt, dass du sie nicht einfach absetzen darfst.«
Ich ging zu ihr und legte die Hand auf ihren Arm. »Mum, ohne deine Medizin fühlst du dich erst mal gut, aber danach wird es dir umso schlechter gehen. Du weißt, dass das so ist.«
Mit unglücklicher Miene rührte sie weiter in der dickflüssigen Suppe, doch schließlich schüttelte sie abermals den Kopf. »Nein, diesmal wird es anders sein. Ihr werdet sehen. Und dieses Mal wird Eddie uns drei bitten, zu ihm in sein schönes Haus zu ziehen. Er wird endlich begreifen, dass er mich, das heißt, dass er uns alle braucht.«
Ich ließ die Schultern hängen, weil ich wusste, dass es sinnlos war, ihr zu widersprechen. Ich war zu erschöpft, um mit ihr zu diskutieren.
Meine Mutter fuhr sich über ihr schimmerndes, kastanienbraunes Haar – das ich von ihr geerbt hatte – und wandte sich mir wieder strahlend zu. »Ich bin immer noch hübsch, Tenleigh. Eddie sagt immer, dass ich die schönste Frau in ganz Kentucky bin. Und ich habe diese Schärpe, die beweist, dass er die Wahrheit sagt.« Sie bekam einen verträumten Blick, wie immer, wenn sie über ihren Titel sprach. Sie war so alt wie ich gewesen, als sie ihn gewonnen hatte, und jetzt hob sie lächelnd eine Strähne meines Haars in die Luft und zwinkerte mir zu. »Du bist genauso hübsch wie ich damals«, erklärte sie, verzog dann aber traurig das Gesicht. »Ich wünschte, ich könnte es mir leisten, dich zu ein paar Wettbewerben zu schicken. Du würdest sie auf jeden Fall gewinnen so wie ich.« Mit einem abgrundtiefen Seufzer wandte sie sich wieder ihrer Suppe zu.
Ich fuhr zusammen, als die Tür aufflog und Marlo keuchend und mit roten Wangen, aber fröhlich grinsend, hereingestürzt kam. »Himmel, heute ist der Wind echt eisig.«
Ich nickte knapp, ohne zu lächeln, und als ich mit den Augen auf unsere Mutter wies, die eine von unseren Plastikdosen mit Kartoffelsuppe füllte, wurde auch die Miene meiner Schwester ernst.
»He, Mum, was machst du da?« Sie zog sich ihre Jacke aus und warf sie auf die Couch.
Lächelnd blickte Mum auf. »Ich bringe Eddie Suppe.« Sie drückte den Deckel auf die Dose und trug sie hinüber in den winzigen Wohn-Essbereich.
»Oh nein, das tust du nicht, Mum«, klärte Marlo sie mit bitterer Stimme auf.
Mum blinzelte verwirrt. »Doch, natürlich, Marlo.«
»Nein. Gib mir die Suppe, Mum. Tenleigh, hol mir ihre Medizin.«
Mum schüttelte nachdrücklich den Kopf, und ich schoss an ihr vorbei, ihr ihre Medizin zu holen, die wir uns nur leisten konnten, weil ich mehrmals in der Woche im einzigen Geschäft des Orts, das einem der mit Abstand größten Arschlöcher der Stadt gehörte, putzte und Regale einräumte. Die Medizin, die wir von dem Geld kauften, das für Marlos und mein Essen vorgesehen war.
Während meine Mutter mit Marlo rang, stürzte ich ins Bad, riss mit zitternden Händen Mums Pillenfläschchen aus dem Medizinschrank und rannte so schnell es ging zurück.
Inzwischen schluchzte Mum, und die Suppe hatte sich gleichmäßig über Marlo und den Fußboden verteilt. Mum ließ sich auf die Knie sinken, warf die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen.
Auch Marlos Hände zitterten, als sie die Medizin von mir entgegennahm, sich zu Mum in die zähflüssige Masse auf dem Boden kniete und sie tröstend in die Arme nahm.
»Ich weiß, dass Eddie mich noch immer liebt. Das weiß ich, Mar!«, heulte Mum. »Denn schließlich bin ich hübsch. Viel hübscher als sie!«
»Nein, Mum, er liebt dich nicht«, widersprach ihr Marlo sanft. »Das tut mir leid. Aber wir lieben dich. Tenleigh und ich lieben dich unendlich. Wir lieben dich über alles, und wir brauchen dich, Mum.«
»Ich will doch nur, dass jemand für uns sorgt. Ich brauche einfach einen Menschen, der uns hilft. Eddie wird uns helfen, wenn ich nur …«
Sie brach erneut in lautes Schluchzen aus, und schweigend wiegte Marlo sie im Arm. Worte richteten bei Mum nichts aus, wenn sie in diesem Zustand war. Morgen würde sie die Schärpe ausziehen, sich in ihrem Bett verkriechen, und in ein paar Tagen, wenn die Pillen wieder wirkten und sie wieder annähernd die Alte war, würde sie erneut beschließen, dass sie ohne Medizin zurechtkam, sie klammheimlich absetzen, und wir würden zum x-ten Mal von vorne anfangen.
Wahrscheinlich war das einer von den Gründen dafür, dass ich schon mit 17 Jahren derart müde war. So abgrundtief und bis ins Innerste erschöpft.
Ich half den beiden auf, wir gaben Mum ihre Medizin und ein Glas Wasser, brachten sie ins Bett und kehrten leise in den Hauptraum unseres Wohnwagens zurück. Die Suppe löffelten wir vorsichtig vom Boden wieder in die Plastikdose, denn wir wären nie auf die Idee gekommen, jemals irgendwelche Nahrungsmittel wegzuwerfen. Später füllten wir die Suppe in zwei Schüsseln um und aßen sie zum Abendbrot, denn, schmutzig oder nicht, war sie doch das Einzige, was es zu essen gab.
2 – Tenleigh
»Hi, Rusty«, rief ich beim Betreten des Geschäfts, in dem ich an vier Tagen in der Woche nach der Schule half. Der Himmel klarte langsam auf, aber ich war nass vom Regen und wischte mir keuchend die verklebten Haare aus der Stirn.
»Du kommst wieder mal zu spät.« Er runzelte die Stirn.
Unter seinem barschen Ton zuckte ich innerlich zusammen und sah auf die Uhr, die im Verkaufsraum hing. Ich war den größten Teil des Wegs gejoggt und vollkommen verschwitzt und atemlos, aber dass man die sechs Meilen von der Schule bis zu seinem Laden unmöglich in weniger als eineinviertel Stunden schaffen konnte, scherte Rusty nicht.
»Nur zwei Minuten, Rusty. Dafür werde ich nachher auch zwei Minuten länger bleiben, ja?« Ich schenkte ihm mein schönstes Lächeln, aber er behielt den grimmigen Gesichtsausdruck auch weiter bei.
»Du wirst eine Viertelstunde länger bleiben, denn in einem von den Sixpacks, die Jay Crowley heute Morgen kaufen wollte, war eine Flasche kaputt.«
Ich presste die Lippen zusammen.
Es war nicht überraschend, dass Jay Crowley schon in aller Frühe einen Sixpack kaufte, doch was hatte ich mit der kaputten Bierflasche zu tun? Die alkoholischen Getränke packte Rusty schließlich immer selbst aus. Trotzdem nickte ich nur schweigend, ging nach hinten, band mir meine Schürze um und nahm den Besen in die Hand.
Wie stets am Monatsersten musste ich so schnell wie möglich die Regale mit den Softdrinks leeren, denn in einer guten Stunde, wenn die Lebensmittelmarken freigeschaltet wurden, würde das Geschäft von Leuten, die die Arme voller Limokisten hatten, überschwemmt werden. Das war Sozialhilfebetrug in Reinkultur. Man nahm die Marken im Wert von 500 Dollar, die eine Familie mit zwei Kindern monatlich bekam, tauschte sie in JoJos Tankstelle gegen die zuckerhaltigen Getränke ein und bot sie dann zum halben Preis, doch dafür gegen harte Dollar, Rusty an, weil man mit Lebensmittelmarken nicht an Wettscheine, an Lotterielose, an Schnaps, an Zigaretten … oder Drogen kam. Und auch Rusty freute sich natürlich über das Geschäft, obwohl vor allem seinetwegen viele Kinder in der Gegend ständig hungrig waren. Doch wenn er den Leuten nicht die Limoflaschen abgenommen hätte, hätte es wahrscheinlich jemand anderes getan. So liefen diese Dinge nun einmal.
Zwei Stunden später hatte sich der größte Ansturm gelegt, und ich staubte gerade eins der hinteren Regale ab, als das Läuten unserer Türglocke mir verriet, dass es neue Kundschaft gab. Ich fuhr mit meiner Arbeit fort, nahm aber aus dem Augenwinkel wahr, dass jemand vor den Kühlschrank an der rückwärtigen Wand des Ladens trat. Ich richtete mich auf und sah, dass Kyland Barrett sich verstohlen ein eingeschweißtes Sandwich unter seine Jacke schob. Als unsere Blicke sich begegneten, riss er die Augen auf, doch als ich plötzlich hinter meinem Rücken Schritte hörte, sah er schreckensstarr an mir vorbei, und ich drehte mich eilig um. Stirnrunzelnd kam Rusty auf uns zu, und Kyland stand mit von dem dicken Sandwich ausgebeulter Jacke hinter mir.
Wenn ich nicht umgehend etwas unternahm, würde Rusty ihn auf frischer Tat erwischen. Im Sekundenbruchteil musste ich entscheiden, ob ich Kyland helfen sollte oder nicht.
Also stolperte ich wenig elegant und riss mit einem leisen Aufschrei mehrere Kartons uralter Cornflakes – der zuckerfreien Sorte, die kein Mensch in Dennville jemals kaufte – aus dem Regal neben mir. Ich wusste nicht genau, warum. Vielleicht weil Kylands panischer Gesichtsausdruck etwas in meinem Inneren berührt hatte, oder vielleicht weil ich aus eigener Erfahrung wusste, wie entsetzlich Hunger war. Dass mein impulsives Handeln Einfluss auf mein ganzes, zukünftiges Leben haben würde, hätte ich ganz sicher nicht gedacht.
Ich trampelte unbeholfen über die Cornflakes-Kartons, bis sich ihr Inhalt auf dem Fußboden ergoss.
»Was machst du da, du dummes Ding?«, fuhr Rusty mich mit lauter Stimme an und bückte sich nach einem der Kartons, während Kyland wie der Blitz an uns vorbei in Richtung Ausgang schoss. »Jetzt reicht’s mir ein für alle Mal mit dir. Du bist gefeuert.«
Wieder läutete die Glocke, ich richtete mich eilig auf und Kyland drehte sich mit großen Augen, aber ausdrucksloser Miene zu mir um. Er zögerte kurz, trat dann aber eilig auf die Straße, und die Tür fiel hinter ihm ins Schloss.
»Es tut mir leid, Rusty. Ich bin gestolpert. Bitte kündige mir nicht.« Ich brauchte diese Arbeit, und so sehr ich es auch hasste, um die Anstellung zu betteln, waren wir auf die paar Dollar dringend angewiesen, die es dafür gab.
»Ich habe dir mehr als eine Chance gegeben. Für den Job werden die Leute morgen Schlange stehen.« Seine kalten Augen funkelten mich boshaft an. »Du hättest diese Arbeit zu schätzen wissen und dich mehr bemühen sollen. Dein Aussehen wird dich auch nicht weiterbringen, wenn dein Kopf nicht fest auf deinen Schultern sitzt.«
Das war mir klar. Um das zu wissen, reichte es bereits, mir meine Mutter anzusehen.
Das Blut rauschte in meinen Ohren, und mit einem heißen Kribbeln im Genick zog ich die Schürze aus und ließ sie auf den Boden fallen, während Rusty weiter vor sich hin murmelte, wie nutzlos und wie undankbar ich war.
Einen Augenblick später trat ich auf die Straße und bemerkte, dass hinter dem Berg in meinem Rücken allmählich die Sonne unterging. Der Himmel leuchtete orange und rosa, und der stechende Geruch von Pinien hing in der regenfeuchten, kalten Luft. Ich atmete tief durch und schlang mir unglücklich die Arme um den Bauch, weil der Verlust von meinem Job für unsere Familie eine sehr, sehr schlechte Nachricht war. Wenn Marlo davon hörte, brachte sie mich um. Ich stieß ein lautes Stöhnen aus und wandte mich dem Universum zu. »Und jetzt?« Aber das Universum war nicht schuld an meiner dämlichen Entscheidung. Die hatte ich schließlich ganz allein gefällt. Manchmal fühlte sich mein Leben winzig klein und unbedeutend an, mein Elend aber nahm ich immer riesengroß und überdeutlich wahr. Das war in höchstem Maße ungerecht.
Ich stopfte meine Hände in die Taschen meiner Jeans und stapfte, meinen Rucksack mit den Schulsachen über der Schulter, heim. Im Frühjahr und im Sommer las ich oft im Gehen. Der Weg war mir derart vertraut, dass ich mich mühelos aufs Lesen konzentrieren konnte, und die Handvoll Autos, die in meine Richtung fuhren, kündigten sich durch das Dröhnen der Motoren immer schon von Weitem an. Doch dafür war es – auch wenn ich das Problem in Zukunft nicht mehr haben würde – in den anderen Jahreszeiten nach der Arbeit im Geschäft bereits zu dunkel, also hing ich auf dem Heimweg einfach meinen Träumen und Gedanken nach. Das tat ich auch an diesem Abend, denn ich hoffte, dass diese mich wenigstens vorübergehend von meinem Elend ablenkten. Ich musste mich ganz einfach an die Hoffnung klammern, dass mein Leben eines Tages leichter werden würde, als es bisher stets gewesen war. Also stellte ich mir vor, wie ich das Tyton-Coal-Stipendium erhielt. Ich rackerte mich seit Beginn der Highschool dafür ab, denn jedes Jahr wurde einer von den besten Schülern ausgewählt, der dann vier Jahre lang die Universität besuchen durfte. Wenn ich das Stipendium bekam, könnte ich der Armut und Verzweiflung, den Sozialhilfebetrügereien und dem in unserer Gegend weitverbreiteten »Vergessenssuff« entfliehen. Endlich würde ich für Mum und für Marlo sorgen können, sie aus Dennville rausholen und einen echten Arzt für Mum finanzieren, statt sie weiterhin dem hohlwangigen Doktor in der freien Klink auszuliefern, der aus meiner Sicht im Zentrum des verbotenen, lokalen Handels mit verschreibungspflichtigen Tabletten stand. Und wenn ich die Stadt verließ, würde ich noch kurz bei Rusty halten und ihm sagen, dass er sich einen Karton uralter Cornflakes in seinen fetten Hintern schieben sollte, weil die Dinger, selbst wenn ich sie nicht aus dem Regal riss, völlig unverkäuflich waren.
Als ich am Fuß des Berges um die Ecke bog, sah ich die alte Mrs Lytle auf den Stufen des geschlossenen Postamts sitzen, wo sie herzhaft in ein Sandwich biss. Die Plastikverpackung lag noch in ihrem Schoß. Ich zwinkerte ihr zu und lächelte, bevor mein Blick auf die Verpackung mit dem Aufdruck »Rustys Schinken-Käse« und dem großen, roten Datumsstempel fiel. Genau die Packung hatte Kyland Barrett vor knapp zehn Minuten in der Hand gehabt.
»’n Abend, Mrs Lytle«, sagte ich, und traurig nickend schob sie sich den Rest des Sandwichs in den Mund. Mrs Lytle war ein Teil der Landschaft … eine alkoholabhängige alte Frau, die durch die Straßen unserer Kleinstadt streifte, leise Selbstgespräche führte und zur Finanzierung ihrer Sucht die anderen Stadtbewohner um ein wenig Kleingeld bat. Sie hatte bei dem Grubenunglück ihre drei erwachsenen Söhne sowie ihren Mann verloren und hoffte offenbar darauf, ihnen möglichst bald ins Jenseits zu folgen, weil das Leben ohne sie nicht zu ertragen war.
»Haben Sie für heute Nacht schon einen Platz zum Schlafen, Mrs Lytle?«, fragte ich und stopfte meine Hände tiefer in die Taschen meiner Jeans. Ich hätte ihr zwar keinen Platz anbieten können, doch sie sollte wissen, dass mir was an ihrem Wohlergehen lag. Vielleicht wäre das ja wenigstens ein kleiner Trost.
Sie nickte kauend. »Keine Sorge«, artikulierte sie überdeutlich. »Ich werde mir ein Plätzchen suchen, wenn die wunderbare Aufführung vorüber ist.« Sie wies mit ihrem Kopf in Richtung Sonnenuntergang.
Ich nickte ebenfalls und lächelte sie an. »Das freut mich. Gute Nacht.«
»Nacht.«
Auf der Schotterpiste, die hinauf zu unserer Siedlung führte, trat mir plötzlich jemand in den Weg. Ich schrie erschrocken auf, wich einen Schritt zurück und landete in einer Schlammpfütze, bevor ich erkannte, dass es Kyland war.
»Musstest du mich so erschrecken?«, herrschte ich ihn an und spürte, wie die Nässe durch die Sohlen, die sich offenbar gelöst hatten, bis in meine Strümpfe drang. Na, super, Kyland. Vielen Dank.
Er warf einen Blick auf meine Füße, sagte aber nichts zu meinen ruinierten Schuhen, sondern sah mich aus zusammengekniffenen Augen reglos an. »Warum hast du das gemacht? Eben im Geschäft? Warum hast du mir geholfen?«
Als ich merkte, dass sein Wangenmuskel zuckte, verengte ich ebenfalls die Augen zu zwei schmalen Schlitzen und legte den Kopf ein wenig schräg. Er war wütend auf mich? Was zum Teufel bildete der Kerl sich ein?
»Warum hast du das verdammte Brot nicht selbst gegessen?« Ich verschränkte meine Arme vor der Brust. »Ich weiß, dass du etwas zu essen brauchst.« Ich starrte auf den Boden, weil ich nicht von dem intimen Augenblick in der Cafeteria hatte sprechen wollen, als unsere Blicke sich zum ersten Mal begegnet waren. Doch dann blickte ich eilig wieder auf.
Er gab mir keine Antwort, und wir starrten uns ein paar Sekunden schweigend an. Doch schließlich fragte er: »Er hat dich gefeuert?«
Sein Gesicht war ernst und angespannt, und gegen meinen Willen fielen mir sein fester Kiefer, seine gerade Nase und die Fülle seiner Lippen auf, und ich seufzte tief, weil mir sein attraktives Äußeres jetzt auch nicht weiterhalf. »Ja.«
Kyland stopfte seine Hände in die Taschen, und als ich mich wieder in Bewegung setzte, stapfte er mir fluchend hinterher. »Verdammt. Du brauchtest diesen Job.«
»Wie kommst du denn auf die Idee? Nein, natürlich habe ich die Fußböden in dem Geschäft alleine wegen Rustys grenzenlosem Charme gefegt. Ach, gäbe es doch mehr so nette Männer auf der Welt.« Ich griff mir ans Herz, als flösse es vor Liebe und Bewunderung für Rusty über, doch falls Kyland mein Sarkasmus auffiel, zeigte er es nicht.
»Das, was du da eben abgezogen hast, war ziemlich dämlich.«
Ich blieb stehen und drehte mich zu ihm herum. »Ein Danke wäre sicher nicht zu viel verlangt. Rusty hätte dich auf alle Fälle wegen Diebstahls angezeigt. Das hätte ihm bestimmt nicht nur den Tag, sondern sein ganzes jämmerliches Leben dauerhaft versüßt.«
Er starrte auf einen Fleck am Horizont, saugte nachdenklich an seiner vollen Unterlippe, runzelte die Stirn und wandte sich mir schließlich wieder zu. »Ja, ich weiß.«
Er sah mir forschend ins Gesicht, und da ich keine Ahnung hatte, was er dachte, machte mich sein durchdringender Blick nervös. »Danke.«
Ich nutzte aus, dass er mir derart nahe war, unterzog ihn meinerseits einer genauso eingehenden Musterung, und er schaute mich argwöhnisch aus seinen grauen Augen unter langen, dichten Wimpern hervor an. Es war nicht gerade einfach, einen derart attraktiven Kerl nicht zu mögen. Was die nächste Ungerechtigkeit in meinem Leben war. Denn ich hätte ihn aus tiefstem Herzen hassen wollen. Stattdessen setzte ich mich wieder in Bewegung, und während der nächsten paar Minuten lief er schweigend neben mir die Anhöhe hinauf.
»Du musst nicht mit mir zusammen gehen.«
»Es ist gefährlich, wenn ein junges Mädchen ganz allein durch die Dunkelheit läuft. Ich werde verhindern, dass dir was passiert.«
»Eigentlich hast du ja genau das Gegenteil gemacht«, rief ich ihm schnaubend in Erinnerung.
Kyland stieß ein überraschtes Lachen aus, und ich schob meinen Rucksack wieder so auf meine Schulter, dass er möglichst gut zu tragen war. »Vor allem, was heißt hier junges Mädchen? Ich bin mindestens so alt wie du. Ich werde im Mai schon achtzehn.«
»Und an welchem Tag?«, erkundigte er sich, lief einen Schritt voraus und ging dann rückwärts weiter, um mir auch beim Laufen ins Gesicht zu sehen.
»Am zweiten.«
Er riss ungläubig die Augen auf. »Nie im Leben. An dem Tag habe ich auch Geburtstag.«
Ich blieb stehen und sah ihn fragend an. »Und um wie viel Uhr bist du geboren?«
»Das weiß ich nicht genau … ich weiß nur, dass es morgens war.«
Wieder setzte ich mich in Bewegung, und als er mich fragend von der Seite ansah, gab ich widerstrebend zu: »Bei mir war’s Nachmittag«, und presste schlecht gelaunt die Lippen aufeinander, weil ihm seine Freude überdeutlich anzusehen war.
Wir liefen schweigend weiter, aber schließlich meinte er: »Aber im Ernst, du solltest vorsichtiger sein. Hier oben in den Bergen gibt es jede Menge Luchse.«
Ich seufzte tief. »Die sind meine geringste Sorge.«
»Nur, solange keiner hungrig vor dir steht. Weil du dann alle deine anderen Sorgen erst einmal vergessen kannst.«
Als ich spöttisch lachte, sah mich Kyland von der Seite an.
»Und was genau würdest du machen, wenn ein Luchs uns in die Quere käme, Kyland Barrett?«
»Du kennst meinen Namen«, stellte er mit überraschter Stimme fest.
»Schließlich leben wir in einer Kleinstadt, und du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass hier irgendjemand lebt, den du nicht mit Namen kennst.«
»Doch. Ich halte mich, so gut es geht, aus allem raus. Ich habe keine Lust, mir die Geschichten irgendwelcher anderen Leute anzuhören, und mir ist auch vollkommen egal, wie sie heißen.«
»Warum denn das?«
»Sobald ich das Tyton-Coal-Stipendium in der Tasche habe, werde ich von hier verschwinden, und je weniger Erinnerungen ich an dieses Scheißkaff habe, umso glücklicher werde ich sein.«
Wieder riss ich überrascht die Augen auf. »Du willst das Stipendium?«
Er zog verwundert eine Braue hoch. »Überrascht dich das etwa? Hast du noch nicht mitbekommen, dass ich mit Abstand einer der besten Schüler bin?«
»Ich … ich meine …«
Ich geriet ins Stolpern, als er grinste, denn ich hatte ihn bisher nie grinsen sehen, und plötzlich war er einfach … wunderschön. Mir klappte die Kinnlade herunter, aber schließlich riss ich mich zusammen und setzte den Weg entschlossen fort.
Bereits nach zwei Sekunden hatte er mich wieder eingeholt, und ich versuchte kopfschüttelnd mich darauf zu besinnen, was das Thema unseres Gesprächs gewesen war. Das Tyton-Coal-Stipendium – ja, genau. Ich war tatsächlich überrascht. Zwar wusste ich, dass Kyland immer gute Noten hatte, doch ich hätte nie gedacht, dass ihm etwas an dem Stipendium lag. Denn schließlich war er bisher nie in irgendeiner Arbeitsgruppe aufgetaucht. Dort waren allwöchentlich nur Ginny Rawlins, Carrie Cooper und ich selbst. Ich wusste, dass die beiden auch versuchten, das Stipendium zu bekommen, denn wir hatten uns schon häufiger darüber unterhalten, und bisher war ich so gut wie sicher davon ausgegangen, dass es keine anderen Interessenten gab.
Und Kyland Barrett wirkte trotz der guten Noten, die er immer hatte, irgendwie … desinteressiert.
»Und wie willst du das Stipendium bekommen, wenn ich selber es kriege?«, fragte ich und sah ihn unter hochgezogenen Brauen hervor an.
Kyland unterzog mich einer amüsierten Musterung und schüttelte den Kopf. »Nie im Leben«, klärte er mich feixend auf. »Aber das macht die Sache interessanter, findest du nicht auch?«
Ich schnaubte leise auf. Ich brauchte das Stipendium. Interessant musste der Weg dorthin für mich nicht sein. Aber seine Chancen standen sicher nicht zum Besten, wenn ich bisher nicht mal mitbekommen hatte, dass er sich darum bewerben wollte. Also brauchte ich wahrscheinlich keine Angst zu haben, dass mir Kyland plötzlich in die Quere kam.
Wir liefen schweigend weiter, bis ich plötzlich von ihm wissen wollte: »Glaubst du nicht, dass Shelly sauer wird, wenn sie erfährt, dass du ein anderes Mädchen vor Luchsen beschützt?«
Er runzelte verwirrt die Stirn. »Weshalb sollte Shelly deshalb …« Wieder fing er an zu grinsen. »Ach ja, richtig.« Kopfschüttelnd fuhr er mit einer Hand durch sein goldbraunes Haar. Zum ersten Mal bemerkte ich, wie dicht und seidig weich es war und dass es ihm in warm schimmernden Locken in den Nacken fiel.
»Shelly ist nur eine gute Freundin, weiter nichts.«
Ich zog die Brauen hoch, enthielt mich aber eines Kommentars, denn ich hatte schon genug Probleme, ohne mir den Kopf darüber zu zerbrechen, mit wem Kyland Barrett etwas hatte oder nicht. »Und wo wirst du hingehen, falls du das Stipendium bekommst?« Auch wenn das nie passieren wird.
»Auf alle Fälle von hier weg.«
»Ach.« Ich biss mir auf die Lippe, und er blickte auf das kleine, blaue Holzhäuschen, das etwas links des Weges lag. Der dunkle Wald ragte wie eine schwarze Wand dahinter auf, und hinter keinem Fenster brannte Licht.
Als er mich wieder ansah, runzelte er leicht die Stirn.
»Nun, danke, Kyland. Es war wirklich ritterlich von dir, mich zu begleiten, auch wenn du dafür gesorgt hast, dass ich meinen Job verloren, mein einziges Paar Schuhe kaputt gemacht und nicht einmal meinen Geburtstag mehr für mich alleine habe.« Ich ging weiter, und als er auch weiterhin an meiner Seite blieb und leise lachte, sah ich fragend zu ihm auf. »Ich muss nur noch ein Stück die Straße rauf und glaube kaum, dass mir auf den paar Metern noch ein Luchs auflauern wird.« Ich setzte ein nervöses Lächeln auf, denn ich war alles andere als erpicht darauf, ihn sehen zu lassen, wie bescheiden unser Wohnwagen verglichen mit dem Haus, in dem er lebte, war. Doch schweigend setzte er den Weg an meiner Seite fort.
»Also, Tenleigh … wegen deines Jobs … kommst du auch ohne klar? Ich meine …« Unbehaglich wandte er sich ab. »Kann ich irgendetwas für dich tun?«
Ich biss mir auf die Lippe, denn was hätte er schon machen sollen? Genau wie ich hatte auch er eine kranke Mutter zu Hause, und nach allem, was ich wusste, ging es ihm vielleicht sogar noch dreckiger als mir. »Nein. Aber ich werde es schon überleben.«
Er nickte, doch als ich ihn wieder ansah, machte er noch immer ein besorgtes Gesicht.
Inzwischen hatten wir den Wohnwagen erreicht, und mit einem angespannten Lächeln blieb ich stehen. »Also, gute Nacht.«
Kyland sah sich mein Zuhause an, und ich errötete. Aus irgendeinem Grund erschien es mir mit einem Mal noch schäbiger als sonst. Der Trailer war uralt und winzig klein, hoffnungslos verrostet, von den Tür- und Fensterrahmen blätterte die Farbe, und nicht einmal literweise Essig löste noch den Schmutzfilm von den Scheiben ab. Sein Zuhause war kaum besser, doch ich schämte mich in Grund und Boden, als ich unseren Wohnwagen mit seinen Augen sah.
Er wandte sich mir wieder zu, und offenbar war die Verlegenheit mir deutlich anzusehen, denn er riss überrascht die Augen auf, und etwas wie Verständnis huschte über sein Gesicht.
Ich machte auf dem Absatz kehrt und lief auf wackeligen Beinen Richtung Tür.
»Tenleigh Falyn«, rief mir Kyland hinterher. Er wusste also, wie ich hieß.
Ich blieb noch einmal stehen und sah ihn fragend an.
Leicht verlegen fuhr er sich erneut mit einer Hand durchs Haar. »Ich habe das verdammte Brot nicht selbst gegessen, weil …« Er blickte in die Ferne, so, als wöge er die nächsten Worte sorgsam ab. »… ich mich bemühe, niemals zu vergessen, dass es manchen Menschen noch viel schlechter geht als mir. Und dass es Hunger in verschiedenen Formen gibt.«
Damit stopfte er die Hände wieder in die Tasche, drehte mir den Rücken zu und wandte sich zum Gehen.
Ich lehnte mich an unseren Wohnwagen und folgte ihm mit meinem Blick, bis er nicht mehr zu sehen war. Kyland Barrett war vollkommen anders, als ich bisher angenommen hatte. Was ich als verwirrend und beglückend, doch vor allem als in höchstem Maß beunruhigend empfand.
3 – Kyland
»Hallo, Mum«, sagte ich. Ich schob die Haustür hinter mir ins Schloss und blickte ins Wohnzimmer, in dem ihr Fernsehsessel stand. Meine Mutter grüßte nicht zurück – das tat sie nie –, doch das war ich inzwischen gewöhnt.
Ich ging weiter in mein Zimmer, öffnete das Fenster so weit wie möglich, stützte mich mit beiden Händen aufs Fensterbrett, sah in den Abendhimmel auf und atmete tief ein.
Ein paar Minuten später legte ich mich auf mein Bett direkt neben dem Fenster und verschränkte meine Hände hinter meinem Kopf. Sofort wanderten meine Gedanken zu Tenleigh Falyn, und mit einem lauten Stöhnen warf ich mir die Hände vors Gesicht. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass sie meinetwegen ihren Job verloren hatte. Was zum größten Teil natürlich ihre eigene Schuld war, weshalb es keinen Grund für Schuldgefühle gab. Schließlich war sie selbst auf die bescheuerte Idee gekommen, mich zu decken. Auch wenn das für mich ein Riesenglück gewesen war. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn Rusty mich tatsächlich wegen Diebstahls angezeigt hätte.
Ich hatte selbst nicht genau gewusst, warum ich Mrs Lytle unbedingt ein Sandwich hatte schenken wollen, bis ich versucht hatte, es Tenleigh zu erklären. Eine Erklärung war das Einzige, was ich ihr hatte geben können, nachdem sie ihren Job geopfert hatte, damit ich ungeschoren davongekommen war. Ich hatte Mrs Lytle auf der Treppe vor dem alten Postamt sitzen sehen, und die Art, wie sie die Schultern angezogen hatte, als versuche sie, sich in sich selbst zurückzuziehen, hatte mir in der Seele wehgetan. Denn so hatte auch ich selbst mich bereits oft gefühlt. Dabei hatte ich im Gegensatz zu ihr zumindest noch ein Dach über dem Kopf und musste nur die letzte Woche jedes Monats hungern, wenn das Geld zur Neige ging. Um ihret-, aber auch um meinetwillen hatte ich sie wissen lassen müssen, dass ich sie sah, und kurzerhand das blöde Brot für sie stibitzt. Auch wenn das eine vollkommen idiotische Idee gewesen war. Die ich jedoch nur deswegen bereute, weil der Preis für diese Tat von jemand anderem gezahlt worden war.
Tenleigh.
Ich dachte an ihr unglückliches Gesicht, das sie gemacht hatte, als ich sie noch bis zu ihrem Wohnwagen hatte begleiten wollen. Sie hatte sich dafür geschämt, doch das war einfach lächerlich, weil schließlich auch das Haus, in dem ich lebte, und mein Leben ein komplettes Durcheinander waren. Ich hatte wahrlich keinen Grund, auf sie herabzusehen. Vor allem hatte ich mir statt des jämmerlichen, kleinen Wohnwagens mehr die Umgebung angeschaut. Sie war aufgeräumt und sauber, und wie auch vor meinem eigenen Haus lag nirgends irgendwelcher Müll herum. Dabei waren die meisten Grundstücke auf diesem Berg mit Unrat übersät. Dadurch stellten die Bewohner Dennvilles öffentlich zur Schau, dass der Kampf gegen den Niedergang für sie verloren war. Den Luxus einer Müllabfuhr konnte sich hier niemand leisten, und die meterhohen Abfallberge vor den meisten Häusern waren eine passende Metapher für die meisten Lebensläufe hier an diesem Ort. Ich selbst aber packte jeden Montag meinen Abfall in zwei Tüten, schleppte sie zum Fuß des Bergs, entleerte sie in den Container hinter Rustys Laden, faltete sie ordentlich zusammen und steckte sie wieder ein. Ich benutzte diese Tüten mehrmals, weil es für das Geld, das ich für eine Rolle neuer Tüten hätte bezahlen müssen, mindestens zwei Dosen Nudeln mit Tomatensoße gab.
Ich hatte schon des Öfteren gesehen, wie Tenleigh einen großen Pappkarton den Berg hinuntertrug, und mich gefragt, was er enthielt. Anscheinend trug auch sie den Müll ins Dorf. Sie hatte sich trotz ihres harten Lebens ihren Stolz bewahrt. Auch wenn das für unseresgleichen eher ein Fluch als Segen war.
Aber sie war mir schon vorher aufgefallen. Ich hatte sie in den wenigen Fächern, die wir zwei zusammen hatten, oft verstohlen angesehen. Sie saß immer in der ersten Reihe, und von meinem Platz ganz hinten konnte ich genau verfolgen, was sie tat. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr lösen. Mir gefiel die unbewusste Reaktion auf Leute, die ihr nicht behagten – wie sie sich die nackten Beine kratzte und die Lippen spitzte, wenn ein Mitschüler, den sie nicht mochte, mit ihr sprach … wie sie mit zusammengekniffenen Augen auf die Tafel schaute und an ihrer pinkfarbenen Unterlippe nagte, während sie sich konzentrierte … oder wie sie manchmal mit verträumtem Blick aus dem Fenster sah. Ich dachte an ihr Profil und ihren sanft geschwungenen Hals, aber beim Gedanken an ihre Schuhe fühlte ich mich ganz leer und elend. Die Sohlen waren durchlöchert, und die Kratzer an der Oberfläche hatte sie mit Filzstift übermalt. Ich stellte sie mir vor, wie sie zu Hause saß und die diversen Macken übertünchte, damit niemand merkte, dass sie täglich mit kaputten alten Schuhen in die Schule kam. Es weckte meinen Zorn, dass sie sich kein neues Paar leisten konnte. Aber das war vollkommen idiotisch, und vor allem zeigte es, dass ich am besten weiter so viel Abstand wie möglich zu ihr hielt. Ich konnte mir Gefühle, wie ich sie empfand, wenn ich sie ansah, schlicht nicht leisten. Und vor allem wollte ich ganz sicher nichts für jemanden empfinden, der aus diesem Scheißkaff kam.
Nachdem sie mich gesehen hatte, wie ich heimlich irgendwelche fremden Frühstücksreste hatte mitgehen lassen, hatte sie mir öfter verstohlen hinterhergeschaut. Die Freude am anderen Geschlecht war mir durchaus nicht fremd, und wenn ein Mädchen sich mir anbot, nahm ich gerne an. Wer ließ sich nicht gern von einer willigen Gespielin ab und zu daran erinnern, dass das Leben nicht nur Not und Elend war? Doch ich spürte, dass Tenleigh mich aus einem anderen Grund beobachtete. Als wolle sie ein Rätsel lösen und erfahren, wer ich wirklich war. Während ich mich selbst fragte, was der Grund für diese Art von Neugier war.
Total bescheuert.
Sie hatte diese ruhige Art und strahlte eine Mischung aus Verletzlichkeit und Stärke aus. Dazu sah sie fantastisch aus – das war mir natürlich aufgefallen –, und dass sie nicht versuchte, ihr phänomenales Äußeres zur Schau zu stellen, machte sie noch anziehender für mich. Sie benutzte keinerlei Make-up und trug ihr Haar meistens zu einem schlichten Pferdeschwanz gebunden. Offensichtlich hielt sie ihre Schönheit nicht für ihren wertvollsten Besitz. Ich fragte mich, worauf sie wohl dann am meisten hielt. Ihre Klugheit? Ja, vielleicht. Nicht, dass sie eine Chance hätte, das Stipendium zu bekommen, denn ich hatte schon vor meinem Wechsel auf die Highschool mit dem Lernen angefangen, mich eingehend mit den Leistungen der früheren Stipendiaten befasst und alles unternommen, um auf jeden Fall genauso gut zu sein. Ich brauchte das Stipendium. Mein gesamtes Leben hing davon ab. Also war es vollkommen irrelevant, dass ich mich so sehr für Tenleigh interessierte. Ich würde Dennville bald verlassen und niemals mehr daran zurückdenken, weder an die wunderhübsche Tenleigh Falyn mit den leuchtend grünen Augen noch an irgendjemand anderen aus diesem Kaff.
Aber weshalb bekam ich sie einfach nicht mehr aus dem Kopf?
Total bescheuert.
Nach einer Weile hob ich meinen Rucksack auf mein Bett und holte meine Schulbücher heraus. Ich musste mich auch weiter ganz aufs Lernen konzentrieren. Mir blieb nur noch ein halbes Jahr, bis ich das Stipendium bekam, das mich fortbringen würde aus diesem gottverlassenen Nest, fort von der Hoffnungslosigkeit, dem Hunger und der Grube, in der mein älterer Bruder und mein Vater in der rabenschwarzen Enge Meilen unter der Erde umgekommen waren.
Ich sah Tenleigh ein paar Tage später, als sie auf der Straße vor mir lief. In ihren Händen hatte sie ein Buch, das sie im Gehen las. Dieses dumme Mädchen – wenn sie nicht aufpasste, stolperte sie irgendwo und brach sich den Hals. Ich lief hinter ihr her und beobachtete sie. Für den Gefallen, den sie mir erwiesen hatte, war ich ihr wohl etwas schuldig. Ich würde also dafür sorgen, dass ihr auf dem Heimweg von der Schule nichts geschah. Ohne dass sie etwas davon mitbekam, denn ich würde nie mehr mit ihr reden. Das war einfach besser so.
Mit einem Mal bog sie in einen Waldweg ab. Ich schreckte leicht zusammen. Wo in aller Welt wollte sie hin?
Ich blieb zunächst auf der Straße stehen und sah, wie sie im Wald verschwand. Das Mädchen hätte es verdient, wenn es von einem Luchs gefressen würde. Ich stieß einen frustrierten Seufzer aus und folgte ihr.
Ich kannte diesen Weg. Ich war bereits jeden Weg auf diesem Berg gelaufen, entweder mit meinem Bruder, als er noch gelebt hatte, oder allein. Doch ich hatte keine Ahnung, weshalb Tenleigh von der Straße abgebogen war, denn am Ende fiel der Weg in einer steilen Kalksteinklippe ab.
Ich trottete ein paar Minuten hinter ihr den schmalen Pfad hinab, bis die Bäume hinter mir lagen. Tenleigh stand am Rand des Abgrundes und starrte auf den Sonnenuntergang. Der Horizont glühte orange und gelb, und durch die Wolken drangen weiße Strahlen, als bräche in dem Augenblick der Himmel auf. Der farbenfrohe Himmel dehnte sich in all seiner Pracht vor unseren Augen aus, als wolle er die Hässlichkeit des Lebens, das wir führten, und die steten Kämpfe, die wir auszufechten hatten, wettmachen. Und während eines flüchtigen Moments war wirklich alles gut.
Ach, könnte ich doch nur die Hände danach ausstrecken und diese Schönheit dauerhaft bewahren. Ach, könnte ich doch irgendetwas Gutes festhalten, damit es mir für alle Zeit erhalten blieb.
Tenleigh setzte sich auf einen Stein und blickte immer noch in den Sonnenuntergang. Langsam ging ich auf sie zu, und plötzlich drehte sie sich um und griff sich mit einem leisen Aufschrei an die Brust. »Mein Gott! Hast du mich erschreckt! Schon wieder. Machst du das mit Absicht?«
»Tut mir leid.«
Als ich mich zu ihr setzte, rollte sie mit den Augen, lehnte sich zurück, stützte sich mit beiden Händen auf den Stein und starrte wieder in den Himmel hinauf. Doch schließlich schaute sie mich wieder an und zog die Braue hoch. »Ich nehme an, du denkst, ich würde mich in dich verlieben, wenn du permanent dort auftauchst, wo ich bin.«
In meiner Kehle stieg ein amüsiertes Lachen auf, doch mein Gesicht blieb ernst. Sie hatte mich mal wieder völlig überrascht. Und davon war ich gegen meinen Willen vollkommen begeistert.
Ich nickte. »Ja, wahrscheinlich.«
Oder – viel schlimmer – ich verliebe mich in dich.
Leise lachend wandte sie den Blick zurück in Richtung Horizont. »Tut mir leid, aber das wird ganz sicher nicht passieren, denn ich habe den Männern abgeschworen.«
Ich stieß ein leises Schnauben aus. »Das sagen sie alle.«
Mit einem amüsierten Blitzen in den Augen wandte Tenleigh sich mir wieder zu. »Hmm, und wie lange denkst du, wird es dauern, bis ich deinem überwältigenden Charme erlegen bin?«
Ich tat, als dächte ich darüber nach. »Eine meiner Eroberungen hat mich mal drei Wochen zappeln lassen.«
»Ah. Das war anscheinend eine wirklich harte Nuss.« Spöttisch zog sie eine Braue hoch und sah mich aus dem Augenwinkel an. »Und woher wirst du wissen, wann es so weit ist?«
»Die Mädchen haben dann diesen ganz bestimmten Blick. Den kenne ich inzwischen ziemlich gut.« Ich schaute sie mit einem möglichst widerwärtigen Grinsen an.
Sie schüttelte den Kopf, behielt aber ihr leises Lächeln bei.
Ich räusperte mich kurz. Ich musste diesen Flirt beenden. Jetzt sofort.
»Nein, im Grunde wollte ich mich einfach vergewissern, dass ich dir nicht gegen irgendwelche Luchse helfen muss. Ich dachte, dass ich dir das schuldig bin.«
Sie schüttelte erneut den Kopf. »Du bist mir gar nichts schuldig, denn ich habe schließlich selbst dafür gesorgt, dass Rusty mich gefeuert hat. Es war nicht deine Schuld, dass ich absichtlich gegen das Regal gestolpert bin.«
»Nein, aber das hättest du nicht machen müssen, wenn ich nicht für eine alte Saufnase ein Sandwich hätte klauen wollen.«
»Hmm, dann hast du also vor, mich regelmäßig vor den Luchsen, die hier auf mich lauern, zu beschützen? Bis du mich herumbekommen hast und meiner – so wie deiner anderen Opfer … eh, Eroberungen – überdrüssig wirst?«, erkundigte sie sich und zog erneut die Braue hoch.