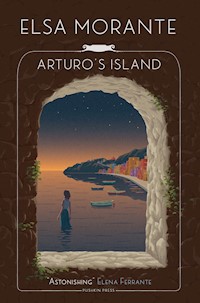Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»La Storia«, das ist die »große« Geschichte: die nüchterne Chronik von Diktaturen, Weltkriegen und Menschheitsverbrechen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit der jedes Kapitel dieses Romans eröffnet. »La Storia« ist aber vor allem die Geschichte der verwitweten Lehrerin Ida in den Jahren 1941 bis 1947. Bis zur Erschöpfung hetzt sie in Rom zwischen den Armenvierteln San Lorenzo und Testaccio hin und her, müht sich ab, ihre beiden Söhne durchzubringen. Nino, der ältere Sohn und präpotente Schwarzhemdträger, will lieber heute als morgen das Lyzeum verlassen und in den Krieg ziehen. Später findet er sich bei den Partisanen wieder. Der kleine Useppe, gezeugt bei einer Vergewaltigung durch einen jungen Wehrmachtsoldaten, immer heiter und neugierig, verbringt seine Tage allein in der Wohnung, manchmal in Gesellschaft des ebenso liebenswerten Hundes Blitz. Inmitten von Bombenangriffen, Hunger und Deportationen wächst Idas Angst, ihre jüdischen Vorfahren könnten der Familie zum Verhängnis werden. Mit unendlicher Zuneigung für ihre Figuren und einer Klarheit ohne jedes Pathos verknüpft Elsa Morante die Geschichte einer Welt in Flammen mit dem Schicksal einer Frau und ihrer Kinder. In der einfühlsamen und sorgfältigen Übersetzung von Maja Pflug und Klaudia Ruschkowski entfalten sich die Frische und Leichtigkeit des Romans – und die magische Sogwirkung, die er bis heute ausübt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1174
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit beinahe kindlicher Wahrhaftigkeit und zarter Wärme erzählt Elsa Morante die Geschichte von Ida und ihren beiden sehr unterschiedlichen Söhnen im faschistischen Rom. Trotz deutscher Besatzung und rivalisierenden Partisanen, trotz Not und Hunger, Krankheit und Tod: ein unvergesslicher, zauberhafter Roman.
Neu übersetzt von Maja Pflug und Klaudia Ruschkowski
»Elsa Morantes Meisterwerk lässt das 20. Jahrhundert körperlich greifbar werden und in hellem Licht erstrahlen.« Francesca Melandri
Elsa Morante
La Storia
Roman
Aus dem Italienischen von Maja Pflug und Klaudia Ruschkowski
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
In keiner menschlichen Sprache gibt es ein Wort,
um die Versuchstiere zu trösten, die nicht wissen, warum sie sterben müssen.
(Ein Überlebender von Hiroshima)
… dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen,
Einfältigen aber offenbart hast.
… denn so hat es dir gefallen.
Lukas 10,21
Por el analfabeto a quien escribo
. . . . . 19**
»… mir einen Katalog, einen Prospekt zu beschaffen,
weil die Neuigkeiten der großen Welt, liebe Mutter,
nicht hierhinunter gelangen …«
(aus den Sibirischen Briefen)
. . . . . 1900–1905
Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Aufbau der Materie kennzeichnen den Beginn des Atomzeitalters.
1906–1913
Nicht viel Neues in der großen Welt. Wie schon alle Jahrhunderte und Jahrtausende, die ihm auf Erden vorausgegangen sind, folgt auch das neue Jahrhundert dem bekannten starren Prinzip historischer Dynamik: den einen die Macht und den anderen die Knechtschaft. Darauf beruhen übereinstimmend sowohl die interne Gesellschaftsordnung (gegenwärtig beherrscht von den sogenannten kapitalistischen »Kräften«) als auch die externe internationale Ordnung (der sogenannte Imperialismus), beherrscht von einigen als »Mächte« bezeichneten Staaten, die sich praktisch die gesamte Erdoberfläche in entsprechende Besitztümer oder Imperien aufteilen. Zuletzt hat sich Italien hinzugesellt, das den Rang einer Großmacht anstrebt. Um ihn zu verdienen, hat es sich bereits mit Waffengewalt einige fremde, weniger mächtige Länder einverleibt und sich dadurch einen kleinen kolonialen Besitz geschaffen, jedoch noch kein Imperium.
Obwohl sich die konkurrierenden Mächte stets drohend und bewaffnet gegenüberstehen, schließen sie sich von Zeit zu Zeit in Blöcken zusammen, zur gemeinsamen Verteidigung ihrer eigenen Interessen (die intern als die Interessen der kapitalistischen »Kräfte« verstanden werden. Den anderen, den der Knechtschaft Unterworfenen, die nicht am Gewinn teilhaben, aber dennoch notwendig sind, werden diese Interessen in Form ideeller Abstraktionen vermittelt, die je nach Propagandastrategie variieren. In diesen ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts ist Vaterland der bevorzugte Begriff.)
Gegenwärtig ringen in Europa zwei Blöcke um die größtmögliche Macht: die Triple Entente, bestehend aus Frankreich, England und dem zaristischen Russland; und der Dreibund zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien. (Italien wird später zur Entente wechseln.)
Im Zentrum aller sozialen und politischen Bewegungen stehen die Großindustrien, die aufgrund ihres enormen Wachstums seit einiger Zeit in die Systeme der Massenindustrien eingegangen sind (die den Arbeiter auf »ein bloßes Zubehör der Maschine« reduzieren). Für ihre Funktionen und ihren Verbrauch sind die Industrien auf die Massen angewiesen und umgekehrt. Und da die Industriearbeit immer im Dienst von Kräften und Mächten steht, nehmen die erste Stelle ihrer Produktion notwendigerweise die Waffen ein (Rüstungswettlauf), die, basierend auf der Ökonomie des Massenkonsums, im Massenkrieg münden.
1914
Ausbruch des Ersten Weltkriegs zwischen den beiden antagonistischen Machtblöcken, denen sich nach und nach andere Alliierte oder Satelliten anschließen. Die neuen (bzw. perfektionierten) Produkte der Rüstungsindustrie, darunter Panzer und Giftgas, kommen zum Einsatz.
1915–1917
Gegen die Mehrheit im Land, die den Krieg ablehnt (und daher als defätistisch bezeichnet wird), setzen sich der König, die Nationalisten und die verschiedenen Interessensmächte durch – mit dem Kriegseintritt Italiens an der Seite der Entente. Ihr schließt sich dann unter anderem die Supermacht der Vereinigten Staaten an.
In Russland wird der Krieg gegen die Mittelmächte beendet, im Anschluss an die große, von Lenin und Trotzki angeführte marxistische Revolution für den internationalen Sozialkommunismus. (»Die Arbeiter haben kein Vaterland.« »Krieg gegen den Krieg führen.« »Den imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg verwandeln.«)
1918
Der Erste Weltkrieg endet mit dem Sieg der Entente und ihrer Verbündeten (27 Siegernationen, unter ihnen auch das japanische Kaiserreich). Zehn Millionen Tote.
1919–1920
Die Siegermächte und ihre Verbündeten werden bei der Friedenskonferenz von 70 Persönlichkeiten vertreten, die untereinander die neue Ordnung der Welt beschließen und die Karte Europas neu festlegen. Mit der Niederlage und Spaltung der besiegten Mittelmächte geht auch die Übertragung ihres Kolonialbesitzes an die Siegermächte einher. Auf Basis des Prinzips der Staatsangehörigkeit werden neue unabhängige europäische Nationalstaaten geschaffen. Deutschland wird unter anderem (um Polen den Zugang zum Meer zu sichern) die Abtretung des Danziger Korridors auferlegt, der Deutschlands Gebiet entzweischneidet.
Die Friedensbedingungen werden von einigen Vertragspartnern, unter ihnen Italien, als nicht befriedigend und unzureichend abgelehnt (verstümmelter Sieg); sie sind unerträglich für die Bevölkerungen der besiegten Länder, die zu Hunger und Verzweiflung verdammt sind (Straffrieden).
Bei den Friedensverhandlungen fehlt Russland, derzeit umzingelt und durch das militärische Eingreifen der Großmächte (Frankreich, England, Japan und die Vereinigten Staaten) in den Bürgerkrieg gegen die Rote Armee zu einem internationalen Schlachtfeld geworden. Diese entscheidende Phase, unter dem Eindruck von Massakern, Epidemien und Elend, führt in Moskau zur Gründung der Komintern (Kommunistische Internationale), die alle Proletarier der Welt, ohne Unterschied von Herkunft, Sprache oder Nationalität, gemeinsam zur revolutionären Einheit aufruft, für eine Internationale Republik des Proletariats.
1922
Nach Jahren des Bürgerkriegs, der mit dem Sieg der Revolutionäre endet, wird aus Russland ein neuer Staat, die UdSSR. Sie stellt für alle »Verdammten dieser Erde«, deren Elend sich durch den Krieg – gleich ob gewonnen oder verloren – nur noch verschlimmert hat, ein Zeichen der Hoffnung dar. Für die Mächte, die Großgrundbesitzer und Industriemagnaten, für die der Krieg hauptsächlich ein großartiges Geschäft bedeutet hat, verkörpert sie das berühmte Gespenst des Kommunismus, das jetzt in Europa umgeht.
Diese Mächte schließen sich in Italien (dem Sitz einer ihrer übelsten Ableger) mit ihren Lakaien und den über den verstümmelten Sieg Verdrossenen zusammen, um die eigenen Interessen bis zum Äußersten durchzusetzen. Sie finden bald ein für sie wie geschaffenes Instrument in Benito Mussolini, einem mittelmäßigen Emporkömmling und »Mischung aus all den Bruchstücken« des schlechtesten Italiens. Nachdem er seinen Aufstieg unter dem Banner des Sozialismus geprobt hat, hält er es für vorteilhafter, in das entgegengesetzte Lager der etablierten Mächte (der Industriellen, des Königs und schließlich auch des Papstes) zu wechseln. Auf der alleinigen programmatischen Grundlage eines zugesicherten, bedrohlichen und billigen Antikommunismus gründet er seine »fasci Italiani di combattimento«, Italienische Kampfbünde, kurz fasci (daher Faschismus), ein Clan von Vasallen und Meuchelmördern der bürgerlichen Revolution. Und in dieser Gesellschaft setzt er die Interessen seiner Hintermänner mit der terroristischen Gewalt armseliger gedungener, konfuser Aktionskommandos durch. Diesen Mann beruft der italienische König (der außer dem ererbten Titel nichts anderes zu bieten hat) bereitwillig an die Spitze der Regierung.
1924–1925
In Russland stirbt Lenin. Unter seinem Nachfolger, der sich den Namen Stalin (der Stählerne) gegeben hat, stellen die inneren nationalen Notwendigkeiten (Kollektivierung, Industrialisierung, Verteidigung gegen die im Antikommunismus vereinten Kräfte und so weiter) in verhängnisvoller Weise einerseits die Ideale der Komintern und andererseits die von Trotzki (permanente Revolution) zugunsten der stalinschen These (Sozialismus in einem Land) hintan. Bis die von Marx verlautbarte Diktatur des Proletariats, nachdem sie sich bereits auf die hierarchische Diktatur einer Partei reduziert hatte, zur persönlichen Diktatur Stalins verkommt.
In Italien herrscht die totalitäre Diktatur des Faschisten Mussolini, der inzwischen eine demagogische Formel zur Stärkung seiner Machtbasis erdacht hat. Sie nimmt vor allem Einfluss auf den Mittelstand, der seine eigene Mittelmäßigkeit in den falschen Idealen (durch seine klägliche Unfähigkeit zu richtigen Idealen) zu kompensieren sucht. Diese Formel besteht in der Berufung auf die glorreiche Abstammung der Italiener als legitime Erben der größten Macht der Geschichte, des imperialen Roms der Cäsaren. Dank dieser und anderer nationaler Zielsetzungen steigt Mussolini zum »Idol der Massen« auf und gibt sich den Titel Duce.
1927–1929
In China beginnt der von Mao Tse-tung angeführte Guerillakrieg der kommunistischen Revolutionäre gegen die nationalistische Zentralmacht.
In der UdSSR: Niederlage der Opposition. Trotzki wird aus der Partei ausgeschlossen und dann der Sowjetunion verwiesen.
In Rom: Lateranverträge des Heiligen Stuhls mit dem faschistischen Italien.
1933
In einer der italienischen Situation vergleichbaren Lage betrauen die etablierten Mächte in Deutschland den Begründer des deutschen Faschismus (Nationalsozialismus), Adolf Hitler, mit der Regierung, ein unseliger, von der Sucht nach Tod durchdrungener Besessener (»Ziel ist Beseitigung der lebendigen Kräfte«). Auch er wird als »Führer« zum Idol der Massen und propagiert als beherrschende Formel die Überlegenheit der germanischen Rasse über alle menschlichen Rassen. Daher verlangt das vorgesehene Programm des Großdeutschen Reichs die vollständige Versklavung und Vernichtung aller niederen Rassen, angefangen bei den Juden. In Deutschland beginnt die systematische Judenverfolgung.
1934–1936
Der Lange Marsch Mao Tse-tungs durch China (12 000 Kilometer), um der Einkreisung durch die übermächtigen Kräfte der nationalchinesischen Regierung (Kuomintang) zu entgehen. Von den 130 000 Mann der Roten Armee kommen 30 000 lebend an.
In der UdSSR beginnt Stalin (auch er inzwischen ein »Idol der Massen«) mit der »Großen Säuberung« durch die rücksichtslose physische Vernichtung der alten Revolutionäre aus Partei und Armee.
Der imperialen Formel des Duce folgend, bemächtigt sich Italien mit Waffengewalt des unabhängigen afrikanischen Staats Abessinien und erklärt sich zum Imperium.
Bürgerkrieg in Spanien, ausgelöst durch den katholisch-faschistischen Franco (Generalissimus oder El Caudillo genannt) im Namen der bereits erwähnten, durch das »Gespenst« bedrohten Mächte. Nach drei Jahren Verwüstung und Massenmorden (unter anderem wird in Europa die Zerstörung ganzer bewohnter Städte aus der Luft zur Gewohnheit) setzen sich dank der massiven Unterstützung von Duce und Führer und mit Duldung sämtlicher Weltmächte die Faschisten (Falangisten) durch.
Der Führer und der Duce begründen die Achse Berlin–Rom, die dann im militärisch-wirtschaftlichen Stahlpakt gefestigt wird.
1937
Nachdem das Japanische Kaiserreich einen Antikominternpakt mit den beiden Achsenländern geschlossen hat, fällt es in China ein. Dort wird der Bürgerkrieg vorübergehend ausgesetzt, um eine gemeinsame Front gegen den eindringenden Feind zu schaffen.
In der UdSSR (politisch isoliert in einer dem Kommunismus feindlich gesinnten Welt) intensiviert Stalin im Inneren das Terrorsystem, setzt aber in den Außenbeziehungen zu den Mächten zunehmend auf die sachliche Strategie einer Realpolitik.
1938
In der UdSSR greift das stalinsche Terrorsystem von den Spitzen der Bürokratie auf die Volksmassen über (Millionen und Abermillionen von Verhaftungen und Deportationen in die Arbeitslager, wahllose und willkürliche Todesurteile in schwindelerregendem Ausmaß und so weiter). Nichtsdestotrotz betrachten die irdischen Scharen der Unterdrückten – unwissend und getäuscht – die UdSSR weiterhin als einzige Heimat ihrer Hoffnung (schwer, auf eine Hoffnung zu verzichten, wenn es keine andere gibt).
Münchner Abkommen zwischen den Regierungschefs der Achse und den westlichen Demokratien.
In Deutschland leitet ein blutiges Pogrom, die sogenannte Kristallnacht, praktisch den unverdeckten Völkermord der Deutschen an den Juden ein.
Dem Diktat des verbündeten Deutschlands folgend, proklamiert auch Italien seine eigenen Rassengesetze.
1939
Trotz der in München mit den Westmächten getroffenen versöhnlichen Vereinbarungen hat Hitler die Absicht, sein Programm, das in erster Linie auf der Verteidigung der deutschen Herrschaftsrechte gegen den 20 Jahre zuvor verhängten Straffrieden besteht, bis zum Ende durchzusetzen. Nach dem sogenannten »Anschluss« Österreichs überfällt er daher die Tschechoslowakei (sogleich kopiert vom Duce, der Albanien besetzt) und nimmt diplomatische Verhandlungen mit der stalinistischen Macht auf.
Das Resultat besteht in einem Nichtangriffspakt zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion – der beiden Vertragspartnern den Überfall auf Polen und dessen Teilung zu ihren Gunsten erlaubt. Nach dem überraschenden Angriff der Hitlertruppen auf Westpolen erklären Frankreich und England dem Deutschen Reich den Krieg. Damit beginnt der Zweite Weltkrieg.
Der Kriegserklärung folgt eine auf Hochtouren laufende Produktion der Rüstungsbetriebe. Durch Millionen von Menschen, die an den Maschinen stehen, werden schon bald neue Erzeugnisse geliefert (unter den ersten modern ausgestattete und äußerst widerstandsfähige Panzer, Jagdflieger und Bomber mit großer Reichweite und so weiter).
In Durchsetzung seiner eigenen strategischen Absichten (wobei sich bereits ein unvermeidlicher Zusammenstoß mit dem Deutschen Reich ankündigt) beginnt Stalin nach dem vereinbarten Einmarsch ins östliche Polen mit der Annexion des Baltikums. Finnland, das sich widersetzt, wird von der Sowjetarmee in die Knie gezwungen. Auch die sowjetische Industrie arbeitet mit ganzem Einsatz an der Massenkriegsproduktion. Sie spezialisiert sich vor allem auf die Entwicklung moderner Raketenwerfer von höchster Schlagkraft und so weiter.
Frühling–Sommer 1940
Die erste Phase des Zweiten Weltkriegs ist durch einen überaus raschen Vormarsch des Führers gekennzeichnet, der nach der Besetzung von Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg in Frankreich einbricht und bis vor die Tore von Paris vorstößt. Der Duce, bis dahin halbwegs neutral, doch jetzt des bevorstehenden Sieges gewiss, beschließt, vollstes Vertrauen in den Stahlpakt zu setzen (»ein paar tausend Menschen müssen geopfert werden, damit ich am Friedenstisch Platz nehmen kann«). Vier Tage vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris erklärt er Großbritannien und Frankreich den Krieg. Weder Hitlers triumphale Erfolge noch seine Friedensangebote erwirken den Rückzug Großbritanniens, das erbitterten Widerstand leistet; zugleich eröffnet die italienische Intervention eine neue Front im Mittelmeerraum und in Afrika. Der Blitzkrieg der Achse weitet sich aus und zieht sich wider Erwarten in die Länge.
Luftschlacht Hitlers gegen England, gekennzeichnet von ununterbrochener Bombardierung und der völligen Zerstörung von Verkehrswegen, Häfen, Industrieanlagen und ganzen bewohnten Städten. Das Verb »coventrieren«, von der englischen Stadt Coventry, die durch die deutschen Bombenangriffe vernichtet wurde, findet Eingang in den Sprachgebrauch. Der Bombenterror, der sich mit der Absicht (im Hinblick auf eine eventuell entscheidende Landung), den britischen Widerstandswillen zu brechen, ohne Unterlass über Wochen und Monate hinzieht, erzielt nicht den gewünschten Erfolg.
Die fortdauernden Kampfhandlungen im Westen bringen den Führer nicht vom heimlichen Vorhaben eines Angriffs im Osten auf die Sowjetunion ab (angelegt im geschichtsträchtigen Entwurf des »Großgermanischen Reichs«, das zugleich die Vernichtung der minderwertigen slawischen Rasse und die Auslöschung des bolschewistischen Gespensts von dieser Erde erfordert). Aber auch hier unterschätzt der Führer nicht nur die Ressourcen des Gegners, sondern auch die Risiken der Operation.
Dreimächtepakt zwischen dem Deutschen Reich, Italien und Japan, mit dem Ziel, in Eurasien eine »neue Ordnung« (imperial-faschistisch) zu schaffen. Dem Pakt treten Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Jugoslawien bei.
Herbst–Winter 1940
Überraschender Angriffskrieg Italiens auf Griechenland, von den Verantwortlichen als »einfacher Spaziergang« angekündigt. Das falsch kalkulierte Unternehmen erweist sich hingegen als katastrophal für die Italiener, die von den Griechen zurückgeschlagen werden. In ungeordnetem Rückzug und ohne Nachschub werden sie in den Bergen von Epirus vom Winter überrascht.
Die italienische Flotte erleidet schwere Verluste im Mittelmeer.
In Nordafrika mühsame Verteidigung der italienischen Stellungen, die von der britischen Desert Force angegriffen werden . . . . .
An einem Januartag des Jahres 1941
ging ein deutscher Soldat
durch das Viertel San Lorenzo in Rom.
Er kannte insgesamt vier Worte Italienisch
und von der Welt kannte er wenig oder nichts.
Mit Vornamen hieß er Gunther.
Der Nachname bleibt unbekannt.
1.
An einem Januartag des Jahres 1941 irrte ein durchziehender deutscher Soldat, der einen Nachmittag frei hatte, allein durch das Stadtviertel San Lorenzo in Rom. Es war gegen zwei Uhr nachmittags, und wie üblich waren um diese Zeit kaum Leute auf der Straße. Keiner der Passanten beachtete den Soldaten, da die Deutschen in diesem Weltkrieg zwar Verbündete der Italiener waren, in bestimmten proletarischen Gegenden aber nicht gern gesehen wurden. Der Soldat unterschied sich in nichts von den anderen seiner Art: hochgewachsen, hellblond, mit der üblichen Haltung fanatischer Disziplin und besonders wie er die Feldmütze trug, eine erklärte Provokation. Natürlich wären jemandem, der ihn näher betrachtet hätte, einige charakteristische Züge nicht entgangen. Zum Beispiel hatte er im Gegensatz zu seinem martialischen Gang einen verzweifelten Blick. Und sein Gesicht verriet eine unglaubliche Unreife, bei einer Größe von etwa 1,85 Meter. Die Uniform – wirklich komisch für einen Soldaten des Reichs, vor allem in den Anfangszeiten des Krieges – war zwar neu und lag eng an seinem mageren Körper an, doch die Taille saß zu hoch, und die Ärmel waren zu kurz, sodass seine nackten Handgelenke herausragten, grob, kräftig und unbedarft, wie bei einem Bauernjungen oder einem Plebejer.
Er war nämlich im letzten Sommer und Herbst auf einmal viel zu schnell gewachsen; und in der Raserei des Wachsens war sein Gesicht aus Zeitmangel unverändert geblieben und schien ihm ständig vorzuwerfen, nicht einmal das Mindestalter zu haben, das für seinen untersten Dienstgrad vorgeschrieben war. Er war ein einfacher Rekrut des zuletzt eingezogenen Jahrgangs. Und bis er zum Militärdienst einberufen wurde, hatte er immer mit den Geschwistern und der verwitweten Mutter in seinem Geburtshaus in Bayern nicht weit von München gelebt.
Genauer gesagt war sein Wohnort die ländliche Kleinstadt Dachau, die später, nach dem Ende des Kriegs, wegen des angrenzenden »Arbeitslagers« mit seiner »Station für biologische Experimente« berühmt wurde. Doch zu der Zeit, als der Junge in der kleinen Stadt aufwuchs, war die wahnsinnige Mordmaschine noch im Stadium erster geheimer Versuche. In der Umgebung und bis ins Ausland galt sie sogar als eine Art Modellheilanstalt für Abweichler … Damals belief sich die Zahl der Insassen auf vielleicht 5–6 000; das Lager sollte von Jahr zu Jahr aber immer voller werden. Zuletzt, 1945, zählte es 66 428 Leichen.
Die persönlichen Erkundungen des Soldaten, die (selbstverständlich) nicht bis in die unerhörte Zukunft reichen konnten, waren aber auch in Bezug auf Vergangenheit und Gegenwart bisher ziemlich wirr, spärlich und beschränkt geblieben. Das mütterliche Dorf in Bayern war für ihn der einzige klare und vertraute Punkt im verworrenen Reigen des Schicksals. Ansonsten kannte er, bis er in den Krieg zog, nur noch die nahe Stadt München, wo er gelegentlich als Elektriker arbeitete und wo er unlängst bei einer alten Prostituierten das Lieben gelernt hatte.
Der Wintertag in Rom war bedeckt, und der Schirokko wehte. Gestern war Dreikönig gewesen, womit die Feierei ein Ende hatte, und erst vor wenigen Tagen hatte der Soldat seinen Weihnachtsurlaub zu Hause bei der Familie beendet.
Mit Vornamen hieß er Gunther. Der Nachname bleibt unbekannt.
An diesem Morgen hatte man ihn in Rom abgeladen, eine kurze Etappe auf der Fahrt zu einem Ziel, das nur dem Generalstab bekannt war, nicht aber der Truppe. Die Kameraden seiner Einheit mutmaßten, das geheime Ziel sei Afrika, wo man anscheinend beabsichtige, Garnisonen zum Schutz der Kolonialbesitzungen des verbündeten Italiens zu errichten. Diese Nachricht hatte ihn anfangs elektrisiert, versprach sie doch ein echtes exotisches Abenteuer.
AFRIKA! Wie das klang, für jemanden, der eben erst großgeworden und höchstens mal mit dem Fahrrad oder dem Bus nach München gefahren war!
AFRIKA! AFRIKA!
… Mehr als tausend Sonnen und zehntausend Trommeln
zanz tamtam baobab ibar!
Tausend Trommeln und zehntausend Sonnen
über den Kakao- und Brotfruchtbäumen!
Rot orange grün rot
die Affen spielen Fußball mit den Kokosnüssen.
Da sitzt der Medizinmann Mbunumnu Rubumbu
unter einem Schirm aus Papageienfedern!!!
Da reitet der weiße Bandit auf einem Büffel
zieht durch die Drachenberge und den Atlas
zanz tamtam baobab ibar
durch die Schluchten der Flusswälder
wo sich in Scharen die Ameisenbären tummeln!
Ich habe eine Hütte voller Gold und Diamanten
und auf meinem Dach hat ein Strauß sein Nest gebaut.
Ich gehe mit den Kopfjägern tanzen.
Ich habe eine Klapperschlange verzaubert.
Rot orange grün rot
ich schlafe in einer Hängematte im Ruwenzori.
Im Land der tausend Hügel
fange ich Löwen und Tiger wie Hasen.
Ich fahre Kanu auf dem Nilpferdfluss
tausend Trommeln und zehntausend Sonnen!
Ich fange die Krokodile wie Eidechsen
im Ngamisee
und im
Limpopo.
… Hier in Italien befand er sich zum ersten Mal im Ausland; und das hätte schon als Vorgeschmack dienen können, um seine Neugier zu wecken und für Aufregung zu sorgen. Aber noch vor der Ankunft, beim Überschreiten der deutschen Grenze, war eine schreckliche Leere und Schwermut über ihn gekommen, die sein ungeformtes Gemüt voller Widersprüche verriet. Teils sehnte sich der Junge nach Abenteuern, teils blieb er aber auch, ohne es selbst zu wissen, ein Muttersöhnchen. Teils träumte er davon, zu Ehren seines Führers unerhörte Heldentaten zu vollbringen; teils argwöhnte er, der Krieg sei eine von den Generalstäben ausgeheckte, unlogische Algebra, die ihn selbst aber überhaupt nichts anging. Teils fühlte er sich zu jeder blutigen Gewalttat bereit; und teils rumorte in ihm die ganze Fahrt über ein bitteres Mitleid mit seiner Prostituierten aus München, die, alt wie sie war, bestimmt nur noch wenige Kunden finden würde.
Je länger es gen Süden ging, umso mehr verdrängte die Traurigkeit in ihm jede andere Regung, bis er blind war für die Landschaften, die Leute, jedes Schauspiel und alles Neue: »Wie die Katze im Sack«, sagte er sich, »werde ich hier in den Schwarzen Erdteil verfrachtet!« Diesmal dachte er nicht Afrika, sondern Schwarzer Erdteil: Dabei sah er das Bild eines schwarzen Vorhangs vor sich, der sich schon jetzt endlos über ihn senkte und ihn sogar von den Kameraden ringsum trennte. Und seine Mutter, seine Geschwister, die Ranken an der Hauswand, der Ofen in der Diele entfernten sich taumelnd hinter diesem schwarzen Vorhang, wie eine Galaxie auf der Flucht durch die Universen.
In diesem Zustand war er in Rom angekommen und nutzte seine nachmittägliche Ausgangserlaubnis, um sich allein und aufs Geratewohl in die Straßen rund um die Kaserne zu stürzen, wo man seinen Zug für den Zwischenstopp untergebracht hatte. Und ohne jede Absicht geriet er in das Viertel San Lorenzo, wie ein von Wächtern umzingelter Angeklagter, der mit diesem letzten, lächerlichen Fetzen Freiheit nichts mehr anzufangen weiß. Er kannte genau vier Worte Italienisch, und von Rom kannte er nur die paar Dinge, die man in der Vorschule lernt. So konnte er leicht annehmen, bei den alten, heruntergekommenen Mietshäusern von San Lorenzo handele es sich wohl um die antiken Baudenkmäler der Ewigen Stadt! Und als er hinter der hohen Mauer, die den Friedhof Verano umschließt, die hässlichen Grabstätten ausmachte, bildete er sich ein, es seien wahrscheinlich die historischen Grabmäler der Cäsaren und der Päpste. Er blieb trotzdem nicht stehen, um sie zu betrachten. In diesem Moment waren Kapitol und Kolosseum für ihn nichts als Müllhaufen. Die Geschichte war ein Fluch. Und die Geographie auch.
Ehrlich gesagt war das Einzige, wonach er in den römischen Straßen gerade instinktiv suchte, ein Bordell. Nicht so sehr wegen einer drängenden, unwiderstehlichen Begierde, sondern weil er sich so allein fühlte; und ihm schien, dass er sich nur im Körper einer Frau, versunken in diesem warmen, freundlichen Nest, weniger allein fühlen würde. Doch für einen Fremden in seiner Lage und in dieser düsteren, wüsten Stimmung, die ihn bedrückte, bestand wenig Hoffnung, um diese Stunde und ohne Hilfe eines Ortskundigen, in der Umgebung eine solche Zuflucht zu finden. Er konnte auch nicht auf das Glück einer zufälligen Straßenbekanntschaft zählen: Denn obwohl er sich fast unbemerkt in einen hübschen Jungen verwandelt hatte, war der Soldat Gunther noch immer ziemlich unerfahren und im Grunde auch schüchtern.
Ab und zu versetzte er den Pflastersteinen, die ihm vor die Füße kamen, wütende Tritte, vielleicht lenkte er sich so kurz durch die Vorstellung ab, er sei der berühmte Andreas Kupfer, oder irgendein anderes seiner Fußballidole; aber sofort erinnerte er sich an seine Uniform eines Soldaten des Dritten Reichs. Ruckartig nahm er wieder Haltung an, sodass sich seine Mütze leicht verschob.
Die einzige Höhle, die sich ihm bei seiner kläglichen Suche anbot, war ein Souterrain, zu dem ein paar Stufen hinunterführten, darüber ein Schild: Vino e cucina – Da Remo; und als ihm einfiel, dass er an diesem Tag seine Ration aus Appetitlosigkeit einem Kameraden geschenkt hatte, bekam er plötzlich Hunger, und er stieg in das Lokal hinunter, angelockt von dem Versprechen auf einen Trost, sei er noch so klein. Er wusste, dass er sich in einem verbündeten Land befand: Zwar erwartete er in dem einladenden Keller sicher kein Zeremoniell wie für einen General, aber doch eine herzliche und familiäre Aufnahme. Stattdessen empfingen ihn sowohl der Wirt als auch der Kellner mit einer verdrossenen, argwöhnischen Kälte und so schiefen Blicken, dass ihm der Hunger sofort verging. Deshalb setzte er sich nicht zum Essen hin, sondern blieb am Tresen stehen und bestellte in herrischem Ton Wein – den er nach einem gewissen Widerstand der beiden und etwas Geflüster im Hinterzimmer auch bekam.
Er war überhaupt kein Trinker; und außerdem mochte er Bier, dessen Geschmack ihm von klein auf vertraut war, viel lieber als Wein. Aber um es dem Kellner und dem Wirt zu zeigen, ließ er sich demonstrativ mit immer bedrohlicherem Gehabe nacheinander fünf Viertel einschenken und kippte sie wie ein sardischer Bandit in großen Schlucken hinunter. Dann warf er grob fast das ganze bisschen Kleingeld, das er in der Tasche hatte, auf den Tresen; dabei hätte er am liebsten vor Wut den Tresen und die Tische umgestoßen und sich nicht mehr wie ein Verbündeter, sondern wie ein Besatzer und Mörder benommen. Doch eine leichte Übelkeit, die aus seinem Magen aufstieg, hielt ihn von jeder Tat ab. Und mit noch ziemlich martialischem Schritt trat er wieder an die frische Luft.
Der Wein war ihm in die Beine gegangen und zu Kopf gestiegen. Und draußen, im faulig riechenden Schirokko, der ihm bei jedem Atemzug fast das Herz zerspringen ließ, überkam ihn der unmögliche Wunsch, zu Hause zu sein, zusammengekauert in seinem zu kurzen Bett, im kalten, sumpfigen Geruch der Felder und dem lauen Dunst des Weißkohls, den seine Mutter in der Küche aufwärmte. Doch dank des Weins quälte ihn dieses abgrundtiefe Heimweh nicht, es machte ihn fröhlich. Für einen, der halbbetrunken durch die Gegend läuft, sind zumindest für ein paar Minuten alle Wunder möglich. Ein Hubschrauber kann vor ihm landen und ihn umgehend nach Bayern zurückbringen, oder ein Funkspruch kann ihm über den Äther eine Verlängerung seines Urlaubs bis Ostern verkünden.
Er ging noch ein paar Schritte weiter, dann bog er auf gut Glück ab und blieb beim ersten Haustor auf der Schwelle stehen, in der leichtsinnigen Absicht, sich drinnen hinzulegen und auf einer Stufe oder in einem Verschlag unter der Treppe zu schlafen, wie an Fasching bei den Kostümfesten, wo jeder macht, was er will, und es keinen schert. Er hatte seine Uniform vergessen; plötzlich regierten die Narren die Welt, äußerste kindliche Willkür hatte das Militärgesetz des Reichs außer Kraft gesetzt! Dieses Gesetz ist eine Komödie, und Gunther pfeift darauf. In dem Augenblick wäre er fähig gewesen, die erstbeste weibliche Kreatur (nicht bloß ein gewöhnliches Mädchen oder Hürchen aus dem Viertel, sondern auch irgendein weibliches Tier: eine Stute, eine Kuh, eine Eselin!), die in diesem Hausflur aufgetaucht wäre und ihn nur ein klein wenig menschlich angeblickt hätte, überschwänglich zu umarmen, sich ihr womöglich zu Füßen zu werfen wie ein Verliebter und sie »Mutter!« zu nennen. Und da er gleich darauf an der Ecke eine Bewohnerin des Hauses auftauchen sah, eine bescheiden, aber anständig wirkende kleine Frau, die gerade mit Einkaufstaschen und Tüten heimkam, rief er: »Signorina! Signorina!« (eines der vier Worte Italienisch, die er kannte). Entschlossen machte er einen Satz auf sie zu, obwohl er selbst nicht wusste, was er von ihr wollte.
Sie jedoch starrte ihn, als er ihr so entgegentrat, mit einem absolut unmenschlichen Blick an, als wäre er die leibhaftige Erscheinung des Grauens.
2.
Die Frau, von Beruf Grundschullehrerin, hieß Ida Ramundo verwitwete Mancuso. Eigentlich hatten ihre Eltern sie Aida nennen wollen. Doch durch einen Fehler des Standesbeamten war sie als Ida eingetragen worden, von ihrem kalabresischen Vater Iduzza genannt.
Sie war 37 und tat wahrhaftig nichts, um weniger alt auszusehen. Ihr ziemlich unterernährter und unproportionierter Körper, mit der welken Brust und dem übermäßig in die Breite gegangenen unteren Teil, war, so gut es ging, in einen braunen Altfrauenmantel gehüllt, mit einem recht schäbigen Pelzkrägelchen und fahlgrauem Futter, dessen zerschlissene Ränder aus den Ärmeln heraushingen. Sie trug auch einen Hut, der mit ein paar Nadeln aus dem Kurzwarengeschäft festgesteckt und seit ihrer Witwenzeit mit einem kleinen schwarzen Schleier versehen war; und abgesehen von dem Schleier wurde ihr Personenstand als Signora auch durch den Ehering an ihrer linken Hand bezeugt (aus Stahl, anstelle des Goldrings, der schon dem Vaterland für den Abessinienfeldzug geopfert worden war). Ihre krausen, pechschwarzen Locken begannen zu ergrauen; aber ihr rundes Gesicht mit den vollen Lippen war vom Alter seltsam verschont geblieben und glich dem eines bekümmerten kleinen Mädchens.
Und in der Tat war Ida im Grunde ein Kind geblieben, denn ihr wesentliches Verhältnis zur Welt war seit je und blieb (ob bewusst oder nicht) eine ängstliche Befangenheit. Eigentlich waren die einzigen Menschen, die ihr keine Angst machten, ihr Vater, ihr Mann und später vielleicht ihre Schulkinder gewesen. Der gesamte Rest der Welt war eine bedrohliche Unsicherheit für sie, da sie, ohne es zu wissen, mit ihren Wurzeln in wer weiß welcher Stammesvorgeschichte hängengeblieben war. Und in ihren großen dunklen Mandelaugen lag eine passive Sanftmut, zutiefst und unheilbar barbarisch, die einem Vorherwissen ähnelte.
Vorherwissen ist allerdings nicht das passendste Wort, denn das Wissen war dabei ausgeschlossen. Vielmehr erinnerten diese seltsamen Augen an die geheimnisvolle Idiotie der Tiere, die nicht mit dem Verstand, sondern mit einem Sinn ihrer verletzlichen Körper die Vergangenheit und die Zukunft jedes Schicksals »kennen«. Ich würde diesen Sinn – der ihnen gemeinsam und mit den anderen Sinnen des Körpers verwoben ist – den Sinn für das Heilige nennen; wobei bei ihnen unter dem Heiligen die universelle Macht zu verstehen ist, die sie auffressen und vernichten kann, allein wegen ihrer Schuld, geboren zu sein.
Ida war 1903 geboren, im Zeichen des Steinbocks, der zu Betriebsamkeit, zu den Künsten und zur Prophetie neigt, in gewissen Fällen aber auch zum Wahnsinn und zur Torheit. Ihre Intelligenz war mittelmäßig; aber sie war eine folgsame, fleißige Schülerin und musste keine einzige Klasse wiederholen. Sie hatte keine Geschwister, und ihre Eltern unterrichteten beide in derselben Grundschule in Cosenza, wo sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Der Vater, Giuseppe Ramundo, stammte aus einer Bauernfamilie aus dem tiefsten Süden Kalabriens. Und die Mutter, Nora Almagià, kam aus einer kleinbürgerlichen Kaufmannsfamilie aus Padua und war nach ihrer Bewerbung auf eine Lehrerinnenstelle als dreißigjährige alleinstehende junge Frau in Cosenza gelandet. In Giuseppes Augen stellte sie mit ihrer Art, ihrem Intellekt und ihrer Gestalt etwas Höheres und Zartes dar.
Giuseppe, acht Jahre jünger als seine Frau, war ein hochgewachsener, korpulenter Mann mit geröteten, klobigen Händen und einem breiten, lebhaften, sympathischen Gesicht. Als Kind hatte ihn unglücklicherweise ein Schlag mit der Hacke am Fußknöchel verletzt, sodass er sein Leben lang leicht verkrüppelt blieb. Und sein hinkender Gang verstärkte noch den Eindruck vertrauensvoller Naivität, den er von Natur aus machte. Eben weil er für bestimmte Feldarbeiten nicht mehr taugte, hatte sich seine Familie armer Halbpächter dazu durchgerungen, ihn etwas lernen zu lassen und ihn zunächst mit Unterstützung des Gutsherrn zu den Priestern in die Schule geschickt; und seine Erfahrung mit Priestern und Grundbesitzern hatte anscheinend eine von ihm gehegte, verborgene Leidenschaft nicht gedämpft, sondern eher geschürt. Ich wüsste nicht, wie noch wo er auf bestimmte Texte von Proudhon, Bakunin, Malatesta und anderen Anarchisten gestoßen war. Und darauf hatte er einen hartnäckigen, aber unbedarften Glauben gegründet, der zwangsläufig seine persönliche Ketzerei bleiben musste. Selbst in den eigenen vier Wänden war es ihm verwehrt, sich dazu zu bekennen.
Nora Almagià, verheiratete Ramundo, war, wie ihr Mädchenname verrät, Jüdin (wie schon viele Generationen vor ihnen, lebten ihre Verwandten sogar noch immer in dem kleinen Ghetto von Padua); sie jedoch wollte das geheim halten und hatte es nur ihrem Ehemann und ihrer Tochter anvertraut, unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit. In amtlichen und praktischen Zusammenhängen pflegte sie ihren Mädchennamen zu verfremden, indem sie ihn von Almagià in Almagía umwandelte: überzeugt, durch diese Akzentverschiebung unbehelligt zu bleiben! Allerdings wurde zu der Zeit die verborgene rassische Abstammung noch nicht erforscht oder nachgeprüft. Dieses arme Almagià (oder Almagía, je nachdem) war, glaube ich, hier im Süden bei allen als ein beliebiger venezianischer Nachname durchgegangen, harmlos und unbedeutend; und sowieso erinnerten sich die Leute längst nicht mehr daran. Nora war für alle die Signora Ramundo, von der man selbstverständlich annahm, sie sei ebenso katholisch wie ihr Mann.
Nora besaß keine besonderen Eigenschaften, weder geistig noch körperlich. Dennoch war sie, ohne eine Schönheit zu sein, auf jeden Fall anmutig. Von ihrer langen Zeit als unverheiratete Frau war ihr eine keusche, puritanische Zurückhaltung geblieben (sogar in der Intimität mit ihrem Mann behielt sie die Schamhaftigkeit eines jungen Mädchens), die ihr in dieser südlichen Region große Ehre machte. Und ihre Schülerinnen liebten sie wegen der venezianischen Eleganz ihrer Manieren. Sie hatte bescheidene Gewohnheiten und einen scheuen Charakter, vor allem unter Fremden. Doch in ihrem introvertierten Wesen schwelten einige stürmische Flammen, die man in ihren tiefschwarzen Augen brennen sah: zum Beispiel uneingestandene Exzesse jugendlichen Gefühlsüberschwangs … Doch vor allem untergründige Sorgen, die sie Tag und Nacht mit verschiedenen Vorwänden umtreiben konnten und schließlich zu fixen Ideen wurden. Bis sie sich, da sie an ihren Nerven zehrten, in den häuslichen vier Wänden in unüberlegten, bedrückenden Formen Luft machten.
Der natürliche Gegenstand ihrer Ausbrüche war nur einer, der, der ihr am nächsten stand: Giuseppe, ihr Mann. Manchmal wandte sie sich schlimmer als eine Hexe gegen ihn, warf ihm seine Geburt, sein Dorf, seine Verwandten vor, verleumdete ihn grässlich mit offensichtlichen Lügen und schrie ihn sogar wegen seines lahmen Fußes an: »Segnà da Dio, tre passi indrio!« – Von Gott Gezeichneter, drei Schritte zurück! Dann war sie plötzlich erschöpft, wie ausgeleert, schlaff wie eine Stoffpuppe. Und begann zu stottern: »… was habe ich gesagt? … das wollte ich nicht sagen … nein, das wollte ich nicht sagen, ich Ärmste … oh Gott, oh Gott …«, mit schwacher Stimme, bleich im Gesicht, und sie fasste sich mit den Händen an den schmerzenden Lockenkopf. Dann bekam Giuseppe Mitleid und tröstete sie: »Ach, was macht das schon?«, sagte er zu ihr, »das macht doch nichts, es ist schon vorbei. Ein Dummerchen bist du, spinnst halt ein bisschen …«, während sie ihn benommen ansah, mit Augen, aus denen grenzenlose Liebe sprach.
Wenig später erinnerte sie sich an ihre Szenen wie an einen entsetzlichen Traum, in dem sie sich spaltete. Das war nicht sie, sondern eine Art blutsaugerische Bestie, ihre Feindin, die sich in ihrem Inneren festkrallte und sie zu einer verrückten und unverständlichen Aufführung zwang. Am liebsten wäre sie gestorben. Doch um ihre Reue nicht zu zeigen, war sie fähig, für den Rest des Tags in ein gereiztes, düsteres, beinah anklagendes Schweigen zu verfallen.
Was sie noch kennzeichnete, waren gewisse übertriebene und feierliche Aussprüche, die vielleicht noch von den alten Patriarchen auf sie gekommen waren. Allerdings mischten sich unter diese biblischen Wendungen die gewohnten Sätze und Kadenzen, die sie in ihrer Kindheit in Venetien aufgeschnappt hatte und die in diesem Zusammenhang wie ein ziemlich komischer Singsang klangen.
Was ihr jüdisches Geheimnis betraf, hatte sie ihrer Tochter von klein auf erklärt, die Juden seien ein Volk, dem seit Ewigkeit der rächende Hass aller anderen Völker bestimmt sei; und die Verfolgung werde, auch in scheinbaren Atempausen, immer gegen sie wüten und sich auf ewig wiederholen, so wie es geschrieben stehe. Aus diesen Gründen hatte sie selbst darauf bestanden, dass Iduzza katholisch getauft werde, wie ihr Vater. Der zum Wohl Iduzzas zugestimmt hatte, wenn auch widerwillig: Bei der Zeremonie hatte er sich dann sogar dazu herabgelassen, sich vor aller Augen mit ausladender Geste hastig zu bekreuzigen. Privat jedoch zitierte er, wenn es um Gott ging, gern den Ausspruch: »Die GOTT-Hypothese ist unnütz«, und fügte in feierlichem Ton den Namen des Autors hinzu: »FAURE!«, wie er es bei seinen Zitaten grundsätzlich tat.
Außer Noras Hauptgeheimnis gab es in der Familie noch weitere Geheimnisse: eines war Giuseppes Trunksucht.
Soweit ich weiß, war das die einzige Schuld dieses arglosen Atheisten. In seinen Zuneigungen war er so hartnäckig, dass er sein Leben lang, wie schon als Junge, einen Großteil seines Gehalts an seine Eltern und Geschwister schickte, die ärmer waren als er. Wären da nicht die politischen Gründe gewesen, hätte er, glaube ich, spontan die ganze Welt umarmt. Doch mehr als alle auf der Welt liebte er Iduzza und Noruzza, für die er sogar Madrigale komponieren konnte. Nora nannte er während ihrer Verlobungszeit »Mein Morgenstern!«, und für Iduzza (eigentlich ja Aida) sang er oft (wohlgemerkt waren sowohl er als auch Nora Stammgäste bei den Opernaufführungen der durchziehenden Wanderbühnen gewesen):
»Celeste Aida forma divina« …
Doch vom Trinken (Noras Kreuz) kam er nicht los, auch wenn er, aus Rücksicht auf seinen Lehrerposten, darauf verzichtete, ins Wirtshaus zu gehen, und sich seinem Wein abends zu Hause widmete, vor allem samstags. Und da er noch jung, noch keine 30 war, kam es vor, dass er in solchen Momenten sorglos seine heimlichen Ideale herausposaunte.
Zuerst zeigte sich sein Redebedürfnis in einer gewissen Unruhe seiner großen Hände, die das Glas anhoben oder hin und her schoben, während seine dunklen, kastanienbraunen Augen gequält und nachdenklich wurden. Dann wiegte er langsam den Kopf und sagte: »Verrat! Verrat!«, womit er meinte, er selbst übe, seit er in den Staatsdienst eingetreten war, Verrat an seinen Genossen und Brüdern. Ein ehrlicher Lehrer hätte den armen Kleinen in der Schule die Anarchie predigen müssen, die globale Ablehnung der bestehenden Gesellschaft, die sie aufzog, um sie auszubeuten oder als Kanonenfutter zu benutzen… An dieser Stelle schloss die besorgte Nora hastig Fenster und Türen, damit solche subversiven Sprüche nicht Nachbarn oder Passanten zu Ohren kämen. Er dagegen stand auf, trat mitten ins Zimmer und zitierte mit erhobenem Zeigefinger und volltönender, immer lauterer Stimme:
… »Der Staat ist die Autorität, die Domäne und die organisierte Macht der besitzenden und angeblich aufgeklärten Klassen über die Massen. Er garantiert immer, was er findet: den einen die auf Eigentum beruhende Freiheit, den anderen Sklaverei, die unselige Folge ihres Elends. BAKUNIN!«
… »Anarchie ist heute der Angriff, der Krieg gegen jede Autorität, gegen jede Macht, gegen jeden Staat. In der zukünftigen Gesellschaft wird die Anarchie die Verteidigung sein, das Hindernis, das sich gegen die Wiederherstellung jeglicher Autorität, jeglicher Macht, jeglichen Staats richtet. CAVIERO!«
Hier fing Nora an zu flehen: »Pssst… pssst …«, während sie wie besessen von einer Wand zur anderen lief. Auch bei geschlossenen Türen und Fenstern war sie überzeugt, dass gewisse Wörter und Namen, im Haushalt zweier Lehrer ausgesprochen, einen universellen Skandal auslösen würden: als wären ihre verrammelten Zimmerchen von einer riesigen Menge lauschender Zeugen umringt. Obwohl sie nicht weniger atheistisch war als ihr Mann, lebte sie in Wirklichkeit, als sei sie einem rachsüchtigen, strafenden Gott untertan, der sie überwachte.
… »Freiheiten werden nicht gegeben. Man nimmt sie sich. KROPOTKIN!« …
… «Ach, was für ein Unglück! Schweig doch still! Du willst unser Haus in Schmach und Schande stürzen! Du willst unsere Familie in den Schmutz ziehen!«, rief sie in Paduaner Dialekt.
»Aber in welchen Schmutz denn, meine liebste Noruzza? Der Schmutz klebt an den weißen Händen der Besitzenden und der Bankiers! Der Schmutz ist die verfaulte Gesellschaft! Anarchie ist kein Schmutz! Anarchie ist die Ehre der Welt, ein heiliger Name, die wahre Sonne der neuen Geschichte, eine immense Revolution, unerbittlich!!«, erwiderte er mit kalabrischem Akzent.
»Ah! Verflucht sei der Tag, die Stunde und der Augenblick, an dem ich diese Stelle bekommen habe! Verflucht sei das gemeine Schicksal, das mich unter diese Süditaliener hat geraten lassen, alles Straßenräuber, Otterngezücht, unwürdiges Pack! Hängen sollte man sie allesamt!«
»Hängen möchtest du uns, Norù? Hängen, mein Schatz?!« Vor Staunen ließ sich Giuseppe wieder auf seinen Stuhl fallen. Doch da, halbhingelümmelt, überkam ihn wieder die unwiderstehliche Lust zu singen, die Augen zur Decke gewandt wie ein Kutscher, der den Mond ansingt:
»Dynamit für Kirchen und Paläste
metzeln wir die verhassten Bürger nieder!« …
… »Aaaah! Schweig still, du Mörder! Schweig still, du Frevler! Schweig still, oder ich stürze mich runter!!«
Damit die Nachbarn nichts hören, achtete Nora darauf, ihre Stimme zu dämpfen, doch vor Anstrengung schwollen ihre Adern an, als würde sie gewürgt. Schließlich warf sie sich halberstickt und ermattet auf das kleine Sofa, worauf Giuseppe fürsorglich zu ihr trat, um sich zu entschuldigen und ihr wie einer Edelfrau die kleinen, mageren, vorzeitig gealterten und von der Hausarbeit und den Frostbeulen aufgesprungenen Hände zu küssen. Und bald darauf lächelte sie ihn getröstet an, für einen Moment von ihren uralten, ererbten Ängsten geheilt.
Auf ihrem bunten Stühlchen (das der Vater extra nach Maß für sie gekauft hatte) verfolgte Iduzza mit aufgerissenen Augen diese Wortgefechte, logischerweise ohne irgendetwas zu verstehen. Sie war zwar von Geburt an nie von aufrührerischem Wesen; hätte sie aber damals eine Meinung äußern können, hätte sie gesagt, dass von den beiden Streitenden ihre Mutter die rebellischere war! Jedenfalls verstand sie bei der ganzen Sache nur, dass die Eltern in bestimmten Fragen uneins waren; und zum Glück erschrak sie bei solchen Szenen nicht zu sehr, sie war ja daran gewöhnt. Dennoch setzte sie ein frohes kleines Lächeln auf, sobald zwischen ihnen wieder Frieden einkehrte.
Für sie waren diese Rauschabende auch immer ein Fest, denn durch den Wein entfaltete der Vater, wenn er seine umstürzlerischen Fahnen geschwungen hatte, voll und ganz seine natürliche gute Laune und seine bäuerliche Kultur, seit jeher mit Tieren und Pflanzen vertraut. Er ahmte alle Tierstimmen für sie nach: von den Vögelchen bis zu den Löwen. Und auf ihre Bitte wiederholte er auch ein Dutzendmal kalabresische Lieder und Märchen, die er für sie ins Komische wendete, wenn sie tragisch waren, weil sie wie alle Kinder gern lachte und ihr unbändiges Gekicher Musik für die Familie war. Irgendwann schloss sich dann auch Nora überwältigt diesem Theater an und sang mit ihrer ungeübten Stimme leicht falsch ihr eigenes, begrenztes Repertoire vor, das, soweit ich weiß, aus insgesamt zwei Stücken bestand. Eines war die berühmte Romanze Ideale:
»Io ti seguia com’iride di pace
lungo le vie del cielo…«
»Ich folgte dir, dem stillen Regenbogen gleich,
entlang der Bahnen hoch am Himmelsrund …«
und so weiter und so weiter.
Das andere war ein Lied in venezianischem Dialekt und ging so:
»Vardé che bel seren con quante stele
che bela note da rubar putele
chi ruba le putele no i xe ladri
se i ciama giovanini inamoradi …«
»Sieh, welch klarer Sternenhimmel
welch schöne Nacht, um junge Mädchen zu rauben
denn Mädchen rauben ja nicht die Diebe
sondern die Jungs auf der Suche nach Liebe …«
Dann, gegen zehn, war Nora in der Küche mit dem Aufräumen fertig, und Giuseppe brachte Iduzza ins Bett und sang ihr wie eine Mutter Schlaflieder vor, die fast orientalisch klangen und die seine Mutter und seine Großmutter für ihn gesungen hatten:
»O veni sunnu di la muntanella
lu lupu si mangiau la pecorella
o nnì o nnà
o la ninna vo’ fa’
vo’ fa’
vo’ fa’
vo’ fa’ … vo’ fa’ … vo’ …«
»Komm, o Schlaf, vom Berg herab
der Wolf hat das Schäfchen gefressen
eiapopeia
mein Kindchen, schlaf ein
schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein …«
Ein weiteres Schlaflied, das Iduzza sehr mochte und das dann an die neue Generation weitergegeben wurde, war auf Hochitalienisch, ich weiß nicht, wo Giuseppe es aufgeschnappt hatte:
»Dormite occhiuzzi dormite occhiuzzi
che domani andiamo a Reggio
a comprare uno specchio d’oro
tutto pittato di rose e fiori.
Dormite manuzze dormite manuzze
che domani andiamo a Reggio
a comprare un telarino
con la navetta d’argento fino.
Dormite pieduzzi dormite pieduzzi
che domani andiamo a Reggio
a comprare le scarpettelle
per ballare a Sant’Idarella …«
»Schlaft Äuglein schlaft
morgen fahren wir nach Reggio
kaufen einen Spiegel aus Gold
hold bemalt mit Rosen und Blumen.
Schlaft Händchen schlaft
morgen fahren wir nach Reggio
kaufen ein Weberrähmchen
mit Schiffchen aus reinem Silber.
Schlaft Füßchen schlaft
morgen fahren wir nach Reggio
kaufen kleine Schühchen ein
und tanzen zu Sankt Idalein …«
An der Seite ihres Vaters verlor Iduzza jede Angst, er war für sie wie ein warmer, leuchtender, holpernder Kinderwagen, unbezwingbarer als ein Panzer, der sie fröhlich herumkutschierte, in Sicherheit vor den Schrecken der Welt: Überallhin begleitete er sie und erlaubte niemals, dass man sie allein auf die Straße schickte, wo ihr von jedem Fenster, jeder Tür oder Begegnung mit einem Fremden Gefahr drohte. Im Winter trug er, vielleicht aus Sparsamkeit, weite, ziemlich lange Hirtenmäntel, und an Schlechtwettertagen schützte er sie vor dem Regen, indem er sie unter seinem Mantel eng an sich zog.
Ich kenne Kalabrien nicht gut genug. Von Iduzzas Cosenza kann ich anhand der wenigen Erinnerungen der Verstorbenen nur ein ungenaues Bild zeichnen. Ich glaube, dass sich schon damals rund um die mittelalterliche Stadt, die den Hügel einfasst, moderne Gebäude ausbreiteten. In einem davon, einem bescheidenen, ganz gewöhnlichen Haus, befand sich die kleine, enge Wohnung des Lehrerehepaars Ramundo. Ich weiß, dass ein Fluss durch die Stadt fließt und hinter den Bergen das Meer liegt. Vom Aufkommen des Atomzeitalters, das den Beginn des Jahrhunderts kennzeichnete, war in diesen Gegenden gewiss nichts zu spüren; und auch nicht von der industriellen Entwicklung der Großmächte, die man höchstens aus den Erzählungen der Auswanderer kannte. Der Ort lebte von der Landwirtschaft, mit der es wegen des ausgelaugten Bodens zunehmend abwärts ging. Die herrschenden Kasten waren der Klerus und die Großgrundbesitzer; und bei den niedersten Kasten war die tägliche Beilage vermutlich hier wie anderswo die Zwiebel … Sicher weiß ich jedenfalls, dass Giuseppe während seiner Lehrerausbildung jahrelang keine warmen Speisen kannte und sich vorwiegend von Brot und getrockneten Feigen ernährte.
Um ihr fünftes Lebensjahr wurde Iduzza einen ganzen Sommer lang von den Anzeichen einer namenlosen Krankheit geplagt, die ihre Eltern ängstigten wie eine Behinderung. Mitten in ihren Spielen und ihrem kindlichen Geplapper wurde sie manchmal plötzlich blass und verstummte, da sie den Eindruck hatte, die Welt ringsum löse sich in einem Schwindelgefühl auf. Die Fragen ihrer Eltern beantwortete sie nur mühsam mit dem Klagelaut eines Tierchens, aber es war offensichtlich, dass die Stimmen kaum noch zu ihr durchdrangen. Und gleich darauf fasste sie sich wie zur Abwehr an den Kopf und die Kehle, während ihr Mund in einem unverständlichen Gemurmel zitterte, als spräche sie erschrocken mit einem Schatten. Ihr Atem wurde keuchend und fiebrig, und nun warf sie sich ungestüm zu Boden, wand und schüttelte sich in wildem Aufruhr, die Augen offen, aber leer und vollkommen blind. Es war, als überfiele sie aus irgendeiner unterirdischen Quelle ein brutaler elektrischer Strom und als würde sie gleichzeitig unverletzlich, da sie nie blaue Flecken oder Verletzungen davontrug. Es dauerte höchstens ein paar Minuten, bis ihre Zuckungen schwächer und seltener wurden und ihr Körper wieder in sanfter, gefasster Ruhe dalag. Ihre Augen schwammen in träumerischem Erwachen, und die Lippen entspannten sich sacht, ohne sich zu öffnen, an den Mundwinkeln ein wenig nach oben gebogen. Es schien, als lächelte die Kleine aus Dankbarkeit, wieder nach Hause zurückgekehrt zu sein, in die doppelte Obhut ihrer treuen Schutzengel, die sich von beiden Seiten über sie beugten: der eine hier mit seinem runden, struppigen Kopf eines Hirtenhundes, die andere da mit ihrem Krausköpfchen einer kleinen Ziege.
Doch dieses schwache Lächeln war in Wirklichkeit nur eine trügerische, physische Erscheinung, ausgelöst durch die natürliche Entspannung der vorher bitter verkrampften Muskeln. Es vergingen noch einige Augenblicke, bevor Iduzza ihre häusliche Heimat wirklich wiedererkannte, und an diesem Punkt wusste sie schon nichts mehr von ihrer furchtbaren Auswanderung und Rückkehr, als seien diese Ereignisse aus ihrem Gedächtnis verbannt. Sie konnte nur berichten, ihr sei sehr schwindlig geworden und sie habe Rauschen wie von Wasser vernommen und Schritte und Stimmengewirr, das von weit her zu kommen schien. Und in den folgenden Stunden wirkte sie müde, aber lockerer und unbeschwerter als sonst, als hätte sie sich, ohne es zu wissen, von einer Last befreit, die über ihre Kräfte ging. Sie selbst meinte auch später noch, sie habe eine gewöhnliche Ohnmacht erlitten, ohne sich der dramatischen Begleitumstände bewusst zu sein. Und die Eltern zogen es vor, sie in dieser Ahnungslosigkeit zu belassen, ermahnten sie jedoch, niemandem zu sagen, dass sie von solchen Anfällen heimgesucht wurde, um ihre Mädchenzukunft nicht zu gefährden. So war in der Familie ein weiterer Skandal dazugekommen, den man vor der Welt verbergen musste.
Die uralte Volkskultur, in Kalabrien und vor allem unter Bauern noch tief verwurzelt, brandmarkte bestimmte unerklärliche Krankheiten mit einem religiösen Stigma, schrieb wiederkehrende Anfälle der Besessenheit durch heilige oder niedere Geister zu, die man in letzterem Falle nur durch rituelle Besprechungen in der Kirche austreiben konnte. Der besitzergreifende Geist, der häufiger Frauen wählte, konnte auch ungewöhnliche Kräfte verleihen, etwa die Gabe, Krankheiten zu heilen, oder Dinge vorherzusagen. Doch im Grunde wurde die Besessenheit als grausame, unverschuldete Prüfung gesehen, die unbewusste Wahl eines Einzelwesens, das die kollektive Tragödie auf sich nahm.
Natürlich war der Lehrer Ramundo mit seinem sozialen Aufstieg aus dem magischen Kreis der bäuerlichen Kultur herausgetreten; außerdem war er entsprechend seiner philosophisch-politischen Ansichten ein Positivist. Für ihn konnten solche krankhaften Phänomene nur von funktionellen Störungen oder körperlichen Gebrechen herrühren; und im speziellen Fall erschreckte ihn der schlecht verhehlte Verdacht, er selbst habe vielleicht durch seinen Alkoholmissbrauch das Blut seines Kinds schon mit dem Samen verdorben. Doch sobald Nora seine Sorge erkannte, bemühte sie sich, ihn zu beruhigen und sagte beschwichtigend: »Aber nein, quäl dich doch nicht mit so dummen Gedanken. Schau die Palmieri an, die haben immer alle getrunken, der Vater, der Großvater und der Urgroßvater! Und die Mascaro, die ihren Säuglingen Wein statt Milch geben! Siehst du nicht, dass sie alle vor Gesundheit strotzen?!!!«
In den Jahren davor zog die Familie für die heißesten Monate immer in Giuseppes Elternhaus an der Spitze Kalabriens um; doch in diesem Sommer rührten sie sich nicht aus ihrer winzigen, glühenden Wohnung in Cosenza weg, aus Angst, Iduzza könnte auf dem Land von ihrer geheimen Krankheit überfallen werden, in Anwesenheit der Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen. Und vielleicht beschleunigten die Hundstage in der Stadt, an die Iduzza noch nicht gewöhnt war, die Häufigkeit ihrer Anfälle.
Von da an hörten die Ferien auf dem Land schließlich ganz auf, weil die Großeltern nach dem Erdbeben in jenem Winter, das Reggio zerstörte und die Ebenen verwüstete, zu einem anderen Sohn gezogen waren, in eine Berghütte im Aspromonte, wo man wegen der Enge niemanden zu Gast haben konnte.
Von den früheren Ferien erinnerte sich Iduzza vor allem an die Brotpuppen, die ihr die Großmutter buk und die sie wiegte, als ob es ihre Kinder wären. Sie weigerte sich verzweifelt, sie zu essen, und wollte sie sogar im Bett bei sich haben, wo man sie ihr nachts, wenn sie schlief, heimlich fortnahm.
Im Gedächtnis geblieben war ihr auch ein gellender Schrei, den die Schwertfischfänger oben auf den Felsen ausstießen und der in ihrer Erinnerung so klang: »FA-ALEUU!«
Als jener Sommer zu Ende ging und Iduzza einen letzten Anfall hatte, entschloss sich Giuseppe, lud die Kleine auf ein ausgeliehenes Eselchen und brachte sie in ein Krankenhaus außerhalb von Cosenza, wo ein von früher mit ihm befreundeter Arzt praktizierte, der zurzeit in Montalto wohnte, aber im Norden moderne Naturwissenschaften studiert hatte. Obwohl sie sich schämte, musste Iduzza unter den Fingern des Arztes, der sie untersuchte, lachen, weil es kitzelte, und es klang hell wie ein Glöckchen. Und als die Untersuchung beendet war und sie sich bei dem Doktor bedanken sollte, errötete sie über und über und versteckte sich sofort hinter ihrem Vater. Der Arzt erklärte sie für gesund. Und da er nebenbei schon von Giuseppe erfahren hatte, dass sie sich bei ihren Anfällen weder verletzte noch schrie, noch sich auf die Zunge biss oder andere beunruhigende Symptome zeigte, versicherte er, es gebe keinen Grund, sich um sie zu sorgen. Ihre Anfälle, erklärte er, seien höchstwahrscheinlich vorübergehende Anzeichen einer kindlichen Hysterie, die im Lauf der Entwicklung von selbst verschwinden würden. Einstweilen, vor allem angesichts des bevorstehenden Schulanfangs (schon seit ihren frühesten Jahren begleitete Iduzza ihre Mutter zum Unterricht, da Nora nicht wusste, wo sie sie sonst lassen sollte), verschrieb er ihr ein Beruhigungsmittel, das sie jeden Morgen nach dem Aufwachen nehmen sollte.
Ida und Giuseppe machten sich fröhlich und beschwingt auf den Heimweg und sangen unterwegs die üblichen Lieder aus dem väterlichen Repertoire, in die Ida ab und zu mit ihrem quäkenden Stimmchen einfiel.
Und von diesem Tag an bestätigten die Tatsachen im weiteren Verlauf die Vorhersage des Arztes. Die Behandlung mit dem einfachen Beruhigungsmittel, das Ida fügsam einnahm, bewies ihre tägliche Wirkung ohne irgendwelche negativen Folgen, abgesehen von einer leichten Schläfrigkeit und Abstumpfung der Sinne, die die Kleine gutwillig überwand. Und nach dem einzigen Auftreten in jenem Sommer meldete sich die seltsame Krankheit von da an nicht mehr, zumindest nicht in ihrer ursprünglichen, brutalen Form. Manchmal zeigte sie sich zwar wieder, aber reduziert auf das, was früher nur ihr erstes Anzeichen gewesen war, eine Art schwindelerregender Stillstand der Empfindungen, bei dem ein Blässeschleier über das Gesicht des Kinds glitt wie ein Nebel. Und alles war so rasch vorbei, dass keiner der Anwesenden etwas bemerkte, selbst Iduzza drang es nicht ins Bewusstsein. Im Unterschied zu den einstigen heftigen Anfällen ließen diese kaum wahrnehmbaren Symptome jedoch einen Schatten trauriger Unruhe zurück, beinah das dunkle Gefühl, etwas Verbotenes getan zu haben.
Diese verbliebenen Zeichen ihrer Krankheit wurden mit der Zeit immer seltener und schwächer. Als Ida ungefähr elf Jahre alt war, überfielen sie sie erneut mit bemerkenswerter Häufigkeit; und nach der Pubertät verschwanden sie fast ganz, wie der Arzt es versprochen hatte. Schließlich konnte Ida das Beruhigungsmittel absetzen und zu ihrer natürlichen Stimmung als junges Mädchen zurückkehren.
Vielleicht lag es auch an der Beendigung der Kur, dass gleichzeitig eine Veränderung in der Chemie ihres Schlafs eintrat. Denn von da an wucherten ihre nächtlichen Träume, die sie in ihrem täglichen Leben mit Unterbrechungen bis zum Ende begleiten sollten, jedoch nicht wie Gefährten, sondern eher wie Schmarotzer oder Verfolger. Noch mit dem Geschmack der Kindheit vermischt, nagten diese ersten Träume schon an der Wurzel des Schmerzes, auch wenn sie an sich nicht allzu schmerzhaft waren. In einem Traum, der in Abständen in verschiedenen Versionen wiederkehrte, sah sie sich an einem von Ruß oder Rauch verfinsterten Ort (Fabrik, Stadt oder Vorstadt) rennen, ein Püppchen an die Brust gedrückt, nackt und blutrot, als wäre es in roten Lack getaucht worden.
Der Weltkrieg von 1915 verschonte Giuseppe wegen seines lahmen Beins; aber die Gefahren, die sein Defätismus barg, umschwirrten Nora wie Schreckgespenster, sodass auch Iduzza gelernt hatte, bestimmte Themen des Vaters zu fürchten (selbst wenn sie nur in der Familie im Verschwörerton angedeutet wurden!). Denn schon seit dem Libyenfeldzug gab es auch in Cosenza Festnahmen und Verurteilungen von Defätisten wie ihm! Und schon stand er wieder mit erhobenem Zeigefinger auf:
… »Die Verweigerung des Gehorsams wird immer häufiger werden; und dann wird nichts bleiben als die Erinnerung an den Krieg und an das Heer, wie sie sich im Augenblick darstellen. Und diese Zeiten sind nahe. TOLSTOI!« …
… »Das Volk ist immer das Monster, das den Maulkorb braucht, das mit Kolonisation und Krieg kuriert und entrechtet wird. PROUDHON!« …
Iduzza dagegen wagte nicht einmal, die Erlasse der Behörden zu beurteilen, die sich ihr als mysteriöse Wesen darstellten und über ihren Verstand gingen, die aber die Macht besaßen, ihren Vater von Wachen abführen zu lassen … Bei der ersten Andeutung bestimmter Reden, die ihre Mutter ängstigten, klammerte sie sich zitternd an Giuseppe. Und um sie nicht zu beunruhigen, entschloss sich Giuseppe, solche riskanten Themen auch in der Familie zu vermeiden. Von da an verbrachte er die Abende damit, dem geliebten Töchterchen bei den Hausaufgaben zu helfen, wenn auch gewöhnlich ein wenig betrunken.
In der Nachkriegszeit herrschten Hunger und Epidemien. Doch wie es so geht, war der Krieg zwar für die meisten eine absolute Katastrophe, für andere dagegen ein erfolgreiches finanzielles Geschäft gewesen (nicht umsonst hatten sie ihn gefördert). Und genau jetzt begannen diese Leute, zur Verteidigung ihrer gefährdeten Interessen schwarze Schlägertrupps anzuheuern.
In den industrialisierten Ländern kam die Gefahr vor allem von den Arbeitern; aber in Kalabrien (wie anderswo im Süden) waren hauptsächlich die Großgrundbesitzer in ihrem Vermögen bedroht, übrigens zum großen Teil Usurpatoren, die sich in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Tricks öffentliches Land angeeignet hatten: Felder und Wälder, die sie häufig brachliegen und verwildern ließen. Es war die Phase der »Landbesetzungen« durch Bauern und Tagelöhner. Doch die Besetzungen erwiesen sich als Illusion: Denn sobald sie das Land urbar gemacht und bewirtschaftet hatten, wurden die Besetzer ganz legal davongejagt.
Viele kamen dabei um. Und was die Leute betraf, die für die Grundbesitzer arbeiteten, so bestand ihre Bezahlung (entsprechend den letzten, in langen sozialen Kämpfen errungenen Arbeitsvereinbarungen) zum Beispiel darin:
für einen Arbeitstag von 16 Stunden ein Dreiviertelliter Öl (für Frauen die Hälfte).
Giuseppes Verwandte (unten in der Provinz Reggio) waren Teilpächter, die zusätzlich als Tagelöhner arbeiteten. Im August 1919 starb eine seiner Schwestern samt Mann und zwei Neffen an der Spanischen Grippe. In manchen Gegenden hinterließ die Epidemie furchtbare Erinnerungen. Es fehlte an Ärzten, Medikamenten und Lebensmitteln. Man war mitten in den Hundstagen. Es gab mehr Tote als im Krieg. Und die Leichen blieben tagelang unbegraben, da nicht genug Bretter für Särge da waren.
In dieser Zeit schickte Giuseppe den Verwandten sein gesamtes Gehalt (das bei den damaligen Schwierigkeiten der öffentlichen Hand nicht immer regelmäßig ausgezahlt wurde). Und während der Teuerung jener Zeit mussten die drei allein mit Noras Verdienst auskommen. Doch Nora, die in bestimmten Familiendingen mutig wie eine Löwin und umsichtig wie eine Ameise war, schaffte es, die Familie ohne allzu große Entbehrungen durchzubringen.
Kaum zwei Jahre nach Kriegsende machte Ida pünktlich ihren Abschluss als Lehrerin. Und während der Sommerferien verlobte sie sich, obwohl sie keine Mitgift besaß.
Der Verlobte, Alfio Mancuso, stammte aus Messina und hatte bei dem Erdbeben 1908 sämtliche Verwandten verloren. Er war damals etwa zehn Jahre alt und wurde durch einen wunderbaren Glücksfall gerettet. Und trotz seiner innigen Liebe zur Familie und besonders zu seiner Mutter klagte er kaum über diese Katastrophe, sondern prahlte mit seinem Glück, das ihm bei jener Gelegenheit beigestanden hatte und ihn auch sonst auszeichnete. Das Wunder (das Alfio beim Erzählen jedes Mal mit neuen Einzelheiten und Variationen ausschmückte), hatte sich kurz gesagt folgendermaßen zugetragen:
Im Winter 1908 arbeitete das Kind Alfio als Lehrling auf einer kleinen Werft bei einem Alten, der Boote reparierte. Beide pflegten auch in der Werkstatt zu schlafen, wo der Meister über ein Feldbett verfügte, während der Junge sich auf dem Boden, in eine alte, wollene Pferdedecke gewickelt, auf einen Haufen Hobelspäne legte.
An jenem Abend nun, während der Alte noch wie gewohnt (in Gesellschaft einiger Gläschen) bei seiner Arbeit verweilte, wollte der Lehrling sich schon für die Nacht in die Pferdedecke wickeln; da kreischte der Alte bei einer unachtsamen Bewegung des Jungen, wie er es in solchen Fällen immer tat:
»Heee! Rapa babba!!« (was heißen sollte: blöde Rübe!)
Gewöhnlich nahm der Lehrling derartige Beschimpfungen widerspruchslos hin; doch diesmal antwortete er aufbrausend:
»Selber blöd!«
Dann rannte er schnellstens (äußerst vorausschauend) samt seiner Pferdedecke ins Freie, aus Furcht vor dem Meister, der in der Tat hinter ihm herlief und schon mit einem doppelt gelegten Seil bewaffnet war, um ihn zu verprügeln.
Nun standen auf dem Grundstück, wo dieser Wettlauf stattfand, gleich weit entfernt ein Pfahl und eine Palme. Nach kurzem Zögern entschied sich Alfio (bemerkenswert!) für die Palme, und gleich darauf saß er schon in ihrem Wipfel, fest entschlossen, sich lieber für immer dort niederzulassen wie ein Affe, als sich dem Alten auszuliefern, der schließlich, überdrüssig, unter der Palme zu warten, in die Werkstatt zurückkehrte.
Kurz und gut, Stunde um Stunde verging, bis zum Morgengrauen! Und Alfio hockte immer noch in seine Decke gewickelt auf der Palme, als das Erdbeben kam, das Messina und die Werft dem Erdboden gleichmachte und den Pfahl umriss, wohingegen die Palme, nachdem ein heftiger Windstoß ihre Wedel durchgeschüttelt hatte, mitsamt dem daran festgeklammerten Alfio unbeschadet stehenblieb. Ob das auch an irgendeiner Zauberkraft dieser Pferdedecke lag (die davor einem Stallburschen namens Cicciuzzo Belladonna gehört hatte)? Wie auch immer, schon damals hatte Alfio beschlossen, seinen ersten Sohn Antonio zu nennen (nach seinem Vater) und mit zweitem Namen Cicciuzzo (also Francesco), und die Tochter mit erstem Namen Maria (nach seiner Mutter) und mit zweitem Palma. (Von klein auf war es immer sein größter Wunsch gewesen, eine Familie zu gründen.)
Zu den weiteren glücklichen Fügungen zählte dann auch, dass das Datum seiner Einberufung mit dem Kriegsende zusammenfiel. Einige Formalitäten zur Entlassung aus dem Militär hatten ihn nach Rom geführt, wo er eine Anstellung als Vertreter bei einer Firma gefunden hatte. Und bei seinen folgenden Geschäftsreisen war er in Cosenza vorbeigekommen, wo er seiner ersten Liebe begegnete.
Zwischen Alfio und dem zukünftigen Schwiegervater herrschte gleich große Freundschaft. Und Ida gewann ihren Verehrer rasch lieb, da er für sie in verschiedener Hinsicht ihrem Vater ähnelte, mit dem Unterschied, dass er sich nicht für Politik interessierte und kein Trinker war. Beide glichen im Aussehen und in ihrem Wesen großen Hofhunden, bereit, sich über jede Gunst des Lebens zu freuen: sei es auch nur ein Windhauch an den Hundstagen. Beide besaßen außer väterlichen auch mütterliche Eigenschaften: viel mehr als Nora, die Iduzza mit ihrem stolzen, erregbaren und in sich gekehrten Charakter immer ein wenig Furcht einflößte. Beide schützten sie vor der Gewalt der Außenwelt; und mit ihrer instinktiven guten Laune und ihrem naiven Spaß an Tollerei ersetzten sie ihr die Altersgenossen und Freunde.