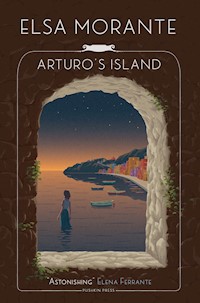Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Andalusien erfährt Manuel die Geschichte seiner Kindheit und blickt erinnernd zurück: Seine Mutter Aracoeli, das schöne und unbändige Bauernmädchen, folgt der großen Liebe ihres Lebens nach Rom. Dort wird Manuel geboren, doch mit der Geburt und dem frühen Tod einer Schwester endet die Liebe der Mutter zu Manuel. Aracoeli wird ein anderer Mensch, wirft alle mühsam erworbenen gesellschaftlichen Umgangsformen über Bord und wird zur unberechenbaren Nymphomanin, die im Bordell endet. Fassungslos sieht das Kind dem Geschehen zu, erst der reife Mann beginnt es zu begreifen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 1982 unter dem Titel Aracoeli bei Giulio Einaudi editore in Turin.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1984 im Claassen Verlag in Düsseldorf.
E-Book-Ausgabe 2021
© The Estate of Elsa Morante
Published by arrangement with The Italian Literary Agency
© 1997, 2021 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Fotografie (1937)
© Herbert List / Magnum Photos / Agentur Focus.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803143242
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2845 4
www.wagenbach.de
Meine Mutter war Andalusierin. Zufällig hatten ihre Eltern beide den gleichen Nachnamen MUÑOZ – so dass sie, wie in Spanien üblich, den doppelten Nachnamen Muñoz Muñoz trug. Mit Vornamen hieß sie Aracoeli.
Ich ähnelte ihr in der Hautfarbe und in den Gesichtszügen, während ich die Augenfarbe von meinem Vater (einem Italiener aus dem Piemont) geerbt hatte. Aus der Zeit, in der ich schön war, kommt mir immer wieder ein kleines, den Vollmondnächten vorbehaltenes Lied in den Sinn, von dem ich nie genug bekommen konnte. Und ausgelassen sang Aracoeli es mir immer wieder vor und warf mich dabei dem Mond entgegen, als wolle sie mich einer kleinen Zwillingsschwester im Himmel vorführen:
Luna lunera
Mondschein, Mondlicht
cascabelera
kleiner Wicht
los ojos azules
blau die Augen
la cara morena.
Das und andere, ähnliche Liedchen aus demselben Repertoire, die mich während meiner frühen, glücklichen Kindheit begleiteten, gehören zu den wenigen Zeugnissen, die mir von der heimatlichen Kultur meiner Mutter geblieben sind. Über das Land, aus dem sie stammte, redete sie bei uns zu Hause in Rom so gut wie gar nicht, und wenn, dann verschanzte sie sich nach den ersten Andeutungen gleich wieder hinter einer störrischen Abwehrhaltung. Denn wie es manchmal bei Hungerleidern mit doppeltem Stolz der Fall ist, wenn sie in die »höheren Schichten« aufsteigen, trug auch sie bei bestimmten Gelegenheiten ihrer Vergangenheit gegenüber zunächst eine harte, mondäne, ja geradezu snobistische Verachtung zur Schau, die jedoch heillos von einer plumpen Scham verseucht war – immer auch bis ins Innerste hinein vermischt mit einer wilden Eifersucht, die Fremden den Zutritt zu ihrem kleinen Territorium untersagte, wie zu einem geheiligten Besitz der Muñoz Muñoz.
Nach den spärlichen, misstrauischen Andeutungen jedoch musste man sich, so unglaublich es auch erschien, ihr Land als eine Art Steinwüste vorstellen, die ein afrikanischer Wind ausdörrte, in der Büsche wuchsen, die nur Dornen hervorbrachten, und wo das wenige Gras, kaum hervorgesprossen, schon wieder verdurstete. Wenn meine Tante Raimonda, genannt Monda (die Schwester meines Vaters), das hörte, riss sie entgeistert die Augen auf, denn ihrer Ansicht nach musste Spanien (und ganz besonders Andalusien) ein einziger Garten sein: mit Orangenbäumen und arabischem Jasmin und Rosengärten, mit österlichen Festen, Volantröcken, Gitarren und Kastagnetten. In ihrer gewohnten Diskretion insistierte Tante Monda jedoch nicht mit allzu vielen Fragen. Tatsächlich stellten die familiäre Herkunft meiner Mutter und ihre voreheliche Existenz als jungfräuliches Bauernmädchen bei uns zu Hause so etwas wie ein ehrenhaftes Staatsgeheimnis dar, dessen einzig rechtmäßiger Verwahrer mein Vater war, während Tante Monda nichts anderes war als eine einfache Treuhänderin mit streng vertraulichen und auf das Allernötigste beschränkten Befugnissen. In Wirklichkeit handelte es sich um ein aufgenötigtes Geheimnis, dem gar nichts Dunkles anhaftete; doch die Phantasie eines Kindes kann sich ein Geheimnis nur als etwas von Dunkelheit Umhülltes oder von strahlendem Glanz Umflutetes vorstellen, ein Glanz, der jedoch zu erlöschen droht, sobald Licht in das Geheimnis dringt. Und so blieb von meiner Seite her unser Geheimnis natürlich unverletzt: ähnlich einem exotischen Schatz, zu dem ich den versteckten Schlüssel absichtlich nicht suchte. Während der kurzen Dauer meines Lebens im Familienkreis (das für mich mit der frühen Kindheit endete), drangen darüber nur zufällige, beiläufige Nachrichten zu mir, über die man (vor allem vonseiten Tante Mondas) eilig hinwegging. Freilich, wenn ich von empirischerem Geist gewesen wäre, hätte mich eine solche Zurückhaltung wenigstens zu einem Minimum an persönlicher Ermittlung angeregt; doch bei mir traf sie eher auf eine bereits ausgeprägte Neigung, visionäre Vorstellungen genauen Untersuchungen vorzuziehen. So ließ ich zu, dass die verschiedenen Hinweise auf die Vorgeschichte meiner Mutter, kaum dass sie vor mir aufgetaucht waren, wieder verlöschten, gleich den Lichtfäden, die im Dunkeln unter den Lidern aufflammen. Bei gewissen schwatzhaften Anspielungen unserer Dienstboten oder irgendwelcher Neugieriger wandte ich mich mit einer instinktiven, fast aristokratischen Unaufmerksamkeit ab, die ich oft noch durch eine finster drohende Miene unterstrich. Ich war bereit, nicht nur das anfällige Eigentum meiner Mutter gegen jegliche vulgäre Indiskretion zu verteidigen, sondern auch die unendlichen offenen Weiten der Unwissenheit gegen alle und jede Begrenzung.
Im Übrigen hatte mich meine Mutter selbst seit den Zeiten unserer innigen Vertrautheit in meiner Unwissenheit belassen. Vielleicht fühlte sie auch, dass ich von ihr – so wie sie von mir – unbewusst ohnehin alles wusste. Ihre Geschichte war schon auf mich übertragen worden, als ich in ihrem Uterus heranwuchs, und zwar mithilfe der gleichen chiffrierten Botschaft, mit der meiner Haut die dunkle Färbung der ihren übertragen worden war. Und es wäre daher umsonst gewesen, eine irdische Übersetzung dessen zu versuchen, was ich von Geburt an in mir trug, bereits gedruckt im eigenen Code des Irrealen.
Dagegen machte es ihr Freude, mir im Vertrauen einige besonders wunderbare Wesen zu beschreiben, die sie daheim in ihrem Dorf zurückgelassen hatte: lauter Bekannte oder Verwandte jener berühmten Liedchen, die ich bereits kannte, und für mich von ebenso verführerischem Reiz. Mit der großen Gebärde einer Königin, die sich ihrer Abstammung rühmt, beschrieb sie mir zum Beispiel ihre Ziege Abuelita (so genannt, weil sie die Großmutter einer anderen kleinen Ziege war, einer Waise namens Saudade) und ihren Kater Patufè (»rot wie Gold«) oder eine Nachbarin, ein wundertätiges altes Mütterlein mit Namen Tia Patrocinio, und dergleichen mehr. Aber über allen Nachbarn, Bekannten und Verwandten, ja über dem ganzen andalusischen und spanischen Volk thronte ihr einziger Bruder Manuel, auch Manolo oder Manuelito genannt. Dieser Onkel von mir (den ich nie kennenlernen sollte) war jünger als sie, doch für sie war er wie ein richtiger großer Bruder. Soviel man erraten konnte, musste er die gleiche Statur haben wie sie, also ziemlich klein sein; doch sein Charakter und seine Tapferkeit streckten ihn in den Augen der Schwester bis auf ein würdiges männliches Maß. »Er ist größer als ich!«, erklärte sie und hob die Hand eine Spanne über ihren Kopf, so als würde sie damit eine seltene Größe anzeigen; und ich, klein wie ich war, folgte der Richtung dieser Hand mit dem ehrfürchtigen Blick dessen, der die Gipfel des Mount Everest bewundert. Sobald Aracoeli anfing, von ihrem Bruder zu reden, ja selbst bei der bloßen Erwähnung seines Namens vibrierte ihre Stimme vor ausgelassenen und weihevollen Tönen, einer Mischung aus Ringelreihen und Halleluja. Und sogleich übertrug sich dieses Tremolo auf meine Kehle, und seine Laute fanden ihren Widerhall in einem verliebten Lachen, das einem lobsingenden Jubel gleichkam. Es gibt, glaube ich, in Wirklichkeit keinen einzigen Jungen, der sich nicht schon von den ersten Lebensjahren an seinen HELDEN erwählt – oder besser gesagt: ihn erkennt. Da dieser HELD der Geschichte, den Märchen oder Mythen, der erlebten Gegenwart oder sogar der Werbung entstammt, kann er sich in Napoleon verkörpern oder in dem Nibelungen Siegfried, in dem Chinesen Mao oder in Kain, in Beelzebub, dem König der Unterwelt, in Casanova, Hamlet oder Mahatma Gandhi, in einem erfolgreichen Fußballspieler, in einem Filmstar oder in einer Comic-Figur … Und natürlich kann er sich verschiedentlich wandeln, je nach dem Wandel von Schicksal, Umgebung und Moden. Ja, das ist sogar in aller Regel der Fall – aber nicht bei mir! Mein HELD war und blieb bis heute nur ein einziger: mein Onkel Manuel, und das seit dem Tag, an dem ich zum ersten Mal etwas von ihm erfuhr. Meinen nachträglichen Berechnungen zufolge musste Manuel damals ungefähr dreizehn Jahre alt gewesen sein und ich zehn Jahre jünger. Und ich stelle mir vor, dass ich, zum Teil wenigstens, gerade meinem geringen und unvernünftigen cascabelera-Alter die besondere Gunst verdankte, mit der mich Aracoeli zum einzigen Verwahrer und Vertrauten ihrer privaten Schwärmereien machte – und in erster Linie der Heldentaten und Schönheiten ihres Manuel. Soviel ich weiß, gewährte sie eine solche Gunst tatsächlich keinem anderen außer mir kleinem Wicht. Keinem anderen, nicht einmal meinem Vater! Doch ihm gegenüber, denke ich, waren es Ehrfurcht und Bescheidenheit, die sie davon abhielten und in ihrem kindlichen Hochmut verunsicherten. Es ist nämlich gewiss, dass ihrer Meinung nach nicht einmal Manuels Glanz dem Vergleich mit dem Sonnenlicht meines Vaters hätte standhalten können.
Andererseits war er wohl der Einzige von uns, der Manuel persönlich begegnet sein konnte, ebenso dem Kater Patufè und möglicherweise der ganzen andalusischen Sippe der Muñoz Muñoz.
Über sechsunddreißig Jahre sind vergangen, seit meine Mutter auf dem Friedhof Campo Verano in Rom (meiner Geburtsstadt) begraben wurde. Ich habe sie dort nie besucht. Und es sind nun schon über dreißig Jahre, dass ich nicht mehr in Rom war, wohin ich auch nicht mehr zurückkehren möchte.
Zum letzten Mal kam ich im Frühsommer 1945 hin, gleich nach Kriegsende. Ich war damals ungefähr dreizehn (aber für mich war es, als sei ich immer noch zehn). Und bei dieser Gelegenheit erfuhr ich unter anderem, dass bei einem Luftangriff auf die Stadt auch der Campo Verano von den Bomben zerstört worden war: viele Grabstätten aufgerissen, die Zypressen entwurzelt. Man sagte mir sogar den Tag und die Stunde des Angriffs: Es war gegen zwölf Uhr mittags gewesen, am 19. Juli 1943. Und seit damals stellte sich mir in meinen Visionen dieser unbekannte Friedhof immer in glühender Mittagshitze dar (ich wusste, dass verano auf spanisch Sommer heißt), als ein Wald aus Rauch und Feuer, aus dem meine Mutter angstvoll floh, blutverschmiert und in dem gleichen zerknitterten Nachthemd, das sie anhatte, als ich sie zum letzten Mal besuchte.
Wohin hätte sie fliehen können, wenn nicht nach Andalusien? Und deshalb mache ich mich heute, nach so vielen Jahren unsinniger Trennung, auf nach Andalusien, um sie zu suchen.
Manchmal – vor allem in Situationen extremer Einsamkeit – setzt bei den Lebenden ein verzweifelter Drang ein, ihre Toten nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum zu suchen. Manch einer geht ihnen in die Vergangenheit nach, andere wieder leben dem Traum entgegen, sie in einer letzten Zukunft einzuholen; aber es gibt auch den einen oder anderen, der, wenn er nicht mehr weiß, wohin er ohne seine Toten gehen soll, die Orte durchstreift, auf der Suche nach einer möglichen Spur von ihnen. Ein solcher Ruf kann einen unerwartet erreichen und die gleiche Begierde auslösen, die einen armen Kerl erfassen würde, dem – nach einer langen Gedächtnisschwäche – plötzlich wieder einfällt, dass er irgendwo versteckt einen Diamanten besitzt. Doch inzwischen kennt er selbst das Versteck nicht mehr, sämtliche Spuren sind getilgt. Und es wird ihm weder etwas nützen, sich auf ein Indiz zu stützen, das es ihm ermöglichen könnte, wieder in den Besitz des Steins zu gelangen, noch wird es ihm je vergönnt sein, einen anderen Schatz zu besitzen.
In diesem nebligen Herbst bin ich seit ein paar Tagen versucht, meinem Mädchen Aracoeli in allen Richtungen des Raums und der Zeit nachzugehen, außer in einer, an die ich nicht glaube: der Zukunft. In Wirklichkeit sehe ich in der Richtung meiner Zukunft nichts anderes als ein verbogenes Gleis, an dem mein gewohntes Ich, immer einsam und immer älter, sich weiter entlangschleppt, hin und her, wie ein betrunkener Pendler. Bis es zu einem gewaltigen Zusammenstoß kommt, jeder Verkehr aufhört. Das ist der äußerste Punkt der Zukunft. Eine Art blendender Mittag oder blinde Mitternacht, wo es keinen mehr gibt, auch mich nicht.
Seit ungefähr zwei Monaten habe ich eine provisorische Anstellung in einem kleinen Verlag, wo ich vor allem die eingehenden Manuskripte prüfen und dann ein kurzes schriftliches Gutachten darüber verfassen muss. Meist handelt es sich um kleine, allgemeinverständliche Abhandlungen wissenschaftlich-praktischen, politischgesellschaftlichen oder auch weltmännisch-belehrenden Inhalts.
Soweit mir bekannt ist, besteht der ganze Verlag aus zwei kleinen Büroräumen und einem dunklen Klo ohne Fenster. Der eine Raum dient in der Hauptsache als Lager, in dem anderen sitze ich. Obwohl der Chef (bei seinen zwar nicht seltenen, aber immer eiligen Besuchen) manchmal schon auf sein unsichtbares »Betriebspersonal« hingewiesen hat, besteht jedenfalls hier drinnen allem Augenschein nach das Personal einzig und allein aus mir. Die Glastür im Treppenhaus, mit der Aufschrift Ypsilon-Verlag und darunter der Aufforderung Drücken, kündigt die Besucher durch ein langes Quietschen an, dem dann sogleich der ungehinderte Eintritt des jeweiligen Besuchers folgt. Gewöhnlich handelt es sich dabei um meist ältere Möchtegernautoren, die mit ihrem abgezehrten, fast finsteren Aussehen die natürliche Kälte des Raums verstärken und mich sofort in eine konfuse Beklemmung stürzen. Gemäß den Vereinbarungen muss ich meine Tage von 9 bis 13 und von 16 bis 19.30 Uhr im Büro zubringen.
Im ersten Moment hielt ich diese Anstellung für einen Glücksfall (denn meine sowieso schon kärglichen Einkünfte reichten in der letzten Zeit nicht einmal mehr aus, die Miete für ein winziges Zimmer zu zahlen), sehr bald aber wurde mir bewusst, dass mein Gehirn sich mit allen Mitteln dagegen sträubte. Bei der Lektüre dieser Traktätchen hatte ich von den ersten Zeilen an das Gefühl, Leim schlucken zu müssen. Ihre Themen waren mir völlig gleichgültig, ja ich begriff gar nicht, dass andere denkende Gehirne sich damit abgeben konnten. Immer wieder verlor ich den Faden. Und obwohl ich seit einiger Zeit auf jede leichte wie schwere Droge und – in den Grenzen des Möglichen – sogar auf Alkohol verzichtete, verfiel ich wieder in meine krankhafte Schlafsucht. Plötzlich also sank ich schlafend, mit offenem Mund, auf meine Arbeit. Und es kam vor, dass ich mich beim Quietschen der Eingangstür mühsam hochraffte und schon einen dieser unseligen Besucher aufrecht vor mir stehen sah, der mit vielsagendem Grinsen meine geschwollenen Augen und den Speichelfaden, der mir übers Kinn rann, betrachtete. Es kam auch vor, dass mir diese Art von Schlummer Träume bescherte, besser gesagt: flüchtige, trostlose Delirien. Zum Beispiel verwandelten sich die Druckbuchstaben unter meiner Nase zu Myriaden von Motten, die von den Blättern ausschwärmten und sie als weißen Staub zurückließen.
Jeden Tag häuften sich neue Traktätchen und neue Druckfahnen auf meinem kleinen Tisch. Und der bloße Anblick dieser Stapel genügte, mir bereits beim Hereinkommen einen Brechreiz zu verursachen. Meine geringe Leistung konnte sicherlich nicht einmal den vielbeschäftigten und eiligen Blicken meines lakonischen Chefs entgehen. Und ohne Zweifel plante der Ypsilon-Verlag schon seit einer Weile meinen unvermeidlichen Rausschmiss. Immerhin wurde mir gegen Ende Oktober mein zweites Gehalt ausbezahlt, das bis zu diesen alljährlichen Feiertagen Anfang November fast unangetastet in meiner Tasche blieb. Dank des nationalen Brauchs, Zwischentage zu »überbrücken«, sind die Ferien großzügig auf vier Tage angesetzt: von Freitag, dem 31. Oktober (Vortag), bis Dienstag, dem 4. November (alter patriotischer Feiertag). Und so habe ich mich heute Vormittag (Freitag, den 31.) auf meine Reise gemacht.
Es ist eine Weile her, dass ich sesshaft geworden bin. Außerdem ruft das Wort Ferien oder Urlaub seit jeher bei mir die Vorstellung von einem desolaten, ausgelassenen Haufen hervor, trunken von Plastiktüten, Coca-Cola und plärrenden Transistorradios. Ich bin bisher noch nie im Ausland gewesen. Und der Entschluss zu diesem Aufbruch weckte bei mir ein extremes Gefühl von Risiko und Tollheit – aber auch einen unbekannten Enthusiasmus (enthusiasmós: Einbruch des Göttlichen). Anfangs jedoch war ich mir über das Reiseziel im Zweifel: Denn wohin sollte ein so ungeselliger, menschenscheuer Typ wie ich auch fahren – ohne die geringste Neugier für die Welt, für keinen einzigen Ort der Welt?! Bis mir der enthusiasmós das einzige für mich in Frage kommende Reiseziel eingab – vielmehr befahl.
Anda niño anda
Lauf, Kindchen, lauf
que Dios te lo manda.
Gott trägt’s dir auf.
Und so bin ich jetzt (es ist ungefähr elf Uhr) dabei, Mailand zu verlassen, um mich auf die Suche nach meiner Mutter Aracoeli zu begeben, und zwar in der doppelten Richtung der Vergangenheit und des Raums. Über ihre Vorgeschichte in Andalusien habe ich nie wesentlich mehr erfahren als zu meiner Kinderzeit. Und sie zu suchen bedeutete für mich selbst jetzt nicht, mir Unterlagen zu verschaffen oder Leute zu befragen, sondern nur, von hier weg- und ihren Spuren in der alten Landschaft nachzugehen: wie ein versprengtes Tier, das den Gerüchen der eigenen Höhle folgt.
Zu dem Wenigen, das mir bekannt war, gehörten ihre wichtigsten persönlichen Daten: das heißt außer ihrem doppelten Mädchennamen ihr Geburtsort, von dem ich wusste, dass er im Gebiet von Almeria lag und El Almendral hieß. Jedoch die wenige Post, die sie in Rom von zu Hause erhielt, trug – dessen erinnere ich mich ganz genau – auf dem Umschlag den Stempel Gergal, ein Name, den ich vergeblich in den üblichen Atlanten suchte, schließlich aber doch auf einer großen Karte des Geografischen Instituts fand. Dieses Gergal stellte sich als ein kleiner Ort heraus, der isoliert mitten in der Sierra liegt, in einer beträchtlichen Entfernung vom Meer.
El Almendral dagegen fand ich auf keiner Karte. Doch gerade dieser entlegene, von der Geografie ignorierte winzige Punkt war zuletzt zur einzigen irdischen Station geworden, die meinem desorientierten Körper eine Richtung wies. Es war ein Ruf, ohne irgendein Versprechen oder eine Hoffnung. Ich wusste über jeden Zweifel hinaus, dass er nicht von der Vernunft an mich erging, sondern aus einer Sehnsucht der Sinne, so groß, dass es für mich nicht die geringste Rolle spielte, ob es diesen Ort überhaupt gab. Mein Zustand glich tatsächlich dem eines Bastardhundes, den man als kleinen Welpen aus seinem Korb gerissen, in einen Sack gestopft und, um sich seiner zu entledigen, weit weg am Straßenrand ausgesetzt hat. Wer weiß, wie er überlebte; auf alle Fälle hat er dort nur feindliche Rudel vorgefunden, die ihn als Eindringling und Tollwütigen behandelten. Und da legt er, geführt von seinen scharfen Sinnen, den ganzen Weg wieder zurück, bis zum Ausgangspunkt (vielleicht bis zu einem wirklichen Wiederfinden?).
Esto niño chiquito
Dies Kindchen, dies kleine
no tiene madre.
hat keine Mutter.
Lo parió una gitana
Die Zigeunerin, die’s gebar
lo echó en la calle.
warf’s auf die Straße.
Die Versuchung zur Reise hatte mich vor Kurzem mit der Stimme meiner Mutter überfallen. Es war keine abstrakte Transkription der Erinnerung an ihre allerersten, längst begrabenen Liedchen, sondern ganz deutlich ihre physische Stimme mit jenem zärtlichen Beigeschmack nach Kehle und Speichel. Ich habe auf der Zunge wieder die Empfindung ihrer nach frischen Pflaumen riechenden Haut verspürt; und nachts, in dieser Mailänder Kälte, fühlte ich ihren noch kindlichen Atem wie einen unschuldigen Hauch von Wärme auf meinen alt gewordenen Lidern. Ich weiß nicht, wie die Wissenschaftler das Vorhandensein dieser anderen, geheimnisvollen Sinnesorgane innerhalb unserer körperlichen Materie erklären – ohne sichtbare Gestalt und von den Gegenständen abgelöst, aber dennoch fähig zu hören, zu sehen, zu jeglicher Empfindung der Natur und auch zu anderen. Man könnte meinen, sie verfügten über Antennen und Lote. Sie agieren in einer Sphäre jenseits des Raums und doch mit unbeschränkter Bewegungsmöglichkeit. Und dort, in dieser Sphäre, verwirklicht sich (zumindest solange wir leben) die fleischliche Auferstehung der Toten.
Aracoeli. In den ersten Jahren meines Zusammenlebens mit ihr klang dieser Name für mich selbstverständlich völlig natürlich. Jedoch als wir, ich und sie, mitten in die Welt geschickt wurden, merkte ich, dass er sie in der Stadt von den anderen Frauen unterschied. Denn unsere Bekannten hießen Anna, Paola oder Luise, allenfalls Raimonda, Patrizia, Perla oder Camilla. »Aracoeli!«, riefen die Damen, »was für ein schöner Name! Was für ein seltsamer Name!«
Später habe ich gelernt, dass es in Spanien allgemein üblich ist, die Mädchen auf solche, auch lateinische, Namen aus dem kirchlichen beziehungsweise liturgischen Bereich zu taufen. Trotzdem hat sich mit dem Erwachsenwerden dieser Name Aracoeli in meiner Erinnerung als Zeichen des Andersseins eingeprägt, als ein einmaliger Titel, durch den meine Mutter abgesondert und eingeschlossen bleibt wie in einem verschnörkelten, schweren Goldrahmen.
Dieses Bild mit dem Goldrahmen kommt mir vielleicht durch den Wandspiegel in den Sinn, den es wirklich in unserem ersten, geheimen Zimmer gegeben hat, von wo er uns dann in die neue, legitime Wohnung in den Quartieri Alti folgte. Und dort ist er geblieben, im Schlafzimmer meiner Eltern, groß und auffällig in der Mitte der Wand, bis zu unserem finanziellen Ruin. Wo er danach hingekommen ist, weiß ich nicht: Vielleicht landete er bei irgendeinem Verwandten oder wurde mit dem übrigen Mobiliar an einen Antiquar oder Trödler verkauft. Wahrscheinlich aber existiert er noch und überlebt die verschwundene Familie.
Seine Scheibe war blank und neueren Datums, aber der alte und in seiner Vergoldung verblasste Rahmen war wuchtiges 17. Jahrhundert. Er stand im Gegensatz zu dem sehr modernen (damals funktional genannten) Stil, der in unserer Wohnung vorherrschte. Tatsächlich war er, ebenso wie der französische Teppich zu seinen Füßen und ein paar wenige andere, da und dort verstreute Stücke, auf dem Weg über Raimonda von meinen Turiner Großeltern väterlicherseits auf uns gekommen.
Nach bestimmten Nekromanten sind Spiegel bodenlose Schlünde, die die Lichter der Vergangenheit (und vielleicht auch die der Zukunft) verschlingen, ohne sie doch je aufzuzehren. Die früheste Vision meiner selbst, die den Hintergrund für all meine Jahre bildet, steigt nun, gleichsam postum, in meiner Erinnerung (oder vielleicht Pseudo-Erinnerung?) nicht unmittelbar auf, sondern in diesem Spiegel reflektiert und von besagtem Rahmen umgeben. Ist es möglich, dass sie dort, in den Unterwasserwelten des Spiegels, festgehalten wurde, um mir heute, aus ihren Atomen zusammengesetzt, aus dem Nichts wiedergegeben zu werden? Es wird behauptet, unsere Erinnerungen könnten nicht weiter zurückreichen als bis ins zweite oder dritte Lebensjahr; aber diese intakte und fast unbewegte Szene kehrt aus einer viel weiter entfernten Zeit zu mir zurück:
Auf einem goldgelben Plüschsesselchen (mir ehemals bekannt und vertraut) sieht man eine Frau sitzen, einen Säugling an der Brust. Sie stützt den nackten Fuß aufs Bett, und am Boden, auf dem französischen Teppich, liegt ein umgekippter Pantoffel. Ihr Gewand kann ich nicht genau erkennen (ein langer, leichter Morgenrock, fuchsienrot?), aber ich entdecke wieder ihre Art, das Band über der Brust zu lösen, ängstlich, mit einer geradezu komischen Schamhaftigkeit darauf bedacht, nur die Spitze freizugeben: eine Frau, die sich sogar vor ihrem eigenen Kleinen geniert. Denn nur wir beide sind im Zimmer, und ich bin dieser Säugling mit dem schwarzen Köpfchen, der immer wieder die Augen zu ihr hebt.
Und von diesem Punkt an verschwindet der Spiegel mit seinem Rahmen. Dafür treten jetzt aus dieser gespiegelten, wie gemalt wirkenden Szene die intimsten Einzelheiten hervor und entwickeln sich zu körperlicher Konkretheit, als ob mein heutiges Ich wieder mit den Augen dieses verzückten, kleinen, an der Brust hängenden Wesens sähe. Kann es sein, dass das eine meiner »apokryphen Erinnerungen« ist? Bei ihrer beständigen Arbeit ist die ruhelose Maschine meines Gehirns fähig, mir visionäre Rekonstruktionen zu fabrizieren – zuweilen fern und täuschend wie eine Fata Morgana, zuweilen aber so nah und besitzergreifend, dass ich mich in ihnen verkörpere. Jedenfalls kommt es vor, dass bestimmte »apokryphe Erinnerungen« sich mir nachträglich als wirklicher erweisen als die Wirklichkeit.
Und das ist so eine. Zwischen den halbgeschlossenen Lidern meines damaligen Ichs sehe ich wieder ihre Brust, entblößt und weiß, mit den blauen Äderchen und einem kleinen orange-rosafarbenen Hof um die Warze. Sie ist rund, nicht zu groß, aber prall; und oft suche ich sie im Saugen mit meinen winzigen, herumpatschenden Händchen und begegne dann Aracoelis Hand, die mir die Brust reicht, sie dabei zur gleichen Zeit entblößend und bedeckend. Ihre Hand ist ebenso wie ihr Hals und ihr Gesicht (mit der Zeit wurden sie dann heller) im Vergleich zur Brust ziemlich dunkel; und die Form dieser Hand ist breit und kurz, mit den in ihrer fast rechteckigen Form ebenfalls kurzen Nägeln. Von irgendeiner Verletzung aus der Kindheit her sind die Glieder des kleinen und des Ringfingers dick geblieben und ein wenig unförmig.
Ihre Milch schmeckt süßlich, lauwarm, wie die der tropischen Kokosnüsse, gleich nachdem sie von der Palme gepflückt wurden. Immer wieder schauen meine verliebten Augen zu ihr auf, um ihrem Gesicht zu danken, das sich verliebt zu mir neigt, zwischen den schwarzen Trauben ihrer ungleich langen Locken, die ihr bis auf die Schulter reichen (sie wollte sie sich nie abschneiden lassen; das war eine ihrer Unfolgsamkeiten).
Ihre Stirn ist bis zu den Brauen von den Locken bedeckt. Wenn sie sich die Haare zurückstreicht, bekommt sie ein ganz anderes Gesicht: von seltsamer Intelligenz und einer unbewussten, angeborenen Melancholie. Ansonsten ist ihre Physiognomie von einer natürlichen Ausgewogenheit: zwischen Vertrauen und Verteidigung, Neugier und Störrigkeit. Jedenfalls schwingt in ihrem Blut beständig eine Freude, schon aus dem einzigen Grund, geboren zu sein.
Zu sagen, »Augen wie eine sternklare Nacht«, klingt nach literarischer Phrase. Aber ich wüßte nicht, wie ich sonst ihre Augen beschreiben sollte. Die Iris ist schwarz, und in der Erinnerung breitet sich dieses Schwarz über die Iris hinaus in einem Geflimmer winziger Tropfen oder Lichter aus. Es sind große Augen, ein wenig mandelförmig, die unteren Lider etwas schwer, wie bei manchen Statuen. Die dichten Brauen (erst später sollte sie lernen, sie mit dem Rasiermesser zu lichten) vereinigen sich auf ihrer Stirn zu einem accent circonflexe und verleihen ihr so zeitweise, wenn sie den Kopf senkt, einen strengen, ernsten, fast finsteren Ausdruck. Die Nase ist wohlgeformt und gerade, nicht kapriziös. Der Umriß des Gesichts bildet ein volles Oval, und die Wangen haben noch etwas Pausbäckiges an sich, wie bei einem Kind.
Noch heute denke ich, dass die Natur in all ihrer Vielfalt schwerlich ein schöneres Gesicht hervorbringen könnte. Was sich jedoch mit besonderer Beharrlichkeit in meiner Erinnerung hält – und den Eindruck unwiederholbarer Einzigartigkeit hervorruft –, sind bestimmte Unregelmäßigkeiten und Mängel dieses Gesichts: eine kleine Brandnarbe am Kinn; die zu kleinen und ziemlich weit auseinanderstehenden Zähne; die Unterlippe, die über die Oberlippe hinaussteht und dem Gesicht im Zustand des Ernstes etwas Unschlüssiges oder Fragendes verleiht, beim Lächeln aber einen Hauch von Schutzlosigkeit oder Erstaunen. Auch bei ihrem Körper von damals fallen mir, mit einer unheilbaren Zuneigung, zuerst gewisse Unproportioniertheiten, Hässlichkeiten oder Plumpheiten ein, die ich damals freilich nicht wahrgenommen habe: der für ihre schmächtigen Schultern vielleicht zu große Kopf; die bäuerlichen, stämmigen Beine mit den zu strammen Waden im Gegensatz zu den Armen und dem noch grazilen Körper; eine gewisse Schwerfälligkeit beim Gehen (vor allem während sie sich daran gewöhnte, hohe Absätze zu tragen) und die kurzen, breiten Füße mit den ungleichen, etwas krummen Zehen und den schlechtgewachsenen Nägeln. Auch nachdem sie mich geboren hatte, behielt ihr Körper etwas fast Jungfräuliches mit gewissen mädchenhaften Eckigkeiten und den ängstlichen, unbedachten Bewegungen eines aus seiner Umgebung gerissenen Tieres.
Ihre ersten Wiegenlieder (tatsächlich die ersten menschlichen Laute, die ich hörte) verbinden sich in diesen meinen »apokryphen Erinnerungen« unweigerlich damit, wie sie mir die Brust reicht oder mich hin und her wiegt. Es ist genau ihre zärtliche, kehlige, speichelgetränkte Stimme, die mir diese Bauernliedehen wieder vorsingt. Sie vermischt sie mit Koselauten und scherzendem Lachen. Und dabei scheint es, als ob ihre Zunge sich löse, um ein Gespräch mit mir zu führen. Während unserer ersten Zeit in dem kleinen Vorstadtzimmer sprach sie noch vorwiegend spanisch, vor allem bei ihren instinktiven Handlungen. Und natürlich erkenne ich bei der Rede, der ich jetzt zuhöre, den spanischen Akzent wieder. Verstehen kann ich sie jedoch nicht, keinen einzigen Satz. Ich erfasse nur die Laute, die aus ihrem lachenden Mund wie ein Gurren auf mich herunterregnen. Und da bemächtigt sich meiner plötzlich ein schreckliches Gefühl: Als wolle sie mir mit diesem unverständlichen Gestammel eine Warnung zukommen lassen, die sie nicht artikulieren kann. Das ist nicht mehr meine übliche »apokryphe Erinnerung«, sondern vielleicht die nachträgliche Anamnese eines namenlosen Leidens, das mich bedroht, seit ich geboren bin.
So glaubte ich zu verstehen, weshalb sie mir jetzt, während ich auf das Alter zugehe, beharrlich so erscheint, wie sie mich als Säugling in ihren Armen hält: Auf die gleiche Weise, in ihren Armen, will sie mich endlich in ihr Nest zurücktragen, so wie die Luft den Samen trägt, der sich eingraben will. Trotz meiner knappen finanziellen Mittel habe ich beschlossen, die Reise mit dem Flugzeug zu unternehmen, und habe rechtzeitig einen Platz in einer Maschine der Iberia gebucht, die am Vormittag abfliegt und nach einem mehrstündigen Aufenthalt in Madrid gegen Abend in Almeria ankommt. Nachdem ich meinen Reisepass erhalten hatte, blieben mir keine großen Vorbereitungen mehr. Seit einigen Monaten wechsle ich häufig meine Unterkunft, wobei ich bei jedem Umzug meine ganze Habe in einer Art Seesack bei mir trage. Zuletzt bin ich in ein winziges Hotel in der Nähe der Porta Ticinese gezogen, in das ich jedoch bei meiner Rückkehr nicht wieder möchte. Im Übrigen ist diese – angesichts meiner beruflichen Verpflichtungen – bereits nach drei oder höchstens vier Tagen vorgesehene Rückkehr für mich im Moment nichts mehr als ein schwacher Schimmer in einer fliehenden Ferne, wie die Galaxis. Ich hatte das Gefühl eines befreienden, unwiderruflichen Abschieds, als ich für immer aus dem kleinen Hotel trat. Und viel zu früh bin ich zu dem großen Platz aufgebrochen, von dem aus die Busse zum Flughafen abgehen.
Das niedrige, gelbliche Gebäude des Terminals steht mitten auf einem weiten, kahlen Feld, umgeben von wenigen, verstreuten Bauten, die aussehen, als hätte man sie nach einer Naturkatastrophe provisorisch errichtet. Ausgeschlossen vom Glanz der Hauptstraßen, empfängt mich diese Vorstadtlandschaft in ihrer formlosen Hässlichkeit ohne Dome und Reklameschilder wie ein Hort der Ruhe und Erholung. Bis hierher kommen die keuchenden Haufen nicht, die schon seit ein paar Jahren durch die Stadt rennen, ihre angebliche Revolution hinausbrüllend – was für mich nur wie Lärm klingt, wie kopflose Raserei. Es ist ein wildes Durcheinander im Chor skandierter Parolen und Sprüche, die für mich unverständlich bleiben und meinem dumpfen Gehirn wie verhängnisvolles Rachegeschrei gegen mich erscheinen. Manchmal ist es vorgekommen, dass ich mich, von meiner eigenen Angst wie von einer Sirene verführt, selbst unter die lärmende Menge gemischt habe. Und man sah meine schwerfällige Gestalt reglos und fehl am Platz im Tumult mitwogen, aus dem ich jedoch rasch wieder verjagt wurde durch meine elende Panik vor der Materie, deren wirre, verkrüppelte Wurzeln dennoch die Bereiche meines Bewusstseins durchziehen. Tatsächlich gibt es nicht wenige Gründe, die mich der öffentlichen Rache empfehlen: Alle jedoch einer einzigen bitteren Knolle entwachsen …
… Unter den verschiedenen möglichen Gütern, auf die die Menschen aus sind, habe ich mein ganzes Leben lang nur nach dem einen verlangt: geliebt zu werden. Doch bald ist mir klargeworden, dass ich niemandem gefallen kann, wie ich auch mir selbst nicht gefalle; und doch brachte ich es nicht fertig, auf meine hartnäckige Illusion – oder Anmaßung – zu verzichten, während sich mein quälendes Verlangen mit der Zeit unerbittlich für mich mit der Vorstellung von Schuld und Schande verband. Schließlich habe ich jedes Verlangen aufgegeben, aber Schuld und Schande sind geblieben. Ich möchte sogar sagen, sie bilden die Substanz meines Protoplasmas und bestimmen meine sichtbare Form, die mich der Welt offenbart. Daher komme ich mir, wenn ich in eine Menschenmenge geraten bin, immer vor wie das zur Lynchjustiz bestimmte Opfer. Das unwägbare Urteil des Kollektivs richtet seine tödlichen Pupillen auf meinen Körper.
Eine finstere und boshafte (dennoch nicht ungraziöse) Nemesis wählt sich nun mit Vorliebe meine Henker unter den Jungen: Jugendlichen um die Zwanzig. Sie vor allem bilden die Miliz dieser Revolution, die mich entsetzt fliehen lässt und gleichzeitig wütend anlockt, wie einen aus seiner Heimat verschleppten Heloten. Sie rücken in Kolonnen heran, ihre rigorosen Spruchbänder schwingend, und unter den langen, schmutzigen Mähnen entbrennen ihre weder von Erinnerung noch von Intellekt überschatteten Milchgesichter angesichts dieses Ausbruchs von Ungehorsam wie bei einem Sonntagsrausch. Ist es mein benommener Blick, der sie verwandelt, oder sind sie wirklich alle schön? Die Gleichförmigkeit ihrer Züge macht sie für mich ununterscheidbar, wie die Tiere einer Herde. Und mit ihren dreisten Schritten und den erbitterten, bei ihrem schrecklichen »ans Kreuz mit ihm« bis zum Schlund aufgerissenen Mündern sehen sie aus wie rasende Spieler bei einem blutigen Sport.
Bei ihrem Verdammungsgeschrei fallen immer wieder Titel und Namen, die meine Ohren aufnehmen, ohne sie zu verstehen – nicht mehr als fremde Laute. Ein Name jedoch, der oft mit ihrem A MORTE widerhallt, ist mir vertraut, und ich erkenne ihn wie einen alten Refrain. Diesen einen kenne ich leider: den Generalissimus Franco! Den Caudillo! Aber jetzt empfinde ich höchstens ein ungläubiges Staunen, flüchtig und zum Lachen reizend wie ein Kitzeln, wenn ich daran denke, dass dieser armselige alte Schmerbauch in meiner Kindheit mein FEIND war.
In Wirklichkeit bin ich ihm nie begegnet, noch habe ich es je versucht; ich kann auch unsere Feindschaft nicht auf politische Differenzen zurückführen (für Politik war ich immer unbegabt, wie jetzt auch noch). Nein, der Grund ist ein anderer: Dieser Mann wurde mein (heimlicher und geschworener) Feind, als ich die Entdeckung machte, dass er der Feind meines Onkels Manuel war.
Franco, der Siegreiche, der Herr über ganz Spanien! Seit ich existiere, hat er immer existiert. Meine ganze Familie (in der Praxis lauter loyale Franco-Anhänger) ist schon seit einer Weile tot (die letzte war Tante Monda, vor elf Jahren). Auch die anderen Figuren unserer Komödie, die großen und kleinen, sind alle tot. Nur der Generalissimus lebt immer noch. In den Straßen der Stadt liest man unter den an die Wände gepinselten Flüchen und Huldigungen: »Nieder mit Franco – Tod dem Henker Franco!« Und an verschiedenen Stellen hängt rot umrandet ein noch nicht altes, aber durch die Unbilden der Witterung schon verdorbenes Plakat mit den Fotografien einiger wegen Verschwörung gegen Franco zum Tod durch die Garrotte verurteilter baskischer Guerilleros. Einer von ihnen (dem Anschein nach der jüngste) hat große, weit aufgerissene Augen, so hell, dass sie auf dem Plakat weiß wirken, wie pupillenlos. Und wenn ich auch die politischen Ereignisse nicht verfolge, so genügt mir doch der Anblick dieser Augen, um zu erraten, dass das Todesurteil inzwischen vollstreckt ist. So ist der junge Baske schließlich ausgewandert, unerreichbar, weit weg von Bilbao und Madrid – mit Küssen und Lachen freudig empfangen von meinem Onkel Manuel, dem Andalusier.
Ihre beiden jugendlichen Körper sind unversehrt, und weder der Baske noch der Andalusier erinnern sich auch nur an den Namen des Caudillo Generalissimo. Der dagegen, inzwischen über achtzig Jahre alt, kämpft auf der Erdkruste gegen sein eigenes, unmittelbar bevorstehendes Erlöschen.
Plötzlich ertappe ich mich, wie ich bei der Erinnerung an gewisse kühne Phantasien meiner Kindheit vergnügt lache: Ich selbst schmiedete manchmal den Plan, nach Spanien auszureißen, um den berühmten Feind zu töten – ohne zu begreifen (und doch brauchte man bloß das Profil seines Kinns und seiner Nase zu betrachten), dass ihm ein anderes Ende bestimmt war. Unter dem Gnadenstoß einer jugendlichen Hand zu fallen wäre für ihn eine undenkbare Barmherzigkeit. Eine äußerste Gunst, die er selbst zurückweist.
Nicht einmal alle zwölf Todesengel zusammen könnten einen Sterblichen vom Kurs auf sein eigenes Ende abbringen. Für den einen wird es ein heftiger und vorzeitiger Eingriff sein. Für den anderen eine langsame senile Nekrose, die ihm das Leben Stück für Stück wegzieht, wie einen Verband, der unersättlich an der eigenen Fäulnis klebt. Und für andere wieder ein weiches, schwereloses Fallen, wie das eines Blattes. Für einen wird es das Kreuz sein und für einen anderen die Lepra oder der Hunger oder der Stich einer Mücke … Aber von den vielen Möglichkeiten des Todes der Materie wird bei genauer Betrachtung keine einzige das Werk eines blinden Zufalls sein; im Gegenteil, eher das eines Kalküls. Vielleicht hätte ein scharfsichtiges Auge bei der Betrachtung des Fotos jenes baskischen Guerilleros entdeckt, dass sein Gesicht das eines Selbstmörders war.
Man könnte tatsächlich im Rückblick auf bestimmte Schicksale sagen, dass wir aufgrund eines uns innewohnenden Gesetzes von Anfang an mit dem Leben auch die Art unseres Todes selbst gewählt haben. Erst mit diesem Schlussakt wird der Plan, den jeder von uns mit seinem alltäglichen Leben skizziert, eine zusammenhängende und endgültige Gestalt annehmen, in der jeder vorangehende Akt seine Erklärung findet. Und es wird diese Wahl gewesen sein – mag sie uns selbst auch verborgen oder verschleiert oder zweifelhaft erscheinen –, die unsere anderen Wahlen bestimmt, die uns den Ereignissen ausliefert, jede Bewegung unserer Körper durchströmt und sie sich anpasst. Wir tragen sie untilgbar in jeder unserer Zellen geschrieben. Und der erfahrene Kenner könnte sie vielleicht schon an unseren Gesten, unseren Gesichtszügen und jeder Falte unseres verwundbaren Fleisches ablesen. Und er könnte bei aller Gewissenhaftigkeit keine Unregelmäßigkeiten oder Widersprüche in ihrem Gewebe feststellen. Vielmehr würde er, wenn er sie von Anfang bis Ende läse, erfahren, dass sie überall einer eigenen, sicheren und konstanten Logik folgt. Keiner von uns Sterblichen begreift freilich diesen Code und seine Zeichen. Gemäß unserer Natur wollen wir den Anfang und das Ende ignorieren. Und selten sind die der Natur widersprechenden Fälle, in denen einer aus freien Stücken (oder zumindest in dieser Illusion) bewusst die letzte Schranke überwindet. Normalerweise leben wir Tag für Tag – gestern, heute und morgen –, ohne uns unserer eigenen Wahl wie der der anderen bewusst zu sein.
Ohne uns bewusst zu sein: Das ist die gewünschte Norm. Und doch, bei manchen Gelegenheiten schlägt eine namenlose Gewissheit mit betäubendem Lärm an unser Bewusstsein: Wie die Schritte eines fremden Heeres im Anmarsch auf unsere Grenzen, zu einer unerhörten Verwüstung, die wir uns nicht erklären können – während uns jemand leise einflüstert, dass wir es selbst gerufen haben.
Ein paar Rückblenden: Sommer 1945: Mein Vater bei meinem ersten und letzten Besuch in dem halbzerbombten Haus in Tiburtino, mit den Fenstern, die alle geschlossen waren, und diesem süßlichen Gestank. Er mit der schmutzig-weißlichen Haut unter den Bartstoppeln. Sein Mund, der leer vor sich hinkaut. Der kalte Schweiß seiner Hand, die sich zurückzieht … Und dieses armselige kleine Lächeln …
… Kurz davor, am selben Tag: Das gackernde Lachen Tante Mondas, während sie sich vor dem Spiegel jenen neuen, unwahrscheinlichen Soubrettenhut über ihr welkes Gesicht setzt – und ihn sich dann jäh vom Kopf reißt, als wolle sie sich verstümmeln …
… Und noch weiter zurück, um das Jahr 1940, in Rom, an einem sonntäglichen Spätnachmittag: Meine Mutter ohne Kopfbedeckung (eine frevelhafte Provokation) in unserer gewohnten, hässlichen Kirche am Corso d’Italia. Seltsames Spiel der Schatten im Kirchenschiff, wo die einzige Beleuchtung von den Votivkerzen eines kleinen Altars in unserem Rücken ausgeht. Die dunkel umrandeten Augen meiner Mutter sehen aus wie riesige schwarze, leere Höhlen. Und auf ihrer Stirn wirken die zu einem einzigen waagerechten Strich vereinten Brauen wie ein magischer Schnitt …
… Und weiter, noch weiter in der Zeit zurück: Der 4. November vor 43 Jahren, nachmittags drei Uhr. Tag und Stunde meiner Geburt, meiner ersten Trennung von ihr, als fremde Hände mich ihrer Vagina entrissen, um mich ihren eigenen Kränkungen auszusetzen. Und damals konnte man mein erstes Weinen hören: jenes typische Klagen eines Lämmchens, das nach Aussage der Ärzte eine rein physiologische Erklärung haben soll – die ich für dumm halte. Denn ich weiß, dass mein Weinen echt war, verzweifelte Trauer: Ich wollte mich nicht von ihr trennen. Ich muss bereits gewusst haben, dass auf diese unsere erste blutige Trennung eine weitere folgen würde und dann noch eine und noch eine, bis zur letzten, der allerblutigsten. Leben bedeutet: die Erfahrung der Trennung. Und ich muss das von jenem 4. November an erfahren haben, mit der ersten Bewegung meiner Hände, einem Zappeln auf der Suche nach ihr. Seit damals habe ich in Wirklichkeit nie aufgehört, sie zu suchen, und seit damals stand meine Wahl fest: in sie zurückzukehren. Mich wieder in ihr zusammenzukauern, meiner einzigen Höhle, die nun, wer weiß wo, wer weiß unter welchem Felsvorsprung verschwunden ist.
Esto niño chiquito
Dieses Kindchen, dies kleine
no tiene cuna.
hat keine Wiege.
»Erwacht! Erwacht! Arbeiter an die Macht!« ist eine ihrer beliebtesten Parolen. Und auch heute morgen auf meinem Weg zum Terminal, fast bis ins Zentrum, haben sich die Horden der Jungen Revolution darauf versteift, das im Chor zu brüllen – als eine offene Anklage gegen mich. Denn tatsächlich habe ich in meinem Leben nie gearbeitet. Und unfähig zur Arbeit, wäre ich auch untauglich für die berühmte Macht, die diese jugendliche Menge als höchstes Gut anzusehen scheint. Ihre Parole bedeutet für mich also eine doppelte Disqualifikation. »Was will der Typ da?! Der gehört nicht zu uns!!« Und prompt war wieder die alte, unbestimmte Angst da; bis mir meine letzte, befreiende große Neuigkeit wie ein Skalpell durchs Fleisch schnitt: »Heute bin ich im Aufbruch! Und von euch will ich nichts mehr!« Automatisch nahm ich mir dabei die Brille ab, wie ich es immer mache, wenn es nichts gibt, was zu sehen sich lohnt.
Sogleich trennte mich ein Nebelvorhang von der Szene, die sich da abspielte – bis das Schauspiel um mich herum sich mit seinen Nebelgestalten allmählich an jenem fernen Punkt verlor, an dem Tag und Nacht eins sind. Und bald darauf verflüchtigte sich sogar der wilde Tanz der Autos mit ihrem verrückten Gehupe zu einem leisen Abschiedsgemurmel.
Auf diesem Weg eben war einer der letzten Gegenstände, die mein Blick durch die Brille erfasste, das bekannte Bild des Basken an der Häuserwand; und plötzlich hatte ich das Gefühl, in seinen weißen Augen eine gewisse Ähnlichkeit mit den meinen zu entdecken. Dabei schnappte ich die Kommentare einer Gruppe von Passanten zu den Tagesereignissen auf. Der Caudillo, so hieß es, liege, nur noch vegetierend, im Sterben, das durch Aufputschspritzen und Elektrobehandlung gewaltsam verlängert werde. Ich weiß nicht, welche politischen, ökonomischen oder dynastischen Interessen es ratsam machten, die Todesmeldung hinauszuzögern. Und unter dem vielen Gerede wurde im Übrigen auch die Meinung laut, dass er in Wirklichkeit schon seit mehreren Tagen tot sei.
Aber seine Angelegenheiten gingen mich zum Glück jetzt nichts mehr an. Er hatte mich vor nunmehr dreißig, wenn nicht schon fast vierzig Jahren verlassen, im Knabenalter, als ich nachts davon träumte, nach Spanien auszureißen, um meinen berühmten FEIND umzubringen. Dein Leben und dein Sterben, armer alter Henker, haben für mich jetzt nicht mehr Bedeutung als das Platzen eines Reifens bei einem Autorennen oder eine Börsenschwankung in der Wall Street. Um mich herum öffnet sich freier luftiger Raum, sobald ich daran denke, dass ich endlich in mein mütterliches Vaterland fliehe, aber nicht um den Feind zu richten, sondern zu einem Rendezvous der Liebe.
Und doch, mein Nervensystem ist so zerrüttet, dass mich, während ich am Ausreiseschalter meinen Pass vorweise, plötzlich die verrückte Angst befällt, ich könnte hier als politisch verdächtiges Individuum festgehalten werden. Aber mit welchen Verdachtsgründen? Möglicherweise ließen sich genügend finden, angefangen von den heimlichen terroristischen Anwandlungen meiner frühen, unreifen Jahre: Vielleicht waren sie auf wer weiß welchen metapsychischen Wegen bis zu den alles sehenden internationalen Geheimdiensten durchgesickert und sind seit damals in deren Karteien festgehalten – in Erwartung der ersten Gelegenheit, mich zu schnappen. Gewisse Phänomene könnten sich in dieser Zeit unheimlicher, für mich völlig undurchschaubarer Technisierung ohne Weiteres hinterrücks verwirklichen. Ja, das eine oder andere Zeichen könnte darauf hindeuten, dass die Zeit für den Schlag aus dem Hinterhalt endlich gekommen sei. Tatsächlich scheint es mir, als betrachte der diensttuende Beamte mein Foto im Pass mit besonderer Aufmerksamkeit: Vielleicht hat auch er die eigentümliche Ähnlichkeit entdeckt, die mich mit dem jungen Basken verbindet (sosehr mich meine Hässlichkeit auch von ihm unterscheidet). Es fehlt nicht viel, und ich sehe mich schon der Garrotte ausgeliefert. Und zum Schluss grüße ich den Beamten, der mir meinen Pass, vorschriftsmäßig gestempelt, zurückgibt, mit einem Lächeln der Dankbarkeit.
Dennoch verfolgt mich nach wie vor der quälende Gedanke, der mich auf allen Bahnhöfen oder an ähnlichen Ankunfts- und Abreiselokalitäten stets von Neuem packt, während ich fieberhaft die Fahrpläne studiere. Das ist nicht nur eine Folge meiner immer wiederkehrenden Ängste, sondern – früher noch – auch meines Sehfehlers. Ich war immer kurzsichtig – und astigmatisch –, von Kindheit an, und mit zunehmendem Alter ist seit einigen Jahren noch die Weitsichtigkeit dazugekommen. Ich bin also kurz- und weitsichtig zugleich, und das hat zur Folge, dass sich mir – vor allem, wenn mein Gehirn nicht klar ist – die gewöhnlichen Gegenstände in befremdliche und undeutbare Formen verwandeln, die zuweilen an bestimmte Science-Fiction-Comics erinnern. Und nicht immer genügt die Brille, um dem abzuhelfen, da ich, aus Geldmangel und Nachlässigkeit, stets zu alte und nicht mehr passende Gläser trage. So treibe ich mich jetzt verloren auf diesem Mailänder Flughafen herum, auf der Suche nach dem Ausgang zum nächsten Flug nach Madrid, ohne aus dieser Entfernung die Bekanntmachung auf den Leuchttafeln lesen oder die wütend und zusammenhanglos aus den Lautsprechern gebrüllten Durchsagen verstehen zu können; und ich weiß auch nicht, an welches unter all diesen verstörten Gesichtern ich mich wenden soll. Als ich endlich – dank irgendeinem besonderen Glücksfall – den gesuchten AUSGANG erreicht habe, bin ich atemlos und schweißgebadet. Wie ein einfältiger Pilger auf der Wallfahrt zum Ort der Wunder habe ich meine Nerven in äußerster Anstrengung bis über die unsichtbare Stratosphäre hinaus gespannt. Bis dorthin, wo mir – im Flug und doch unbeweglich – meine staffetta encantadora, mein zauberischer Kurier, in seinem Spiegel mit dem verschnörkelten Rahmen vorauseilt: Sie! Aracoeli! – die ihr Kind in ihrer beider unvergängliches Zimmerchen trägt.
Es ist heute das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit dem Flugzeug reise. Und obwohl ich natürlich weiß, dass das inzwischen überall ein ganz normales Verkehrsmittel ist, habe ich beim Besteigen der Maschine jenes Gefühl kennengelernt, das wahrscheinlich den Schamanen befällt, wenn er in den magischen Schlaf sinkt. Vor dem Start war diese übliche, billige Unterhaltungsmusik zu hören, die einem auf Magen und Gehirn schlägt und mich mit ihrer öden Blödheit immer anwidert. Aber heute war ich gegen ihren leeren Lärm immun und fast taub. Gleich als ich die Maschine betrat, hüllte mich eine Art Narkose ein, die mich von den gewöhnlichen Vorgängen und den Menschen isoliert. Die übrigen Passagiere (die ich kaum voneinander unterscheide, fast als handle es sich um Skizzen zu einer einzigen Vignettenfigur) sind alle zu handfesten, von der Vernunft diktierten Ankunftsorten unterwegs. Ich allein mache mich auf nach El Almendral: dem äußersten Sternennebel der Schöpfung, der den Horizont der Geschehnisse durchbricht, um meine ganze Existenz in seinen schwindelerregenden Abgründen zu verschlingen.
Hier geraten meine Sinne wieder in den Sog gewisser mystischer Leidenschaften meiner Jugend: als ich mich vom Selbstmord versuchen ließ wie von einer riskanten Expedition zu weiß Gott welchen Paradiesen – unmöglich und daher um so exotischer und neiderregender.
Ich habe die Zeit meiner »Narkose« nicht registriert, noch habe ich bemerkt, dass das Flugzeug inzwischen – wer weiß, wie lange schon – die Durchquerung des Raums unternommen und nun, in seiner vertikalen Bewegung, die Erde bereits zurückgelassen hat. Die dumme Musik hat zum Glück aufgehört. Und die erste phantastische Überraschung meines Erwachens ist, dass ich über den Wolken fliege. Beim Abflug, auf der Erde, war das herbstliche Licht regnerisch und trüb gewesen; hier dagegen, über unserer fliegenden Maschine, öffnet sich ein klares, unendliches Blau; und unten, in Richtung Erde, ist jede Spur der Welt verschwunden. Die einzigen sichtbaren Körper sind die Wolken, die mit ihren wellenartigen Formationen eine lichte Wüste aus Dünen, weich wie Ruhekissen, bilden. Und über ihnen, im blauen, grenzenlosen Raum, schwebt das Flugzeug unbeschwert dahin, wie ein Drachen, der sich von der Schnur gelöst hat.
Dieser hinreißende Anblick muss für die normalen, reifen, flugerfahrenen Leute in Wirklichkeit etwas ganz Gewöhnliches sein. Die anderen Passagiere machen sich nämlich nicht einmal die Mühe, aus den Fenstern zu schauen – so gleichgültig, als säßen sie in der Straßenbahn, plaudern sie oder lesen in ihren Zeitungen und Comics. Jetzt fällt mir wieder ein, dass ich – vielleicht kurz nach dem Start? – mit meinen vom Halbschlaf umnebelten Augen verschwommen wahrgenommen habe, wie eine Frau in Uniform Zeitungen verteilte; und tatsächlich halte ich selber eine in der Hand. Es ist eine spanische Tageszeitung mit dem heutigen Datum, und auf der ersten Seite prangt ein großes Foto des Generalissimus Franco in seiner bekannten Uniform, wie er, in Begleitung seiner Frau und eines hohen Würdenträgers, vor einem Kruzifix kniet. Der Generalissimus sieht darauf zwar gebrechlich, aber lebendig aus; also würde dieses Foto – wenn es wirklich (wie darunter steht) neuen Datums ist – die zuletzt von mir gehörte Nachricht dementieren, nach der mein berühmter »Feind« bereits im Todeskampf liegen sollte. Für mich jedenfalls, unterwegs in der Zeitmaschine, jenseits der Schallgrenze, verliert sich das alles in einer zurückliegenden und vielleicht schon seit Jahrhunderten erloschenen Sphäre, so dass es mir vorkommt, als vergilbe die Zeitung, die mir jetzt auf den Schoß gefallen ist, unter meinen Augen. Schlaftrunken wie durch Zaubertrank, stelle ich mir unten auf der Erde mein Mailänder Verlagsbüro vor, das wegen des verlängerten Novemberwochenendes geschlossen und verlassen ist: nicht jedoch in diesem November 1975, sondern in irgendeinem anderen, früheren November. Das Büro zeigt sich mir seit Wochen, Monaten, Jahren verwaist. Die Spinnen haben darin ihre Netze von einer Wand zur anderen gespannt. Regale, Karteikästen und Bücher sind von einer Staubschicht wie von Moos überzogen. Und die Korrekturfahnen, die auf meinem kleinen Tisch liegengeblieben sind, haben die Motten zerfressen.
Für mich, der ich El Almendral zustrebe, vereinigen sich die Zeiten zu einem einzigen, leuchtenden Punkt: einem Spiegel, in dem alle Sonnen und Monde versinken. Und dort, in diesem unbestimmten Punkt, eilt mir, im Flug und doch unbeweglich, meine staffetta encantadora voraus.
Jetzt haben sich die Wolken in ein regnerisches Grau verwandelt, in das die Maschine langsam absinkt. Vom Cockpit her hat eine Stimme verkündet: Wir setzen zur Landung auf dem Flughafen von Madrid an.
In Madrid muss ich ein paar Stunden auf die Anschlussmaschine nach Almeria warten. Mein himmlischer Kurier hat sich inzwischen aufgelöst. Und für meinen verworrenen Kopf ist der Flughafen von Madrid mit den irrealen Stimmen seiner Lautsprecher, seinen hektischen Passagieren und seinen Zeitungs- und Andenkenkiosken lediglich eine halluzinierte Kopie des Mailänder Flughafens, von dem ich abgeflogen bin. Hier wie dort eile ich von einem Schalter zum anderen, um Auskünfte zu erbitten, denen ich misstraue, meine paar Worte Spanisch stammelnd, den Sack über der Schulter und den Reisepass wie einen Revolver in der Rechten. Das also bin ich, an der ersten Station meines legendären mütterlichen AUSLANDS angelangt: nichts als ein verlorener Tourist außerhalb der Saison. Nach dem kurzen Flugabenteuer jenseits der Zeit wühlt die Rückkehr zur Erde meinen Magen bis zur Übelkeit auf. Und das allgemeine Gedränge mit den misslichen Zusammenstößen zwischen Kommenden und Gehenden kränkt mich und gibt mir wieder das unerbittliche Wissen um die Gleichgültigkeit des Universums meinem Schicksal gegenüber zurück.
Während ich meine Taschen auf der üblichen Suche nach der Brille abtastete, wäre ich beinahe wie ein Sack eine Treppe hinuntergerollt. Daraufhin habe ich mich in einem schwach beleuchteten und wenig begangenen Winkel auf eine der Stufen gesetzt, in dem Entschluss, hier die Wartezeit bis zum Anschluss zu verbringen. Im Flughafengebäude und unter den Vordächern sind die elektrischen Lampen angegangen; draußen ist es bereits dunkel, und es regnet. Und ich fühle aus den Untiefen meiner Neurose bis in die Haut hinein die Empfindung emporsteigen, ein Staatenloser zu sein, der vom Schicksal in einen Wartesaal an der Grenze abgeschoben wurde, in Erwartung eines Transportes nach nirgendwo.
Ich habe zwar die Brille aus der Innentasche meiner räudigen Parka gefischt, aber für den Moment verzichte ich darauf, sie aufzusetzen, da ich annehme, dass es doch nichts zu sehen gibt. Von Zeit zu Zeit werfe ich einen flüchtigen Blick da- und dorthin, und die Welt um mich herum löst sich in meinen ohne Brille halbblinden Augen wie üblich in ein wässriges Durcheinander auf, mit verbogenen Lichtern und verzerrten Bildern. Die Lampen blähen sich zu riesigen Flammenblasen auf, Funken durchbohren die Wände, und elektrische Kabel verknäueln sich zwischen den Schritten der Menschen. Von der Decke hängt eine große dunkle Scheibe, versehen mit Leuchtpupillen und beweglichen grünen Wimpern; eine fettleibige Frau mit zwei Köpfen geht vorüber; und in einer Reihe, gegen eine Wand gedreht wie zu einer Durchsuchung, schwanken Individuen, die an Stelle des Gesichts einen Rüssel tragen. Doch solche optischen Scherze sind für mich schon gewohnte, vorhergesehene Erscheinungen, und ich mache mir nicht die Mühe, sie zu demaskieren.
Zu dieser Jahreszeit ist die Menschenmenge auf dem Flughafen nicht allzu groß; aber es ist eine geschwätzige Menge, die sich ständig ändert und bewegt und dabei mit dem Lärm ihrer Stimmen über meine Ohren herfällt. Ab und zu stößt ein Fuß im Vorbeigehen an meinen Sack, den ich neben mich auf die Stufe gestellt habe, oder es streifen mich beim Hinauf- und Hinuntergehen Leute, die sich in verschiedenen Sprachen unterhalten, vorzugsweise natürlich auf spanisch. Aber gerade diese Sprache dringt unter den anderen bar jeder Bedeutung in mein Gehirn und reduziert sich für mich auf wenig mehr als ein unverständliches Geräusch. Das ist ein altes Phänomen. Tatsächlich bin ich (obwohl ich seit meiner Kindheit die wichtigsten Fremdsprachen beherrsche) seit wer weiß wie langer Zeit nicht mehr fähig, Spanisch zu verstehen und mit Erfolg zu sprechen. Dabei muss mir diese Sprache damals, als ich, noch im Vorschulalter, die ersten Liedchen Aracoelis lernte, vertraut gewesen sein. Später aber versank sie – mit Ausnahme der hartnäckigen Wiederkehr dieser Wiegenliedchen – in irgendeinem unzugänglichen, dunklen Abgrund meines Bewusstseins. Und jetzt schlägt ihr beinahe fremdländisches Geräusch um meine einsame Stufe her bei mir in ein abwehrendes Heimweh um, in Ablehnung – wie das Rauschen eines gefällten Baums bei einem Spatzen, der früher sein Nest darin hatte.
In Wirklichkeit könnte es – nachdem Aracoeli meine Kindheit bis zu den Wurzeln abgehauen hat – mein (wenngleich uneingestandener) eigener Wille gewesen sein, der mich veranlasste, unsere erste Sprache der Liebe wie eine Sirenenstimme von mir zu weisen. Meine idiotische Unfähigkeit für das Spanische wäre also nichts anderes als eine Waffe in meinem verzweifelten Krieg gegen Aracoeli. Ja ich frage mich sogar, ob ich mit dieser Reise unter dem verrückten Vorwand, Aracoeli wiederzufinden, nicht eher eine letzte, wirre Therapie versuche, um von ihr zu genesen. In ihren Wurzeln zu wühlen, bis sie unter meinen Händen verdorren – denn sie auszureißen, bin ich nicht fähig.
Eines Tages in Rom (ich muss ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein) geschah es, dass eine Zigeunerin, die meine Handlinien genau studiert hatte, auf der Straße plötzlich in einen theatralischen Schreckensruf ausbrach. Und nachdem sie Aracoeli beiseite gezogen hatte, enthüllte sie ihr flüsternd (aber doch nicht leise genug, als dass ich es nicht hätte hören können), dass ich nach dem, was mir in der Hand geschrieben stehe, noch vor meinem fünfzehnten Lebensjahr an Liebe sterben werde. In der Annahme, dass ich nichts gehört hätte, zwang sich Aracoeli (die an weissagende Zigeunerinnen nicht weniger glaubte als an die Heiligen in der Kirche), mir ihr Entsetzen zu verbergen, doch noch am selben Tag hängte sie mir an das Kettchen, das ich um den Hals trug, ein kleines Holzamulett, dem sie die Macht zuschrieb, den Tod von mir fernzuhalten. Es war eine winzige menschenähnliche Gestalt primitiven Zuschnitts, die mit ausgebreiteten Armen einen Bogen über dem Kopf hielt; ich glaube, sie entstammte dem persönlichen Gepäck (für das eine Strohtasche ausgereicht hatte), das Aracoeli nach der ersten Vermählung mit meinem Vater aus Andalusien mitgebracht hatte. Dieses Zaubermännchen, Garant meines Lebens (ihr Glaube machte es meinem Glauben heilig), gesellte sich somit zur geweihten Medaille und zu den anderen mütterlichen Schutzanhängern, die bereits an meinem Taufkettchen baumelten. Und dort blieb es bis zum letzten Sommer meiner Kindheit – als ich mir in einer Stunde unheilvollen Zaubers im tragischen Gefühl einer Selbstamputation das Kettchen mit all seinen Anhängern plötzlich vom Hals riss und in einen unbewacht auf der Straße stehenden Müllkarren warf. Es besteht kein Zweifel, dass es meine Absicht war, mit dieser Geste Aracoeli abzuschwören und mich von ihr und meiner übergroßen Liebe wie von etwas Schändlichem gewaltsam zu befreien. Jedoch während ich mich ihrer Obhut entriss, die mir das andalusische Amulett, das mich vor dem Tod retten sollte, aufzwang, gab ich mich mit ebenjener Geste meinem vorbestimmten Tod anheim: aus Liebe, vor dem fünfzehnten Lebensjahr! Aber wer war seit jeher meine Liebe? Und wer also mein Tod? Und was für ein Spiel war das, ein schändliches Weib von sich zu stoßen und ihm gleichzeitig wie ein Märtyrer sein eigenes Leben zu Füßen zu werfen?
Schon damals also, in meiner verkrampften Unschuld, machte ich mir selbst etwas vor. Auch das Spiel hat sich nicht geändert: Denn noch heute durchwirke ich diese Art ungeregelten Monologs, wie ich ihn hier eben mir selbst vortrage, von Anfang an mit den Fäden des Missverständnisses und des Betrugs. Anda niño, anda. Wie ein Waisenkind vom Land erzähle ich mir selbst fromme Geschichtchen. Und ich laufe hinter meiner treuen Mutter-Geliebten her, hinter ihrer singenden Ikone, und vertreibe dabei wie einen Eindringling jene andere, Frau gewordene Aracoeli, die mich auf so hässliche Art noch vor ihrem Tod zur Waise gemacht hat. Ich versuche, mir heute selbst zu verbergen, dass auch diese zweite Aracoeli meine Mutter war, dieselbe, die mich in ihrem Schoß getragen hat, und dass auch sie in jeder meiner Zeiten nistet und sich über meinen lächerlichen Vorsatz, mir fern von ihr ein normales Nest bauen zu wollen, lustig macht. Sosehr ich sie auch verjagen will, sie erspart mir ihre Heimsuchungen nicht: Wobei sie oft mit der ersten Aracoeli, gleich einer verzerrten Doppelgängerin, erscheint. Die eine Aracoeli raubt mir die andere; und sie verwandeln und verdoppeln und spalten sich, eine in der andern.
Und ich liebe beide: nicht wie einer, der zwischen zwei Lieben hin- und hergerissen ist, sondern wie der Geliebte eines Zwitterwesens, dessen Spezies er, im Orgasmus, nicht erkennt und dessen Machenschaften er nicht begreift. Wie einen Exorzismus, der mich von der zweifachen Besessenheit befreien soll, rufe ich mit lauter Stimme: ARACOELI IST TOT! Und dabei richte ich meinen inneren Blick auf den gegenwärtigen Zustand meiner Mutter: kein Leichnam mehr, vielleicht nicht einmal mehr Knochen; nichts mehr als ein elendes Häufchen Asche. Und auch das ist vielleicht verstreut. Wer hat sich denn in all den Jahren je um Aracoelis Grab auf dem Campo Verano gekümmert? Niemand. Und der Platz auf den Friedhöfen reicht nicht mehr aus, es sind zu viele Tote, sie drängen sich an den Gittertoren, um einen Platz zu ergattern. TOT: So viel wie NIE GEWESEN.
Und obwohl ich mir, als ich mich auf diese verrückte Pilgerfahrt machte, eine Richtung und ein Ziel vorgaukelte, verhehlte ich mir in Wirklichkeit von Anfang an nicht, dass ich mich selbst zum Narren hielt: Dort unten in der Sierra erwartet mich genauso viel oder wenig wie anderswo, nichts und niemand von Aracoelis Seite. Außer ihrem kleinen bisschen Asche hat sie weder Gefolge noch Erbschaft noch Familie hinterlassen. Von ihrer Verwandtschaft lebt meines Wissens keiner mehr. Ihr einziger Bruder, Manuel, wurde im Bürgerkrieg ermordet und vielleicht nicht einmal beerdigt. Und von ihren Eltern (die bereits bei Aracoelis Geburt nicht mehr jung waren) wird schon seit Langem nicht einmal mehr der Staub existieren. Jedenfalls habe ich mich nie bemüht, etwas über ihren Verbleib und ihr Schicksal ausfindig zu machen – ich hielt zwischen ihnen und mir die berühmte Wand aufrecht, die zu anderen Zeiten Aracoelis Vorgeschichte vor unserer Welt verbergen musste.
Für mich hatte diese Wand (und bis zu einem gewissen Grad tut sie das noch) eine Art magischer Pforte bedeutet, hinter der sich mir jegliche Überraschung auftun konnte: eine Rumpelkammer oder eine steil hinabführende Bodenluke oder ein Zimmer der Wunder. Die geheimnisvolle Verpflichtung, die bei uns zu Hause Stillschweigen über meine mütterlichen Vorfahren auferlegte, bot sich mir als Kind wie eine Basis für mögliche Flüge zu sagenhaften Nestern an. Es waren kaum geahnte und auch nicht ausgesprochene Möglichkeiten, nur gerade ein bisschen von meinen unerfahrenen Flügeln erprobt. Immer jedoch konnte meine Mutter auf diesen unerforschten Planeten meiner Unwissenheit von Zigeunern oder Bettlern, von Toreros, Banditen oder großen Hidalgos (vielleicht hatte sie in einem uneinnehmbaren Schloss gewohnt? Vielleicht in irgendeiner Alhambra oder einem Alkazar?) abstammen. Und jedes dieser möglichen Schicksale – auch wenn sie nur flüchtig in meinen Gedanken aufblitzten – war wieder ein neuer unter unzähligen Strahlenkränzen, der von ihr wie von einem leuchtenden Körper ausging.
Trotzdem war es für mich schon damals nicht schwer zu begreifen, dass dieses große Geheimnis – das für mich etwas Exotisches gewann, sich beinahe zu einem wundersamen heimlichen Gast verkörperte – bei uns zu Hause eher so etwas wie die Leiche im Keller darstellte, wie man zu sagen pflegt. Ursprünglich bestand es nur in einem beträchtlichen Klassenunterschied zwischen meinen Eltern. Gewisse Vorurteile hatten damals noch ihre Bedeutung in unserer kleinen Welt – ganz zu schweigen von dem geradezu sakralen Wertkodex, der für die Kaste der Kriegsmarine galt, der mein Vater angehörte.
Aus dem mannigfaltigen Küchenklatsch, der um mich herumsummte, musste selbst ich bald merken, dass unser berühmtes häusliches Geheimnis nur ein Scheingeheimnis war, in Wirklichkeit jedoch ein öffentlich bekannter, wenngleich mit Schweigen übergangener Tatbestand: Meine Mutter gehörte keinem jener Geschlechter an, die mit Stolz in den Offizierszirkeln genannt werden.
Jedes Mal, wenn man die Bekanntschaft einer Dame gemacht hatte, die mit einem Herrn der Gesellschaft (einer Exzellenz oder einem hohen militärischen Dienstgrad, einem Adeligen oder einer Parteigröße) verehelicht war, fragte Tante Monda – nach einer traditionellen Angewohnheit – als Erstes: Was ist sie für eine Geborene? Was so viel bedeutete wie: Stammt sie aus einer angesehenen Familie? Oder umgekehrt, um kundzutun, dass eine bestimmte Dame nicht aus einer angesehenen Familie stammte, beklagte sie, mit einem leichten Blick gen Himmel: Sie ist keine Geborene