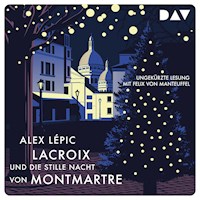Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Kampa VerlagHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Im August ist Paris wie ausgestorben, Cafés und Restaurants sind geschlossen, die Pariser am Meer oder in ihren Ferienhäusern auf dem Land. Commissaire Lacroix genießt die Ruhe, bis er eine Vorladung der besonderen Art erhält: Madame de Touquet muss etwas mit ihm besprechen und duldet keine Widerrede. Persönlich getroffen hat Lacroix sie noch nie, doch ihr Ruf eilt der Grande Dame voraus. In ihrer Wohnung, einem Prachtbau an der Seine mit Blick auf den Eiffelturm, schildert sie dem Commissaire ihr Anliegen: Jemand will sie töten, seit Wochen verabreicht man ihr kleine Dosen Arsen. Lacroix soll zu ihrem jährlichen Sommerfest nach Giverny kommen, wo Madames Familie residiert und die Lacroix' ein kleines Sommerhaus besitzen, ganz in der Nähe von Monets berühmtem Seerosenteich. Der Commissaire mischt sich unter die Schönen und Reichen, genießt Champagner und Foie gras und merkt bald: Auch in den feinsten Kreisen geht es mitunter reichlich schmutzig zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Alex Lépic
Lacroix und das Sommerhaus in Giverny
Sein vierter Fall
Kampa
Eine Einladung wider Willen
1
Lacroix’ Blick war entrückt. Wie stets, wenn er hier stand, konnte er seine Gefühle nicht im Zaum halten. Sein Staunen. Dominique, die neben ihm auf der niedrigen Bank saß, ging es genauso. Er spürte es. Wie sie schwieg und doch bebte, im selben Augenblick.
Der weiß gestrichene Raum. Die Rundung der Wand. Der goldene Rahmen. Und dann das Zentrum, um welches sich alles gruppierte, auf das jeder hier schaute:
Gebogen hing das riesige Tableau an der Wand, gebogen, weil so überhaupt erst die Dimensionen klar wurden – Monets Seerosenteich auf einer Länge von siebzehn Metern.
Es war epochal, er wusste es, ein Meisterwerk. Aber da war noch etwas anderes, ganz Persönliches. Etwas, was nur wenige Kunstwerke vermochten: Monets Werk erschlug Lacroix nicht mit Opulenz oder Klugheit, sondern es erfreute ihn, mehr noch, seine Bilder machten ihn regelrecht glücklich. Sie waren Schönheit pur – auf die Leinwand gebannt.
Lacroix nutzte immer beide Möglichkeiten. Er ging zuerst ganz nah an das Bild heran. Betrachtete die feinen Pinselstriche, die roten Blüten der nymphéas, genau wie die hellgrünen Blätter, die dunkelgrünen Schlingpflanzen am Ufer und die Lichtstimmung des Wassers, changierend zwischen blau und violett, immer wieder kleine Tupfer von Farbe, wenn der Künstler die Spiegelung der Sonne im Teich einfing.
Und dann, nach einem ausgiebigen Gang an dem raumlangen Gemälde entlang, setzte sich der Commissaire neben seine Frau auf die gepolsterte Bank, nun in ausreichender Entfernung, um das ganze Gemälde in den Blick zu nehmen: Die Vollkommenheit des Teiches, den Lacroix so gut kannte, dass er meinte, in seiner Wohnung umherzugehen, und an dem er doch jedes Mal etwas Neues entdeckte, wenn er mit Dominique hierherkam, in das wunderbare Musée de l’Orangerie.
Vorher hatten sie in einem der Cafés in den Tuilerien gesessen, sich das Journal du Dimanche geteilt und den Möwen im Tiefflug zugeschaut. Der Park war voller Menschen gewesen, an ihrer Kleidung und den neugierigen Blicken erkannten die Lacroix’, dass es in der Mehrzahl Touristen waren. Die Pariser hatten fast vollständig die Stadt verlassen.
Dann waren sie ans Ende des Parks spaziert, wo der Verkehr von Concorde herüberdrang, und Lacroix hatte gemächlich eine Pfeife geraucht. Dank ihrer Dauerkarten hatten sie sich schließlich an der endlos scheinenden Schlange vorbeigeschmuggelt.
»Ich habe plötzlich so Lust auf Giverny«, hatte Lacroix gesagt.
»Wie jedes Mal, wenn wir hier sind«, sagte Dominique und ergriff seine Hand.
Sie beobachteten zwei japanische Mädchen, die vor dem gebogenen Bild Aufstellung für ein Selfie bezogen hatten. Dominique schien die Teenager mit aufrichtigem Interesse zu beobachten. Doch auf einmal wandte sie ihren Blick und sah ihn an.
»Du, ich habe das völlig vergessen, mein Lieber«, sagte sie, und ihre Stimme schien von weit her zu kommen, »aber jetzt fällt es mir wieder ein. Mich hat Madame de Touquet besucht, in der mairie. Sie kam ganz plötzlich, du kennst sie ja, sie ist einfach an meiner Vorzimmerdame vorbeigelaufen. Dabei dachte ich immer, es sei ein Ding der Unmöglichkeit, an Veronique vorbeizukommen. Aber nicht für sie, nicht für Madame de Touquet.«
»Was wollte sie?«, grummelte Lacroix. Mit dem Namen war die Wirklichkeit in sein gedankliches Idyll eingebrochen. Giverny – das war das Paradies, aber es war auch die Welt von Madame de Touquet.
»Sie hat uns eingeladen, für einen der nächsten Tage. Zum dîner in ihrer Wohnung am Pont d’Alma.«
»Wieso das denn?« Aus dem Grummeln war eine deutlich zunehmende Unruhe geworden.
»Sie kam nicht, um mich zu sehen, mon cher. Sie kam, weil sie mit dir reden wollte.«
»Wieso ist sie denn nicht in Giverny, zu dieser Jahreszeit?«
Lacroix verzog das Gesicht.
»Ich denke, sie hat es sehr eilig, mit dir zu sprechen. So schien es mir jedenfalls.«
»Und warum kommt sie dann zu dir und nicht …« Lacroix ließ die Frage in der Luft hängen, und Dominique lächelte ihn an.
»Du weißt so gut wie ich, dass sie keinen Fuß in ein Kommissariat setzt. Sie denkt, dort wäre alles voller Verbrecher. Nein, das Rathaus ist mehr ihr Fall. Ich habe es noch im Ohr, wie sie sagte: Ich muss Ihren Mann sprechen, Madame la Maire. Sie werden zu mir zum Essen kommen, wie ist es am Montag?«
Er sah sie verdutzt an.
»Du hast schon zugesagt? Und einen Termin ausgemacht?«
Dominique sah ihn verschmitzt an, ihr bereitete die Idee offensichtlich eine diebische Freude.
»Es hat mich neugierig gemacht, dass sie den Montag wählte«, erwiderte Lacroix’ Gattin, und er wusste genau, was sie meinte. Der Montag war ein Tag, an dem man in Paris keine privaten Besucher empfing, keine Familie. Es war ein Tag, der für geschäftliche Termine reserviert war.
»Meinst du, sie will mich fragen, ob ich als neuer Butler für sie arbeite?«
»Na, bei dem, was man so hört, hat sie einen ordentlichen Verschleiß an Dienstboten«, entgegnete Dominique lachend. »Aber keine Angst: Ich lass dich nicht gehen.«
»Psst, psst«, zischte die Museumsaufseherin von ihrem Stuhl in der Ecke aus.
Lacroix warf ihr einen entschuldigenden Blick zu.
»Na, dann gehen wir wohl morgen Abend in die Höhle des Löwen«, flüsterte er.
»Der Löwin, chéri, der Löwin. Sie bietet uns sicher ein ordentliches dîner.«
Der Commissaire betrachtete die wunderschönen Seerosen, die sich vor ihm auf dem Gemälde ergossen, ein so friedvolles Bild, dass er spürte, wie er langsam wieder ruhiger wurde. Noch einmal seufzte er.
»Rohes Fleisch oder Schnecken, beides würde gut zu ihr passen.«
2
Im Büro schrumpften die Aktenberge, denn die zweite Augusthälfte bot sich dafür an, Berichte zu schreiben. Paganelli tat diese Arbeit gegen seine Natur auf geradezu vorbildliche Weise, denn er langweilte sich.
In den zwei Wochen vor der rentrée war die Stadt wie ausgestorben. Die Pariser aalten sich an den Stränden, und sogar die Verbrecher machten Urlaub. Ein paar Taschendiebe, die es auf die vollen Geldbörsen der Amerikaner abgesehen hatten – das war alles. Die Habgierigen und Eifersüchtigen warteten, bis die Geschäfte wieder geöffnet und die untreuen Ehegatten nach Paris zurückgekehrt waren.
Capitaine Rio war mit den Zwillingen auf ihre Heimatinsel nach Mayotte geflogen – mit Camille, ihrer Frau. Die Krise zwischen ihnen war noch nicht gänzlich überstanden, aber es war ein zarter Versuch der Annäherung. Lacroix hatte Rios Urlaubsantrag mit einem Lächeln unterschrieben.
Paganelli war hiergeblieben. Direkt nach der rentrée machte er sich auf nach Korsika, in die alte Heimat. Die Strände in Ajaccio waren dann »pariserfrei«, wie er stets betonte, nicht ohne laut zu lachen.
Lacroix trat aus seinem kleinen Büro in den großen Raum, in dem Paganelli saß, gegenüber stand der verlassene Schreibtisch seiner Kollegin. Der Korse las in einer Akte und hob immer wieder den Blick, um auf den Bildschirm seines Computers zu sehen.
»Ich gehe schon hinaus«, sagte Lacroix, »Sie erreichen mich noch für eine Stunde im Chai, danach habe ich ein dîner. Sie können mir aber daheim auf den Anrufbeantworter sprechen, wenn es etwas Dringendes geben sollte, d’accord?«
»Keine Sorge, Chef«, sagte Paganelli gedankenverloren. »Wenn es so weitergeht, habe ich meine Jahresberichte fertig, bevor Rio zurückkommt. Was soll ich dann machen? Inventur in der Waffenkammer?« Er grinste.
»Nun, allzu oft fühlt sich die Ruhe vor dem Sturm so an«, gab Lacroix zurück.
Der Korse blickte auf und sah ihn prüfend an, dann lächelte er unter seinen dunklen Brauen. Seine Mitarbeiter fürchteten Lacroix’ Intuition.
»Nun gehen Sie schon, Maigret«, sagte Paganelli, »ich melde mich, wenn etwas passiert.«
Lacroix nickte brummend. Der Korse liebte es, den Commissaire mit seinem Spitznamen zu necken, den er zudem selbst in die Welt gesetzt hatte, weil Lacroix wie der berühmte Maigret meist einen Hut trug und gerne Pfeife rauchte. Lacroix mochte Paganelli trotz seiner kleinen Provokationen, deshalb verzieh er ihm, doch dass es der Spitzname sogar in die Presse geschafft hatte, ärgerte ihn sehr.
Der Commissaire ging wieder in sein Büro, griff nach dem leichten braunen Sommermantel und dem Hut und stieg dann im Flur die drei Treppen hinab, vorbei am kleinen Museum der Pariser Polizeigeschichte, das im zweiten Stock eingerichtet war. Es war eine kostenlose Ausstellung in den verstaubten Räumen des Kommissariats. Paris war schon vor zweihundert Jahren eine Weltmetropole gewesen und damit natürlich auch eine Stadt des Verbrechens, und so ließen sich Exponate von damals finden, Waffen, Uniformen, gruselige Mordbeschreibungen. Die meisten Besucher waren Schulklassen und Polizisten aus dem ganzen Land, die einmal sehen wollten, wie die erfahrenen Kollegen der Hauptstadt-Polizei heute und damals ihre Arbeit machten.
Lacroix nickte im Vorbeigehen den Beamten zu, die den Eingang bewachten, dann trat er hinaus in den spätsommerlichen Tag.
Der Feierabendverkehr auf dem Boulevard Saint-Germain hatte schon eingesetzt, die Wagen fuhren gemächlich in Richtung Pont de Sully. In anderen Monaten war hier Dauerstau, nicht nur zu Hauptverkehrszeiten. Auf der Busspur jagten die Taxis vorbei, und die grün-weißen Busse klingelten, wenn sie die Spur wechselten.
Lacroix überquerte die Straße und genoss den kurzen Bummel über das breite Trottoir, bestaunte die herrlich gestalteten Schaufenster der Einrichtungsboutiquen und Haute Couture-Läden. Dann bog er rechts in die Rue de Seine ein und betrat nur zwei Minuten später sein Stammlokal mit der roten Markise. Glücklicherweise hielt Yvonne Abeille nichts von Sommerurlaub, und so war hier fast jeden Tag im Jahr geöffnet – bis auf den ersten Weihnachtstag, den Abend vorm neuen Jahr und den 28. Januar. An dem Tag hatten Yvonne und ihr Mann Geburtstag – gemeinsam, was für ein Zufall. Diese drei Tage waren ihr heilig.
Am alten Zinktresen des Bistros Chai de l’Abbaye war keine Spur von den üblichen Verdächtigen. Lacroix sah auf die Uhr und nickte. Alain hatte in seinem Obstladen gegenüber noch zu tun, jetzt, da die Leute aus den Büros strömten. Lacroix’ Bruder Pierre-Richard hingegen musste noch die Achtzehn-Uhr-Messe halten, in der Basilique Sainte-Clotilde, weiter unten im siebten Arrondissement.
Doch da trat schon Yvonne, die Wirtin, aus der Küche, deren Blick sogleich zur Uhr wanderte.
»Ah, du bist aber früh dran, mon cher.«
»Dominique und ich haben eine Einladung zum dîner, da wollte ich vorher noch einen Moment durchatmen.«
»Und passt zum Durchatmen besser ein Wein oder ein Bier?«
Lacroix lächelte und nickte ihr dankbar zu. Sie griff zu einem der kleinen Gläser, ging zum Zapfhahn mit der Aufschrift Meteor und ließ das kalte goldgelbe Bier in das Glas laufen.
Kleine Gläser. Immer kleine Gläser. Niemals trank Lacroix aus großen Gläsern. Das Bier wurde zu schnell schal und verlor seinen Esprit, und das hatte diese wunderbare Marke aus dem Elsass nun wirklich nicht verdient.
Sie stellte es vor ihm ab, und er trank in großen Schlucken, der Tag hatte ihn durstig gemacht.
»Was ist die plat du jour?«, fragte er Yvonne.
»Eine getoastete tartine mit Schinken aus Bayonne und altem fromage de chèvre.«
»Die hätte ich sehr gerne«, sagte er.
»Sagtest du nicht, du wolltest zu einem dîner?«, fragte Yvonne.
»Ich glaube, das wird nicht sehr üppig. In diesen Kreisen …«, Lacroix senkte die Stimme, »ist es nie sehr üppig.«
»Hm«, murmelte Yvonne und zapfte ein zweites Bier, »aber das ist nicht alles, oder?«
Lacroix sah auf und blickte sie ruhig an. Er wusste, dass sie alle seine Regungen und Stimmungen kannte. Wahrscheinlich verbrachte er an Werktagen mehr wache Stunden im Chai als in seiner Wohnung in der Rue Cler.
»Du hast recht. Ich glaube, der Abend könnte höchst unerfreulich werden.«
»Erzähl …«
»Lieber nicht«, sagte Lacroix. »Ich brauche wirklich diesen Moment.«
»Na dann«, sagte Yvonne und änderte sogleich ihre Miene, sie wusste, wann sie den Commissaire besser in Ruhe ließ. Also rief sie, freilich viel lauter, in Richtung Küche: »Eine tartine für Monsieur Lacroix!«
Dann eilte sie in den Saal des Bistros, um an einem Tisch ein altes Paar zu bedienen, das eben Platz genommen hatte.
Das kalte Bier erfrischte ihn, belebte seine Gedanken, der herbe Geschmack kitzelte auf seiner Zunge.
»Madame de Touquet«, murmelte er, das Bild der alten Dame klar vor Augen. Ihr Haus und ihr Stammbaum waren gleichermaßen Institutionen in Giverny, diesem normannischen Dorf, zwei Stunden von Paris entfernt. Und doch redete man mehr über Madame de Touquet als mit ihr, denn sie verbarg sich gerne hinter den hohen Mauern des Anwesens. Er versuchte, sich an ihre Stimme zu erinnern. Es wollte ihm nicht recht gelingen. So merkwürdig es auch war: Er hatte mit der Dame in all den Jahren nur Smalltalk gehalten. Eigentlich mochte er diesen neumodischen Anglizismus nicht. »Smalltalk« – was sollte das sein? Andererseits beschrieb es ihre Unterhaltungen ganz gut, wenn sie sich zufällig im Dorf begegnet waren oder vor der kleinen mairie, einmal auch bei einem Fest in Monets Garten. Mehr nicht. Er kannte sie nicht gut, und doch wollte sie mit ihm reden. Merkwürdig war das. Lacroix verspürte die innere Unruhe, die er so gut kannte und die ihn gleichermaßen ärgerte und doch in Aufregung versetzte. Es war wie eine Vorahnung düsterer Ereignisse.
Gleich darauf verspürte er einen Windhauch, so schnell kam Yvonne zurück, blieb neben ihm stehen und schlug sich gegen die Stirn.
»Herrje, mon cher, das habe ich ganz vergessen: Vorhin, als ich drüben bei Alain Petersilie kaufen war, hat hier eine Frau angerufen. Mon mari«, sie wies in Richtung Küche, »hat den Anruf angenommen.«
»Ein herrisches Frauenzimmer«, rief Yvonnes Mann von nebenan, der am Herd stets jedes Wort vernahm, das am Tresen gesprochen wurde, Bestellungen natürlich ausgenommen.
Die Wirtin sah auf den Zettel. »Hier steht’s: Madame de Touquet ersucht Commissaire Lacroix, sie vor dem dîner zu beehren, um in Ruhe ein wichtiges Thema zu besprechen. Um 18:30 Uhr an bekannter Adresse.«
Lacroix runzelte die Stirn. »Hat sie wirklich beehren gesagt?«
Wieder rief Yvonnes Mann aus der Küche: »Ich habe es wortwörtlich mitgeschrieben.«
»Vergiss die tartine, Yvonne«, sagte der Commissaire seufzend. »Der Adel ruft – und die letzte Revolution ist leider zu lange her, als dass man ihn warten lassen sollte.«
Mit zerknirschter Miene und hungrigem Magen verließ er den Chai – doch so langsam gewann die Neugier die Oberhand: Was in aller Welt war so wichtig, dass Madame de Touquet ihn so dringend sprechen wollte?
3
Die Fenster im 63er-Bus standen weit offen, und Lacroix schloss die Augen, um den Fahrtwind zu genießen, während sich die Fahrerin ihren Weg bahnte, vorbei am Quai d’Orsay und am Außenministerium. Die Seine lag durch die Trockenheit so tief in ihrem Flussbett, dass sie von der Straße aus nicht mehr zu sehen war.
An der Avenue Bosquet stieg der Commissaire aus und ging die letzten Meter zu Fuß.
Die Hitze lag immer noch schwer auf der Stadt und strahlte vom schwarzen Asphalt ab, doch dunkle Wolken kündigten für die Nacht ein Gewitter an.
Unter dem Pont d’Alma fuhren im Minutentakt die Ausflugsboote über den Fluss, die Oberdecks waren voller Menschen, und Lacroix lauschte einen Moment lang den Ansagen auf Chinesisch, Japanisch und Arabisch.
An der Flamme de la Liberté, der Freiheitsflamme, blieb er kurz stehen. Die goldene Skulptur war zum Symbol geworden für den Tod Prinzessin Dianas, die im Tunnel darunter zu Tode gekommen war. Dabei stand das Denkmal schon viel länger. Die Amerikaner hatten es den Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts als Dank für die Restaurierung der Freiheitsstatue geschenkt. Doch nun lagen zu Füßen der Skulptur Tag für Tag Blumen und Kerzen, die an die englische Prinzessin erinnerten.
Einen prestigeträchtigeren Ort würde man in Paris wohl nur schwer finden, dachte Lacroix und sah auf das elegante Haus, das direkt auf das Denkmal und die Seine blickte. Erste Reihe am Fluss, rechts Trocadéro, gegenüber der Eiffelturm, zentraler und zugleich eleganter ging es nun wirklich nicht. Die Avenue de New York war, wenn man aus dem Zentrum kam, die erste Straße des mondänen sechzehnten Arrondissements.
Das Haus war frisch sandgestrahlt, die schmiedeeisernen Balkone erst kürzlich gestrichen, orangene Sonnenmarkisen schirmten die bodentiefen Sprossenfenster ab. Ein echter Prachtbau. Und ganz oben, in der dritten Etage, dort, wo der Balkon umlaufend war, befand sich die Wohnung der Familie de Touquet, für die wenigen Wochen im Jahr, in denen Madame eben nicht in Giverny war.
Lacroix klingelte beim Concierge, einem mürrischen Portugiesen, der den Lift rief und den Commissaire wortlos einsteigen ließ. Nun würde er oben anrufen und die Ankunft des Gastes ankündigen.
Und richtig: Als sich die alte Aufzugtür öffnete, sah Lacroix, dass die Wohnungstür schon offen stand.
Er trat ein, und sofort eilte ihm eine junge Frau in einer weißen Schürze entgegen. Sie war von rundlicher Erscheinung, das Gesicht ganz und gar freundlich.
»Monsieur Lacroix, nehme ich an?«
»Ganz recht.«
»Nicht zu warm?«, fragte die Haushälterin und wies auf den Hut des Commissaire.
»Ach«, sagte Lacroix lächelnd, »der leistet bei der Sonne gute Dienste.«
Er reichte ihr seinen Sommermantel und den Hut, und sie verstaute beides an einer großen schmiedeeisernen Garderobe in der hinteren Ecke des Flurs.
Dann führte sie den Commissaire weiter in die Wohnung hinein, stieß eine Flügeltür auf und ließ ihn in den Raum treten, wo ihn sogleich das grelle Sonnenlicht umfing.
Lacroix musste die Augen zusammenkneifen, um sich an das Gegenlicht zu gewöhnen.
Er fand sich in einem riesigen Salon mit drei hohen Fenstern wieder, die den Blick freigaben auf die Seine und rechts gegenüber – eine unbezahlbare Aussicht – auf den Eiffelturm.
»Madame wird gleich bei Ihnen sein, Monsieur, nehmen Sie doch Platz. Madame wird es übernehmen wollen, Ihnen einen Apéro zu servieren, deshalb biete ich Ihnen nichts an.«
Mit diesen Worten verschwand sie, und Lacroix war allein.
Er sah sich um, nahm die Weite des Raumes in sich auf und ließ den Blick über die Einrichtung schweifen. Hier war die gute alte Zeit noch nicht vorbei: die zwanziger Jahre, als in den Salons die Boheme tanzte, feierte, trank, als große Literatur erschaffen wurde, als Paris die Hauptstadt der Welt war.
Der Salon sah aus, als wäre seitdem keine Zeit vergangen. An einer Wand stand ein Sekretär aus Nussbaum, daneben ein hoch aufragender Schrank mit hölzernen Türen, in den Lacroix zu gern einen Blick geworfen hätte. Seine Ornamente waren zweifellos handgearbeitet. Gegenüber befanden sich zwei dreisitzige Sofas aus glänzendem und mit rosa Blumen bedrucktem Chintz. Dahinter sah Lacroix eine Bar, die mit Spirituosen aller Couleur, Eisbehältern und diversen Gläsern beladen war.
Was daneben nicht ins Bild passte, war der extravagante Lady Chair, ein Designersessel, den Lacroix nur kannte, weil seine Frau immer davon schwärmte. Doch das Möbelstück nach dem Entwurf eines italienischen Designers war ihnen nicht nur zu teuer gewesen – es war schlicht unbezahlbar. Hier, inmitten all der antiken Möbel, sah der moderne Sessel wie ein Fremdkörper aus.
Die linke und die rechte Wand waren übervoll, dicht an dicht mit kleinen und großen Gemälden behängt. Lacroix trat näher heran und musste nicht lange schauen, um festzustellen, dass es allesamt Originale waren. Dieses hier, ein expressionistisches Porträt eines Mädchens mit einer Katze auf dem Arm, war von Franz Marc. In der Luft lag ein Hauch von Parfum, nur dezent süß, als sollte der Duft so nobel sein wie der Rest der Wohnung.
Der Commissaire ging zur Rückseite des Raums, wo ein gewaltiger Marmorkamin in die Wand eingelassen war. Oben auf dem Sims ein einziges gerahmtes Foto, lang gezogen und in Schwarz-Weiß: Die Menschen darauf aber waren modern gekleidet, sie standen vor dem Haus, das Lacroix sehr bekannt vorkam. Und in das er schon bald einen Fuß setzen würde – zum ersten Mal. Nur wusste er das noch nicht.
Er beugte sich ein Stück hinunter, um das Foto genauer zu betrachten. Alle Mitglieder der Familie de Touquet waren darauf zu sehen.
»Sie sind pünktlich, Monsieur. Ich hatte nichts anderes erwartet.« Die Stimme hinter ihm klang zufrieden. Lacroix hatte sie nicht bemerkt. Er spürte, wie er automatisch die Schultern straffte, dann wandte er sich zu ihr um.
»Madame de Touquet«, entgegnete er. »Es ist mir eine Freude.«
Das letzte Mal war er ihr auf dem Bahnsteig in Giverny begegnet, am Gleis nach Paris. Sie hatten sich aus der Ferne zugenickt, ein Zeichen des Erkennens. Doch das hier war etwas anderes: Ihre Präsenz war beeindruckend, jetzt, wo sie so dicht vor ihm stand. Hier, in ihrem Reich, wirkte sie wie eine Königin. Dabei war sie winzig, vielleicht etwas über anderthalb Meter groß, die weißen Haare fielen glatt zu den Seiten herab, auf der Nase trug sie eine kleine runde Brille mit metallenem Rand. Lacroix erinnerte sich nicht, wie alt sie genau war. Sicher aber Ende achtzig. Dennoch zeigte ihr Gesicht kaum Falten, die kleinen Augen, die sich schnell bewegten, zeugten von einer überbordenden Intelligenz. Sie trug ein enges graues Wollkleid und braune Lederschuhe. Ihre Kleidung war im pariserischen Sinne stilvoll und modern zugleich.
»Bitte«, sagte sie, ohne ihm die Hand zu geben, »nehmen Sie Platz.«
Sie wies zu dem Sofa, und Lacroix ging die paar Schritte hinüber, vor die breite Fensterfront.
»Beginnen wir den Abend doch mit einem Laphroaig. 25-jährig.«
Sie fragte ihn nicht, sondern trat an die Bar, gab Eis in zwei Tumbler und schenkte großzügig ein. Whisky an diesem heißen Tag – er musste aufpassen, dass er nachher noch zwei gerade Sätze herausbrachte. Lacroix ließ sich auf dem Sofa nieder, dessen Polster fest wirkten, in denen er aber sofort versank. Er fühlte sich, als würde er eingesogen. Es würde schwer sein, später wieder würdevoll daraus aufzustehen.
Sie trat ums Sofa herum und reichte ihm sein Glas, dann setzte sie sich ohne zu zögern in den modernen Sessel.
»Auf Ihr Wohl, Monsieur«, sagte sie und hob ihr Glas kaum wahrnehmbar.
»Auf Ihres, Madame.«
Dann tranken sie. Sofort legte sich der Duft von Sherry und Äpfeln auf seine Zunge, die Würze, der Rauch, das alles blieb in seinem Kopf, die Aromen der fünfundzwanzig Jahre, die der Whisky Zeit hatte zu reifen.
»Das Gute daran ist, dass ich keine Sorge mehr um meine Gesundheit habe, jetzt, wo ich spüre, dass sich alles dem Ende zuneigt.«
Er sah sie interessiert an, doch ihr Gesicht war ohne Traurigkeit, es war eher, als prüfte sie seine Reaktion, dabei hatte sie es so ungerührt gesagt, als wollte sie über das Wetter reden.
»Wie meinen Sie, Madame de Touquet?«
Sie räusperte sich, dann betrachtete sie die schimmernde Flüssigkeit in ihrem Glas.
»Jemand ist auf dem besten Wege, mich zu töten.«
Lacroix erwiderte nichts. Er hatte geahnt, dass Madame de Touquet ihn nicht nur zum Plaudern eingeladen hatte. Aber mit dieser Offenbarung hatte er nicht gerechnet. Er brauchte sie nicht aufzufordern weiterzureden.
»Tatsächlich, Monsieur Lacroix, habe ich große Lust, so viel Whisky zu trinken, wie ich nur kann, weil ich sorgenfrei bin, was meine Zukunft angeht. Hingegen habe ich überhaupt keine Lust darauf, jetzt schon von dieser Welt abberufen zu werden. Die Mitglieder der Familie de Touquet, müssen Sie wissen, werden im Allgemeinen sehr alt. Mit hundert Jahren ist meine Mutter noch zu Jagdgesellschaften gegangen. Und bis dahin fehlen mir noch ein paar Jährchen.«
Lacroix versuchte, sich im Sofa aufzurichten, aber es gelang ihm nicht gänzlich, also räusperte er sich und rieb sich die Stirn.
»Wie sollen Sie denn daran gehindert werden, hundert zu werden, Madame?«
»Es geschieht bereits«, sagte sie leise und deutete mit dem linken Zeigefinger auf ihre Brust.
»Was geschieht?«
»Hier drinnen. Es arbeitet. Ich spüre es.«
Es ging ihm gegen den Strich, das alles hier. Ihre Unverblümtheit und gleichzeitige Geheimnistuerei, dieses Sofa, die Art und Weise, wie sie ihn hierherbestellt hatte. Lacroix stellte sein Glas neben sich und sagte:
»Madame, ich weiß, dass meine Frau sehr verlässlich ist – und sehr pünktlich, erst recht, wenn es sich um eine Einladung bei Ihnen handelt. Sie wird also bald hier sein. Und Sie wollen mir sicherlich sagen, worum es geht, bevor sie eintrifft. Es wäre also gut, wenn Sie zum Kern des Problems kommen würden.«
Es war härter herausgekommen, als er es gewollt hatte, aber sie hatte dem Commissaire etwas mitteilen wollen, und wenn es um seinen Beruf ging, war Zögerlichkeit nicht seine Sache.
»Jemand vergiftet mich«, brach es aus ihr hervor, mit lauter Stimme, es schien, als würde ein Stück ihrer Schale abplatzen. »Jemand will, dass ich sterbe. Ich spüre es, an meiner Übelkeit am Morgen, am Grummeln in meinem Bauch. Ich habe keine Gebrechen, ich hatte niemals welche. Deshalb weiß ich, wenn etwas nicht stimmt. Und hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht.«
Lacroix schüttelte sanft den Kopf.
»Madame de Touquet, das überrascht mich, wenn ich das so sagen darf. Eine Vergiftung …«, er ließ die Worte in der Luft hängen, »aber … also wenn dem so sein sollte, dann werden wir es herausfinden.« Er sah sie ernst an. »Waren Sie schon bei einem Arzt, um Ihre Theorie untermauern zu lassen?«
Sie schüttelte entrüstet den Kopf.
»Wo denken Sie hin, Monsieur? Ich pflege nicht derart persönliche Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen.«
»Ihr Arzt ist ja sicherlich so diskret, wie Sie es verdienen. Und nun erzählen Sie es ja auch mir.«
Sie wedelte mit der Hand im Raum herum. »Ich bitte Sie, Monsieur, Sie sollten nicht kokettieren. Sogar in meinem Salon wird Ihr Name ständig im Mund geführt, wenn es darum geht, wie verkommen die Pariser Behörden sind, Sie aber als Leuchtturm aus diesem ganzen Sumpf von Misswirtschaft und Unvollkommenheit herausragen. Deshalb gab es für mich keinen Zweifel, dass ich mich an Sie wenden muss – schließlich geht es um eine sehr persönliche Frage von Leben und Tod. Verstehen Sie? Ich möchte nicht, dass der Urheber dieser Sache sein Ziel erreicht, und gleichzeitig möchte ich den Ruf meiner Familie …«
Wieder ließ sie den Satz unvollendet.
»Madame, meinen Sie etwa …«
Sie nickte fest.
»Ja, ich meine, dass mir jemand aus meiner eigenen Familie nach dem Leben trachtet.«
»Wie kommen Sie darauf?«